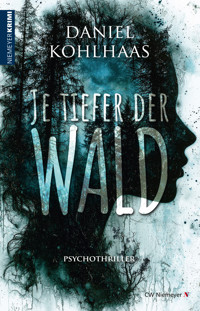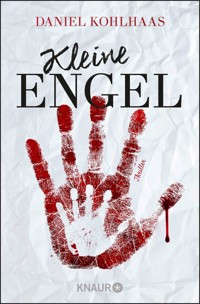Fußball und Gesellschaft - Die Entwicklung des Fußballspiels aus sozio-kultureller Sicht E-Book
Daniel Kohlhaas
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Soziologie - Kultur, Technik, Völker, Note: 1,8, Universität Siegen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit umfasst eine sozio-historische Analyse, einen Vergleich von Fußball und Arbeit, Professionalisierung und Kommerzialisierung des Fußballspiels, einen Abriss über den Zusammenhang zwischen Fußballsport und Männlichkeit und die Frage danach, ob Fußball Kultur im soziologischen Sinne ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Page 1
Page 4
Page 5
1Dietrich Schulze-Marmeling, (2003), S. 9f
Page 6
1. Einleitung
Die vorliegende Staatsarbeit wurde im Rahmen des Ersten Staatsexamens geschrieben und trägt den Titel: „Fußball und Gesellschaft. Die Entwicklung des Fußballspiels aus soziokultureller Sicht“.
Da das Thema breit gefächert und sehr umfangreich ist, erhebt diese Arbeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr wurden zentrale Aspekte des Themas ausgewählt und differenziert bearbeitet.
Fußball wird überall auf der Welt gespielt und er ist solch ein Bestandteil des Lebens, von dem wir uns kaum vorstellen können, dass es ihn einmal nicht gegeben hat, auch wenn für manche die Begeisterung für diesen Sport irrational erscheint.
Unbestritten ist jedoch die Tatsache, dass er ein Produkt der Gesellschaft ist. Als ein solches wirkt er auch auf Besagt zurück und diese Wirkung kann die unglaublichsten und verschiedensten Folgen mit sich bringen.
Als positives Beispiel dafür sei an dieser Stelle an die Stimmung und Atmosphäre in Deutschland während der Fußballweltmeisterschaft 2006 erinnert.
Diesem Sportereignis ist es gelungen, einer Nation, die Möglichkeit einzuräumen, durch die Präsentation von Nationalflaggen an Fenstern und Autos, sportliche Einheit und Nationalstolz zu demonstrieren, ohne in der Betrachtung der übrigen Nationen auf historisch negative Konnotation reduziert zu werden. So konnte die Bundesrepublik als multi-kultureller Gastgeben erstrahlen, bei dem das Motto „Die Welt zu Gast bei Freunden“ nicht nur Motto blieb.
Dagegen kann man an dieser Stelle aber auch die tragische Geschichte des früheren kolumbianischen Nationalspielers Andrés Escobar als Negativbeispiel anführen.
Page 7
Dieser erzielte bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA ein folgenschweres Eigentor, welches dem kolumbianischen Team nicht nur das Weiterkommen, sondern ihn selbst sein Leben kostete. Escobar wurde nach der Rückkehr in Kolumbien von Humberto Muñoz Castro erschossen.
Als Grund für seine Tat, nannte dieser, Zeugenberichten zur Folge, das erzielte Eigentor. Ob der, mittlerweile aus der Haft entlassene, Täter nur als enttäuschter Fan oder als Auftragsmörder der kolumbianischen Wettmafia handelte, konnte nie zweifelsfrei aufgeklärt werden, die Frage nach dem Motiv verblasst jedoch hinter der Tatsache, dass ein Mensch aufgrund des Ausgangs eines Spiels, sein Leben verlieren musste. Demnach drängt sich die Frage auf, ob Fußball eine Entwickelt durchlaufen hat, die ihn zu mehr als einem Spiel werden ließ?2
BILL SHANKLEY, früherer Manager des englischen Fußballvereins FC Liverpool, sagte einmal: „Einige Leute halten Fußball für einen Kampf um Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich versichere Ihnen, dass es weit ernster ist.“3
Diese Aussage ist im Kontext eines Spiels übertrieben und doch scheint der Fußball mehr zu sein, als nur ein Spiel von 90 Minuten. Als Indikator dafür sind die im Schnitt über 40.000 Menschen zu betrachten, die jedes Wochenende zu einem der Spiele der Fußballbundesliga aufbrechen.
Warum sie das tun und wie sich der Fußball zu diesem Zuschauermagneten entwickelt hat, wo und warum er entstand und wie er auf die Gesellschaft, die ihn erfunden hat, zurückwirkt, sind nur eine Auswahl der Fragen, mit der sich die vorliegenden Arbeit beschäftigt. Zunächst erfolgt eine sozialgeschichtliche Einführung in das Fußballspiel, bei der vor allem die zivilisatorische Entwicklung des Fußballspiels im Vordergrund steht.
2vgl. http://www.zeit.de/2009/04/Medellin und http://www.ballesterer.at/index.php?art_id=584
3Axel Nowak/Pascal Bernstein (2001), S. 16
Page 8
Im nächsten Kapitel „Fußball und Arbeit“, werden nicht nur die Entwicklung des Spiels zu einem Arbeitersport, sondern auch die Zusammenhänge dieser beiden scheinbar unterschiedlichen Begriffe aus soziologischer Sicht betrachtet. Zudem soll auch die Entwicklung des Amateurs zum Profi Gegenstand der Betrachtung sein. Wie bereits erwähnt, ist der Fußball ein Zuschauermagnet, daher ist auch ein Blick über den Spielfeldrand hinaus auf die Tribünen interessant. So wird im vierten Kapitel die Rolle des Zuschauers und seine Entwicklung zum Fan untersucht. Dabei soll vor allem sein Handeln in den Fokus treten und die sogenannte „Fußballfankultur“ untersucht werden. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den Folgen der Kommerzialisierung des Fußballs und dessen Entwicklung zu einer Art Show.
Um ein möglichst lückenloses Bild des Fußballs aufzuzeigen, befasst sich das sechste Kapitel, welches provokativ mit „Abseits - Frauen und Fußball“ betitelt wurde, mit dem Frauenfußball.
Trotz großer Erfolge im internationalen Wettbewerb des Frauenfußballs, scheint es unbestritten, dass dieser nur „Abseits“ des Fußballs ein Nischendasein fristet, was nicht nur durch seine eigene Terminologie hervorgehoben wird.
Um die Frage zu beantworten, ob Fußball tatsächlich mehr als ein Spiel ist, geht das siebte Kapitel der Frage nach, ob Fußball Kultur sei und welches soziokulturelle Kapital darin zu finden ist.
Ein kurzes Fazit beendet schließlich die vorliegende Staatsarbeit.
Page 9
2. Eine kleine sozialgeschichtliche Einführung in das Fußballspiel
2.1. Anstoß - Wer spielt wo?
ERIC DUNNING unterteilt die Entstehung des Fußballsports in vier Phasen. Dabei fällt auf, dass sich im Laufe der Jahre ein Spielverhalten entwickelte, welches durch komplexe und formalisierte Regeln und Organisation gestützt wurde. Des Weiteren enthalten diese Phasen, laut Dunning, „ ... eine Tendenz zu ‚zivilisierteren’ Verhaltensformen.“4
Die erste Phase, zeitlich vom 14. bis zum 20. Jahrhundert einzugrenzen, wird in diesem Kapitel einer genaueren Betrachtung unterzogen. Der Fußball war laut Dunning ein „ ... vergleichsweise simples, wildes und unreguliertes Volksspiel, das nach ungeschriebenen, tradierten Regeln gespielt wurde.“5
Es erweist sich als schwierig, die wirkliche Geburtsstunde und den Geburtsort des Fußballs, so wie wir ihn in der heutigen Zeit verstehen, zu bestimmen. Verschiedene Quellen chinesischer Sporthistoriker deuten zum Beispiel auf eine Entstehung im alten China hin. Können wir demnach China als das Mutterland des Fußballs ausrufen? HANS ULRICH VOGEL (2000) erläutert hierzu:
Dieser Anspruch kann kaum aufrecht erhalten werden. Da das Spiel mit dem Ball, unter Zuhilfenahme von Fuß, Hand, anderen Körperteilen oder unter Einbeziehung eines Gegenstandes, eine universelle kulturelle Erscheinung ist, die nicht immer unbedingt schriftlich festgehalten wurde, kann die erste schriftliche Erwähnung eines Ballspiels unter Zuhilfenahme der Füße kaum als Indiz für den tatsächlichen Ursprung gewertet werden. (S.11)
4Eric Dunning (1979), S.13
5Ebd. S. 13
Page 10
Zudem darf behauptet werden, dass diese Form des Fußballs nicht viel mit dem gemein hat, was wir unter modernen Fußball verstehen.6
Verschiedenste Quellen scheinen sich jedoch mittlerweile darin einig zu sein, dass England „ ... in vielfacher Hinsicht Mutterland und Pionier des Fußballspiels“7sei. Am häufigsten findet der Fußball, „ ... in königlichen Edikten und obrigkeitlichen Erlassen, die das Spiel verbieten“8etwa seit dem 14. Jahrhundert9Erwähnung.
Der Fußball formte sich im Laufe der Zeit aus englischen Volksspielen, wieFolk FootballoderVillage Football.Bei diesen Spielen suchen wir jedoch vergeblich nach Gemeinsamkeiten zum heutigen Fußball.
Das Volksspiel „ ... basierte auf simplen, ungeschrieben Gewohnheitsregeln und kannte keine präzise Begrenzung des Spielfelds, der Spieldauer und der Zahl der Spieler.“10Gespielt wurde hauptsächlich an Feiertagen und Gegner waren benachbarte Dörfer, aufgrund der beschränkten Reisemöglichkeiten der damaligen Zeit.
Bereits in dieser frühen Zeit lässt sich eine Funktion des Spiels herausfiltern. Durch die nachbarschaftliche Rivalität und damit verbundenen und auch heute noch gelebten Derby-Charakter, der Begriff geht zurück auf ein traditionelles Spiel in der Ortschaft Derby, war es in der Lage „ ... lokale Identität zu stiften und zu demonstrieren“.11Wir sprechen jedoch über ein Spiel, welches im Wesentlichen durch Gewalt beeinflusst und bestimmt war. Roh und mit variierenden, ungeschrieben Regeln wurde es zu meist von unteren Schichte betrieben und von höheren Schichten missachtet.12Wie bereits erwähnt,
6Vgl. Hans Ulrich Vogel (2000), S.11
7Dietrich Schulze-Marmeling (2000), S. 11
8Ebd. S.11
9Nobert Elias/Eric Dunning (2003), S. 316
10Ebd. S.316
11Dietrich Schulze-Marmeling (2000), S. 12
12Dietrich Schulze-Marmeling (2000), S. 13