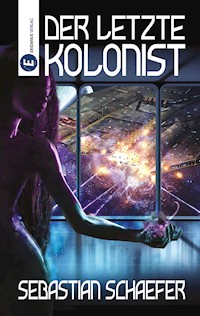4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eridanus Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Dein Weg war, ist und wird mühsam, aber wenn es dann zum Ende kommt, dann wird es ein gutes sein, da bin ich mir sicher." Der Klang goldener Fanfaren hallt durch die Galaxien. Permana, die kleine, einem funkelnden Saphir gleiche Welt, ruft zum bedeutendsten Turnier des Universums und die Champions aller Völker eilen herbei, um den Schatz der Dynastie und mit ihm immerwährenden Ruhm zu erlangen. Noch ahnt niemand, dass für den Sieg weit mehr nötig sein wird als Kampfgeschick und Tapferkeit. Fernab des Wettstreits taumelt ein gesichtsloser Reisender im verschmutzten Sartre-Anzug durch Raum und Zeit und stellt sich einer entsetzlichen Bedrohung, welche die gesamte Schöpfung ins Chaos stürzen könnte. Die Schicksalsfäden von elf Charakteren, die unterschiedlicher kaum sein könnten, werden in G.O.T.T. auf höchst unerwartete Weise miteinander verwoben und schließlich zu einem großen Finale geführt. Das bildgewaltige SF-Spektakel bringt ein Wiedersehen mit den unsterblichen Wjui, dem Kult von Aszlil und den Gepps – diesen kleinen, neugierigen Nagetieren, die allzu gern Verwirrung stiften, indem sie mit ihren beherzten Pfoten am großen Rad des Schicksals drehen. Sebastian Schaefer erschuf mit G.O.T.T. ein weiteres Kapitel seiner bildgewaltigen Space Opera. Der Initialroman für dieses Werk, »Der letzte Kolonist«, wurde für den Phantastikpreis der Stadt Wetzlar und den Deutschen Science-Fiction-Preis nominiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
G.O.T.T.
von Sebastian Schaefer
Sciencefiction Roman
Vollständige E-Book-Ausgabe der Druckausgabe
ISBN 978-3-946348-26-9
ISBN 978-3-946348-25-2 (Print Ausgabe)
© Eridanus Verlag | Jana Hoffhenke
Hastedter Heerstr. 103 | 28207 Bremen
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Jana Hoffhenke
Coverdesign: Detlef Klewer
Satz | Gestaltung: Eridanus IT-Dienstleistungen
Für meine Melanie
»Es gibt große, herrschaftliche Hallen und hohe,
lichte Säle, es gibt kleine, schmucke Zimmer und
feine Salons, aber es gibt auch schmucklose enge
Kammern, die im Verborgenen liegen, Kammern,
die über verschlungene Pfade zu versteckten
Winkeln führen, zu geheimen Orten und
Plätzen, die wichtig sind.«
- Aus dem Gespräch zweier Legenden -
Durch Verdammnis und Trostlosigkeit
Das blutrote Wasser perlte an der knöchernen Staude herab und formte dabei ein Gebilde aus groben Adern, die den Anschein erweckten, als wäre noch irgendeine Art von Leben in dem versteinerten Leib der urwüchsigen Ishtiria. Auf den klebrigen Tropfen des dunklen Regens glitzerten die Lichter der elektrischen Nebel, die über den dampfenden Mooren aus verfaulten Algen und den unsichtbaren Fundamenten ausgelöschter Geschichte aufstiegen. Hin und wieder manifestierten sich festere Strukturen in dem Dampf aus Energie und gespenstischem Leuchten. Ab und zu würde man komplexere Gebilde in ihnen erkennen können. Manche von ihnen glichen Trichtern oder Röhren, deren Konturen deutlich zu sehen und durchscheinende, schimmernde Oberflächen so verfestigt waren, dass sich der von der stickigen Atmosphäre verfärbte Niederschlag in ihnen sammeln konnte. Nicht selten bildeten sich auf diese Weise glitzernde Rinnsale, die sich durch das Gewirr venöser Kanäle ihren Weg in die Tiefe bahnten, um dort unten Seen aus düsterem Karmesin entstehen zu lassen.
Wenn sich diese unwirklich wirkenden Tümpel aus Flüssigkeit und dem Staub einer entsetzlichen Vergangenheit irgendwann so sehr anfüllten, dass sich ihre immer mehr verdichtenden Körper nicht länger von den vergänglichen Formen elektrisierter Schwaden im Zaum halten ließen, zerrissen ihre instabilen Hüllen. Das verfestigte Innere der Tümpel und Teiche zerbrach ihr Gefängnis und fiel gleich herrlich leuchtenden Rubinen hinunter, um in den Sümpfen der vor den schroffen Gebirgshängen liegenden weiten Ebenen bis in alle Ewigkeit zu verschwinden. Das, was sich hinter dem dunstigen Areal des morastigen Plateaus abzeichnete, war nicht etwa klobiges Gestein oder verwaschener Fels, auch wenn es auf einen ersten Blick den Anschein erweckte. Es waren die geschmolzenen Überreste einer riesigen Metropole, die einstmals Milliarden von Lebewesen sicheres Obdach gewährt hatte. Heute waren jede Sicherheit und jeder Schutz verloren und einem Höllenpfuhl aus verstrahltem Schutt und ätzenden Gewässern gewichen, der noch weniger zu ertragen war als das, was die wahr gewordene Apokalypse nicht mit aller Gewalt getroffen und in den Abgrund der Vernichtung gerissen hatte. Aber auch dort, wo nicht das Zentrum der tödlichen Vernichtung gelegen hatte, gab es kaum noch etwas, das auf die Zeit hindeutete, in der noch alles ganz anders gewesen war. Die Vegetation war verdorrt und vergangen, mumifiziert wie die Ishtiria oder zu sterilen Einöden geworden wie die einst in goldener Pracht blühenden Titanweizenwälder an den vormals tosenden Wasserfällen der weit im Süden gelegenen Täler. Das, was die Zivilisation zustande gebracht hatte, war zerbrochen wie dünnes Glas. Es war einfach nicht fähig gewesen, Widerstand zu leisten gegen etwas, auf das es nicht gefasst gewesen war. Die Natur hatte sich dem Übermächtigen gebeugt und dort in Ehrfurcht verneigt, wo das übrige Leben aufrecht und starr geblieben war und so das eigene Ende hatte kommen sehen können. So gab es weder Augen noch Ohren, die Zeuge von dem wurden, was sich nun ereignete, auch wenn es nicht unbemerkt bleiben würde.
Blitze zuckten durch die verregnete Nacht voller Schwärze und erhellten die verstümmelten Überreste dieser Welt. Ihr gleißendes Feuer nahm an Intensität zu, als sie den Himmel in Brand setzten und eine klaffende Wunde in die alptraumhafte Realität schlugen, die das Schicksal hier hinterlassen hatte. Der Horizont zerbarst in schrillen Farben und ein triefender Körper wurde hervorgeschleudert.
Die humanoide Gestalt, die einen vormals weißen, aber jetzt zerkratzten, verrußten und vollkommen verschmierten Schutzanzug trug, rollte sich geschickt auf dem schlüpfrigen Boden ab und sprang auf die Beine, um eine breitläufige Massekanone von der Schulter zu reißen und durchzuladen. Das blasse Licht der Munitionsanzeige spiegelte sich auf dem glatten, kugelförmigen und vollkommen blickdichten, schwarzen Helm. Die Gestalt stand geduckt und wandte sich ruckartig zu allen Seiten, so als wartete sie nur darauf, von etwas angefallen zu werden. Nur zögerlich richtete sie sich langsam auf und zog sich vorsichtig einen kleinen Tornister von den Schultern, der nur den oberen Teil ihres Rückens verdeckt hatte. Noch immer schien sie mit einem plötzlichen Angriff zu rechnen und daher dauerte es doch eine ganze Weile, bis sie die weiße Tragevorrichtung von sich gelöst hatte und mit erneut gebeugtem Körper das mitgenommene Behältnis auf dem unsicheren Untergrund abstellen und öffnen konnte. Mit schützendem Stoff überzogene Hände fuhren hinein und ergriffen etwas, das ein wenig wie das Zepter eines Monarchen wirkte, allerdings anstelle von wertvollen Edelsteinen mit feinen Sensoren und blinkenden Leuchtdioden besetzt war. Der Ankömmling aktivierte das Gerät an dem mit aufgerauter Yill-Faser überzogenen Schaft und hob es anschließend abwartend in die Höhe. Die Gestalt schien auf etwas zu warten, vielleicht auf eine Veränderung in den wirr und willkürlich erscheinenden Mustern flackernder Lämpchen. Ein Außenstehender aber hätte zunächst nicht erkennen können, ob er den Sensorstab mangels eines besonderen Ergebnisses oder gerade wegen einer gewünschten Fluktuation im Lichterspiel wieder senkte, um ihn anschließend im Inneren des Tornisters verschwinden zu lassen. Als nächstes förderten flinke Hände ein quaderförmiges Gebilde aus mattem Metall zutage, das gerade so groß war, dass es die Seiten des breiten Gürtels überdeckte, an dem es die Gestalt über ihrer Hüfte befestigte. Es war ein einfacher Filter, wie ihn Waldarbeiter auf den Giftinseln von Certion oder die Bergleute auf Je’hmal benutzten, aber in einer Umgebung wie der hier vorhandenen, konnte er allenfalls eine Art gutgläubige Rückversicherung sein, für den Fall, dass die übrigen Schutzvorrichtungen des Sartre-Anzuges versagen würden. Mehr als ein letzter Hoffnungsschimmer, der vor dem Hintergrund der entstellten Welt kaum länger währen konnte als vielleicht drei oder vier Sekunden, würde damit nicht bewirkt werden, denn was nutzte schon ein einziges, trotziges Aufglimmen, wenn einem die erbarmungslose Kälte des sicheren Endes entgegenschlug?
Nachdem der Ankömmling in dem keine Linderung versprechenden Schatten der Ishtiria diese Vorkehrungen getroffen hatte, nahm er den Tornister wieder über die Schultern und machte sich daran, mit vorsichtigem und nach festem Boden tastendem Gang den Weg nach vorne zu wagen. Es waren nicht die Überreste der untergegangenen und wie zu einem mahnenden Grabmal wieder ausgespieenen Stadt, die ihn zu locken schienen, sondern die unter einer borkigen Kruste liegende Quecksilberwüste, die in der von der Gestalt eingeschlagenen Richtung ruhte. Das über Gelenken und Wirbelsäule ruhende Exoskelett des Anzuges unterstützte die Bewegungen mit mechanischer Kraft und Stärke, aber auch so war es sichtlich mühsame Arbeit, vorwärts zu kommen und dem unwirtlichen Ort Meter für Meter abzugewinnen. Die Gestalt überwand die vor ihr befindlichen Hindernisse zielstrebig, wenn auch nicht übereilt. Ihre Schritte waren bedacht gewählt und immer wieder begleitet von Pausen, in denen sie stehenblieb und sich sorgfältig nach möglichen Gefahren umsah. Dabei waren es augenscheinlich weder die irisierenden Blasen, die aus den zu dichten Knoten verwachsenen Knollen von Fenris-Kraut austraten, um nach kurzem Flug in einem heißen Feuerregen zu zerplatzen, die der Ankömmling mit besonderem Argwohn durch die pechschwarze Oberfläche des Helms hindurch betrachtete, noch die aus scharfkantigem Metall erblühenden Replikorchideen, welche als unaufhaltsamer Wildwuchs schon lange keiner kontrollierenden Aufsicht mehr unterworfen waren. Er fühlte sich verfolgt. Verfolgt von dem, was als einziges erspüren konnte, wohin sich sein noch immer vom Transfergel triefender Körper seinen Weg gebahnt hatte. Die surreale und lebensfeindliche Landschaft war nicht das, was mehr als alles andere zu fürchten war, sondern das, was in dieser ihre Existenz bewahrt und der Umgebung aufs Schrecklichste angepasst hatte.
Die in den Sartre-Anzug gehüllte Gestalt schritt weiter auf den dunklen Schorf über dem wabernden Silber zu, in dessen Tiefen vielleicht etwas verborgen sein konnte, was es wert war, einen Ort wie diesen aufzusuchen. Es war unwahrscheinlich, nahezu undenkbar, aber dennoch möglich, das ein lockendes Geheimnis unter allem Gift doch Heilung versprach.
In gleichmäßigen Abständen unterbrach die Gestalt ihre Wanderung durch Verdammnis und Trostlosigkeit und zog aufs Neue den Sensorstab zu Rate, um die gewählte Route zu überprüfen und Abweichungen auf dem gewählten Weg mithilfe neuer Messungen ausgleichen zu können. So war ihr Vorankommen nicht schnell oder zügig, aber sie legte größeren Wert auf besondere Genauigkeit, auch wenn im Inneren des Schutzanzuges Angstschweiß über eine besorgte Stirn rann. Die Szenerie war leblos und bis auf den gesichtlosen Wanderer leer, aber dennoch nicht geräuschlos oder ohne Bewegung. Immer wieder zuckte er unter dem lauten Brechen einer Wüstenscholle oder dem auch noch hier ohrenbetäubenden Aufschlag eines Klumpen gefrorenen Gases zusammen, der auf den noch in Sichtweite ruhenden Kadaver der Stadt und dort hinunterging, wo ihre höchsten Türme den Himmel zu berühren schienen. Manchmal bedurfte es auch nur eines lauteren Knisterns der energetischen Moornebel, um den Sartre-Anzug zusammenfahren zu lassen, und je mehr sein Aufenthalt sich in die Länge zog, umso deutlicher fielen derartige Reaktionen aus.
Mit spürbarer Erleichterung zog die Gestalt abermals den mit mit Yill-Faser überzogenen Schaft hervor und die empfindsamen Instrumente etwas erfassten, was sie schon sehr lange gesucht hatten. Sie kniete sich auf den nicht sonderlich stabilen Untergrund, legte Sensor und Massekanone beiseite und fuhr mit ausgestrecktem Arm in einen der mit der quecksilberartigen Substanz gefüllten Krater. Immer wieder brachten die aufgeregten Finger des Ankömmlings nur winzige Knochen an das Licht einer gestirnlosen Nacht. Manchmal waren es kleine Krallen, dann ein fast vollständig erhaltener Kieferknochen, schließlich wieder die Überreste von zersprungenen Rippen und Wirbeln. Vielleicht waren es die Skelette von 15 oder 20 einzelnen Wesen, aber als die tastende Hand nach etwas Größerem griff, war die Gestalt so gebannt, dass sie nicht bemerkte, wie sich hinter ihr eine Wesenheit manifestierte. Vorsichtig zog sie den silbrig verschmierten Leib eines kleinen Nagetiers aus dem feuchten Grab seiner Artgenossen, und nachdem er das Meiste der dickflüssigen Substanz von seinem Pelz gewischt hatte, begann das kaum mehr als faustgroße Geschöpf bereits wieder mit seiner kleinen Schnauze zu schnuppern.
Das Tier schlug die schwarzen Knopfaugen auf und erspähte als erstes die amorphe Kreatur, die sich wie eine riesige Amöbe hinter ihrem Retter emporgehoben und bereits dazu angesetzt hatte, jeden Moment ihren wulstigen, durchscheinenden Leib über ihn zu stülpen und zu verschlingen. Wie zur Warnung vor der drohenden Gefahr stieß es einen gellenden Pfiff aus und sprang die Gestalt im Sartre-Anzug so heftig an, dass diese das Gleichgewicht verlor und auf den erstarrten Untergrund stürzte. Die Amöbe peitschte mit einer Geschwindigkeit nach vorn, die man ihr aufgrund ihrer vorherigen Behäbigkeit wahrscheinlich nicht zugetraut hätte, aber verfehlte den zu Boden gegangenen Körper seines sicher geglaubten Opfers. Es zischte verräterisch, als dieses sich zur Seite rollte und aus seinem Anzug an den Stellen Atemluft entwich, wo der Sturz auf die borkige Oberfläche der flüssigen Wüste das schützende Gewebe beschädigt hatte. Eine Sekunde verging und die Gestalt brachte sich mit einem Sprung ins bodenlose Silber außer Reichweite ihres Angreifers. Eine weitere Sekunde verging und sie riss sich den Tornister von den Schultern. Die dritte Sekunde verging und sie hatte den Tansportdecoder in den Händen. Die vierte Sekunde verging und das Gerät war aktiviert und hochgefahren. Die fünfte Sekunde verging und der richtige Kanal zum Ebenenwechsel war bestimmt, während die es umklammernde Hand erschlaffte und kraftlos aus ihrem Griff entließ.
Doch dann geschah etwas, was zwar sonderbar, aber wohl nicht unbedingt überraschend sein mochte. Die letzte Sekunde wehrte sich vehement dagegen, sang- und klanglos zu vergehen. Sie wandelte sich stattdessen und wurde zu der, die ihr vorausgeeilt war, und diese wiederum zu ihrer Vorgängerin. Die Zeit hatte still gestanden und kehrte dann ihren Fluss für wenige Momente in die entgegenlaufende Richtung. Unbeeindruckt von dieser Wendung folgte der Decoder seiner Bestimmung und schleuderte die Gestalt im Sartre-Anzug und das knopfäugige Gepp, das sich in seinem Ärmel verbissen hatte, in weite Ferne, während der amorphe Jäger von Neuem die Fährte aufnahm.
Über allem Sein
An dieser Stelle im unendlichen Firmament schien das Licht von Planeten und Sternen deutlich schwächer zu sein als an allen anderen Orten, die er jemals gesehen hatte. Die Schwärze des leeren Raumes war von der gleichen Tiefe und Absolutheit, die er auf der Westminster oder anderen Schiffen durchquert hatte, aber das Funkeln flimmernder Reflexionen war blasser als anderswo und kam ihm fast noch weniger intensiv vor, als er es von seiner erst sieben Monate zurückliegenden Reise durch diese Gefilde in Erinnerung hatte.
Gill Cillian nahm seine Stirn zurück von der kühlen Scheibe des Bullauges und hob seinen Kopf, der schwer war von seiner letzten Schicht an Bord des träge durch das All ziehenden Litrarium-Frachters. Auch wenn der widerstandsfähige Industrieschaum in den Fässern im Rumpf des Schiffes besonders leicht zu verarbeiten war, hieß das noch lange nicht, dass es sich genauso einfach gestaltete, hier als erster Maat seinen Dienst zu tun, wenn die gerade erst überholten Navigationssysteme aufgrund von Spannungsschwankungen in der Phillipus-Welle durchgeschmort waren. Kapitänin Filder hatte ihm die Hölle heiß gemacht und Cillian konnte es nicht leiden, wenn sie das tat. Ihre Anfälle waren berühmt und gefürchtet und die Schreie eines Laabflüglers waren nichts dagegen. Es wäre so viel einfacher gewesen, seine eigene Wut über die schlechte Behandlung durch die hässliche Frau, die sich Kommandantin der Westminster nannte, an den Wartungsmannschaften auszulassen. Jedoch hatte Gill Cillian sich schon nach der ersten Woche auf dem alten Kreuzer geschworen, mit jedem einzelnen Mitglied der Besatzung – und wenn es auch nur eine Xcols-Milbe war, die sich irgendeinen Hohlraum in den Zwischendecks zum Laichen auserkoren hatte – ein geheimes Bündnis einzugehen und der stets schlecht gelaunten Schreckschraube Widerstand zu leisten.
Die Erinnerung ließ den Mann, der gerade die 40 überschritten hatte, schwach lächeln, obwohl er selbst dafür eigentlich zu müde war. Die Schwierigkeiten mit der schnippischen KI, die für die Steuerungskontrolle verantwortlich war und solange darauf bestanden hatte, dass kein interner Fehler in der Navigationsbank vorliege, bis er ihr mit der Versetzung in die Systeme der biologischen Aufbereitung gedroht hatte, hatten ihm viel abverlangt, aber alles, was Ärger für die verhasste Filder bedeutete, konnte ihn letztlich eigentlich doch nur aufmuntern. Erster Maat Cillian setzte sich zurück an seinen Platz in der eher spartanisch eingerichteten Messe des Frachtschiffs und begann damit, die gedünstete Forelle zu zerlegen, die ihnen Venice heute aufgetischt hatte. Sie schmeckte nicht schlecht, was nicht zuletzt daran lag, dass der schnuckelige Metallbolzen aus der Kombüse anders als die künstliche Intelligenz der Steuerung etwas von seinem Handwerk verstand. So verzehrte Gill Cillian die Salzkartoffeln, den Fisch und das genau richtig temperierte Quiv mit großen Genuss und wirklichem Wohlbehagen. Er achtete dabei nicht auf die Matrosen, deren Schicht mit seiner geendet hatte und die nun über die übrigen Tische verteilt ebenfalls mehr oder minder lautstark ihre Mahlzeiten einnahmen. Auch hatten die vorzüglich zubereiteten Speisen schnell seinen Ärger mit der Kapitänin, der Navigationsdatenbank und der Steuerungs-KI verdrängt, denn der Fisch war zart wie Butter, die Kartoffeln ein Gedicht und das Quiv so herb und säuerlich, wie man es sich nur erträumen konnte. Wahrscheinlich fühlte und dachte so mancher Matrose ähnlich oder sogar genauso und so war es nicht sonderlich verwunderlich, dass keiner das sanfte statische Flackern der chamäleoiden Kuppel vor dem Bug der Westminster bemerkte, als der Frachter sich durch die tarnende Projektion bohrte und anschließend mit immenser Wucht gegen die Außenhülle des pyramidenförmigen Satelliten prallte, daran zerschellte und in einem prächtigen Farbenregen explodierte.
In dem Bruchteil einer einzigen Sekunde vergingen sie alle, Gill Cillian, die nervige KI, Venice, die restliche Mannschaft und eine Handvoll Xcols-Milben und der dazugehörige Laich. Selbst Kapitänin Filder verglomm im stillen Glanz atomarer Strahlung und vielleicht, ganz vielleicht hätte es ihren Ersten Maat gefreut, dass sie, anders als er, keine so wohlschmeckende Henkersmahlzeit genossen hatte.
Die Kontrollen der langsam kreisenden Pyramide hatten keinen Alarm gegeben, weil die Kollision mit dem Frachter, dessen schmauchende Trümmer augenblicklich noch an ihr abperlten wie warmer Frühlingsregen, niemals eine Gefahr für die nahezu unzerstörbare Struktur dargestellt hatte. Erst jetzt erwachten schlafende Instrumente zu neuem Leben und begannen seit unzähligen Jahrtausenden ruhende Maschinen das wiederzuerwecken, was niemals zum Einsatz hatte kommen sollen. Zunächst war es in den labyrinthartigen Fluren und Tunneln des Satelliten noch finster, aber nach und nach schaltete sich die spärlich gehaltene Beleuchtung ein und tauchte das Innere von etwas, das seine Erschaffer als das Abbild von etwas gefertigt hatten, dass sie selbst nie erblickt hatten, in gespenstisches Licht. Die Tarnvorrichtung, die nur zum Teil aus den Energien der umliegenden Himmelskörper gespeist worden war, wurde abgeschaltet, um den Generatoren, die nun ihre wichtigste Aufgabe zu erfüllen hatten, alle möglichen erreichbaren Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Bis jetzt hatten automatisierte Systeme den Prozess eingeleitet, aber das, was noch bevorstand, war ein zu komplizierter Vorgang, als dass ihn die Konstrukteure der Station nicht unter eine besondere Aufsicht gestellt hätten, die den weiteren Aufgaben gewachsen war. Nahe dem bunkerartigen Fertigungsbereich wurde die mit dem Eis des Weltalls überzogene Abdeckung eines silbernen, aufrecht stehenden Zylinders entfernt, in dem der träumende Körper einer einzelnen Eternen zurückgelassen worden war. Sie weinte bittere Tränen, als sie erwachte und mit ihrem Augenaufschlag erkannte, dass ihr eigentlicher Plan fehl gegangen war. Langsam, aber keineswegs benommen von dem unendlich langen Schlaf, bewegte sie ihren zierlichen Leib, der von nichts verhüllt war außer einem durchsichtigen Gesichtsschleier, einigen langen Perlenketten, Armreifen und einer schneckenförmigen, bronzefarbenen Haube über ihrem ebenholzfarbenen Haar. Ihre Trauer währte nur einen schnell vergessenen Moment und die salzige Flüssigkeit, die die helle Haut ihrer weichen Brüste benetzt hatte, trocknete, noch bevor sie ihre schlanken Füße auf den kalten Boden vor ihrer Ruhestätte gesetzt hatte. Unbeeindruckt von der Kälte der Umgebung ließ die Eterne den Raum hinter sich, den sie seit Ewigkeiten nicht verlassen hatte, um sich auf den Weg dahin zu machen, wo die andere von zwei zur Verfügung stehenden Alternativen darauf wartete, alles Existierende auszulöschen. Anmutig und mit Bewegungen, die die Grazie einer Wju noch übertrafen, ging sie auf schnellen Schritten zu dem Raum, in dem das Werkzeug für den Untergang der Schöpfung geschaffen werden würde. Die Eterne betrat bald die Fertigungsanlagen, die hinter gigatonnenschweren Panzerplatten und verschlossen von den ausgeklügeltsten Sicherheitssystemen auf die Inbetriebnahme warteten. Durch den Schleier hindurch küsste sie den kreisrunden Aufsatz einer Sensorsäule, die aus blankem Marmor zu bestehen schien, und schaltete damit das Herz des pyramidenförmigen Ungetüms ein, das als verborgenes Damoklesschwert über allem Sein gehangen hatte. Sofort brannten feinste Strahlen aus 1408 Linsen erste Konturen in die in einem goldenen Bassin befindliche milchige Substanz, die ein längst vergessener Poet der Vergangenheit einmal als das »Wachs der Götter« bezeichnet hatte. Es brodelte und dampfte, während sich Farbe und Form dieses Wachses auf immer wieder neue Weise wandelte. Tiefrotes Gas wich einem Gelee, das so dunkelblau war, wie das Innere einer Lek. Dann verflüssigte sich prächtiges Purpur, welches erst wieder versteinerte, als es das Weiß von frischem Schnee angenommen hatte. Die Eterne beobachtete regungslos den Vorgang, der 77 Umdrehungen des Satelliten andauerte, bis er schließlich gänzlich abgeschlossen war. Dann trat sie näher an das heran, in was nicht nur sie, sondern mit ihr auch alle anderen Eternen ihre letzte Hoffnung gesetzt hatten. In dem güldenen Behältnis vor ihr lag nun eine humanoide Gestalt mit angedeutetem männlichem Körperbau, die so aussah, als bestünde sie aus zerbrechlichstem Glas. Allerdings bestand das, was ihr augenlos entgegenblickte, aus dem härtesten Material, das jemals geschaffen worden war. Die Eterne lächelte mit dunklen Lippen und strich mit zarten Fingern über die glatte Oberfläche des Ultimaten, um ihm mit süßer Stimme vorbestimmtes und zweckgerichtetes Leben einzuhauchen: »Erwache, mein Krieger der Vergeltung und beginne die letzte Reise!«
Der Ultimat erhob sich ohne jedes Zögern und folgte dem Befehl, der in jede Faser seines Körpers eingearbeitet worden war. Die Eterne kam nicht auf die Idee, ihm bei dem Ausstieg aus der hochwandigen Quelle seiner Schöpfung behilflich zu sein, denn das, was vor ihr stand, brauchte keine Hilfe. Er war die wahr gewordene Perfektion, all das, was die Wjui hätten sein sollen, aber vielleicht auch aufgrund ihrer biologischen Grundlage letztlich doch nicht gewesen waren. Der Krieger der Eternen hatte keine DNA. Er kannte keine Zellen, in denen sich das Siechtum des Versagens einrichten würde. Er hatte kein Fleisch, das schwach werden konnte, kein Blut das sinnlos vergossen werden würde. Der Ultimat hatte weder Gewissen noch Herz und würde keine Reue zeigen, wenn er das tat, was die Eternen von ihm verlangten. Er war ein williges, aber gleichzeitig unendlich machtvolles Instrument, dessen Einsatz verheerend sein würde. Die Eterne schmiegte sich an den Körper des Wesens, das anders als sie nicht aus einem Traum erwacht, sondern neu in ein Dasein geboren worden war, das mit allem Anderen vergehen sollte. Ihre eigene Wärme wurde von der Kühle des Gläsernen aufgesogen und ihr erregter Atem stieg als sichtbarer Dampf an ihm auf. Er war soviel mehr als die Wjui, die Göttinnen, die sie als Ersatz für das gezüchtet hatten, was sie einstmals mit ihrer Überlegenheit bezwungen und getötet hatten.
Zu anderer Zeit hätte sich die Eterne von ihm lieben und verehren lassen, er hätte ihr gedient und sie mit jeder Wonne bedacht, die sie von ihm verlangt hätte, aber durfte sie zögern, den Vollstrecker ihrer Ideale zu entlassen, um ihn in den bevorstehenden Krieg zu senden? Der Gedanke war berauschend und die Eterne, die solange nichts gehabt hatte als immerwährenden Schlaf, verfing sich in dem Gedanken, einen der letzten Augenblicke noch ein einziges Mal dazu zu nutzen, sich ganz ihren Begierden hinzugeben.
»Du kennst die Göttinnen, Ultimat?« Angelehnt an seine Brust sah sie zu dem blinden Gesicht des gläsernen Kriegers auf und lächelte ihn verführerisch an. »Die Wjui werden dir sagen können, wo sich der Schlüssel befindet. Sie sind lange genug durch Zeit und Raum gewandert, um auch das letzte Rätsel gelöst zu haben. Finde sie, um dich ihres Wissens zu bemächtigen. Bestrafe sie, um sie für den Frevel büßen zu lassen, den sie mit ihrem Unvermögen bewirkt haben!« Die Eterne zögerte noch einen Moment. Dann gab sie der Verlockung nach, die ihre Gedanken mit leisem Flüstern umgarnt hatte. »Aber bevor du aufbrichst, sollst du mir zu Diensten sein!« Die Eterne küsste den gläsernen Oberkörper des Kriegers und ließ sich dann elegant zu Boden sinken, von wo aus sie den Ultimaten verschwörerisch anlächelte und heranwinkte. »Komm zu mir, Liebster!« Die Worte der Eternen schwangen durch die Luft, betörend wie der Duft feinster Blüten, doch nichts geschah. Die Kreatur, die der Eternen ihr Dasein zu verdanken hatte, rührte sich nicht. »Liebe mich, Ultimat, liebe und bewundere mich!« Noch immer wurde ihren Wünschen und Befehlen nicht gefolgt und die Eterne wurde zornig. »Du hast mir zu gehorchen, Krieger. Ich bin deine Schöpferin. Du gehörst mir.«
Der Gläserne, der bewegungslos vor seiner Erschafferin gestanden hatte, ergriff mit der Rechten den Arm der Eternen und hob sie hoch und vor sich in die Höhe. Dann packte er sie mit beiden Händen an den Schultern und zerriss die nur kurz aufschreiende Frau in der Luft, so als wäre sie nicht mehr als ein einfaches Stück Stoff, und warf die Überreste achtlos zur Seite. Daraufhin verließ er die stark gesicherten Fertigungsanlagen und machte sich daran, in das spitze Ende der Pyramide hinabzusteigen. Auf dem Weg dahin betätigte er verschiedene Schalter und Hebel an Apparaturen, die allesamt dazu gedacht waren und nur den einen Zweck hatten, die Stätte seiner Geburt, diese wichtigste verbliebene Bastion der Eternen ein für alle Mal aus den dunklen Weiten des Alls zu tilgen.
Das Schiff, das die Eternen dafür vorgesehen hatten, dass der Ultimat der Selbstzerstörung des Satelliten entging, war nicht groß, sondern bot gerade genug Raum, dass sein eigener Körper Platz darin fand. Groß genug für Mitgefühl war es nie gewesen. Der Krieger der Eternen setzte sich in den Jäger, der ihn weit weg und zu den Wjui tragen würde, wo sein Schicksal bereits auf ihn wartete. Ein Bogen aus gleißendem Licht katapultierte ihn hinaus in eine arglose Welt und hinter ihm wurde das Becken aus Gold als Erinnerung an seine einstige Schwäche mit allem anderen und der Pyramide selbst vernichtet.
Das Innere des Palastes
Mit einer Mischung aus Euphorie und Besorgnis liefen Professor Selde und seine beiden Begleiter durch eine der engen Gassen unter dem mitternächtlichen Himmel der Kronkolonie Moira. Nur eine Handvoll Sterne war durch den Dunst zu erkennen, der sich über die schmalen Spalten zwischen den Reihen aus eng gebauten Fachwerkhäusern aus rotem Lehm gelegt hatte. Es war schwül und die Luft ungeheuer stickig von den Abwässern, die in den verschmutzten Kanälen seitlich der schlecht gepflasterten Straße verliefen. Der Gestank erschien nahezu unerträglich und Hieronymus Selde, Dekan der Universität von Pree und Mitvorsitzender des königlichen Wissenschaftsrates, hielt sich einen mit Lavendelblüten gefüllten Beutel vor das Gesicht, um den Würgereiz, den er nicht erst verspürte, seit er die Herberge »Zur lustigen Glom« verlassen hatte, zu mildern. Selde, der Ende 50, mittelgroß und im Ansatz noch dunkelhaarig war, schaute aus gequälten grauen Augen in die vor ihm liegende Dunkelheit. Der Professor befand sich nun schon seit fast vier Tagen in Moira, einer winzigen Siedlung auf dem durchs Weltall jagenden Kometen Gamma-Zeta-9172635 und hatte bis zum jetzigen Augenblick noch immer nichts gesehen, was es wert war, die aus dem wissenschaftlichen Hilfsfonds entnommenen Mittel so zu veruntreuen, wie er es in den letzten Wochen getan hatte.
Auch, wenn der Komet nur alle 28 Jahre im eigentlichen Hoheitsgebiet der Monarchie verweilte und den Rest der Zeit quasi als rechtliche Grauzone durch viele verschiedene andere Gebiete schoss, hatte es nicht den größten Anteil an Transcashflow erfordert, hierher zu gelangen. Das meiste hatten ihm ein paar Halsabschneider von Grabräubern abgenommen, wie er sie noch nie zuvor getroffen hatte. Ihre Vorschussforderungen für etwas, dessen Existenz noch nicht mal durch den Hauch eines Beweises bestätigt worden war, hatten immer größere Löcher in die einstmals recht umfängliche Stipendienkasse kommender Semester gerissen. Professor Selde zweifelte jetzt immer mehr daran, dass die immensen Ausgaben tatsächlich gerechtfertigt waren. Zuletzt hatte er sich sogar dazu gezwungen gesehen, einige unbedeutendere Artefakte aus dem archäologischen Archiv der Universität zu veräußern, und alles nur deshalb, weil er noch immer darauf hoffte, dass seine zwielichtigen Kontaktmänner in einem der zahllosen Schächte im eisigen Untergrund des rastlosen Moira etwas wirklich Bedeutendes aus den Schatzkammern der legendären Dynastie entdeckt hatten.
Professor Selde und seine beiden Begleiter eilten weiter durch die engen Straßenschluchten und in Richtung des alten Förderturms, den man zum Treffpunkt für die Übergabe von Geld und Ware auserkoren hatte. Nach einer guten Viertelstunde erreichten sie das verfallene Bauwerk, das ein wenig wie der skelettierte Hals eines Japp-Drachen aussah. Schon lange wurden hier keine Metalle mehr aus dem Boden geholt und das einzige, was hier noch immer als einigermaßen ertragreiche Einnahmequelle sprudelte, war das Plündern von Schätzen, die weit mehr wert waren als Gold und Silber. Plötzlich hörte Hieronymus Selde ein Husten und Keuchen. Einer seiner Begleiter, ein gedungener Söldner namens Nick Handernoon, den er als abgeklärten, durchtrainierten und an sich sehr widerstandsfähigen Mann kennen gelernt hatte, stützte sich mit einer Hand gegen einen stark verrosteten Transportcontainer und würgte Galle hervor. Sein anderer Leibwächter, ein robustes Schwergewicht, das wenn überhaupt nur auf etwas hörte, das wie »Groschel« klang, kicherte belustigt, was seinen grünen Rüssel auf und ab wippen ließ.
»Halt … deinen … Rand … !« Handernoon übergab sich und kam nicht dazu, weiter zu sprechen. Die übel riechenden Dämpfe, die aus dem Gemisch vom Unrat der Bevölkerung, giftigen Abwässern und brackigem Regenwasser emporstiegen, hatten ihn anscheinend mehr getroffen als seinen Kumpanen, dessen Geruchsinn zwar sensibel sein konnte, aber durch insgesamt neun aus feinen Hautlappen bestehende, natürliche Filter geschützt wurde, wenn es darauf ankam.
Professor Selde schüttelte den Kopf: »Wenn Sie nicht mein Angebot abgelehnt hätten und sich wie ich vor diesen unsäglichen Miasmen schützen würden …« Der Dekan der Universität von Pree schwieg, weil ihn die drei Augen Handernoons nun wirklich böse anstarrten. »Aber lassen wir das Reden, wir sind gleich am Ziel.« Selde lächelte eingeschüchtert und, so gut es ihm auch nur eben gelang, betont versöhnlich. Bisweilen hatten Kommunikationsprobleme mit Abkömmlingen des trigonischen Volkes ernsthafte und tragische Folgen und so kurz vor dem Abschluss dieser Odyssee von wissenschaftlicher Feldforschung wollte er den Erfolg nicht noch durch unbedachte Worte gegenüber einer recht gewalttätigen Spezies riskieren.
Nick Handernoon hob kurz die gefärbten Augenbrauen, aber nickte dann wortlos. Sein Freund Groschel gab ein bestätigendes Glucksen von sich und wies in Richtung der vor ihnen liegenden Förderanlage. Das doppelflügelige Tor zum Turm war stark verwittert, aber dem Aussehen nach noch so stabil, dass es dem direkten Ansturm einer kleinen Armee standgehalten hätte. Dafür war der Rest des Bauwerks wiederum in einem so desolaten Zustand, dass es sich bei einer auf diese Weise vorgehenden Streitmacht durchweg um Schwachköpfe handeln musste, die nicht begriffen, dass jede einzelne Wand beim nächsten kräftigen Windstoß einstürzen würde. Professor Selde hatte nicht vor, darauf zu warten, das Opfer von Sturm und herabfallenden Trümmerstücken zu werden, und so klopfte er schnell und ohne weiteres Zögern an der stabilen Pforte, was einen dumpfen Klang verursachte.
Die drei Männer warteten, aber als nichts geschah, nahm sich Groschel die Freiheit, nicht auf ein erneutes Klopfen zu warten, sondern mit seinem Rüssel gegen die zerkratzte Oberfläche des Tores zu drücken, die sich daraufhin tatsächlich mit einem unangenehmen Kreischen öffnete.
»Das gefällt mir nicht.« Der Trigon zog einen Vulkan-Revolver aus dem Halfter an seinem breiten Gürtel und Groschel griff nach dem Blastergewehr, das er an einem Gurt über sein breites Kreuz geschnallt hatte. Auch den Professor beschlich ein höchst ungutes Gefühl, das nicht allein seine Sorge um verschwendeten Cashflow beinhaltete, sondern über dies hinaus auch die Angst, um seine körperliche Integrität. Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht. Handernoon warf einen kurzen Blick in den Eingangsbereich, dann trat er ein und Groschel folgte ihm. Hieronymus Selde wusste zunächst nicht, was besser war. Sollte er ihnen nachgehen und vielleicht mit ihnen in eine Falle von Strauchdieben geraten oder sollte er allein vor dem verfallenen Förderturm auf sie warten und riskieren, dass er hier draußen marodierenden Mörderbanden zum Opfer fiel? Er wägte noch immer das Für und Wider seiner Möglichkeiten ab, als ihn grauenerregenden Schreie aus dem Inneren des Turmes zusammenfahren ließen. Irgendjemand oder irgendetwas erlitt Höllenqualen und er hatte weder die Entladungen eines Blasters noch die Explosion einer Vulkanwaffe vernommen. Der Professor war wie gelähmt und sein Gesicht war aschfahl geworden. Dann war es mit einem Mal wieder vollkommen still. Sein Körper zitterte wie Espenlaub und er wagte es nicht zu atmen. Die hinter dem Eingang liegende Finsternis starrte ihn an wie ein gähnender Abgrund oder der Schlund eines Ungeheuers. Endlich fasste er sich ein Herz und rief nach seinen Gefährten: »Handernoon?« Er bekam keine Antwort. »Groschel?« Wieder hörte er nichts. Aber was war das? Hatte sich dort etwas bewegt? Blickten ihn aus der Dunkelheit nicht bösartig funkelnde Augen an? Er verspürte keine Lust es herauszufinden. Der Dekan der Universität von Pree rannte los. Seine Beine trugen ihn so schnell weg von dem unheimlichen Ort, dass er ihn bald hätte nicht mehr sehen können, selbst wenn er einen Blick zurückgeworfen hätte. Aber er tat es nicht und machte erst wieder Halt, als das Adrenalin nachließ und seine Beine müde geworden waren. Hieronymus Selde sah sich erschöpft um. Er wusste nicht, wo er sich befand, denn irgendwie sahen die alten Bauten der Kronkolonie doch alle gleich aus. Er setzte sich hin und überlegte, was er tun konnte. Würde er es noch irgendwie zustande bringen, einen der geheimnisvollen Oktaeder der Dynastie in seinen Besitz bringen zu können?
Als der Grykk sich von einem der niedrigen Dächer auf ihn herabstürzte und mit wild hin und her zuckenden Klingen aus platinfarbenen Stahl auf ihn einhieb und ihn in Sekundenschnelle zerschnitt, traf es ihn vollkommen unvorbereitet und wie ein Blitz. Czesakz Gzii, heiliger Inquisitor der Acht, hatte den fliehenden Sünder verfolgt, ihn ergriffen und mit den gesegneten Geißeln geläutert.
Wie die Ankunft des tiefschwarzen Metaraumers Erlösung in der Kronkolonie Moira bereits unentdeckt geblieben war, so war zuvor auch die heimliche Abreise des Grykk-Ordenskriegers nicht bemerkt worden. Die spinnenartigen Wesen hatten die Reise durch das Gefüge zwischen den Welten nahezu perfektioniert und waren selbst dazu im Stande, die größten Schlachtkreuzer ihrer fürchterlichen Armada durch Zeit und Raum zu lenken, ohne sie Schaden nehmen zu lassen. Das besondere Glück für die meisten Welten war, dass die Grykk ihre wirkliche Heimat an einem unendlich weit entfernten Ort zu haben schienen und man die schrecklichen Kreaturen daher meist nur aus Aufzeichnungen und Überlieferungen kannte. Wenn man den Gerüchten Glauben schenkte, die über sie verbreitet wurden, dann unterhielten sie außerhalb der eigenen auf Kampf und Religion fixierten Kultur nur lockere Beziehungen zu dem Kult des untergegangenen Aszlil und planten gemeinsam mit diesen die Unterjochung zahlloser Zivilisationen und über lange Sicht das Ende aller bekannten Galaxien. Daher konnte man sich wohl glücklich schätzen, dass die silbrigen Webschiffe der Spinnenkönigin einfach zu groß und zu träge waren, um in das Zentrum der bevölkerten Galaxien vorzudringen. Die Jäger der Inquisition waren jedoch klein und um ein Vielfaches wendiger und schneller und damit fähig, wie aus dem Nichts an so gut wie jedem Ort zu erscheinen, um ihre gnadenlosen Missionen ausführen zu können. Die in ihnen reisenden Ordenskrieger waren wie Geister, ein Mythos wie die Schatten und vielerorts genauso gefürchtet wie diese. Czesakz Gzii war einer von ihnen. Er war der Liebling der Königin und sollte ihr einmal unzählige Enkel schenken, wenn ihre einzige noch unvermählte Tochter, Prinzessin Fassz, von ihrem Feldzug in das verwundbare Herz der Dynastie zurückgekehrt sein würde. Manche Grykk hielten Gzii für besessen, für bösartig und mordgierig, aber seiner Gönnerin gefielen diese Züge. Manche mutmaßten, dass selbst Königin Xassz Angst vor dem Inquisitor der Acht hatte, aber dieses laut auszusprechen, hatte aus gutem Grund noch niemand gewagt.
Als Czesakz Gzii die Erlösung durch die entsicherten Pforten des hunderte Kilometer durchmessenden Hauptnestes steuerte und vorbei an dem feuchtwarmen Gebilde aus hefeartiger Materie in das Innere des Palastes vordrang, ruhten die besorgten, aber auch neugierigen Blicke unzähliger achtäugiger Wesen auf ihm und begleiteten seinen Flug, bis er im verbotenen Trakt verschwunden war. Bis zu den Gemächern der Königin gelangten nur die Prätorianer, ihre Töchter und bemitleidenswerten Ehemänner, aber auch den Mitgliedern der Inquisition wurde der Zutritt nicht verwehrt. Als der in die Ordensrobe gehüllte Gzii das abgedunkelte Boudoir der mächtigsten Grykk betrat, war die noch von dem erst kürzlich beendeten Liebesspiel berauschte Xassz gerade dabei, den vierten Schenkel ihres verstorbenen Partners mit ihren verzierten Kieferklauen aufzubrechen, um sich das süße Mark einzuverleiben. Sie lächelte, als sie den Inquisitor erblickte, und winkte ihn zu sich heran: »Willkommen, Inquisitor. Ich hoffe, Eure Reise war erfolgreich.«
Czesakz Gzii verneigte sich. »Das war sie, Königin. Ich habe das Artefakt in die Kirche bringen lassen, wie Ihr es gewünscht habt.«
»Ich bin Euch dankbar, damit sind wir unseren Bestrebungen ein deutliches Stück näher gekommen. Setzt Euch und speist mit mir, Inquisitor.«
Gzii ließ sich auf dem Bett der weltlichen und geistigen Führerin der Grykk nieder und riss ein Stück warmes Fleisch aus dem letzten Geliebten der Königin, aber wartete mit dem Verzehr, bis auch die Monarchin einen erneuten Bissen zu sich nahm.
»Mittlerweile sollte Prinzessin Fassz bereits die übrigen Oktaeder in ihren Besitz gebracht haben. Die Kampfverbände der Dynastie haben der Allmacht nichts entgegenzusetzen gehabt, seid Euch sicher, Inquisitor.«
Der Ordenskrieger nickte, ohne Zweifel an den Worten der Spinnenherrscherin zu haben. »Wünscht Ihr, dass ich gleich zum Webschiff der Prinzessin aufbreche, Königin?«
Die Monarchin schüttelte ihr mit feinem Flaum bedecktes Haupt und wischte sich Blut von den Beißwerkzeugen. »Das hat Zeit bis morgen, lieber Gzii. Ich kenne Euch und weiß, dass ihr Ruhe zum Meditieren brauchen werdet, wenn ihr als heiliges Werkzeug der Acht in den Krieg ziehen müsst. Die Prinzessin wird es ertragen müssen, dass noch etwas Zeit vergehen wird, bis Ihr ihr Eure Aufwartung macht.«
»Wie Ihr wünscht, Königin Xassz.«
Jenseits der Eisgipfel
Der laue Wind des Morgens säuselte leise über die fleischigen Halme der flüsternden See und auf dem satten Grün der unüberschaubar weiten Graslandschaft glitzerte der frische Tau wie ein funkelnder Teppich aus schimmernden Perlen. Die Nacht war warm und ereignislos gewesen, aber dennoch hatte er an dem Ort, an dem niemals Stille herrschte, keinen Schlaf finden können. Immer wieder hatten ihn die Laute, die durch die wogenden Gräser und das Aneinanderreiben ihrer fingerbreiten und beinlangen Schäfte entstanden, wach gehalten. Vielleicht hatte er auch deshalb seine Augen nicht geschlossen, weil er sich in dieser besonderen Umgebung an etwas erinnert fühlte, was weit zurücklag, an eine schmerzliche Vergangenheit, die er, wann immer er konnte, in die dunkelsten Winkel seines Herzens verdrängte.
Tellec, der Prinz von Korinia lächelte aber, als er erneut dem Klang des Meeres lauschte, das weder Ebbe noch Flut, sondern nur den Wechsel der Jahreszeiten kannte. Es waren Stimmen, die er vernahm, Geschichten, die ihm erzählt wurden, auch wenn er die Worte nicht verstand und die geheimnisvolle Sprache ihm fremd blieb. Es reichte dem Prinzen, der die letzten beiden Tage in der Ebene zwischen den Eisgipfeln und der Donnerkluft verbracht hatte, selbst nach dem tieferen Sinn der Laute zu suchen, die als einziger Gefährte seine Jagd begleiteten. Es war vergleichbar mit der Stille, die auf den Wellen friedlicher Ozeane wogte oder zwischen den Wolken über einer Landschaft trieb, die weit, weit entfernt lag. Dennoch war das, was ihn in der flüsternden See umfing, letztlich doch anders. Tellec fühlte sich berührt und in eine besondere Stimmung versetzt, die ihm heilsame Ruhe spendete, aber in der er nicht einsam war, sondern verbunden mit etwas, das es gut mit ihm meinte und ihm Gedanken, Träume und Wünsche spendete, die er ohne seine Anwesenheit in einer der schönsten Landschaften auf Korin Theta nicht erfahren hätte. Der breitschultrige Chimaerer, der irgendwann einmal den Thron von Korinia besteigen sollte, betrachtete das Licht der ersten Sonnenstrahlen, das sich auf einzelnen Tautropfen brach und fühlte dabei seinen ruhigen und gleichmäßigen Herzschlag. Er fühlte sich von einer besonderen Stimmung erfasst, bereit für etwas, das nur darauf wartete, dass er den nächsten Schritt tat. Die kommenden Tage und Wochen würden alles andere als leicht werden, das wusste er. Er brauchte nicht die Gabe seiner Mutter, um das erahnen zu können. Seine Kindheit lag hinter ihm und er war ein Mann. Jetzt war es an ihm, zu beweisen, dass er auch ein Krieger war und darüber hinaus auch würdig, die Ehre und den Ruhm seiner Heimat auf dem Feld zu verteidigen. Vorsichtig legte Tellec seine Hand auf den stabilen Schaft seiner Lanze. Irgendetwas sagte ihm, dass er bald Zeuge eines seltenen Schauspiels sein würde. Seine scharfen Augen tasteten den Himmel ab und tatsächlich entdeckte er nach wenigen Momenten das Paar durchscheinender Schwingen, das er erwartet hatte. Das, was er jetzt sah, war beinahe ein Mythos. Als er zum ersten Male die Berichte über die Sichtung eines Laabflüglers auf Korin-Theta gehört hatte, hatte er ihnen keinen Glauben geschenkt, doch nun waren auch seine letzten Zweifel mit der gleichen Schnelligkeit verflogen, mit der das seltene Tier über das unter ihm liegende Grün eilte. Es war ein faszinierendes Schauspiel, mitzuerleben, wie das Laab es auskostete, mit seinen unter dem farblosen Federkleid liegenden Knochen die erste Sonne aufzusaugen und in Energie zu verwandeln, die es aufglimmen ließ und dem Wesen der Lüfte Auftrieb und Geschwindigkeit verlieh. Da war sie nun, die Trophäe, die er sich erhofft hatte. Vor ihm leuchtete das Skelett des Laabflüglers in irisierenden Farben. Jetzt hing alles von den Ködern ab, die Tellec aus dem Hause der Vergannen ausgelegt hatte. Seine Anspannung stieg und Minuten schienen wie Stunden zu vergehen. Noch immer kreiste das Laab über dem wogenden Grasmeer und schien unbeeindruckt von den Xos, die als Leckerbissen auf ihn warteten.
Doch dann geschah etwas, mit dem der korinische Prinz nicht gerechnet hatte. Der majestätische Laabflügler setzte tatsächlich zur Landung an, aber das nicht einmal in der Nähe einer der von Tellec aufgespießten Schuppenmaden. Dort, wo das Gras besonders dicht war, ließ er sich nieder. Sogleich begann er damit, mit seinem elfenbeinernen Schnabel gierig den Tau von den breiten Halmen zu trinken. Es war ein Schauspiel, dessen Zeuge wohl kaum jemand vor ihm geworden war. Als das Laab es berührte, verdampfte die in den Knochen gespeicherte Kraft das schillernde Nass mit elektrischen Entladungen in feines Aerosol. Geräuschvoll sog es den frischen Dampf durch seine Nüstern und gab dabei Töne von sich, die an schäumende Gischt erinnerten. Laabs waren selten und vielleicht mochte das auch der Grund sein, warum noch niemand beobachtet hatte, dass sie tranken, aber die Art, wie sie es taten, war tatsächlich erstaunlich. Vielleicht war es die Bewunderung, die er dem Tier entgegenbrachte, die Tellec zu lange zögern ließ, jedenfalls gab der Laabflügler mit einem Male ein schrilles Kreischen von sich und flatterte auf. Ohne nachzudenken riss der Prinz von Korinia seine Lanze hoch und schleuderte sie in Richtung des fliehenden Ziels, verfehlte es jedoch. Das Laab schoss in die Höhe, aber noch hatte Tellec nicht aufgegeben. Auch er preschte los, ließ seine Lanze, wo sie war, und erhob sich in die Lüfte. Der Chimaerer breitete seine mächtigen Schwingen aus, die er gemeinsam wie den scharfen Schnabel von seiner Mutter geerbt hatte, und jagte einer Beute nach, die ihm an Geschick und Schnelligkeit nicht nachstand. Das Laab stieg steil nach oben und in Richtung der aufsteigenden Sonne. Sollte es tatsächlich so sein, dass er die Atmosphäre verlassen konnte, musste der Prinz, der neben dem Körper auch das mutige Herz seines Vaters hatte, ihn stoppen, bevor es soweit war. Das tiefe Blau seines Felles glänzte seidig im langsam stärker werdenden Licht, als Tellec zur Seite ausbrach und versuchte, die die Flucht des Laabflüglers unterstützenden Luftströmungen mit seinem eigenen Leib zu stören und wegzulenken. Tatsächlich gelang es ihm auf diese Weise zunächst, den Abstand zu der fliehenden Trophäe zu verringern. Aber das Laab reagierte mit einem Instinkt, den eine möglicherweise Jahrhunderte umfassende Erfahrung geprägt hatte. Es legte die Flügel an und stürzte einen Moment im freien Fall nach unten, um dann durch einen gezielten Ausstoß der in ihm geladenen Energien seinen Verfolger zu blenden und gleichzeitig wie ein abgefeuertes Projektil erneut und um einiges beschleunigt davonzuschießen.
Nun war es der Prinz von Korinia, der sich auf seine Gefühle verlassen musste, denn vor seinen empfindlichen Augen tanzten augenblicklich nur irritierende Reflexionen und weiße Schleier. Er versuchte den flüchtenden Laabflügler mit den verbliebenen Sinnen zu erfassen und es gelang ihm irgendwie, die richtige Richtung zu erahnen. Seine Muskeln und Sehnen arbeiteten mit ganzer Kraft, während die fast schwarzen Federn seiner Flügel unablässig auf und nieder schlugen. Er war seinem Ziel schon so nahe, dass er das Knistern des schmalen Kondensstreifens beinahe schon fühlen konnte. Nur noch wenige Meter trennten Tellec aus dem Hause der Vergannen, den Prinzen von Korinia, von einem einzigartigen Schmuck und etwas, dass er seinem Vater Topite mit stolzgeschwellter Brust überreichen konnte, um damit die Tapferkeit zu beweisen, die notwendig sein würde, um auf dem großen Turnier von Permana zu bestehen.
Dann war es endlich soweit. Das prächtige silberne Horn auf seiner Stirn wurde warm, als es in den glitzernden Strudel eintauchte, den der Laabflügler hinter sich herzog. Tellec hieb nach dem Rücken seines Gegners, den er auch endlich wieder sehen konnte, aber traf diesen nur an der gefiederten Oberfläche und ohne ihn wirklich zu verletzen. Es konnte nur noch Sekunden dauern und er hätte auch ohne Lanze ein Wesen aufgespießt, das fast so selten war, wie eine brennende Kerze im Vakuum. Doch dann geschah etwas, mit dem Prinz Tellec nicht gerechnet hatte. Irgendetwas krachte mit großer Wucht gegen seine Seite und versetzte ihm einen Schlag, der ihm für einen Moment die Besinnung zu rauben schien. Er taumelte ungelenk durch die Luft und fiel hinab in die Tiefe. Während er stürzte und versuchte, die Benommenheit abzuschütteln, starrte er fassungslos dem verschwindenden Laabflügler nach und suchte gleichzeitig den sich immer weiter entfernenden Himmel nach dem schwarz-weißen Etwas ab, mit dem er soeben kollidiert war. Trotz der Augen eines Raubvogels konnte er jedoch nichts mehr entdecken. Es war so, als wäre da nie etwas gewesen, was wild rudernd gegen ihn geprallt war. Nachdenklich segelte der Prinz von Korinia über die flüsternde See, über der nun endgültig der Tag erwachte.
Es war bereits Nachmittag, als Tellec an einem der Marmortische der Palastbibliothek saß und eine durchsichtige Feder durch die Finger gleiten ließ, anstelle sich mit den Werken Harpytischer Philosophen der Frühgeschichte zu beschäftigen. Er hatte sie ganz in der Nähe seiner Lanze gefunden, wo der Laabflügler sie wohl verloren hatte, bevor er sich in den Himmel emporgeschwungen hatte. Es war ein seltenes Kleinod, aber nicht so kostbar wie das wertvolle Elfenbein, das er sich erhofft hatte. Dennoch waren seine Mutter Linja und sein Vater, Hochkönig Topite, sichtlich voller Stolz gewesen, als er es ihnen präsentiert hatte. Irgendwie schämte er sich jetzt sogar etwas, da er vielleicht gedacht hatte, sich ihnen noch einmal beweisen zu müssen.
Chimaerer trugen ihre Kämpfe schon lange nicht mehr nur um Stolz und Ehre willen aus. Sie waren tapfer und ruhmreich aus zahllosen Schlachten hervorgegangen und hatten die Fesseln des Chors als erstes der Protektorate gewaltsam zerrissen. Sie hatten mehr als genug Grund gehabt, sich den schlimmsten Gefahren zu stellen und sie hatten es getan. Daher erschien es Tellec jetzt bei schon weniger genauem Nachdenken als nicht mehr so wichtig, dass ihm der schon sicher geglaubte Schatz verloren gegangen war. Seine Gedanken kreisten jetzt eher um etwas anderes, das sich ebenfalls am Morgen jenseits der Eisgipfel abgespielt und was er sich möglicherweise doch nur eingebildet hatte.
»Du siehst besorgt aus, Prinz von Korinia. Eine so junge Stirn sollte nicht in Falten liegen.«
Der Chimaerer kannte die Stimme und sprang freudestrahlend auf: »Onkel Benjamin!« Seit Tellec denken konnte, gehörte Benjamin zu den ältesten und besten Freunden des Königshauses. »Wie geht es der neuen Welt?«
Benjamin Kramer ging bereits auf die Sechzig zu, wirkte aber nach außen hin noch immer so kraftvoll und munter wie man ihn auf Korin Theta seit jeher in Erinnerung hatte. Doch Tellec kannte ihn zu gut, als dass er nicht wusste, dass ihm der Verlust Novas viel von seiner früheren Lebensfreude geraubt hatte. »Der neuen Welt geht es gut. Wir haben uns übrigens darauf geeinigt, sie weiterhin Neue Erde zu nennen. Was soll ich sagen? Das Projekt ist auf einem guten Weg.«
Der Chimaerer umarmte seinen Paten und vergaß die Dinge, die ihn zuvor beschäftigt hatten. Er war einfach zu froh, den guten Freund, Ratgeber und Mentor nach langer Zeit einmal wieder zu sehen. »Es ist großartig, dass du hier bist! Hat dich Mutter eingeladen?«
Ben lächelte verschmitzt. »Der Hochkönig selbst hat mir eine Audienz gewährt, werter Prinz. Er hielt es wohl für weise, die Beziehungen zu der stärksten Macht im Universum nicht zu sehr im Sande verlaufen zu lassen. Nein, ganz im Ernst, der gute Topite hat mich eingeladen, weil es ja von jetzt an deine Aufgabe sein wird, das Königshaus Korinias im großen Wettstreit von Permana zu vertreten. Auf dem Fest vor deiner Abreise sollte ich nicht fehlen und wollte es natürlich auch nicht.«
Tellec strahlte und seine Augen funkelten noch intensiver als das Silber seines Horns. Dann legte er jedoch seinen Kopf grinsend zur Seite. »Wie sieht es denn mit einem Champion der Neuen Erde aus? Werdet ihr ebenfalls jemanden antreten lassen?« Für eine Sekunde erschien es dem Prinzen von Korinia so, als hätte seine Frage den Führer des letzten bekannten Weltenschiffes in irgendeiner Weise irritiert. Dann lächelte Ben Kramer jedoch weiter so, als wäre nichts gewesen, und Tellec nahm an, sich geirrt zu haben.
»Ach was!« Kramer winkte ab. »Wir haben weitaus Wichtigeres zu tun, als uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, weißt du? Politik ist der Krieg der Neuzeit, wusstest du das nicht? Ich habe die grauen Haare nicht etwa deshalb, weil ich alt geworden wäre, sondern weil mich das ewige Debattieren einfach fertig macht. Steht denn darüber nichts in euren Büchern?«
Der Chimaerer schüttelte den Kopf und lachte. »Das steht zumindest in keinem der Bücher, die ich schon gelesen habe, und glaube mir, Onkel Kramer, das waren wirklich etliche.«
»Du weißt doch, dass ich großes Vertrauen in dich habe.« Ben klopfte dem jungen Mann, den er in der Vergangenheit sooft hatte mit seiner Nichte spielen sehen, auf die Schulter und lachte ebenfalls. Dann verließen sie gemeinsam und weiter scherzend die Bibliothek und machten sich auf den Weg in den Thronsaal.
Seinen Weg durch das Schlachtfeld
Das Singen der 800er Spinette erfüllte die vom Waffenfeuer und dem Angstschweiß der Freisänger erhitzte Luft. Auch wenn in naher Zukunft bereits die dritte Dekade der großen Stille anbrechen sollte, waren die Feuer, in deren heißem Schein die eintausend Türme und unzähligen anderen Gebäude der gläsernen Stadt zu düsterer Schlacke zusammengeschmolzen waren, noch immer nicht erloschen.
Die junge Frau, deren erste Worte einmal »Krieg« und »Widerstand« gewesen waren, presste ihren Rücken gegen die versengte Außenhülle einer zerstörten Bariton-Raupe. Ihr Keramikharnisch knirschte unangenehm, als er über das aufgerissene Metall kratzte, aber in einer Welt, in der die Schmerzensschreie der Sterbenden schon seit Jahrzehnten nicht mehr verklangen, nahm sie den störenden Klang nicht einmal wahr. Rekrutin May ließ den Blick ihrer rehbraunen Augen über die Anzeigen ihrer Kampfoptik schweifen. Ein Dutzend der Freisänger, die sich mit ihr noch vor wenigen Stunden in der neuen Kapelle der phonischen Kavernen versammelt hatten, um gemeinsam mit General Nestrige zu beten, war bereits tot und der Tag war noch jung. Salome May blinzelte konzentriert und tastete sich so durch das visuelle Leitsystem der militärischen Software, die noch immer beständig mit den Daten der Aufklärung gefüttert, abgeglichen und aktualisiert wurde. Statistisch betrachtet blieben dem Kampftrupp und ihr noch eine knappe Stunde, bis die elektromagnetischen Speerwinde des Auditoriums den Transfer unterbrechen würden und sie mehr oder minder auf sich allein gestellt sein würden.
Der alte Platz der vierten Harmonie, der in den Tagen der Revolution als Schädelfeld bekannt geworden war, lag nun nur noch zwei Wimpernschläge entfernt von ihrer Position, aber May wusste, dass das zweimalige Klimpern ihrer Augen über einer holographischen Mobilkarte auf dem Schlachtfeld eine Ewigkeit oder, wenn es schnell ging, auch nur den Rest eines Lebens andauern konnte. Vinner Carz klopfte ihr auf die rechte ihrer gehärteten Schulterplatten und wies mit der behandschuhten Hand auf die Säulen eines zum Skelett einer Ruine gewordenen Atriums, das von den eigenen Trümmern, aber auch weiteren Raupenpanzerwracks eingerahmt wurde. »Ping und Camon werden mich begleiten. Du gibst uns Deckung.« Das war in etwa das, was der Mann, der vielleicht nur wenige Tage älter war als sie, ihr zugerufen hätte, wenn er es nicht mit Gesten ausgedrückt hätte.
Salome nickte und wünschte ihm und den anderen Rekruten Glück. Dann hob sie die schwere Wagner über die Schulter und feuerte ihr gleißendes Licht in Richtung der verborgenen Nester des Feindes. Salome schaffte es tatsächlich, ihren Gefährten einige Sekunden zu verschaffen, in denen sich das Feuer der Auditorianer nicht gegen sie wandte, und das reichte bereits aus. Die in das leichte Panzergeschirr gekleideten Freisänger warfen sich in die Deckung der massiven Pfeiler, die mit den gemeißelten Worten der verstummten Ein-Stimme verziert waren, bevor Chor-Waffen ihre brennenden Ladungen über ihren Köpfen und auf dem unzerstörbaren Kristall der stabilen Stützen verteilten. Noch waren die Schüsse der Gegner in den von ihnen erlebten Gefechten nur gefährlich gut gezielt gewesen, aber wenn die Gerüchte, die in den letzten Tagen in den unterirdischen Labyrinthen der Kavernen die Runde gemacht hatten, der Wahrheit entsprachen, dann würden die Rekruten von General Chez Nestrige bald auf die perfektionierte Präzision von Echosoldaten treffen. Glück und das schützende Feuer einer einzelnen Wagner würden dann kaum noch ausreichen, um auch nur eine geringe Chance zu haben, am Leben zu bleiben.
Ping Lolo, die zierliche Offizierin, deren bläuliche Hautfarbe einen Farbstich hatte, der leicht ins Rosé ging, kauerte sich, so gut es ging, hinter die Reste eines heruntergestürzten Baldachins und begann damit, den klobigen Mollbeschleuniger aufzubauen. Camon Nocas half ihr dabei, die kantigen Einzelteile aus dem Rückentornister zu ziehen und übernahm es, die herunter gekühlten Intensitätselemente in den Lauf zu schieben, während Vinner diejenigen unter Beschuss nahm, die Rekrutin May von ihrer Position aus nicht erreichen konnte. Ping hatte die Ausbildung ein gutes Jahr vor Vinner und drei Jahre vor Salome abgeschlossen und war anschließend bei der Artillerie untergekommen. Nicht jeder verstand es, die schweren Waffen aus den umfänglichen Waffenkammern des Chors einzusetzen, aber Ping Lolo war eine sehr kluge Frau und hatte in der Vergangenheit mangelnde Körperkräfte oft mit Raffinesse und Einfallsreichtum wettmachen können.
Camon Nocas, der ebenfalls Artillerist der Freisänger war, zeichnete sich neben überdurchschnittlicher Intelligenz wohl vor allem dadurch aus, dass er sich auch unter schlimmsten Bedingungen nicht aus der Ruhe bringen ließ. Ein Neuzugang von der Westfront hatte ihn einmal damit aufziehen wollen, dass er anscheinend noch immer den beruhigenden Klang der Ein-Stimme hörte, hatte das aber mit einem gebrochenen Arm gebüßt. Camon hingegen hatte selbst keine Miene verzogen, als er den Knochen zum Bersten gebracht hatte.
Vinner hatte Salome erzählt, dass die Eltern des Freisängers, der mehr als zwei Köpfe größer war als Ping Lolo, Insassen der phonischen Kavernen gewesen waren und sein Vater dort durch die Qualen psychischer Foltern wahnsinnig geworden und ums Leben gekommen war, was wiederum seiner Mutter das Herz gebrochen hatte. Die Freisänger aus der gläsernen Stadt hatten meist härtere Wege hinter sich, als die der anderen Welten des Chors. Hier waren die Kämpfe, aber auch die Vergeltungsschläge am schwersten gewesen und hatten millionenfache Opfer gefordert. Täglich starben hier Tausende und die Gewalt des Auditoriums nahm in der jüngsten Zeit sogar noch weiter zu.
Vinner Carz selbst war eine Kriegswaise. Das Patrizierhaus, in dem er mit seinen Eltern, einem Bruder und sieben Schwestern gelebt hatte, war in Flammen aufgegangen, weil hier niemand auf die Reden der Restaurationsanhänger hatte hören wollen. Salome blickte während einer kurzen Feuerpause zu ihm herüber. Er war ein gutaussehender Mann. Seine klaren Augen und sein ernster Blick bildeten einen anziehenden Kontrast zu den verspielten Haarlocken, die unter dem Helm hervorlugten und in die Stirn fielen. Salome mochte ihn, aber auch ohne den Krieg hätte sie nicht mehr in ihm gesehen als einen guten Freund oder so etwas wie den Bruder, den sie nie gehabt hatte. Er war nicht das, was ihr fehlte, wenn sie in der Nacht von Stille träumte, die sie mit jemandem teilen konnte. In den wenigen Momenten, wo Rekrutin May alleine war und die nötige Ruhe fand, um nachdenken zu können, war es kein Freisänger, dem sie in eine Welt folgen wollte, in der es weder Schmerz noch Angst gab. Erneut feuerte Salome die Wagner ab und brannte ihre Gegner mit vernichtendem Licht aus den Schatten ihrer Verstecke.
Ping Lolo klinkte das letzte der acht Standbeine in den ovalen Korpus des Mollbeschleunigers und justierte die Ablassdüsen so, dass ihnen die Treibgase nicht das Gesicht wegreißen würden, wenn sie ihn aktivierten.
Nocas richtete die Zielvorkehrung aus und nahm dann einen Schluck aus der Feldflasche, die an den breiten Ausrüstungsgürtel geheftet gewesen war. Vielleicht bedurfte das Starten des M-Beschleunigers neben einer sicheren Hand auch eine nicht vollends ausgetrocknete Kehle.
Es war dieses Bild, das sich als die letzte Erinnerung an den Artilleristen in Salomes Gedächtnis festsetzte. Er lehnte den Kopf leicht zurück, legte das perlmuttfarbene Trinkgefäß an seine Lippen, trank begierig das Nährstoffsoda und bekam ein leichtes Glänzen in den Augen. Sie vergaß, wie seine Brust zu einem brennenden Gefängnis für sein sterbendes Herz wurde, als der Chor-Strahler den Oberkörper Nocas’ auflodern ließ. Sie verdrängte das widernatürliche Geräusch, das sein berstender Leib erzeugte, als die Hitze ihn zerplatzen ließ, und die Schreie von Ping Lolo, die von den heißen Überresten ihres Waffenbruders überschüttet wurde. Wie so viele Male zuvor wurde Rekrutin May von ihrem Körper davor geschützt, den Verstand zu verlieren, und rettete sie mit einer Erinnerung, an der sie nicht zerbrechen würde wie andere, die weniger durchgemacht hatten als sie. Camon Nocas hatte erleichtert auf sie gewirkt. Salome May beneidete ihn. Er würde nie wieder leiden, nie wieder Schmerzen erfahren, nie wieder schreien und nie wieder weinen. All das, was sein Leben ausgemacht und erfüllt hatte, lag nun hinter ihm. Er war als Freisänger geboren worden und gestorben. Sein Leben war vorüber, aber wenigstens seinen Tod konnte ihm niemand mehr streitig machen.
Etwas ganz anderes galt für den Echosoldaten, der Salomes Kampfgefährten einen qualvollen Tod bereitet hatte. Breitbeinig stand der Echosoldat auf dem Dach eines herankriechenden Baritonpanzers und ließ den flammenden Schweif seines Strahlers über das Schlachtfeld streichen. Die Gerüchte stimmten also: Maestro Calva war im Namen der Ein-Stimme auferstanden und zurückgekehrt.
Ping Lolo schrie noch immer, während sie versuchte die klebrigen Funken von ihrer Panzerung und der darunter liegenden Montur abzuwischen. Vinner Carz gab Salome ein Zeichen und sprang anschließend zu der verbliebenen Artilleristin, um den Mollbeschleuniger gemeinsam mit ihr in Gang zu bringen. Als Rekrutin May ihre Hand in die Abzugsmulde der Wagner legte, zitterte sie und das Herz schlug ihr bis zum Hals. Sie kniff die Lippen zusammen, visierte das Phantom an und feuerte. Maestro Calva, der Dirigent von Permana und Kalindrid explodierte. Die Wagner erschütterte die Szenerie ein weiteres Mal mit einem Feuerregen aus den tiefsten Tiefen der Hölle und ihre Hitze hinterließ keine Spuren des Maestros, als sie ihn vergehen ließ. Als Antwort gab die Bariton-Raupe einen Schwall von Schrapnellen und Todeskreiseln ab, von denen jedes einzelne tödlicher war als das hungrige Maul einer Glomstute, aber Salome ging nicht ihretwegen so schnell sie nur eben konnte in Deckung.
Mit von Furcht und Panik geweiteten Augen riss sie die Wagner herum und suchte nach dem nächsten Ziel. Wo war es? Von wo aus würde der nächste Angriff kommen? Ein Geräusch, das dem plötzlichen Gefrieren von Wasser ähnelte, ließ sie zusammenfahren und selbst frösteln, als wäre ihr Innerstes zu Eis erstarrt. Der Echosoldat manifestierte sich. Maestro Calva sprang hinter einer der mit Hieroglyphen bedeckten Säulen hervor und schoss seinen Strahler in ihre Richtung ab. Salome May verlor das Gleichgewicht, aber behielt das Leben, als Angst ihre Knie weich werden und ihre Beine einknicken ließ. Sie spürte die unbarmherzige Energie ihre Augenbrauen versengen und schmeckte vergifteten Ozon auf ihrer trockenen Zunge. Mit der Kraft der Verzweiflung hob sie die Wagner über den Kopf und feuerte Salve für Salve auf den unbezwingbaren Gegner ab, aber verfehlte ihn jedes Mal.
Calva war bekannt für Geschick und Kampfkunst gewesen, was die Theorie anbelangte. Aber nun wurde die Freisängerin auch Zeuge seiner praktischen Stärken. Der Maestro wich den Geschossgarben der jungen Rekrutin aus, als wären es die ungelenken Hiebe mit einem groben Knüppel. Er trat einen Schritt zur Seite und neben ihm wurde Stein zu dampfendem Magma. Er neigte das Haupt und die Wagner brannte ein unsichtbares Loch in den Himmel und das weit über ihnen ruhende endlose Meer aus Sternen. Dann hob er selbst erneut seinen Strahler und feuerte. Die Wagner wurde in Stücke gesprengt und Salome von der Druckwelle getroffen und auf den Boden gedrückt. Sie spürte das Brechen ihrer Panzerung und darunter liegender Rippen. Dann war der Echosoldat schon über ihr und setzte ihr seinen Stiefel auf die schmerzende Brust, die darum bemüht war, Luft in die betäubten Lungen zu pressen. Sein Blick traf den ihren und versetzte ihrem Herzen einen Stich. Das war kein Mensch mehr, was sie da sah und betrachtete. Die fahlen Gesichtszüge des Dirigenten von Permana und Kalindrid hatten jegliche Menschlichkeit und jeden Hinweis auf Mitgefühl verloren. Maestro Calva war nur noch ein bloßes Abbild seiner selbst. Mit Wut in den Augen beugte er sich tief über die Gefallene und rezitierte eindringlich und mit zorniger Stimme eine Inschrift aus der siebten Halle der gläsernen Stadt, die jedem ihrer freien Bewohner bekannt geworden war: »Gleißendes Licht und tiefe Düsternis sind die Feinde meiner Göttlichkeit. Denn wo ich nicht sehe, kann ich nicht geben.«