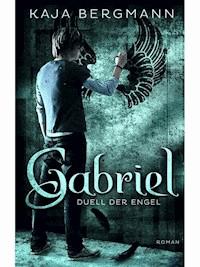
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bookspot Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Edition 211
- Sprache: Deutsch
Der 17-jährige Gabriel spürt, dass er ein Engel ist. Und er hat einen Auftrag, den nur er erfüllen kann: er muss Seraphin stoppen, einen Todesengel, der ihn bedroht und wahllos Menschen tötet. Als Seraphin ankündigt, auch Gabriels Freundin Sonja zu ermorden, sieht Gabriel nur noch eine Chance … oder ist es schon zu spät? "Ich erinnere mich an eine Sportstunde in der sechsten Klasse. Es war Sommer. Unglaublich heiß. Die Sonne brannte auf die Laufstrecke und ich konnte die Luft flimmern sehen. Wir saßen im Schatten eines unpassend neben dem Platz emporragenden Baumes und sollten unseren Puls messen. Den Zeigefinger auf die Innenseite des Hadngelenks legen. Dann sollten wir eine Runde laufen, schnell laufen, uns wieder hinsetzen und den Puls noch einmal messen. Ich habe ihn nicht gefunden. Habe dann einfach irgendwelche Zahlen leicht verändert von anderen abgeschrieben. Später habe ich ihn noch mal gesucht, meinen Puls. Gefunden habe ich ihn nie. Drei Jahre später wurde mir klar, dass ich tot war." Ein außergewöhnlicher All-Age-Thriller für Leser ab 12 Jahren mit verblüffendem Showdown.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Kaja Bergmann
Gabriel
Duell der Engel
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.
Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind von der Autorin nicht beabsichtigt.
Copyright © 2013 by EDITION 211, ein Imprint von Bookspot Verlag GmbH
1. Auflage
Lektorat: Eva Weigl
Layout: Mirjam Hecht
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München
Wie viele Engel gibt es?
Einer, der unser Leben verändert, genügt völlig.
Inhaltsverzeichnis
Habe keine Lust, ein Inhaltsverzeichnis anzulegen, tut mir leid!
Der Versuch, mein Leben in Kapitel zu gliedern, kommt mir falsch vor.
Prolog
Ich wusste nicht, dass ich tot war. Ich dachte, ich sei ganz normal. Wie du. Sofern du normal bist. Weiß nicht, kenn dich nicht. Aber du wirst wahrscheinlich mich kennenlernen. Wenn du das hier weiterliest. Wenn nicht – nun, dann nehme ich an, meine Geschichte interessiert dich nicht, du legst das Buch schon nach den ersten zwei Seiten weg und widmest dich anderen Dingen. Computerspielen zum Beispiel. Oder du liest einfach ein anderes Buch. Eins über lebende Menschen. Reale Menschen. Zumindest glaubst du das.
Ich hätte kein Problem damit. Ehrlich nicht. Eigentlich macht es mir Angst, wenn ich mir vorstelle, dass sich tatsächlich jemand für meine Geschichte interessieren könnte. Das bin ich nicht gewohnt. Aber selbst, wenn sie dir nicht egal ist, wirst du sie niemals glauben. Aber ich erzähle sie trotzdem. Einfach so. Weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Und dafür fange ich noch mal ganz von vorne an.
Vorgeschichte
Mit fünf Jahren erfuhr ich, dass ich adoptiert war. Mit zehn Jahren verstand ich, was das bedeutet.
Meine Adoptiveltern waren für mich immer meine einzig wahren Eltern gewesen. Schon immer. Für immer. Meine leiblichen Eltern hatten mich nie interessiert. Ich verstehe nicht, wie jemand Menschen suchen kann, die einen behandelt haben wie das letzte Stück Dreck. Schlimmer noch. Dreck existiert. Immerhin. Für meine leiblichen Eltern existierte ich scheinbar nicht.
Ich wurde aus dem Waisenhaus geholt, als ich gerade mal drei Wochen alt war. So in etwa. Mein genaues Alter weiß ich nicht. Meinen Eltern wurde erzählt, als man mich vor der Tür des Hauses gefunden habe, hätte ich ein Schild um den Hals getragen. Darauf habe »Gabriel« gestanden. Sie beschlossen, den Namen zu behalten.
Wir wohnten in einem kleinen Einfamilienhaus in Frankfurt am Main. Ich hasste diese Stadt. Sie war laut, dreckig und grau. Es schien immer zu regnen, selbst wenn die Sonne schien. Man kann auf viele Arten scheinen. Nein, Regenbogen habe ich hier noch nie gesehen. Nein, wirklich nicht.
Mit meinen Eltern kam ich immer gut klar, obwohl (oder weil?) beide wegen ihrer Jobs nie viel Zeit für mich hatten. Auch in dieser, meiner Geschichte werden sie keine große Rolle spielen. Genauer: Sie werden gar keine Rolle spielen.
Geschwister hatte und vermisste ich keine.
Meine Kindheit war kurz und glücklich. Kurz, weil ich mich kaum an sie erinnern kann. Glücklich, weil das, was ich noch weiß, nicht traurig ist.
Ich erinnere mich an eine Sportstunde in der sechsten Klasse. Es war Sommer. Unglaublich heiß. Die Sonne brannte auf die Laufstrecke und ich konnte die Luft über ihr flimmern sehen. Wir saßen im Schatten eines unpassend neben dem Platz emporragenden Baumes und sollten unseren Puls messen. Den Zeigefinger auf die Innenseite des Handgelenks legen. Dann sollten wir eine Runde laufen, schnell laufen, uns wieder hinsetzen und den Puls noch einmal messen.
Ich habe ihn nicht gefunden. Habe dann einfach irgendwelche Zahlen leicht verändert von anderen abgeschrieben.
Später habe ich ihn noch mal gesucht, meinen Puls. Gefunden habe ich ihn nie.
Hab was vergessen!
Habe vergessen, mich vorzustellen. Wie unhöflich. Entschuldige.
Ich bin Gabriel, wie du inzwischen ja schon mitgekriegt hast. Vielleicht. Zum Zeitpunkt deines Weiterlesens bin ich fünfzehn. Meinen Geburtstag habe ich bisher immer am 11. November gefeiert. Der Tag, an dem ich im Waisenhaus abgegeben wurde. Sankt-Martins-Tag.
Ich habe blond gelockte, längere Haare. Nein, ich habe noch nicht darüber nachgedacht, sie abzuschneiden und schwarz zu färben. Okay, ja, habe ich doch, sonst würde ich das hier nicht schreiben. Aber nein, ich werde es sicher nicht tun. Keine Ahnung, sie gefallen mir. Egal. Meine Augen sind braun und ich bin eher klein, würde ich sagen.
Ich wohne noch immer mit meinen Eltern in Frankfurt. Leider.
Am liebsten esse und trinke ich Schokoladeneis.
Mein Lieblingsbuch ist »Die Verwandlung«. Sie hat mich von dem irrwitzigen Wunsch befreit, Käfer sein zu wollen.
Ich mag den Nebel, aber hasse die Kälte. Innen wie außen.
Mein Lieblingsfilm ist »Der Sternwanderer«. Grandiose Landschaften, wundervoller Soundtrack, humorvoll, geniale Schauspieler, voller Liebe und Fantasie.
MeinLieblingsliedist "Come as you are”.Wow, Anführungszeichen oben, weil mein Rechtschreibprogramm erkannt hat, dass es ein englischer Titel ist. Ich bin begeistert.
Ich habe einen kleinen Block (nein, keinen Blog, einen normalen, altmodischen Block aus Papier!), in den ich meine Gedanken schreibe, wenn ich Angst habe, sie zu verlieren. Meistens aber bin ich zu langsam und verliere sie trotzdem.
Mir wird schlecht, wenn ich daran denke, dass die meisten Sätze dieses Kapitels mit »Ich« beginnen, obwohl ich weiß, dass das in diesem Buch noch öfter der Fall sein wird. Egal.
So, jetzt weißt du genug über mich. Wolltest du das überhaupt? Ich hoffe schon, denn ich fühle mich nun ziemlich nackt. Angreifbar. Als hätte man mich aufgeschnitten und mein Inneres nach außen gestülpt. »Heute tragen wir’s mal linksrum!« Nur dass ich kein T-Shirt bin. Und man nicht nur Nähte sieht, die sonst verdeckt bleiben. Wäre es nur so.
Tut mir leid, wenn all das inzwischen etwas langweilig für dich geworden ist. Die Einleitung ist wohl für beide Seiten etwas anstrengend, für mich vielleicht sogar noch mehr. Aber es ist so einfacher. Für uns beide. Glaub mir; inzwischen kennst du mich ja. Ein wenig.
Ach, und noch was: Versuch nicht, ein psychologisches Profil oder so was von mir zu erstellen. Minderwertigkeitskomplexe, auf der Suche nach wahrer Identität, Selbstzweifel.
Lass es. Das funktioniert nicht. Wirst schon sehen.
Notizen
November
Alles wird grau. Alles wird kalt. Alles wird dunkel. Das Licht verabschiedet sich aus der Welt und ich habe Angst, dass es nie mehr zurückkommt. Wenn ich daran denke. Meistens denke ich nicht daran.
Ich sitze an meinem Fenster, in eine weiche Decke gehüllt, die mir durch die Dunkelheit draußen umso behaglicher erscheint. Außer wenn ich daran denke. Dann scheint sie hart. Meistens denke ich nicht daran.
Im kalten Weiß der Straßenlaternen schweben lange Regenfäden gen Boden. Irgendwo zieht eine Gruppe kleiner Lichter vorbei. Sie sind gelb und warm, nicht weiß und kalt. Erstaunlich, wie eng die Dinge beieinanderliegen. Wenn ich daran denke, fällt mir auf, wie unterschiedlich sie sind. Meistens denke ich nicht daran.
Die Lichter werden von Tönen begleitet. Auch sie sind warm, warm und hell. Wie Nebelschwaden gleiten sie vorbei. Nebelschwaden im November. Wenn ich daran denke, fällt mir auf, wie vergänglich sie sind. Meistens denke ich nicht daran.
4. Dezember 2009, 07:15 Uhr
Liebe macht blind. Und ist gefährlich. Aber all das nehmen die Menschen in Kauf. Nur um zu lieben. Um geliebt zu werden. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich verachte sie nicht für die Gefahr und den Schmerz, den sie bringt, die Liebe. Ich liebe sie. Und bereue nichts.
Der Morgen empfing mich dunkel. Das tat er schon lange. Eine schlechte Angewohnheit, finde ich. Abends mag ich die Dunkelheit. Morgens nicht.
Während ich zum Bus stapfte und mich fragte, warum der Schokoladenweihnachtsmann, der gestern Abend wegen mir hatte sterben müssen, nicht geblutet hatte, dachte ich an den Nachmittag. Freitag. Endlich! Jeden Montag beginne ich, mich auf den Freitag zu freuen. Aber dieser Freitag schien besonders schön zu werden. Denn heute Nachmittag wollte ich mich mit Sonja treffen. Eis essen gehen. Eis im Dezember. Es gibt nichts Schöneres!
Ich bog um die Ecke und da war sie. Sonja. Sie stand unter dem Dach der Bushaltestelle und sah mich – nicht. Ich lief etwas schneller und plötzlich wandte sie den Kopf, sah mich an und lächelte. Mein Herz schlug einen Salto. Ich versuchte es zu beruhigen und blieb stehen. Presste meine Hand auf die Brust und dachte, es so zum Stillstand bringen zu können. Heute weiß ich, dass ich das nie können werde. Mein Herz ist da, es schlägt, aber es haucht mir kein Leben ein. Es ist da, um mir zu sagen, wie ich mich fühle, dass ich fühle. Nicht, um mir zu sagen, dass ich lebe. Hätte es das versucht, hätte es gelogen.
Während ich auf der Straße stand und vergeblich versuchte, mein Herz zu beruhigen, bemerkte ich, wie sich Sonjas Gesichtsausdruck veränderte. Das Lächeln verschwand. Zuerst blickte sie leicht irritiert, dann erschrocken und schließlich ließ pures Entsetzen sie von einem Schlag auf den anderen aschfahl werden. All das spielte sich wahrscheinlich in Sekundenschnelle ab. Mir kam es unendlich langsam vor. Und doch konnte ich nicht reagieren. Wollte nicht reagieren. Ich stand einfach nur da und blickte Sonja an, während mein Herz einen Rückwärtssalto mit anschließender Schraube drehte. Wow, wenn es so weitermachte, sollte ich es bei den Olympischen Spielen anmelden.
Da hörte ich plötzlich Stimmen. Ich hörte sie, aber verstand sie nicht. Ich glaube, sie riefen meinen Namen. Sonja fuchtelte mit den Armen. Ihr Mund öffnete sich, aber ich hörte nicht, was sie schrie. Ich wollte es auch gar nicht hören, denn mir war gerade aufgefallen, wie schön sie war. Mit ihrer weißen Mütze, den schulterlangen, braunen Haaren und den vor Kälte geröteten Wangen sah sie aus wie ein Engel. Welche Ironie …
Der BMW erwischte mich in voller Fahrt. Ich spürte einen Schlag, dann wurde ich durch die Luft geschleudert. Sah den schneebedeckten Boden, den dunklen Morgenhimmel und wieder den Boden. Irgendwo in einem versteckten Winkel meines Gehirns hörte ich leise Major Tom. Völlig losgelöst, von der Erde … Keine Ahnung, wo es das ausgegraben hatte.
4. Dezember 2009, 12:59 Uhr
Leise schwebte ich über die unberührte Schneefläche hinweg, ein glänzend weißer Boden in der konturlosen Dunkelheit. Alles war weiß und dunkel. Vereinzelt sah ich Menschen, nicht größer als Glühwürmchen in kleinen Puppenhäusern. Draußen war es leer, leer und schön. Ich wusste, dass es kalt sein sollte, aber ich spürte die Kälte nicht. Meine Arme hatte ich ausgebreitet und das Einzige, was ich trug, war ein langes, weißes Hemd. Ich spürte einen sachten Luftzug und stellte fest, dass es mein Flügelschlag war. Als ich die Flügel ein wenig anlegte, schoss ich plötzlich hinab, wurde schneller und schneller. Der Schnee war auf einmal ganz nah. Ich spürte, dass ich Angst haben sollte, Angst vor dem Aufprall und dem darauf folgenden Schmerz. Aber ich hatte keine. Mein Herz pochte ruhig und gleichmäßig in meiner Brust und meine Körperhaltung war so locker und entspannt, als würde ich gerade im Wohnzimmer vorm Fernseher sitzen, anstatt mit Überschallgeschwindigkeit meinem sicheren Ende entgegenzusteuern.
Da wurde mir klar, dass ich so entspannt war, weil ich wusste, dass mir nichts passieren würde. Weil ich wusste, dass ich, wenn ich auf dem Boden aufkam, nicht sterben würde. Weil ich wusste, dass ich ein Engel war.
In meiner Brust breitete sich ein Gefühl unendlicher Freude aus. Mein Herz begann, pochende Saltos zu schlagen – das machte es sonst nur, wenn ich Sonja sah. Ich flog über die Welt, die mir in ihrer ganzen Größe und Schönheit offenstand. Nichts war zu weit für mich, nichts zu groß und nichts zu hoch. Wo ich hinwollte, konnte ich hinfliegen, einfach so. Einmal um die Welt? Kein Problem! Ich wusste, es konnte höchstens ein paar Minuten dauern.
Als der Boden nur noch wenige Meter entfernt war, breitete ich meine Flügel wieder aus und sauste in einem perfekten Bogen über ihn hinweg, wieder hinauf, den Sternen entgegen.
4. Dezember 2009, 14:32 Uhr
»Hey, ich glaube, er kommt zu sich!«
»Na ja, er war ja auch lange genug weg!«
Langsam öffnete ich die Augen. Eigentlich wollte ich länger in meinem Traum bleiben. Noch ein bisschen über die schneebedeckte Dezemberlandschaft gleiten. Noch ein bisschen das Gefühl der unendlichen Freiheit auskosten. Aber ich fühlte, dass es sich lohnte, die Augen zu öffnen und den Traum verblassen zu lassen.
Die Helligkeit erschlug mich. Alles war weiß, doch ich konnte nicht sehen, was es war. Vor meinen Augen flimmerte es so gewaltig, dass mir schlecht wurde. Ein Stöhnen drang ungewollt aus meiner Kehle, es klang rau und kratzig. Ich kniff die Augen wieder zu und versuchte dann langsam, Schritt für Schritt, sie nochmals zu öffnen.
»Gabriel, Gabriel, geht’s dir gut?«
»Pst, lass ihn erst mal zu sich kommen.«
»Aber er hat gestöhnt! Gabriel, was hast du?«
»Pssst!«
Mit der Zeit wurde es besser. Ich konnte eine weiße Zimmerdecke erkennen. Weiße Wände. Weiße Vorhänge vor einer weißen Dezemberlandschaft draußen, die von einem weiß-grauen Himmel überspannt wurde. Dann ein Gesicht. Sonjas Gesicht! Sie beugte sich über mich, ihre Augen voller Sorge und Schmerz. Mein Herz zog sich zusammen. Ich musste husten.
»Gabriel«, flüsterte Sonja. Ihr Gesicht war meinem ganz nahe. »Wie geht’s dir? Hast du Schmerzen?«
»Mir geht’s super«, flüsterte ich zurück. Meine Stimme klang noch immer rau. Das Sprechen hinterließ ein juckendes Kratzen in meinem Hals und ich musste wieder husten. Das Husten tat meinem Herz weh. Das Husten oder Sonjas vor Sorge verzerrtes Gesicht.
»Du hörst dich aber gar nicht super an«, meinte sie mit einem traurigen Lächeln.
»Was ist passiert?« Ich nahm mir vor, nur noch so wenige Worte wie möglich zu benutzen. Worte sind scharf und gefährlich. Ich hatte Angst, sie würden meinen Hals zerschneiden.
»Du hattest einen Unfall. Heute Morgen. Du bist plötzlich auf der Straße stehen geblieben und der Idiot in dem BMW hat nicht angehalten. Nicht mal richtig gebremst hat er. Wenigstens hat er keine Fahrerflucht begangen. Na ja, es haben ihn wohl auch zu viele gesehen. Vielleicht kommt er ja zu dir und entschuldigt sich. Keine Ahnung. Aber warum bist du denn auch stehen geblieben? Mitten auf der Straße, verdammt?!« Die letzten Worte schrie sie fast. Es machte mir Angst. Ich sagte leise »Ich weiß nicht« und hasste mich dafür. Ich hätte so was sagen sollen wie »Weil ich dich gesehen habe und mein Herz verrücktgespielt hat« oder » Weil ich blind war. Blind vor Liebe zu dir.« oder schlicht »Weil ich dich liebe.« Ich hätte einfach die Wahrheit sagen sollen. Aber ich tat es nicht. Und kam mir unglaublich feige vor.
»Wo sind meine Eltern?«, fragte ich stattdessen weiter.
»Weißt du doch. Auf Geschäftsreise. In China oder so. Die Leute vom Krankenhaus haben ihnen Bescheid gesagt, sie versuchen, so schnell wie möglich heimzukommen, aber es wird wohl noch ein wenig dauern. Na ja, du kennst sie ja. Hast du Schmerzen?«
»Was?«
»Ob du Schmerzen hast.«
»Nein.« Und das war nicht mal gelogen. Ich spürte keinen Schmerz bis auf den in meinem Hals.
»Na ja, bei den Mengen an Morphium, die die dir reingepumpt haben, ist das auch kein Wunder.«
»Ich bin ein Engel.«
»Was?«
»Ich bin ein Engel.«
In ihrem Blick lag reine Irritation. Sonst nichts. Nur Irritation. Sie sah kurz zur Seite und murmelte etwas von wegen »Ich hab’s ja gesagt, Morphium«.
»Nein, du verstehst nicht!« Der Schmerz in meinem Hals explodierte. Und ich schrie trotzdem weiter. Schrill und laut. Obwohl Sonja zurückschreckte. Obwohl der Schmerz sich zu einem brennenden wütenden Punkt zusammenzog, der mir fast die Kehle zuschnürte. »Ich bin geflogen! Gerade eben! Über eine weiße Landschaft. Es war unglaublich! Mir war nicht ein bisschen kalt! Mein Herz ist nicht mit meinem Körper verbunden, weißt du? Es ist da, aber eben nicht verbunden. Aber ich kann trotzdem fühlen, verstehst du? Ich hab ein Herz, aber keinen Puls. Weil ich ein Engel bin!«
Zweifelnd sah mich Sonja an. Dann beugte sie sich wieder zu mir. »Du liegst seit heute Morgen im Krankenhaus, Gabriel. Du hast geträumt.« Sie tat mir weh. Mein Herz krümmte sich, als müsse es sich übergeben. Es war die Art, wie sie zu mir sprach. Leise und sehr deutlich. Als wäre ich wieder fünf. Als wäre ich verrückt.
Doch bevor mein Herz sich tatsächlich übergeben konnte, stand ich neben mir. Ich sah zu mir herab, wie ich bleich im Bett lag, mit dunklen Ringen unter den Augen und aufgeplatzten Lippen. Meine blonden Locken klebten mir dunkel an den Schläfen. In meinen Augen stand ein wirrer Ausdruck. Und ich sah Sonja, wie sie auf einem Stuhl neben meinem Bett saß, zwar ebenfalls bleich, aber schön wie immer. Ich sah, wie sie mit mir sprach, besorgt und voller Angst. Und ich verstand, wie es auf sie wirken musste. Meine ganze Geschichte. Alles, was ich sagte. Und dann verstand ich, dass sie recht hatte. Ja, ich hatte den gesamten Vormittag im Krankenhaus gelegen. Natürlich, der wunderbare Flug über die dunkle Dezemberlandschaft war nur ein Traum gewesen. Sicherlich musste es auf sie wirken, als sei ich verrückt. Und trotzdem – irgendwie wusste ich, dass in dem Traum eine unbestreitbare Wahrheit lag, die ich soeben entdeckt hatte.
Und dann sah ich noch etwas. Einen Mann, der einen weißen Kittel trug und an der Wand lehnte. Warum hatte ich ihn zuvor nicht bemerkt? Und plötzlich war ich wieder in meinem Körper, mit dem seltsamen Gefühl, dort nicht hinzugehören.
Ich blickte den Mann an der Wand an. »Wer sind Sie?«, fragte ich leise. Mir wurde plötzlich bewusst, dass er alles mit angehört haben musste, und ich spürte, wie Blut versuchte, in meinen Kopf zu steigen, es aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht schaffte.
»Ich bin Dr. Schmitt«, sagte der Arzt ruhig. Er hatte eine tiefe, angenehme Stimme. Um seine Augen spielte ein Lächeln, das es sofort unmöglich machte, ihn nicht zu mögen. Lässig stieß er sich von der Wand ab und gab mir die Hand. »Angenehm. Und du bist also ein Engel, ja?« Er sagte das nicht spöttisch, sondern sachlich und ruhig, als wäre es das Normalste der Welt. Trotzdem konnte ich ihn nicht ansehen. Mein Blick wanderte zu Sonja, die mich immer noch besorgt anblickte.
»Nein«, sagte ich leise. »Ich habe nur geträumt. Ich stand kurz neben mir.« Im wahrsten Sinne des Wortes. Sofort entspannten sich Sonjas Gesichtszüge und in ihren Augen spiegelte sich reine Erleichterung.
»Tatsächlich?« Dr. Schmitt sah mich prüfend an. »Nun, das ist nichts Ungewöhnliches, musst du wissen. Der Traum, meine ich. Schließlich warst du den gesamten Vormittag lang ohnmächtig.« Ich blickte ihn wieder an, doch er sagte nichts mehr.
»Und weiter?«, fragte ich deshalb.
»Wie weiter?«, erwiderte Dr. Schmitt gelassen.
»Na ja, Ihre Diagnose. Was habe ich?«
»Ach, das meinst du. Na ja, es grenzt an ein Wunder. Du hast nur ein paar Prellungen. Keine Knochenbrüche, keine inneren Verletzungen, nichts. Du musst dich instinktiv genau richtig über das Auto abgerollt haben. Der geborene Stuntman, sozusagen.«
Sonja blickte auf. »Und warum haben Sie ihm dann so viel Morphium gegeben?«
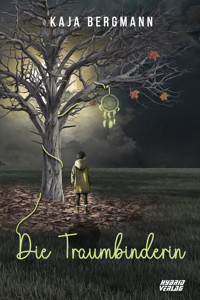
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











