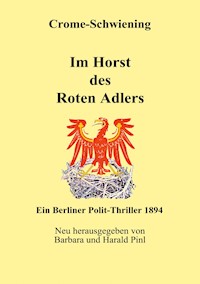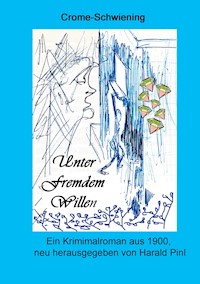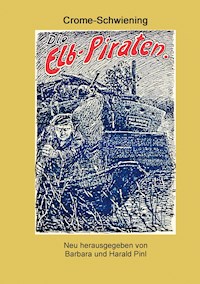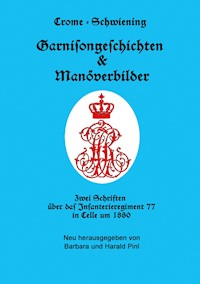
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Einjährig-Freiwilliger erlebt und hört Crome-Schwiening in seinem Infanterieregiment Nr. 77 in Celle um 1880 herum so manches Anekdotenhafte. Aus der Perspektive der Mannschaftsstube erzählt er eine Reihe einzelner Geschichten, die sich in der Garnisonstadt Celle und bei Manövern in der Provinz Hannover zugetragen haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UmschlagZirkel des 2. Hannoverschen Infanterieregimentes Nr. 77, aus den Buchstaben H, I, R und den Zahlen 2 und 77.
Inhalt
Einleitung
Garnisongeschichten
Personen und Orte
I Die Wurst
II Tambour Kreikemeyer
III Die „Spatzen“
IV Der Genius von „48“
V Füsilier Säuglings Rache
VI Kantinenwirts Töchterlein
VII Ick bün bal‘ wedder da
Manöverbilder
Personen
Orte
I Meiers Taschentuch
II Sein Geheimnis
III Der Hund des Kapellmeisters
IV Der Manövergaul
V Das Biwakhuhn
VI Der Füsilierteufel
Das Regimentslied der 77er
Erläuterungen
Historische Hintergründe
Kurzvita Crome-Schwienings
Militärschriften Crome-Schwienings
Quellen und Literaturhinweise
Abbildungen mit Nachweis
Einleitung
Carl Crome-Schwiening leistete nach seinem Abitur an einem Celleschen Gymnasium Wehrdienst als Einjährig-Freiwilliger im 2. Hannoverschen Infanterieregiment Nr. 77. Seine Geschichten spielen meist in der Garnison Celle, wo das Regiment in der großen Infanteriekaserne, dem heutigen Neuen Rathaus, stationiert war. Die beschriebenen Manöver des Regimentes fanden zwischen Lüneburg und Göttingen, Hannover, Lüchow und Helmstedt statt.
Ursprünglichkeit und Ortstreue seiner Schilderungen lassen davon ausgehen, dass Crome-Schwiening die Geschichten selbst erlebt oder von ihnen während seiner Dienst- und Übungszeiten etwa in den Jahren zwischen 1877 und 1882 erfahren hat. Sein Alter, geboren 1858, und die Erwähnung des Kommandeurwechsels 1881 deuten darauf hin. Somit haben wir Geschichten eines Zeitzeugen über die Zustände auf unterster Ebene der preußischen Armee vorliegen – wenn vielleicht auch anekdotenhaft überzeichnet.
Die zahlreichen Worte auf Französisch, Englisch und Lateinisch wurden in […] übersetzt. Ausdrücke und Begriffe, die näher erklärt werden, sind mit * gekennzeichnet und am Schluss der Schrift unter den Erläuterungen zu finden.
Dem Garnison-Museum Celle sei für die Abdruckerlaubis von Photos gedankt. Der Nachweis aller Abbildungen befindet sich am Schluss der Schrift. Schmuckleisten, Initialen und Vignetten wurden aus den originalen Schriften übernommen.
Altencelle, im Januar 2023
Barbara und Harald Pinl
Inhalt der Garnisongeschichten
I Die Wurst
II Tambour Kreikemeyer
III Die Spatzen
IV Der Genius von „48“
V Füsilier Säuglings Rache
VI Kantinenwirts Töchterlein
VII Ick bin bal‘ wedder da
Personen
Cordes, Fritz : Offiziersbursche
Dürbig : Küchenunteroffizier
Kätchen : Tochter des Kantinenwirtes Langhans
Knollstiebel : Unteroffizier und Korporalschaftsführer
Kreikemeyer : Tambour
Langhans : genannt „Papa Langhans“, Kantinenwirt
Leutnant von R. : genannt der „Bullenbeißer“
Meier : Einjährig-Freiwilliger
Prisky : Musketier, genannt „Polacke“
Säugling : Füsilier
Staats : Musketier, auch „Rotkopp“ genannt
Orte
In und auf dem Gelände der Infanteriekaserne Celle:
* Exerzierhalle und Exerzierplatz (Wildgarten)
* Kantine mit Hinterstübchen
* Kasino
* Militär-Arrestlokal
* Stube 48
* Unteroffizier-Versammlungs-Zimmer
Die Wurst.
L ei der vierten Kompanie meines Regiments stand ein Polacke *. Er war der einzige im ganzen Regimente, dessen Stammbaum seine Wurzeln in der sogenannten „Wasserpolackei“ * hatte. Welches Schicksal ihn nach Mitteldeutschland und in die Reihen einer Truppe getrieben, die sich sonst nur aus Landeskindern und einer ziemlich erheblichen Anzahl von Elsässern rekrutierte, das mag der Himmel wissen. Genug, er war da und blieb da.
Einen Rüpel hat jede Kompanie. – Auch die vierte Kompanie hatte ihn und zwar in der vierschrötigen Gestalt unseres Wasserpolacken. Er war durchaus kein schlechter Soldat, aber er hatte Pech, entschiedenes Pech. Er exerzierte so stramm wie einer, aber wenn zufällig der Herr Major auf den Exerzierplatz kam und auch nur zwei Minuten dem Exerzieren zuschaute, so machte er in diesen zwei Minuten gewiss ebenso viele Dummheiten. Weiß der Teufel, wie es kam, aber unser Polacke hatte allein für seine Person mehr Stunden nachzuexerzieren, als die halbe Kompanie, und die Tage Mittelarrest, die mit seiner Person bereits in Verbindung gebracht waren, konnte selbst der gewiegteste Rechner nicht mehr zählen.
Prisky, wie der Rüpel hieß, war seines Zeichens ein Schlächter. Er glich selbst einem Ochsen mehr als einem Menschen. Er war durchaus nicht intelligent, aber er hatte einen gewissen Instinkt, der ihm manch' liebes Mal gute Dienste leistete. Die Mannschaften konnten ihn ganz gut leiden, denn er war der gefälligste Kamerad, der sich denken ließ; der Korporalschaftsführer aber, zu dessen Korporalschaft er gehörte, war sein bitterster Feind, denn Prisky hatte eine Untugend, die sich selbst durch die fürchterlichsten Prügel nicht beseitigen ließ – er war bodenlos schmutzig.
Das Reglement schreibt dem Soldaten Sauberkeit vor. Bei Prisky war jede Mühe in dieser Hinsicht vergebens. Sein Unteroffizier hatte ihn mit Bürsten und Sand abreiben lassen, dass die Haut dabei in Fetzen gegangen war. Es war und blieb love's labour lost – Prisky blieb schmutzig.
Der Hauptmann von der vierten Kompanie war ein Nörgeler. Es gibt solche unter den Hauptleuten in großer Menge. Ein schlecht geputzter Knopf machte ihn wütend, ein Schmutzstreif am Halse eines Mannes ließ ihn erzittern und ein Fleck in einer der besseren Garnituren brachte ihn so zum Toben, dass man für seinen Verstand zu fürchten geneigt gewesen wäre, wenn ein Hauptmannsverstand überhaupt im Stande wäre, sich je zu verwirren.
Wie es zuging, wusste kein Mensch. Hatte Unteroffizier Knollstiebel den Polacken eigenhändig vor dem Appell gewaschen – er war schmutzig, wenn des Hauptmanns Auge auf ihn fiel. Und hätte man ihm nach dem Bade selbst die erste Kriegsgarnitur, die noch mit keinem Menschenleibe in Berührung gekommen war, angezogen – sie hätte sicher ein paar Flecke aufzuweisen gehabt, noch ehe eine Minute verflossen wäre.
„Isse alles nutz nichts!“ pflegte Prisky reumütig und verzweifelnd in seinem scheußlichen Deutsch zu sagen, wenn er wieder eine donnernde Philippika [Strafpredigt] des Hauptmanns angehört und beim Wiedereinrücken eine gehörige Tracht Prügel von Knollstiebel erhalten hatte. Und der gute Polacke hatte Recht. In Bezug auf seine Reinlichkeit konnte man von allen Hilfsmitteln sagen: „isse alles nutz nichts!“
Der Polacke aß nicht, sondern er fraß. Ließ einer seiner Stubengefährten ein Stück Kommissbrot eine Sekunde nur unbewacht liegen, so hätte er es nur vermittelst der Sektion [Leichenöffnung] Priskys wiederentdecken können. Über Priskys Appetit ging nichts; ja, er klagte mir einmal, als ich während meines Dienstjahres probeweise die Korporalschaft führte, mit Tränen in den Augen: „Isse Prisky immer hungrig, isse nie genug viel Essen da für Prisky!“
Unser Polacke war kein Gourmand [Schlemmer]. Was die anderen als ungenießbar wegwarfen, war „gut für Polack“. Knollstiebel selbst war vor seinem Appetit nicht sicher. So hatte er sich im letzten Winter von seiner „Jette“ eine Hand voll alter Speckschwarten mitgebracht und seine sämtlichen Stiefel damit eingerieben. Am folgenden Morgen waren sie verschwunden. Prisky gestand endlich, mit der Zunge schnalzend, dass „Speck isse gut vor Prisky!“
Nachdem Unteroffizier Knollstiebel seine Hände an dem Unglücklichen braun und blau und fast sämtliche Schemelbeine in der Stube auf dessen Rücken entzweigeschlagen hatte, verzweifelte er. Er wollte nichts mehr mit dem Schmutzfink zu tun haben und betraute einen stämmigen Gefreiten mit Priskys stetiger Überwachung. Jetzt begann für den Polacken eine Prügelsaison, die ihres Gleichen nicht hatte, und in dem dumpfen Hirne desselben nistete sich endlich der Gedanke nach Rache an demselben langsam aber um so nachhaltiger fest.
Und doch – gegen äußere Einflüsse, mochten sie nun durch Faust, Stuhlbeine oder Klopfpeitschen * hervorgebracht sein, war Prisky zu abgehärtet, um von ihnen zu einer rächenden Tat angestachelt zu werden. Ein Attentat gegen seinen Magen war allein geeignet, ihn zu blinder Wut zu reizen und die Gelegenheit zu einer solchen ließ nicht lange auf sich warten.
Ein Lieferant hatte für die Speisebedürfnisse des ganzen Regimentes zu sorgen. Er bezog die Fleischvorräte von einem Schlächter, dem er das Vieh lieferte. Die sämtlichen Feldwebel und Küchenunteroffiziere standen mit diesem Lieferanten natürlich auf höchst freundschaftlichem Fuße. Und nur dieser Intimität ist es zu danken, dass, als der betreffende Schlächter eines schönen Tages Hilfe brauchte, Prisky als „gelernter“ Schlächter vom Feldwebel den Auftrag erhielt, sich zur Aushilfe nachmittags bei demselben einzufinden.
Des Polacken Antlitz glänzte, als er vom Feldwebel diesen Befehl erhielt, sofort zog er seinen Drillichanzug an und verschwand. In seinem Handwerk musste er ein nicht zu verachtender Gehilfe sein, denn als er am Abend in die Kaserne zurückkehrte, brachte er außer einem Topf voll Branntwein noch eine Mark bares Geld und eine leckere Leberwurst mit.
Nur mit Mühe hatte Prisky der Versuchung widerstanden, die ganze Wurst bereits auf dem Heimwege zu verzehren. – Aber eine gewisse Gourmandise [Feinschmeckerei], die in seinem Magen aufzukeimen begann, hielt ihn davon ab. Vor seinem entzückten Geiste malte sich ein viel zu verlockendes Abendbrot: ein frisches Kommissbrot, eine Flasche Nordhäuser und die Wurst – ein schöneres Göttermahl gab's für unseren Polacken schlechterdings nicht.
Im Vorgefühle desselben schwelgend, betrat er die Stube. – Die Stubenmannschaft saß unter Leitung des Gefreiten an den Tischen und putzte Patronenhülsen. Knollstiebel saß mit brummigem Gesicht hinter seinem Verschlage und rauchte und las in einem alten Kalender.
Prisky meldete sich bei ihm und trat an sein Spind, um seine Stubengarnitur anzulegen, nicht ohne vorher mit einem faunischen Grinsen seinen Kameraden die leckere Wurst gezeigt zu haben. Hätte er in diesem Augenblicke das teufliche Lächeln auf dem Antlitz des Gefreiten gesehen, er hätte sie selbst auf die Gefahr augenblicklicher Erstickung hin sofort verschlungen.
Prisky suchte seinen Spindschlüssel noch, als Knollstiebel seinen Namen rief.
„Herre Und'offzier!“ rief der Polack, während er sich vergeblich bemühte, den Schlüssel in aller Eile in das Schloss zu bringen.
„Kreuzmillionenschock, verdammter Halunke, bist Du noch nicht da!“ schrie Knollstiebel grimmig hinter dem Verschlage hervor, als Prisky nicht unmittelbar seinem Rufe Folge leistete.
„Donnerwetter, scheer' Dich hin!“ schrie der Gefreite, der Prisky und seine Wurst keinen Augenblick aus den Augen gelassen. – „Willst Du, verdammter Wasserpolacke, oder – “
Prisky warf mit schmerzlichem Lächeln die Wurst auf ein Bett und lief zu Knollstiebel.
Während Knollstiebel seiner Gewohnheit nach den Anzug Priskys einer genauen Okularinspektion [augenscheinlichen Besichtigung] unterzog, wurde in der Stube selbst ein unerhörtes Attentat vollführt.
Der Polacke war nicht sobald hinter dem Unteroffiziersverschlage verschwunden, als der Gefreite aufsprang, einigen älteren Soldaten winkte und mit einem Satze an dem Bette war, auf dem Priskys Wurst im ruhigen Bewusstsein ihres fettigen Wertes lag.
Ein halbes Dutzend Taschenmesser war im nächsten Augenblick damit beschäftigt, die Wurst in ebensoviele Teile zu zerlegen, und während der unglückliche Polacke bei Knollstiebel ein peinliches Verhör über seine Tätigkeit als Schlächter bestand und schließlich den Auftrag erhielt, ihm seine sämtlichen Stiefel – Knollstiebel besaß zehn Paar solcher – blitzblank zu putzen, waren ein halbes Dutzend derber Zahnreihen damit beschäftigt, den Transitverkehr der Wurst von den Lippen zum Magen zu befördern.
Fünf Minuten waren vergangen, Prisky kehrte mit zehn Stiefelpaaren beladen aus seinem gezwungenen Aufenthalte hinter dem Verschlage in die Stube zurück. Ein scheuer Blick streifte seine Kameraden. Alle saßen eifrig an den Tischen und putzten. Nur auf ihren Gesichtern lag es wie ein unterdrücktes Lachen.
Als Prisky an dem bewussten Bette vorüberschritt, reckte er seinen Hals so lang wie möglich, um einen Blick auf seine Magenfreude zu werfen.
Im nächsten Moment fielen zwanzig Stiefel dröhnend zur Erde. Ein gellender Schrei lockte selbst Knollstiebel aus seinem Refugium hervor und ein kolossales Gelächter, aus zwanzig Soldatenkehlen erdröhnend, erschütterte die Luft.
Prisky aber stand, eine bejammernswerte Gestalt, bleich vor Wut und mit Tränen in den Augen da, den starren Blick auf ein winziges Häufchen Wurstschale gerichtet, die an der Stelle seiner schönen Wurst in eklem Durcheinander auf der Bettdecke lag.
Es war entschieden nicht philosophisch, dass Prisky seiner Entrüstung lauten Ausdruck gab. Diejenigen seiner Kameraden, denen er die Entwendung seiner Wurst auf den Kopf zusagte, vergalten ihm diesen schmählichen Verdacht mit einer solchen Tracht Prügel, dass der Polacke es als eine Erleichterung empfand, als er zehn Minuten darauf, zitternd an allen Gliedern, herausgeworfen aus der Stube, in dem halberleuchteten Korridore stand.
Von diesem Augenblicke an dachte der Pole nur an Rache, und diese richtete sich ganz allein gegen den Gefreiten, den sein Instinkt als Hauptattentäter bezeichnete.
Alle zwei Jahre findet bei den Infanterieregimentern eine sogenannte „Musterung“ statt. Dieselbe erstreckt sich weniger auf die Mannschaften, als auf ihre Ausrüstungsgegenstände. „Lumpenparade“ nennt man sie deshalb im Kasernenjargon. Die Lumpenparade wird gemeiniglich von dem Brigadekommandeur abgehalten und Wochen vorher werden die Kammern und die in den Händen der Mannschaften befindlichen Gegenstände einer Reinigung unterzogen, die das Äußerste in dieser Kunst erreicht.
Priskys Gehirn brütete lange über einen Racheakt nach. Und sein Gehirn, das in den Instruktionsstunden vollständig unfähig zu irgend einem Gedanken erschien, brachte einen Plan zusammen, der an diabolischer Kompilation die Ideen einer Teufels-Großmutter beschämt hätte.
Der wichtige Tag war erschienen. Der Herr General war da. Alle Capitains d'armes [Waffen-Unteroffiziere] * schwitzten Blut. Die Hauptleute waren ein Gemisch von Angst und Erwartung und die Mannschaften sahen dem Ergebnis eines wochenlangen Putzens mit stiller, aber um so ängstlicherer Erwartung entgegen.
Das Bataillon hatte – da es schönes heiteres Wetter war, auf dem Exerzierplatze vor der Kaserne „ausgelegt“. – In Abständen von je drei Schritt standen die Glieder, vor jedem Mann lag der Mantel, der Tornister und neben diesem die verschiedenen kleinen Montierungsstücke *, alles nach der Schnur gerichtet.
Seit dem frühen Morgen war die vierte Kompanie damit beschäftigt auszulegen. In Knollstiebels Korporalschaft lagen die Tornister des Gefreiten und Priskys friedlich neben einander. Der Gefreite hatte schlechte Laune heute. Noch vor dem Ausrücken hatte er den armen Polacken fürchterlich geprügelt, als Vorsichtsmaßregel, damit er keine Dummheiten heute mache. Aber Prisky hatte dabei keine Miene verzogen, ja, in seinem Antlitz hatte sich sogar ein Zucken bemerkbar gemacht, das bei ihm die Stelle des Lachens vertrat.
Als Knollstiebel und der Gefreite, kurz vor dem Kommando „Stillgestanden", noch einmal die Lage der Sachen revidierten [prüften], bückte sich Prisky nieder, um seinen Tornister, der sich ein wenig verschoben, wieder gerade zu rücken. Ohne dass die anderen es bemerkten, griff er in die hintere Rocktasche und schob im nächsten Moment auch den Tornister des Gefreiten auf den Zuruf des Unteroffiziers besser in die Richtungslinie, nicht ohne vorher die Hand unter den Deckel desselben gesenkt zu haben.
Das Kommando „Stillgestanden“ kam. – Von der dritten Kompanie her näherte sich die Suite [das Gefolge], der General an der Spitze. Um ihn herum tanzte ein schlankes Windspiel. Das war zwar wider das Reglement, aber bei dem Herrn General nahm man es nicht so genau.
Der Hauptmann überreichte den Kompanierapport und die Musterung begann. Der Herr General nahm hier höchst eigenhändig einen Mantel in die Höhe und besah sekundenlang die gleichmäßig graue Fläche, dort griff er nach einer Patronentasche und versuchte mit aller Schärfe, deren Generalsaugen bekanntlich fähig sind, einen Flecken auf der spiegelblanken Fläche zu entdecken. So schritt er von Mann zu Mann weiter.
Das Windspiel betrachtete, voranlaufend, mit höchst geringschätzender Miene die ausgelegten Sachen, hier beroch es einen alten Helm, dort stieß es mit der Schnauze an einen Kochkessel, dass dieser aus der Richtungslinie gerückt wurde und nur ein leichter Jagdhieb des Adjutanten hielt es davon ab, gerade auf dem Mantel des Feldwebels einen Fleck zu hinterlassen, der wahrscheinlich von dem besten Fleckpulver nicht wieder entfernt worden wäre.
Jetzt bog die Suite um den Flügel des zweiten Gliedes. „Stillgestanden!“ erschallte das Kommando für das dritte Glied, an dessen rechtem Flügel Knollstiebels Korporalschaft stand. Das Windspiel hatte seine Beschnoperei augenscheinlich satt, denn es schritt gravitätisch durch die Gasse, als es plötzlich in Priskys Nähe die Nase hob, die Luft begierig aufschnoperte und plötzlich mit einem Freudengeheul auf den Tornister des Gefreiten los sprang.
Dieser erbleichte unwillkürlich; um Priskys Mundwinkel aber zuckte es.
In der Suite des Generals war man auf das Gebaren des Hundes aufmerksam geworden. Dieser selbst warf einen Blick zur Seite und als er seinen Liebling mit der Schnauze wiederholt an dem Tornisterdeckel herumwühlen sah, beschleunigte er unwillkürlich seine Schritte.
Ein fröhliches Gebell des Hundes ertönte und mit einem leichten Satz stand das Windspiel auf dem Tornister, mit der rechten Vorderpfote eifrig an der Klappe kratzend.
Der Hauptmann wurde rot vor Wut, der Feldwebel käsebleich, und bleich wie eine Wachspuppe stand der Gefreite, mit angstvoll pochendem Herzen dem Gebahren des Hundes zuschauend.
Jetzt trat der General heran. Ein leichter Schlag mit der Hand trieb den Hund von dem Tornister, aber neben diesem blieb er knurrend stehen.
Mit gerunzelter Stirn blieb der General vor dem Gefreiten stehen.
„Tornister vorzeigen.“
Der arme Gefreite war sich bewusst, seine sämtlichen Sachen in der vorschriftsmäßigen Ordnung zu haben. Trotzdem zitterten seine Hände, als er den Tornister emporhob. Es polterte etwas darin und im nämlichen Augenblick sprang der Hund schweifwedelnd an dem Soldaten empor.
„Aufmachen und umkehren!“
Dem Befehle wurde Folge geleistet. Aber was war das? Dem geöffneten Tornister entfiel ein – großes Stück Wurst, mit dem der Hund in der nächsten Sekunde davonsprang.
Das Gesicht des Generals legte sich in strenge Falten. Der Oberst runzelte die Stirn. Der Hauptmann stand sprachlos da ob dieser Unverschämtheit eines seiner Gefreiten und die zum Lachen verzogenen Gesichter der Mannschaften wurden ernst bei diesem Anblick – vierzehn Tage Kasernenarrest war das Mindeste, was der ganzen vierten Kompanie blühte.
„Eine solche Unordnung ist mir noch nicht vorgekommen!“ sagte der General mit einem vernichtenden Blicke auf den Gefreiten, unter dem dieser fast zusammenbrach. „Herr Hauptmann, ich erwarte eine nachdrückliche Bestrafung dieses Mannes!“
Die Besichtigung war vorüber. Aber jetzt brach ein Strafgericht über den armen Gefreiten herein, dass selbst dem abgehärtesten Unteroffizier die Haut schauderte. Trotz aller seiner Beteuerungen wurden ihm acht Tage Mittelarrest wegen „Unordnung im Dienst“ aufgebrannt und als am Nachmittage die Mannschaften dienstfrei auf der Stube sangen und rauchten, machte sich der Gefreite fertig, seinen Arrest mit Tränen der Wut anzutreten.
Als er wenige Minuten später mit dem Dujour-Unteroffizier [Unteroffizier vom Dienst] die Kaserne verließ, um auf die Hauptwache gebracht zu werden, stand Prisky am Kasernentore und warf dem Unglücklichen einen zufriedenen Blick nach.
„Isse gut!“ sagte er dann ruhig und kehrte auf die Stube zurück. Das war des Polacken Rache!
Musketier im Dienstanzug
Tambour Kreikemeyer.
T ambour Kreikemeyer! Wenn irgend eine müßige Stunde mich in das holde Reich der Erinnerungen zurückführt und alle die Gestalten vor meinem geistigen Auge wieder aufleuchten, die dereinst in der engen militärischen Gemeinschaft, welche die Kompanie bildet, mit mir die Freuden und Leiden eines Kgl. preußischen Infanteristen durchkosteten, dann bist Du, Tambour Kreikemeyer von der sechsten Kompanie meines alten und lieben Hannoverschen Regimentes einer der Ersten, die sich mir präsentieren! Du, der Pechvogel in der Kompanie, dem auch das Beste, das Du gewollt und erstrebt hast – wenn von einem Streben bei einem simplen Tambour überhaupt die Rede sein kann, zum Bösen ausschlug, wie viel Heiterkeit hast Du unter Deinen Kameraden verbreitet, Heiterkeit, die Dir selbst das gegenteilige Gefühl einflößte, denn, o Kreikemeyer, ich muss auch dies meinen Lesern wahrheitsgemäß berichten, ein volles Sechstel Deiner Dienstzeit fast hast Du armer guter Pechvogel in dem kleinen Häuschen nahe der Wiesenwache zugebracht, dessen mit Eisentraillen [Eisenstäben] verzierte Fenster es als Militärarrestlokal jedem Eingeweihten kennzeichnen! Jetzt winkt Dir der schönste Lohn – denn in diesen Blättern sollen Dein Name und Deine Taten fort leben, so lange sie Leser finden und so lange nicht irgend ein Viktualienhändler sie benutzt, um echten Limburger Käse – Dein Leib- und Magenessen, guter Kreikemeyer – darin einzuwickeln!
In jeder Kompanie fast gibt es einen Mann, auf den Fortuna während seiner Dienstzeit mit eisiger Miene herabschaut. Wem einmal das Signum „Pechvogel“ beim Militär anfgedrückt ist, der braucht kein Muselmann zu werden, um an die Existenz eines Fatums zu glauben. Sein Pech, nie versiegend, stets sich im unerwarteten Moment einstellend, ist sein Fatum und ist zuverlässiger als die chronische Geldnot eines jungen Leutnants an den letzten Tagen des Monats, und was gäbe es zuverlässigeres auf Erden?
Pechvogel zu sein, mag im Leben mitunter sein Angenehmes haben, im militärischen Leben aber keineswegs. Die Arrestpforten stehen für jeden, der den bunten Rock tragen muss, in bedenklicher Weise offen und nur, wenn sie sich hinter einem Arrestanten geschlossen haben, ist die Leichtigkeit ihres Geöffnetwerdens eine höchst problematische. Wir hatten in unserer kleinen Garnisonstadt vier Arrestlokale und jedes von ihnen wies eine ganz respektable Anzahl von Zellen auf – lagen doch in der kleinen Provinzialstadt ein ganzes Regiment Infanterie und ein halbes Feldartillerie, aber keine von ihnen dürfte unserem guten Tambour fremd geblieben sein.
Es ist wahr, Kreikemeyer kämpfte anfänglich tapfer gegen sein Pech an, vergeblich! So lange er Rekrut war, passierte ihm nichts, seitdem er aber den Spielleuten beigesellt war und unter dem unmittelbaren Kommando des Tambourmajors stand, begann seine Leidensgeschichte, die eine ununterbrochene Kette von kleinen Verstößen gegen die Dienstvorschriften und von ihren Arrestfolgen darstellt.
Wurden im Sommer weiße Hosen getragen und irgend ein Köter, der sich im Straßenschmutze herumgewälzt hatte, kam mit einem der leuchtenden Soldatenbeine in Berührung, so war es gewiss dasjenige Kreikemeyers; war beim Nahen des Herrn Oberst „Stillgestanden“ kommandiert und es ertönte im selbigen Augenblicke ein herzkräftiges Niesen, so konnte man tausend gegen eins wetten, dass die Nase des unglückseligen Tambours auf diese Weise sich bemerkbar gemacht hatte; wurde irgend ein greulich verhunztes Trommelsignal hörbar, so lief es von Mund zu Mund durch die ganze Kompanie: das ist Kreikemeyer und ich kenne leider keinen einzigen Fall, in dem er es nicht war.
Aber die geschilderten kleinen Anklänge an das Urpech unseres Tambours waren allzu harmlos, um noch irgend welche Sensation zu erregen. Eine Stunde Nachexerzieren, eine Strafwache oder Kasernenarrest am Sonntag, mehr trugen die nicht ein. Aber es gab auch Fälle, in denen das Schicksal geradezu raffiniert dem armen Menschen mitzuspielen schien und diese, in ihrer ununterbrochenen Folge, ließen schließlich alle Anstrengungen unseres Pechvogels, Herr seines Pechs zu werden, erlahmen. Er klagte auch nicht mehr, wenn ihm wieder eine Arreststrafe angedroht wurde. „Dat's min Pech!“ war seine ganze Verteidigungsrede.
„Heute hat Kreikemeyer dem Stabsarzt seinen Essnapf an den Kopf geworfen!“ hieß es eines schönen Mittags in der Kaserne. Wer je selbst Soldat war, muss diese Worte für eine abenteuerliche Fabel halten und doch war es nur allzu wahr. Die Stubenkameraden hatten den Tambour, der gerade den letzten Rest seiner weißen Bohnen ausgelöffelt hatte, solange mit seinem Pech gehänselt, bis er in Wut geriet und dem ärgsten Quäler den Napf an den Kopf schleuderte. Natürlich verfehlte er sein Ziel, denn wann hätte Kreikemeyer je in seinem Tun das richtige getroffen! Der Napf sauste durch das unglücklicherweise offen stehende Fenster und streifte die Achsel des gerade unter demselben vorübergehenden Stabsarztes, seine linke Brust mit einem Ordensstern aus weißen Bohnen dekorierend.
Bekanntlich werden die Spielleute bei Felddienst-Übungen von den berittenen Offizieren mit Vorliebe zum Halten der Pferde benutzt, sobald einmal Halt gemacht wird. Die Pferde der Infanterieoffiziere stehen nun zwar im allgemeinen nicht in dem Rufe, die feurigsten zu sein, aber wenn Kreikemeyer aus Versehen – denn mit Absicht vertraute ihm der jüngste Adjutant seinen Gaul nicht mehr an – einmal ein Pferd zum Halten bekam, so passierte gewiss irgend eine Tollheit. Entweder riss sich das Tier los und machte eine kleine Galopp-Promenade auf eigene Faust, oder es riss ihm mit den Zähnen einen Fetzen aus dem Uniformrock. Der erste Fall trug ihm die fürchterlichsten Grobheiten des Pferdeeigentümers ein und der letzte sicherte ihm eine längere liebevolle Auseinandersetzung mit seinem Korporalschaftsführer, die hinter verschlossenen Türen stattfand und die mit dem Institut der Ohrenbeichte nur insofern einige Ähnlichkeit hat, als auch hier die Ohren in Leidenschaft gezogen wurden. –
Stabsarzt, mit „Ordensstern“ dekoriert.
Wenn bei einem Pechvogel das Schicksal eine etwas längere Pause in seinem „Pech“ eintreten lässt, so sorgen die Kameraden schon dafür, dass diese Pause nicht allzu lang sich ausdehne. Du lieber Gott, es stecken im Waffenrocke nicht eben lauter zartbesaitete Naturen und ein derber Spaß kommt im Kasernenleben wohl vor, auch wenn er für den davon Betroffenen unangenehme Dinge im Gefolge hat. Der folgende aber, der hier erzählt sein mag, hat eine ganze Kompanie der Gefahr nahe gebracht, in Lachkrämpfe zu fallen und die Zurückverweisung Kreikemeyers in die Kompanie als Resultat gehabt.
Bekannt ist die Anekdote des mit Reisbrei verstopften Waldhorns. Ich bin fest überzeugt, hätte das Schicksal in Gestalt des Bataillonstambours dem guten Kreikemeyer ein Signalhorn an Stelle der Trommel in die Hände gegeben, die Anekdote wäre in etwas veränderter Form, namentlich was den Inhalt des Hornes betrifft, auch bei uns zur Tatsache geworden. An eine Trommel aber wagt sich so leicht keiner.
Kreikemeyer war, wie die meisten seiner Landsleute, ein gutmütiger Bursche. Er ließ sich necken, so lange es ihm gefiel, und ihn aus seiner Ruhe zu bringen war erst wenigen gelungen. Unter diesen wenigen aber befand sich auch der Urheber des Essnapf-Attentats auf den Stabsarzt, mit dem unseres Tambours Konto beschwert wurde, ein rothaariger impertinenter Bursche aus den Rheinlanden, der sich zur Zeit seiner Aushebung auf der Wanderschaft in der Provinz Hannover befand und so zu unserm Regimente kam. Staats, oder wie er gewöhnlich genannt wurde „der Rotkopp“, war tückisch und hinterlistig zugleich, und wenn seine vielen schlechten Streiche, die er machte, ihm nicht so viele Misshelligkeiten eintrugen, als er verdiente, so verdankte er dies nur seiner Verschlagenheit und seinem guten Glücke, das ihn vor den verdienten Folgen seiner Streiche in manchmal gänzlich unverdienter Weise schützte.
Der Rotkopf war auch derjenige, welcher den Tambour hänselte, wo er nur konnte. Die beiden lagen zusammen auf einer Stube und so war die Gelegenheit zu Neckereien täglich gegeben. In den letzten Tagen nun mochte Staats wohl zuviel gewagt haben, denn eines Nachmittags nach dem Dienst war Kreikemeyers Geduld zu Ende und nun hielt er über seinen Peiniger ein erbarmungsloses Strafgericht. Der Rothaarige mochte sich drehen und wenden wie er wollte, eine der muskulösen Fäuste des Tambours hielt ihn wie in einem Schraubstocke fest und die andere, in welcher sich ein Schemelbein befand, ließ dies letztere mit einer solchen Vehemenz dem rothaarigen Halunken über Schultern und Rücken tanzen, dass der Unteroffizier, der eine ganze Weile wohlgefällig der Prozedur zugesehen hatte, schließlich doch intervenierte und den wütenden Tambour zwang, sein heulendes Opfer fahren zu lassen.
Vor Wut und Schmerz heulend, unfähig, ein Wort hervorzubringen, ballte der Geprügelte beide Fäuste gegen den Züchter und verließ das Zimmer.
Seit jenem Tage trachtete der Rothaarige danach, dem Tambour einen Streich zu spielen, der alle früheren an Raffiniertheit übertreffen sollte.
Es war um die Zeit der größeren Felddienst-Übungen, wie sie dem Manöver vorherzugehen pflegen. Zwei Kompanien vereinigten sich gewöhnlich zu solchen und selten verschmähte es der Herr Oberst, selbst Zeuge zu sein von der praktischen Taktik, die seine jüngeren Offiziere bei solchen Anlässen zu entfalten hatten.
Nun war unser Oberst ein seelensguter Mann, aber ein unharmonischer Laut konnte aus dem milddenkenden Offizier einen ärgerlichen, alten Haudegen machen, der dann mit Fluchen ebensowenig wie mit Arreststrafen sparte. Vornehmlich waren es die Regimentsmusik und die Spielleute, die unter seiner Laune zu leiden hatten, denn er hatte eine bei der Kapelle unter seinem Vorgänger eingerissene Lodderei so mit Stumpf und Stiel auszurotten verstanden, dass unserm Kapellmeister, wenn er an diese Zeit zurückdachte, noch jetzt die Haut schauderte.
Es war eines Morgens im Anfange des Julimonats, als das bekannte „Raustreten“ die Korporalschaften, die des Signals bereits auf den Stuben harrten, auf den Kasernenhof beorderte. Schon auf der Kasernentreppe fiel mir Kreikemeyer auf, der mit einem sorgenvolleren Gesicht, als man bei ihm zu sehen gewohnt war, die Steinstufen der Treppe herabschritt. Er hatte dabei seine Trommel mit der Linken etwas in die Höhe gehoben und schlug nach jedem dritten Schritt mit den Knöcheln der Rechten auf das Kalbfell, dazu mit immer verdutzter werdendem Gesicht aufmerksam dem leisen und dumpfen Klange lauschend.
Hautboist eines Infanterieregimentes mit großer Trommel
„Antreten!“ hieß es draußen. Die andere Kompanie, die unsern „Feind“ darstellte, marschierte gerade zum Kasernentore hinaus. Unser Übungsfeld lag nicht weit von der Kaserne entfernt, und da wir zum Osttor hinausmarschieren sollten, jene aber zum Westtor hinauszogen, so konnten wir uns darauf gefasst machen, dass das Marschkommando für uns auch in wenigen Minuten ertönen werde.
Die Offiziere sahen flüchtig den Anzug der Leute nach; der Hauptmann hielt auf seinem Braunen vor dem Tore, schnell wurde in drei Gliedern angetreten, die vier Spielleute traten auf den rechten Flügel, Sektionen wurden abgezählt und dann kam auch schon das Kommando: „Mit Sektionen rechts schwenkt, marsch – Halt! Bataillon Marsch!“
„Mensch! Stieren Sie doch nicht so auf Ihre Trommel. Die reißt Ihnen ja doch nicht aus!“ rief der Premier dem wie tiefsinnig vor sich niederstarrenden Kreikemeyer zu, als er die Tête passierte, um dem harrenden Hauptmann die herkömmliche Meldung zu machen: „Die sechste Kompanie mit dreizehn Unteroffizieren, vier Spielleuten und 98 Mann zur Stelle.“
Ja, Kreikemeyer – was war mit dem Tambour heute nur los? Auf seiner Stirn standen die hellen Schweißtropfen und doch war der Morgen durchaus nicht so warm – .
Mit seiner Trommel war's nicht richtig!
Dieser Gedanke stieg in seiner ganzen Entsetzlichkeit in seiner Seele empor. Seine Trommel, die nachher die Signale zum Feuern, zum Stopfen [des Gewehrs] geben sollte, war nicht mehr die alte, treue, zuverlässige – es machte sich etwas Fremdes an ihr bemerkbar.
Ja, aber was?
Kreikemeyer hätte zweifelsohne den Versuch gemacht, sich selbst zu umarmen, wenn er im Stande gewesen wäre, diese Frage selbst zu beantworten. Aber seine ganze mühsam eingelernte Tambourkenntnis ließ ihn heute im Stich. In seiner Trommel klapperte etwas; so hörte es sich an. Wenn er sie schüttelte, schnurrte es drinnen mit dumpfem Laut und wenn er, erschreckt, sie wieder hin und her rüttelte, so war es totenstill darinnen, so dass er glaubte, er müsse sich getäuscht haben. Aber dann wieder, wenn die Trommel unbeweglich fast an seiner Seite hing, kam urplötzlich ein Ton, wie wenn ein Finger leise über das Kalbfell striche und dann folgte ein leichtes Klatschen, als habe sich drinnen eine Schraube von ihrer Stelle bewegt und sei hinunter auf das Fell gefallen – kurz, etwas Rätselhaftes war es mit Kreikemeyers Trommel, soviel stand fest.
Er prüfte, so gut sich dies beim Marschieren bewerkstelligen ließ, die einzelnen Schrauben; sie waren sämtlich fest angezogen. Wer sollte auch bei seiner Trommel gewesen sein? Die war ja Königliches Eigentum und an solches wagt sich so leicht die Unternehmungslust der jungen Mannschaften nicht heran.
Wir hatten unser Übungsfeld erreicht. Der Premierleutnant nahm den ersten Zug, der älteste Sekondeleutnant den zweiten und der Feldwebel den Schützenzug. Der Hauptmann behielt einen Signalisten und einen Tambour an seiner Seite. Unter diesen beiden befand sich auch Kreikemeyer.