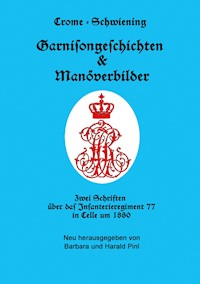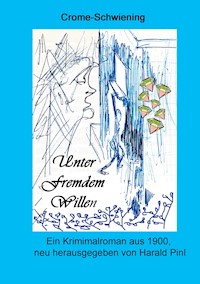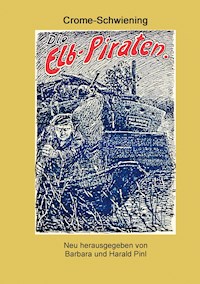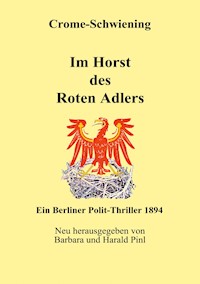
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Roman spielt im Berlin des Jahres 1894, das durch den Roten Adler des Markgrafen von Brandenburg, einem kaiserlichen Nebentitel, symbolisiert wird. Die politische und publizistische Szene mit Intrigen, insbesondere zwischen den Anhängern und Gegnern von Bismarck, und Spionage wird noch von tragischen Liebesverhältnissen durchwoben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Umschlag
Der Rote Adler Brandenburgs
auf einem Adlerhorst
Inhalt
Vorwort
Die Personen
Orte des Geschehens
I.
Ein Hohenzollerntag
II.
Ein umgestürztes Coupé
III.
Die schöne Fremde und der Prinz
IV.
Politik beim Opernball
V.
Ein gewiefter Hofrat
VI.
Eine bezaubernde Französin
VII.
Im Nest des Gallischen Hahnes
VIII.
Auf Friedrichsruh
IX.
Begegnungen
X.
Im Zwiespalt
XI.
Intrigen
XII.
Spione im Zwiespalt
XIII.
Ringen einer Agentin
XIV.
Gespräche über Politik und Liebe
XV.
Wahrheitsliebe oder Verleumdung?
XVI.
Zerfall des Spionagenetzes
XVII.
Aussprachen
XVIII.
Aufforderung zum Duell
XIX.
Das Ende
Erläuterungen
Gebäude, Straßen und Plätze
Kurzvita Crome-Schwienings
Abbildungen mit Nachweis
Vorwort
Als „Horst des Roten Adlers“ bezeichnet Crome-Schwiening das Berliner Stadtschloss an der Spree, das seit dem 15. Jahrhundert Residenz der Markgrafen (Kurfürsten) von Brandenburg war. Ihr Wappentier war der Rote Adler. Auch Kaiser Wilhelm II. führte noch den Titel eines Markgrafen von Brandenburg. Der Buchtitel könnte so auch „Im Horst des Kaiseradlers“ lauten. Um den kaiserlichen Hof, Intrigen in der Regierung, die Gegnerschaft zwischen Bismarck-Anhängern und -Gegnern sowie Spionage ausländischer Auftraggeber spielt dieser „Roman aus der jüngsten Vergangenheit“, wie es im Originaltitel der Ausgabe von Kutschbach in Halle an der Saale 1895 heißt. Die Handlung beginnt im Januar 1894 in Berlin und der Zeitpunkt wird genau angegeben. Carl Crome-Schwiening schildert die erste Begegnung zwischen Kaiser Wilhelm II. und Bismarck nach dessen Entlassung und lässt die Erzählung im Mai desselben Jahres nach dem Besuch des Kaisers beim Altkanzler auf Friedrichsruh enden.
Im Original des Romans wurde der Name des Autors nicht angegeben. Vermutlich waren Crome-Schwiening seine zeitnahen politischen Äußerungen zu riskant, um seinen Namen öffentlich damit zu verbinden. Die politische und journalistische Szene wird noch romanhaft mit mehreren Liebesgeschichten durchwoben.
Die der damaligen Zeit entsprechenden zahlreichen französischen Ausdrücke werden nicht übersetzt. Sie lassen sich mit Hilfe von Lexika auch online leicht klären. Heute nicht mehr gebräuchliche Ausdrücke werden am Schluss erläutert.
Zur leichteren Orientierung wurden hier, anders als bei Crome-Schwiening, über die einzelnen Kapitel selbstgewählte Überschriften gesetzt. Außerdem wurde der Text des Romans mit möglichst zeitnahen Abbildungen und zwei Karten illustriert. Weitere Bilder zu im Text geschilderten historischen Ereignissen und Gebäuden sind im Internet zu finden, z.B. in der Bildagentur der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Im Personenverzeichnis sind nur die im Roman mehrfach genannten Romanfiguren aufgeführt.
Altencelle, im September 2022 Harald Pinl
Die Personen
(handelnde hervorgehoben)
Almader, Frau, führt einen schöngeistigen Salon für Künstler, Schriftsteller, Diplomaten; hält Diensttag-Soiréen ab
Almader, Konsul, Haus der Haute finance
Altenbruch, von, Legationsrat im AA, Diplomat und Schriftsteller
Brettnitz, Baron von, ehem. Offizier, höhere Charge am Kaiserhof
Brettnitz, Zora (Zore) von, Tochter von Baron B., Baronesse, Hofdame bei einer Prinzessin
Bylle, Bertha, Tochter von Konrad Bylle, Liebestod
Bylle, Konrad, ehem. Soldat (Zahlmeister), Hofsekretär im Zivilkabinett bei Hofrat X. und Brettnitz
Chrysander, Dr. med., Arzt, Sekretär von Prof. Schweninger, dem Leibarzt von Bismarck
Didier, Kutscher von Madame Céline
Edwards, Mr., alias Guychillard, Haushofmeister bei Madame Celine
Ernest (alias Jeanlin), „Diener“ bei Mme. Céline Saint-Ciré
Friedrich, Faktotum bei Härting, auch „Obelisk“ genannt.
Guychillard, Père, alias Mr. Edwards, Vater von Ernest Jeanlin, Onkel von Céline de St.-Ciré; „Haushofmeister“ bei seiner Nichte Céline St.-Ciré
Härting, Bildhauer, Busenfreund von Mark
Jeanlin, alias Ernest, Diener von Mme. Céline de Saint-Ciré
Kowalczy, Freiherr von, Geheimer Legationsrat im AA, Leiter des –Pressebüros des AA, Gegner von Bismarck
Lange, Oberförster im Sachsenwald
Mark, Hermann, Dr., Schriftsteller, Leiter eines publizistischen Unternehmens in Berlin, Herausgeber der „Rechtsstimmen“
Paulsen, Dr. , dänischer Publizist, einflussreicher Korrespondent
Péricheux, Père, Concierge in Paris, Vater von Toinon
Péricheux, Toinon, Pariserin, franz. Zofe von Mme. Céline de Saint-Ciré
Pinnow, Kammerdiener Bismarcks
Poyritz, von, Tante von Else von Rheden
Prinz, anonymer Freund von Mme. Céline de Saint-Ciré
Rheden, Else von, Tochter des hannöverschen Landedelmannes von Rheden, Calenberg; Verlobte von Hermann Mark
Saint-Ciré, Céline de, Mme., Witwe des franz. Edelmannes de Saint-Ciré aus Paris; Freundin des anonymen Prinzen
Schweninger, Prof., Leibarzt von Bismarck
Weber, Anna, Frl., Zofe bei Zoré von Brettnitz; verliebt in Jeanlin
Wedel, Ernst August von, Graf, Oberstallmeister des Kaisers
X., Hofrat, Untergebener von Baron Brettnitz und Intrigant
Politiker und Militärs
Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898), Altreichskanzler
Bismarck-Schönhausen, Herbert Graf von (1849-1904), Sohn von Otto von Bismarck; Staatssekretär des Äußeren
Caprivi, Leo von (1831-1899), Reichskanzler, General, Vizeadmiral und Chef der Marine
Ebmeyer, Otto von (1850-1919), Major, Adjutant von Caprivi
Eulenburg, August Graf zu (1838-1921), Minister Haus Preußen
Guesde, Jules (Jules Bazile, 1845-1922), franz. Sozialist, Minister
Kaiserin Friedrich, Gemahlin von Kaiser Friedrich III.
Moltke, Graf, Flügeladjutant des Kaisers
Natzmer, Oldwig von (1842-1899), Oberst, Stadtkdt. Berlin
Plessen, von, Generalmajor, Kdt. Kaiserliches Hauptquartier
Prinz Heinrich von Preußen, Bruder von Wilhelm II.
Seckendorff, Albert Freiherr von (1849-1921), Vizeadmiral, Adjutant / Hofmarschall von Prinz Heinrich von Preußen
Wilhelm II., Deutscher Kaiser
Orte des Geschehens
Berlin: Stadtschloss, Auswärtiges Amt, Reichskanzlei, Oper und
umliegende Straßen und Plätze
Potsdam: Neues Palais
Friedrichsruh im Sachsenwald (Aumühle)
I. Ein Hohenzollerntag
H eller Sonnenschein vergoldete den winterlichen Januartag. Er spiegelte sich nicht allein wider in den vergoldeten Knöpfchen der Fahnenstangen, die zu Tausenden und aber Tausenden auf den Dächern der hohen Gebäude emporragten, sich aus zahllosen Fenstern und Luken hervorgeschoben hatten oder von den Balkonen herab die bunten Fahnentücher, die sie trugen, im leisen Morgenwinde flattern ließen – er strahlte wider von den Gesichtern der Hunderttausende, die sich vom Lustgarten bis zum Brandenburger Tor dichtgedrängt vor- und zurückschoben! Ein Name auf aller Lippen, der Name des Langentbehrten, schwer Vermissten; – eine Sehnsucht in den Herzen dieser aller: den Mächtigen wieder zu sehen, den ein höherer Wille einst gehen ließ und den nun dieser Wille auf’s neue zu sich beschied – ein Hochgefühl in jeder Brust: die schwere, dunkle, unbegreifliche Scheidewand, die sich da aufgerichtet hatte zwischen Kaiser und Altreichskanzler, endlich fallen zu sehen!
„Ein Hohenzollerntag!“ glitt es fast unbewusst über zahllose Lippen, wenn das Auge warm berührt wurde von einem huschenden, glänzenden Sonnenstrahl. Wahrlich, ein Hohenzollernwetter! Und die Gedanken, die dem Erwarteten entgegen eilten, flogen im Nu zurück zu dem ragenden alten Stadtschloss an der Spree, diesem Horst des roten Adlers, der so viele gewaltige Momente im Leben der Hohenzollern erlebt, so manche große Stunde kommen und schwinden sah. Vom Kaiser, der dort jenem die Hand auf’s neue entgegenstrecken wollte, der im Groll einst gegangen war, zum Kanzler und vom alten Kanzler zurück zum Kaiser, als könne dieser Gedankenflug all‘ dieser Hunderttausende gar keine andere Richtung einschlagen. Ein Alb war von der Brust der Deutschen genommen durch das hochherzige Handeln jenes gewaltig über Deutschland horstenden Kaiseraars – heute, am 26. Januar [1894] sollte all‘ die schmerzliche Klage, die tiefe, leidenschaftliche Erbitterung, das unmutsvolle Schweigen 1 sich lösen in dem einen Jubelrufe: „Hoch, unser ritterlicher Kaiser! Hoch, Du alter Kämpe für Deutschlands Größe und Einheit, hoch Bismarck!“
Wie das flutete und wogte und hin- und wiederzog, bis die Massen wie in einander gekeilt dastanden und nur die Fahrwege frei blieben für die königlichen Equipagen, die zu den Bahnhöfen eilten, um die Fürstlichkeiten in Empfang zu nehmen, welche morgen, am Geburtstage des Kaisers, in dessen Nähe sein wollten, und für die mit Passierscheinen versehenen wenigen Fuhrwerke, welche jene Glücklichen zum Lehrter Bahnhof führten, denen Rang und Stellung, oft so himmelweit von einander entfernt, eines jener Kärtchen verschafft hatten, deren Besitz heute den Neid aller erregte. – Stunden vergingen noch, bevor der Salonzug des Fürsten Bismarck in die geräumige Halle des Lehrter Bahnhofs einlaufen konnte, aber heute galt es frühzeitig am Platze zu sein, sollte nicht selbst das „Sesam öffne dich“ des Passierscheines vor den umlagerten Türen versagen.
Lehrter Bahnhof 1903
Im Schritt nur konnte eine Droschke erster Klasse, geöffnet, als lache der Maihimmel auf die darinnen herab und als herrsche nicht der frostige Januar, sich ihrem Ziele, dem Lehrter Bahnhofe nähern. Ein junges Menschenpaar saß in derselben: Ein junger Mann mit großen, dunklen Augen in dem feingeschnittenen Gesichte, dessen Weichheit selbst der feine dunkle Schnurrbart nicht zu bannen vermochte und an seiner Seite ein junges, blondes Wesen, mit einem Kinderlächeln auf den frischen Lippen und mit dem Ausdruck des Staunens und der Erwartung in den blauen, stillen Augen, die alles, was sie erblickten, in sich einzusaugen schienen zu bleibendem Gedächtnis. Gewiss, diese beiden jungen Menschenkinder gehörten zu einander. Aber die Größe dieser Stunden schien selbst die längst Zusammengehörigen noch näher zu einander zu führen. Sie hatte des Mannes Rechte in ihre Hände genommen und sie lehnte sich leicht an ihn, als sei das alles, was sie umgab, zu überwältigend und als bedürfe sie, um das alles zu fassen, seiner Stütze. Es waren der Schriftsteller Dr. Hermann Mark und seine Braut Else von Rheden, die sich stumm den Eindrücken dieser Stunde überließen. Dr. Mark weilte erst kurze Zeit in Berlin, er war berufen worden, ein neues puplizistisches Unternehmen zu leiten, das sich zum Ziele setzte, eine Katze auch eine Katze, das heißt die Dinge beim rechten Namen zu nennen. Dr. Mark war ein Norddeutscher, aus einer der im Jahre 1866 annektierten Provinzen [Hannover] und hatte seine hervorragenden puplizistischen Talente bereits in Paris und London erprobt. Sein junges Unternehmen hatte mit einem Schlage Bedeutung gewonnen durch die mannhafte und ehrliche Kritik, mit welcher er die politischen Ereignisse begleitete und ihn selbst in den publizistischen und literarischen Kreisen Berlins zum bekannten, vielleicht auch von manchen Kreisen gefürchteten Mann gemacht. Vor Jahresfrist, als er von London kam, hatte er auf dem Gute eines hannoverschen Landedelmanns Else von Rheden, gleich ihm eine Tochter des alten Kalenbergischen Volksstammes, kennen und lieben gelernt. Wohl hatten die adelsstolzen Verwandten Else’s, welche die Besiegung ihres schimmernden Welfenpferdes durch den preußischen Aar noch nicht vergessen konnten, Einsprache erhoben gegen ihre Verlobung mit dem jungen Schriftsteller, der sich vom ererbten Hass zur feurigen Bewunderung Bismarcks durchgerungen hatte, aber nichts hatte die Herzen zu trennen vermocht, die einmal für einander in Liebe erglüht waren. Nach schweren Kämpfen hatten sie ihre Verlobung durchgesetzt, der im kommenden Sommer die Vermählung folgen sollte. Aber Elise’s stilles Leben auf dem Gute ihres Oheims, der sie nach ihrer Eltern Tode zu sich genommen hatte, büßte doch an Frieden ein, so lange sie dort in jenen Kreisen weilte, in denen man nicht vergessen kann und will. Und so hatten sie denn mit Beginn des neuen Jahres voller Freude die Einladung einer in Berlin lebenden Verwandtenfamilie, die sich mit dem durch das 66er Jahr geschaffenen Verhältnissen ausgesöhnt hatte, angenommen, die Monate, welche bis zu ihrer Vermählung mit Dr. Mark noch zu verfließen hatten, in deren Heim zuzubringen. Seit drei Tagen weilte sie in dem „Riesennest“, in jenem Berlin, das als des Reiches Hauptstadt auch dem Reiche seine Gesinnungen, seine Sympathien und seine Antipathien aufdrängen möchte; gerade zur rechten Zeit war sie gekommen, um einen Tag zu erleben, dessen ganze Bedeutung dem stillen klugen Mädchen, dessen Blick sich unter Dr. Marks Leitung dem ganzen wunderlichen Getriebe der Großen und der Kleinen in der politischen Welt verständnisvoll erschlossen hatte, klar geworden war. –
Der Wagen hatte gerade das Brandenburger Tor passiert und lenkte den Weg zu dem noch in seinem bizarren Gerüstkleide steckenden unvollendeten Reichstagsneubau ein.
Dr. Mark hatte sich aufgerichtet und warf einen langen Blick auf die Linden zurück, mit ihren schwarzen Menschenmauern, ihrem reichen Fahnenschmuck, ihrer ganzen lautatmenden Erwartungsfülle. Else drückte seine Hand. „Was hast Du, Hermann?“ flüsterte sie ihm zu, der schweigend, als banne ihn ein Gedanke, vor sich niedersah. „Ich denke an die Erwartungen dieser Stunde und der Zweifel an ihrer Erfüllung bedrückt mich“, gab Dr. Mark mit klingender Stimme zur Antwort. „Ich denke an den jungen herrlichen Monarchen, der jetzt in seinem Schlosse einem Wiedersehen entgegenblickt, das auch sein Herz schneller pochen machen wird. Ich denke an die starken Charaktere dieser beiden mächtigen Menschen, die sich ergänzend, Feuergeist und edles Wollen mit tiefer Menschenkenntnis und einem Menschenalter voll Erfahrung paarend, den Hain des deutschen Volkes säubern könnten von den Giftpflanzen, die darin sich eingenistet haben und ich denke –“ Er verstummte. „Vollende!“ bat sie. „Lass mich weiter in Deiner Seele lesen!“ Dr. Mark lächelte. Sein Lächeln hatte etwas schwermütiges. Wer ihn so sah, mochte ihn für einen Schwärmer halten und erkannte in ihm gewiss nicht jenen Mann wieder, dessen Feder mit unbarmherziger Logik die Tatsachen zergliederte, ihre geheimen Nerven bloßlegte und mit unerbittlicher Deutlichkeit sie den Blicken aussetzte. „Ich dachte an den guten märchenhaften Harun al Raschid, den Kalifen Bagdads, der mit seinem getreuen Wesir nachts die Straßen der Stadt durchwandelte und zu erfahren suchte, was seinem Volke fehle und ihm nutzbringend sei. Und ich ertappte mich auf dem Gedanken, dass in diesen morgenländischen Märchen oft mehr Weisheit liege als in dem so grundgelehrten pfaustolzen abendländischen Wissen. Dieser Harun al Raschid war ein reicher Fürst und doch misstraute er sich selbst. Er fürchtete, einmal glauben zu können, was die Wände seines Palastes durch den Mund gefälliger Diener zu ihm sprechen könnten und er entfloh diesen Wänden und den Hofschranzen, die sie bargen. Er pochte nicht an bei den Großen des Reiches und fragte: Sagt Ihr mir, was dem Volke not tut, damit es glücklich sei. Er wusste, dass er die Wahrheit nicht erfahren würde, denn jene Großen kannten nicht die Leiden des Volkes und seine heißen, sehnenden Wünsche, – sie konnten sie nicht kennen! Er durchdrang jene Schicht, welche die Leidenschaften und die Selbstsucht, die höfische Schmeichelwut und ihre Interessen zwischen Herrscher und Volk zu bereiten wissen und die auch das strahlendste Adlerauge nicht zu durchdringen vermag. Er stieg hinab zum Volke und hob sich dadurch selbst zur Sonnenhöhe der Herrschertugend empor –“
„Halt!“ tönte eine barsche Stimme dicht an ihrer Seite. Sie blickten auf. Ein berittener Schutzmann, zu dessen bärbeißigem Gesicht mit dem mächtigen Schnauzbart die gutmütig zwinkernden Augen einigermaßen kontrastierten, hatte das Halten ihrer Droschke veranlasst. „Sie können hier nicht weiter. – Ich darf keine Privatwagen mehr durchlassen. Wenn Sie einen Passierschein haben, so rate ich Ihnen, zu Fuß den Bahnhof zu erreichen zu suchen. Tut mir leid, mein Herr,“ fuhr er auf einen Protest Dr. Marks höflich aber bestimmt fort – „meine Instruktion duldet keinen Widerspruch und keine Ausnahme!“
Dr. Mark und Else stiegen aus, und setzten zu Fuß ihren immer beschwerlicher werdenden Weg zum Bahnhofe fort. An der Moltkebrücke boten sich ihnen neue Schwierigkeiten. Studenten in vollem Wichs, die hier Spalier bilden wollten, ordneten sich erst und die Schutzleute hatten alle Hände voll zu tun. Else drängte sich ängstlich an die Seite ihres Verlobten, der vergeblich die achselzuckenden Beamten aufforderte, ihnen zum Durchkommen behilflich zu sein. Endlich erspähte er einen ihm bekannten Studenten, der im vollen Chargierten-Ornat ihnen die eine halbe Ewigkeit währende Passage über die Brücke erleichterte. Es war zwölf Uhr, als sie die Wartesäle erreichten. Sie hätten um keine Viertelstunde später kommen dürfen, denn gleich nach zwölf Uhr wurden auch diese polizeilich abgesperrt. „Ordre des Kaisers!“ hieß es als Antwort auf die dringenden an die in unerschütterlicher Ruhe ihres Amtes waltenden Beamten gerichteten Fragen. Ein schöner Zug des Monarchen! Prinz Heinrich, der an des Kaisers Statt den Fürsten Bismarck beim Einlaufen des Zuges in die Halle begrüßen sollte, sollte auch der erste sein, der ihm den Willkomm entgegenrief, ihm die Hand drückte!
In dem großen, nach der Tiergartenseite des Bahnhofs gelegenen Wartesaale befand sich eine buntgestaltete Menge – jene Glücklichen, die einen Passierschein erhalten hatten : Herren und Damen vom diplomatischen Corps, Offiziere und angesehene Journalisten. Dr. Mark, der von einigen der letzteren mit sichtbarer Hochachtung begrüßt wurde, fand ein unbesetztes Eckchen und war glücklich genug, verhältnismäßig schnell für Else, welche die beschwerliche Wanderung durch das Menschengewühl angestrengt hatte, auch eine Erfrischung herbeischaffen zu können. An einem der hohen Fenster, welche einen weiten Ausblick auf das Hafenbecken und den Fluss mit seinen breiten Uferstraßen gewährten, standen zwei Herren, halblaute Bemerkungen miteinander austauschend. Der Eine, ein hochgewachsener Herr mit schön gepflegtem Vollbart und einem Antlitz, das ebenso sehr den Mann von Welt wie den geistigen Arbeiter verriet, war der Geheime Legationsrat von Kowalczy, der eines der wichtigsten Nebenämter im Auswärtigen Amte, das Pressebüro, unter sich hatte und der kleinere, korpulentere Herr mit dem vollen Gesicht, den scharfen Brillengläsern vor den Augen und dem spröden blonden Schnurrbart über der Oberlippe war der Legationsrat von Altenbruch, ein Diplomat, der seine Erfolge außerhalb seiner amtlichen Tätigkeit als Dichter fand. Die beiden Herren schienen in dem ganzen Saale die Einzigen zu sein, welche statt der fieberhaften Erwartung, welche alle beherrschte, eine kühle Gleichgültigkeit zur Schau trugen.
„Sie haben ja damals nach dem Kriege auch den Einzug der Truppen in Berlin mitgemacht, lieber Altenbruch“, sagte Herr von Kowalczy mit sarkastischem Lächeln, während er seine behandschuhte Rechte wie kosend über den weichen vollen Bart gleiten ließ. „Was sagen Sie zum Rummel heute? Toller war's damals auch nicht mit dem Gedräng, wie?“ „Die liebe Neugier!“ entgegnete der andere. „Sie steckt den Berlinern nun 'mal im Blut. Wenn sie 'mal die Gelegenheit haben können, ordentlich Hurrah zu rufen, so sind sie alle dabei.“ Das Lächeln des Herrn von Kowalczy verlor sich. „Überraschend schnell ist das doch gekommen!“ sagte er leise, sich durch einen Seitenblick vergewissernd, dass sich kein allzu neugieriger Journalist in ihrer Nähe befand. „Unser Chef ist davon am meisten überrascht. Ich hatte gestern Vortrag bei ihm. Bei dem Alten konnte man's selten nur recht machen, da war man's gewöhnt, hie und da 'mal – na, Sie wissen schon. Das war eben Bismarck'sche Eigenart und wir fügten uns, bis 'mal die Sache eine andere Wendung kriegte und wir beim Hineinlavieren in den neuen Kurs hie und da ein bisschen am Steuer nachhalfen, bis das Schiff denn glücklich über Stag gegangen war und wir den Alten los waren. Aber gestern ward ich doch an die ehemaligen Zeiten erinnert. Ebmeyer's Miene stand gestern den ganzen Tag auf ‚drohendes Gewitter‘, na, der Adjutant kennt ja die Launen unseres Herrn und Meisters. Ich glaube, am liebsten gäbe der Kanzler heute seine Demission – das ‚Volldampf zurück‘ des heutigen Tages hat ihn gewaltig angegriffen.“ „Ich erstaune, Herr Geheimrat“, lächelte der Dichter-Diplomat, „über Ihre nautischen Kenntnisse. Aber freilich – die Begleitung Sr. Majestät auf den Nordlandfahrten –“ „Gehört heute zum Hofton!“ lächelte jener leicht. „Was wollen Sie? Wie's von oben herunterschallt, schallt's in unseren Kreisen hundertfältig nach. Im Übrigen ist's doch auch einmal eine gesunde Abwechslung. Unter dem alten Regime war alles infanteriemäßig, steifkragig, parademäßig – nun kommt die freiere Haltung der Marine auch einmal zu Ehren –“
Er unterbrach sich. Draußen bot sich jetzt alle Augenblicke der harrenden Menge ein neues Schauobjekt. In diesem Moment rückte die Ehreneskorte heran. Das Gardekürassier-Regiment, dasselbe, das beim Scheiden des Altreichskanzlers am 29. März 1890 die Eskorte gestellt hatte, war für den heutigen Tag zu diesem Ehrendienste befohlen. Zwei Züge ritten heran. Die prächtigen Soldatengestalten auf den mächtigen Pferden empfingen manchen freundlichen und bewundernden Blick aus der Menge. Mit den Fähnchen an den Lanzenspitzen spielte der leise Wind. „Schade, dass wir sie von hier nicht sehen können,“ meinte Herr von Altenbruch. „Aber sie nehmen wahrscheinlich vor dem Fürstenzimmer Aufstellung. Ich hätte gern gewußt, wer die Ehreneskorte führt.“ „Damit kann ich Ihnen dienen, Verehrtester,“ gab Herr von Kowalczy zurück. „Es ist der Major von Kramsta. Ich war am gestrigen Abend mit ihm auf einem Rout zusammen und hörte es von ihm selbst. Aber ich denke, es ist Zeit, dass wir uns auf den Bahnsteig begeben,“ fuhr er fort, „es ist halb ein Uhr vorüber. Der Prinz und das Gefolge wird gleich eintreffen.“ Sie schritten durch den Wartesaal dem Bahnsteig zu, welcher mit Teppichen belegt war und vor den Fürstenzimmern als einzigen Schmuck eine Reihe hochstämmiger Lorbeerbäume aufwies. An der Ausgangstür trafen sie auch Dr. Mark und Else.
Herr von Kowalczy warf einen bewundernden Blick auf die schimmernde blonde Haarfülle des jungen Mädchens und wollte ihr folgen, als er Herrn von Altenbruch's Hand auf seinem Arme fühlte. Er wandte sich um und ließ auf einen Wink des Legationsrates den Dr. Mark und seine Braut vorausgehen. „Nun?“
„Kannten Sie den Herrn nicht, der soeben an der Seite der blonden jungen Dame den Wartesaal verließ?“ „Nein!“
„Es ist Dr. Mark.“ „Ach!“ machte Herr von Kowalczy sichtlich interessiert. „Der Herausgeber der ‚Rechtsstimmen‘?“ „Derselbe!“ Herr von Kowalczy sandte ihm einen langen Blick nach. „Ich traf bisher noch nicht persönlich mit dem Herrn zusammen,“ sagte er dann. „Der Mann hat eine verteufelt geschickte Feder. Ist der nicht für uns zu gewinnen?“ „Man rühmt seinen festen Charakter –“
Der Diplomat lächelte fein. „Mein Lieber,“ sagte er vertraulich dem Dichter ins Ohr –“ Mir sind schon Dutzende vorgekommen, die mit solchen festen Charakteren behaftet waren und die es nach einer Weile dennoch nicht verschmähten, ihre Festigkeit gegen gelegentliche ‚Informationen‘ einzutauschen. Aber es wird nun die höchste Zeit. Hören Sie das Hurrah draußen? Der Prinz Heinrich fährt an – wir müssen eilen! – Unser Chef verlangt von mir über diesen Empfang in specie einige Details und die kann ich nur eigenen Wahrnehmungen abgewinnen.“
Die hochgestimmte Menge hatte dem Prinzen Heinrich, der von seinem persönlichen Adjutanten Freiherr von Seckendorff, begleitet, in offener zweispänniger Hofequipage anfuhr, einen sympathischen Empfang bereitet. Mit immer steigendem Interesse verfolgte sie das Erscheinen der zum Empfang kommandierten hohen Offiziere und Notabeln. „Das ist der Generaloberst von Pape“ hieß es bei den Kundigen unter der Menge, als ein Offizier in großer Generalsuniform erschien. Drei Flügeladjutanten des Kaisers erschienen. Vorher schon waren Fürst Radziwill, der Stadtkommandant Oberst von Natzmer und der Oberstallmeister Graf Wedell erschienen, Major Krause vertrat die Berliner Schutzmannschaft. Vor dem Ausgange der Fürstenzimmer des Bahnhofs hielt die zweispännige Galakutsche, bestimmt, den Fürsten zum Schloss zu bringen. Auf dem behängten Kutschersitz saß in steinerner Würde der Kutscher, den betressten Gala-Dreispitz auf dem Kopfe; zwei Lakaien harrten am Wagenschlage des Moments des Einsteigens. Der Augenblick, dem die auf dem Bahnstieg Versammelten in unruhiger Spannung entgegenharrten, nahte. Auf der Kurve des Abfahrtsgleises ward der kurze Salonzug sichtbar, der langsam, umbraust von den Hochrufen der Erschienenen, einfuhr. Die wenigsten der Versammelten vermochten sich einer tiefen Bewegung zu erwehren, als Fürst Bismarck die Stufen seines Salonwagens herabstieg. Das war noch die imposante Gestalt, die in der bekannten Uniform der Halberstädter Kürassiers doppelt reckenhaft sonst zur Geltung kam. Aber diese Jahre der ungewollten Ruhe, der nagenden Erinnerung hatte diese Gestalt, die Ewigkeiten trotzen zu können schien, doch gebeugt; die Falten dieses Antlitzes, so oft von den Malern und Photographen wiedergegeben, dass jeder Deutsche sie kennt, schienen sich tiefer eingegraben zu haben und härtere Linien erschienen in dem mächtigen Antlitz, nur die großen, hellen Augen leuchteten in unverändertem Glanze, wenn man auch darin die tiefe seelische Bewegung, welche den gewaltigen Mann in diesem Augenblicke erfasste, deutlich schimmern sehen konnte.
„Na, die Begrüßung war ja herzlich genug“, flüsterte Herr von Kowalczy dem Herrn von Altenbruch zu. – „Aber das ist der Bismarck nicht mehr, der von uns ging. Sehen Sie, wie schwer er sich auf den Arm des Prinzen Heinrich stützt, wie langsam es vorwärts mit ihm geht. –“ Er verstummte, der Fürst, am Arme des Prinzen, schritt an den laut ihm zujubelnden Gruppen vorüber, grüßend, ihnen einen langen, wie forschenden Blick zusendend. Herr von Kowalczy schob wie absichtslos sich hinter einen vor ihm stehenden baumlangen Offizier zurück; Dr. Mark umfasste unbewußt mit der Linken Else, als der Fürst vorüberschritt und aus seinen Augen blitzte mehr als Bewunderung und Ehrfurcht, als diese das Bild des Fürsten einzusaugen schienen. Else sah, wie ein Zittern seine Gestalt durchlief und wie sein Mund sich öffnete und wieder schloss, als sei er unfähig, das, was in dem Herzen dieses Mannes in diesen Minuten vorgehen mochte, durch ein banales Hoch wie die anderen zum Ausdruck zu bringen. Und nun nahm ein Triumphzug seinen Anfang, der die Herzen aller derer erzittern machte, die ihm beiwohnten. Fürst Bismarck hatte mit dem Prinzen Heinrich die geschlossene Galakutsche bestiegen, die nun gegen die Moltkebrücke sich in Bewegung setzte. Ein scharfes Kommando, die Eskorte der Gardekürassiere setzte sich hinter den Wagen und nun erdröhnte die Luft von den brausenden Hurrahs der aufgeregten Menge, die sich nicht erschöpfen zu können schien in ihren Ovationen für den ersten Kanzler des neuen deutschen Reichs, den der Kaiser zu sich gerufen hatte, um mit einem versöhnenden Händedruck die Nebel zu bannen, die sich dunkler und dunkler auf das Volk zu senken begannen, und es von Tag zu Tag mit ängstlicheren Zweifeln erfüllten.
Wenige Worte waren es, welche der Fürst mit dem Bruder seines Kaisers während dieser Fahrt zum Schlosse wechselte. Grüßend hob und senkte sich seine Rechte, wie leise Wehmut zuckte es in seinem starren ernsten Antlitz auf, als die Equipage durch die Porta Triumphalis der Hohenzollern, durch das Brandenburger Tor fuhr und auf den mit Menschen vollgestauten Seiten der Linden weithin sich fortpflanzend, immer aufs neue das zu dröhnenden Salven sich formende „Hurrah!“ der begeisterten Massen ertönte. Niemand las in diesem Augenblick in der Seele des Mannes, der hier mehr gefeiert wurde als ein Kronenträger. Aber Prinz Heinrich, der seinen Blick voll ehrlichen Mitgefühls auf dem Antlitz des Fürsten ruhen ließ, sah, dass diese Ovationen, weit entfernt, ein freundliches Lächeln auf seinem Antlitz sich widerspiegeln zu lassen, den starren, fast finstern Ernst desselben noch erhöhten. Als die Tage der Ungnade kamen, wie schnell ward er von den Berlinern vergessen – heute, nun ihm die Huld des Kaisers wieder im Sonnenglanze leuchten sollte, empfing man ihn gleich einem der ersten Monarchen dieser Welt. Eine Wunde, die ein altes Herz bluten macht, verharrscht nicht mehr, sie blutet nach, selbst in dem Augenblick, in dem der heilende Balsam sie schließen soll.
Vor dem Schlosse war eine kombinierte Ehren-Kompagnie des zweiten Garderegiments zu Fuß unter dem Kommando des Hauptmanns von Stein aufgestellt. Auf dem rechten Flügel stand die Regimentsmusik mit dem Tambourzuge. Die Mannschaften waren im Wachanzuge, die Hosen in die Stiefel gesteckt. Um ein Uhr hatte der Kaiser die Front der Ehren-Kompagnie abgeschritten und war dann mit seiner Suite in das Schloss zurückgekehrt. Drüben über die Brücke fuhr die Galakutsche mit dem Fürsten heran. Brausend hallte das Hurrah der Menge über den Platz. „Achtung!“ dröhnte das Kommando des Hauptmanns. Jetzt hielten die Salonequipage und die anderen Hofwagen. „Stillgestanden! Gewehr auf! Achtung, präsentiert das Gewehr!“ Der Kapellmeister hob den Arm, der Tambourmajor den Stock – die Trommeln rasselten, die Musik fiel ein – die Klänge des Hohenfriedberger Marsches tönten dem Nahenden entgegen, der Moment des Wiedersehens zwischen Kaiser und Altreichskanzler war gekommen. Fürst Bismarck hatte, als er an der Ehren-Kompagnie vorüberschritt, die Hand aufs neue in den Arm des Prinzen Heinrich gelegt. Er richtete sich straff auf, die linke, fest am Pallaschgriffe liegend, hob diesen ein wenig. In wenigen Schritten Abstand folgten die Flügeladjutanten, Freiherr von Seckendorff und Graf Wedell. Am Schlage des Galawagens blieb, den hohen Seidenhut in der Hand, Prof. Schweninger, der in der Begleitung des Fürsten gekommen war, stehen und sandte aus den mit blitzenden Brillengläsern bedeckten Augen einen besorgten Blick dem alten Kanzler nach.
Die Töne schwiegen draußen. Fürst Bismarck hatte das Schloss betreten. Inmitten seiner Suite empfing ihn der Kaiser. Er sah ernst aus, er stand fast unbeweglich, als er den Fürsten sich nahen sah. Erst, als dieser in tiefer Bewegung auf die ihm sich entgegenstrekkende Hand des Kaisers sich niederbeugen wollte, schien es, als gieße sich ein warmer, heißer Strom in die majestätische Gestalt des Herrschers. Wie von einem plötzlichen Impuls übermannt, schlang er seinen Arm um die Schultern des Fürsten und küsste ihn auf die Wange. Fürst Bismarck erbleichte in tiefer Bewegung und schloss für eine kurze Sekunde die Augen. Er atmete hastig und schwer und wie abgebrochen kamen die Worte hervor:
„Ich danke Eurer Majestät aus tiefstem Herzen für die Gnade –“ Aber der Kaiser unterbrach ihn.
„Mit hoher Freude, mein lieber Fürst, sehe ich Sie genesen und gesundet vor mir.“ Er winkte mit dem Kopfe. Der Kreis der Offiziere öffnete sich und die Herren traten zurück. Auf eine einladende Bewegung seines kaiserlichen Herrn trat der Fürst an seine Seite, der Kaiser selbst führte seinen Gast in sein Gemach. Minuten nur waren es, welche Kaiser und Kanzler hier im Gespräch mit einander verweilten. Kein Wort rührte an der Vergangenheit. Dieser Tag sollte nur der Gegenwart gehören. Als der Kaiser seinen Gast entließ, war dieser um einen neuen kaiserlichen Gunstbeweis reicher. Das Halberstädter Kürassier-Regiment, dessen Uniform der Altreichskanzler mit Vorliebe trug, war ihm soeben verliehen worden.
Otto von Bismarck
Von dem Empfange und den Ehrungen, mehr noch von seiner eigenen Gemütsbewegung erschöpft, betrat Fürst Bismarck die für ihn im Schlosse reservierten Gemächer. Graf Herbert Bismarck und Professor Schweninger erwarteten ihn dort. Der letztere drückte seine Besorgnis aus über das angegriffene Aussehen des Fürsten und mahnte zur Schonung. Der Fürst lächelte ihm leicht zu und hob wie abwehrend die Hand. „Ich fühle mich kräftig genug, um auch die Strapazen dieses Tages zu überdauern,“ sagte er, und als Professor Schweninger mit leisem Unmut hinzufügte: „Ich wollte, Durchlaucht säßen erst wieder auf Ihrem bequemen Canapé in Friedrichsruh“, fügte er lächelnd hinzu: „Bequem habe ich es hier ja auch und ich will gleich nachher ein Viertelstündchen ruhen.“
Er nickte Professor Schweninger gütig zu und zog den Grafen Herbert näher zu sich heran, um in einigen kurzen Worten ihm Mitteilung von der soeben erfolgten Verleihung zu machen. „Und nun lasst mich einen Augenblick allein!“ schloss er. „Ich möchte für zehn Minuten nur mich sammeln von den Eindrücken der letzten halben Stunde.“ Graf Herbert blickte den treuen Arzt des Fürsten unschlüssig an, dieser zuckte leicht die Achseln. Als beide das mit königlicher Pracht ausgestattete Gemach verließen, sagte Schweninger leise: „Wir hätten nicht hierherkommen sollen, Herr Graf! Und es ist nicht gut, dass wir ihm gerade jetzt den Willen ließen, allein zu bleiben. Mehr als das Wiedersehen und die Aufregung des Empfanges fürchte ich die Gedanken, die ihn in diesen Minuten, in denen er allein ist, beherrschen werden. Sorgen Sie nur dafür, dass er nicht gezwungen wird, Besuche seines Nachfolgers oder seiner ehemaligen Ministerkollegen anzunehmen – angesichts der Bitterkeit, die ihn befallen dürfte, wären meine schweren Besorgnisse verdoppelt.“
In das helle, gewölbte, mit geschnitzten Möbeln, die grüner Damast deckte, ausgestattete Vorgemach, in das sich Herbert mit dem Leibarzte des Fürsten zurückgezogen hatte, trat ein Lakai, eine Karte in der Hand. „Seine Excellenz der Herr Staatsminister von –“ „Ich danke im Namen des Fürsten für die Aufmerksamkeit Seiner Excellenz“ sagte der Graf rasch, indem er auf den Lakaien zutrat und einen Blick auf die ihm dargereichte Karte warf. „Leider ist der Fürst momentan nicht im Stande, Seine Excellenz zu empfangen.“
Der alte Kanzler hatte inzwischen sich auf dem Diwan niedergelassen, aber er erhob sich schon nach wenigen Sekunden wieder. Die Hand auf die Lehne eines Sessels gestützt, blickten seine großen, weißumbuschten Augen zum Fenster. Es regte sich in ihm der Wunsch, heranzutreten und die Blicke nach außen wandern zu lassen, als könnten sie auch seine Gedanken mit hinausziehen, die doch von hier nicht weichen wollten und die zurückkehrten immer wieder zu dem einen Punkte in dem Kreis der Geschehnisse. Und mochte ihm der heutige Tag die höchsten Ehren bringen, die je einem Ungekrönten zu Teil wurden, sie löschten die brennende Wunde nicht in seinem Innern. Nicht das bittere Gefühl einer geminderten Machtfülle hatte sie zu einer blutenden gemacht. Dieselbe Glut, die das Herz seines kaiserlichen Herrn durchströmte und die mit jedem Pulsschlag diesen antrieb, das deutsche Volk groß und glücklich zu machen, dieselbe Glut durchpulste auch die Blutwege seines neunundsiebzigjährigen Körpers und doch standen sie, ob auch heute so nahe, getrennt von einander und sie würden getrennt bleiben. Die Schlangen bleiben nicht nur in den Sümpfen und Niederungen. Die Schlangen der Verleumdung, der arglistigen Schmeichelei sind die giftigsten Nattern und diese Nattern finden sich auf den Bergen, selbst auf den Höhen, auf denen Adler horsten. Des Aares Augen aber durchmessen den Äther, sie verschmähen den Blick zu ihren Füßen hinab –. Die Hände auf den Rücken gelegt, durchmaß Fürst Bismarck in grübelndem Schweigen das Gemach.
In dem Vorsalon hob plötzlich Professor Schweninger lauschend den Kopf. „Ich dachte mir's,“ flüsterte er – „das nennt der Fürst nun Ruhe. Ich wusste, dass er sie hier in diesen Räumen nicht finden würde!“ Und die Uhr ziehend, wandte er sich aufstehend an den Grafen Herbert:
„Die Zeit ist um! Lassen Sie uns zum Fürsten hineingehen!“
1 Anspielung auf die Entfremdung zwischen Kaiser Wilhelm II. und Reichskanzler Bismarck und dessen Entlassung 1890.
II. Ein umgestürztes Coupé
E s war gegen halb neun Uhr am Abend desselben Tages, als Dr. Hermann Mark, in einen warmen Havelock gehüllt, einen weichen Hut auf das dunkle lockige Haar gedrückt, durch die Friedrichstraße kommend, in die stille Mittelstraße einbog. Es war wieder kalt geworden, aber der junge Schriftsteller hatte den Hut aus der Stirn geschoben und den oberen Verschluss seines Havelocks geöffnet, als sei es ihm zu warm geworden. Nach dem Empfange des alten Fürsten auf dem Bahnhofe waren Else und er, als die Menschenmassen sich zu zerstreuen begannen, zu der Familie von Poyritz, den Verwandten Else’s, die in der Potsdamer Straße eine bequeme und behaglich eingerichtete Wohnung innehatten, zurückgekehrt. Man bat dort Dr. Mark zu Tisch zu bleiben und sich, falls es seine Zeit erlaube, den Herrschaften abends für einen Besuch der Oper anzuschließen, aber Dr. Mark lehnte, ohne auf Else’s freudig-zustimmenden Blick zu achten, die freundliche Einladung ab. Der heutige Tag gehöre ganz seinem Berufe und den Abend wie einen Teil der Nacht müsse er zum Arbeiten benutzen. Else bezwang ein leises Gefühl von Trauer und drückte ihrem Verlobten die Hand.
„Ich hätte mich von Herzen gefreut, wenn wir heute vereint geblieben wären“, flüsterte sie ihm zu, – „aber ich weiß ja, wem Dein heutiger Tag, gehört. Unb ob ich auch Deinem Herzen am nächsten stehe – mit Jenem kann ich mich doch nicht messen!“ Er drückte ihr die Hand und dankte ihr mehr mit einem Blick als mit Worten. Er eilte in ein Restaurant in der Nähe und aß einige Bissen. Er war heute nicht dazu angetan, sein Denken und Fühlen in die konventionellen Formen, welche die Gesellschaft nun einmal sklavisch verlangt, einzuspinnen. Mehr als das, was sich in diesen und den nächsten Stunden im Schlosse ereignete, beschäftigte ihn die Stimmung des Volkes selbst, das den heutigen Tag zu einem Festtage machen zu wollen schien und in kaum verminderter Zahl auf den Straßen, die das „Königliche“ Berlin einschließen, umherwogte. Und so trat er bald in ein Café, um die neuesten Depeschen zu durchfliegen, bald blieb er inmitten ber promenierenden Menschengruppen stehen, um aus den Gesprächen der immer noch erregten Menschen aufzufangen, was sich von dem Eindruck, den alle empfangen hatten, darin niederschlug.
Als es zu dunkeln begann, traf er an einer Ecke mit einem blonden Herrn zusammen, in dem er einen journalistischen Kollegen erkannte, mit welchem er zuweilen eine Stunde verplauderte. Es war ein Däne, Korrespondent der „Berlinske Tidende“, den er vor Jahren in Paris, als jener noch den Brüsseler „Nord“ bediente, kennen gelernt hatte. Der Däne nahm in ungezwungener Art seinen Arm. „Was sagen Sie, Doktor Mark? Ihr Kaiser, alle Wetter, Respekt vor ihm! Er versteht seinen fürstlichen Gast zu ehren. Und wie! Mit einer Steigerung, die fast dramatisch zu nennen ist. Ich erfreue mich eines gewissen Wohlwollens hier in Hofkreisen – vous savez bien, Monsieur le docteur! Man sieht es gern, in unseren dänischen Blättern freundliche Bemerkungen über den Hof des Deutschen Kaisers zu finden und man spart an den Stellen, an denen man auf diese Weise Stimmung zu machen sucht, nicht mit Informationen, wenn ich um diese ersuche. Die neuesten Ereignisse wissen Sie wohl noch nicht? Ich habe sie soeben in alle Winde, nicht nur nach meinem schönen Kopenhagen telegraphiert.“
„Ah, Sie wissen noch mehr, als man zu telegraphieren pflegt!“ „Viel und nichts, Doktor!“ lachte der augenscheinlich durch seine „Informationen“ in vergnügte Stimmung versetzte bewegliche Däne. „Mancherlei allerdings. Zunächst: der zweite Kanzler hat den ersten nicht gesprochen. Man hat von einem flüchtigen Besuch gefabelt, von einem Zusammentreffen bei der Kaiserin Friedrich, bis herab zum einfachen ‚Kartenabwerfen‘ – alles nicht wahr. Graf Caprivi hat seinem großen Vorgänger eine fatale Minute erspart. Der Löwe sieht eben nicht gern einen Puma auf seinem Lager.“
„War der Fürst bei der Kaiserin Friedrich?“ „Längere Zeit, als man nötig hat, um die Zeremonie eines fürstlichen Händedrucks abzumachen. Wenn alte Zeiten am heutigen Tage berührt sind, so haben die Wände im Palais der Kaiserin Friedrich davon gehört. Ich höre, dass der Besuch länger als eine halbe Stunde gedauert hat. Sie kennen das Impressement dieser Fürstin, der man einst eine leidenschaftliche Feindschaft zum Kanzler zuschreiben wollte. Ich glaube, wenn je ein Gefühl der Kränkung hüben und drüben bestanden hat, jene Märztage des Jahres 1890 haben es ausgeglichen. Ich habe für gewisse Dinge ein Feingefühl und ich möchte behaupten, die größte Bewunderin des Fürsten ist ihm in der hohen Gemahlin jenes Unvergesslichen erwachsen, dessen Leiden eine ganze Welt zum Mitgefühl zwang.“
„Seltsam!“ erwiderte Dr. Mark sinnend. „Ist es nicht wie ein Verhängnis, das über diesen gewaltigen Mann sich breitet? Missverstanden, verleumdet zu werden, bis sich der Hass breit gemacht hat gegen ihn, um dann, nach Jahren erst recht erkannt zu werden in seiner ganzen großen schlichten Reinheit, in seiner den Mann zum Heros stempelnden Vaterlandsliebe? So wie es Einzelnen erging, ist es ganzen Völkern ergangen. Nur diejenigen, deren kleinliche Interessenpolitik sie so umfangen hält, dass sie nicht über den Horizont ihrer eigenen Kleinlichkeit hinauszuschauen vermögen, nur sie stehen grollend abseits vor diesem Bilde menschlicher Größe.“
„Hm!“ sagte der Däne. „Dass Sie ein Bismarckverehrer sind, wusst ich ja. Ich vermag mich zu Ihrer Höhe natürlich nicht aufzuschwingen. Das werden Sie begreifen. Auf der – anderen Seite behauptet man, dass sich in diesem Gesamtbilde von Größe auch mancher kleine und kleinliche Zug vorfinde. Von den Orleans sagt man bekanntlich, dass sie im Exil nichts gelernt und nichts vergessen hätten. Der erste Satz wäre bei einem Bismarck ein nonsense, aber etwas vom zweiten Teil des Satzes mag doch auch wohl auf ihn passen. Der heutige Tag will zwar alles vergessen machen, aber obs ihm gelingt –?“
Dr. Mark bedauerte insgeheim, das Gespräch nach dieser Richtung gelenkt zu haben und gab ihm eine andere Wendung durch die Worte: „Da sind wir ja von den jedenfalls erfreulichen Tatsachen, die Sie zweifellos noch in petto haben, zu den unerfreulichsten Konjekturen gekommen. Vorwärts, erzählen Sie!“ „Dass der Kanzler Chef des Halberstädter Kürassier-Regiments geworden ist, wissen Sie?“ „Ich hab' es vorhin erfahren.“ „Nun denn, so hören Sie das Wichtigste: Der Kaiser will den Tag damit krönen, dass er seinen Gast persönlich nach dem Bahnhofe geleitet.“ „Ist das wahr?“ rief Dr. Mark mit aufleuchtenden Augen. „Ich erfuhr es vor zwanzig Minuten in der bestimmtesten Form.“ „Der Kaiser und Er beisammen,“ murmelte Dr. Mark – „was wird nach dem heutigen Morgen das Volk noch an Ovationen übrig haben, um sie den beiden heute Abend zu widmen?“ Der Däne schüttelte den Kopf.
„Man wird dem Publikum heute Abend nicht den gleichen Spielraum lassen,“ sagte er. „Ich habe auch darüber Informationen erhalten. Seine Majestät haben weit strengere Absperrmaßregeln angeordnet als für den Empfang vorgesehen waren. Der Salonwagen des Fürsten wird in den 7 Uhr nach Hamburg gehenden Zug einrangiert.“ Dr. Mark blieb erregt stehen. „Das darf ich nicht versäumen!“ rief er. „Ich muss hin.“ „Haben Sie eine Passierkarte?“ „Ja.“ „Versuchen Sie es immerhin, aber ich glaube nicht, dass es Ihnen nützen wird. Selbst wenn Sie den Zug benutzen wollten, werden Sie nicht viel sehen.“ „Ich versuche es trotzdem.“ „Dann will ich Sie bis zum neuen Parlamentsbau begleiten, wenn es Ihnen recht ist. Ich habe so wie so in die Dorotheenstraße einen Gang zu machen.“ „Kommen Sie!“
Die Kälte und die Dunkelheit vertrieben allmählich die Massen von den Straßen und hinein in die großen Schankstätten. Wohl ein jeder fühlte sich gedrängt, die Ereignisse des Tages noch einmal in Freundeskreise oder mit Bekannten durchzusprechen. Und doch standen vom Lustgarten ab, wo starke Gruppen von Polizeimannschaften scharfe Absperrung hielten, bis in die Linden hinein noch Zehntausende, die nicht wichen und wankten, ob sie sich auch sagen konnten, dass ihr Auge schwerlich den alten Kanzler bei der herrschenden Dunkelheit in der geschlossenen Kutsche, die er ohne Zweifel benutzen würde, zu sehen bekäme. Aber der einmal entflammte Enthusiasmus ist ja bescheiden. Er begnügt sich mit dem Gefühl, dort, in dem Gefährt, dessen Konturen beim schnellen Vorüberrollen kaum dem Auge sich einprägen, sitzt der, den du sehen willst, und das jubelnde Hoch ertönt sich kaum minder laut, als dem Ersehnten selbst gegenüber. Bis zum Bahnhof hatte man Dr. Mark, der sich inzwischen von seinem dänischen Kollegen getrennt, gelangen lassen, nachdem bei den absperrenden Schutzmannsposten an der Moltkebrücke sein Passierschein noch einmal gute Dienste geleistet hatte. Aber am Bahnhof selbst wurde er schroff zurückgewiesen. Einige Schritte zurückgehend, sah er sich um. Der Platz vor dem Bahnhof war schlecht beleuchtet. Dennoch erkannte er unter der nächsten Laterne in dem Polizeileutnant, der einigen Wachtmeistern Instruktionen zu erteilen schien, ein bekanntes Gesicht. Er hatte den jungen Polizeioffizier hier und da in Gesellschaften, deren Besuch er nicht zu umgehen vermochte, getroffen und ihn artig und zuvorkommend gefunden, herantretend begrüßte er ihn und machte ihn mit seinen Wünschen bekannt.
„Ich kann nichts für Sie tun“, sagte der junge Polizeileutnant bedauernd, „die Instruktionen lauten sehr streng. Wir sollen absolut Zivilpersonen, welche nicht den Zug benutzen wollen, von dem Betreten des Bahnhofes fernhalten. Und selbst wenn Sie ein Billet lösten und den Zug einige Stationen weit benutzten, so würde das Ihnen hier nicht viel helfen. Vom Wartezimmer aus werden Sie nicht viel sehen können und ehe der Fürst erscheint, sind alle Coupé's bestiegen und geschlossen.“ „Und hier dürfen Sie mich auch nicht lassen?“ fragte Dr. Mark. Der Leutnant überlegte einen Augenblick. „Wenn Sie sich hier nicht von der Laterne entfernen wollen, will ich's wagen, Sie hier zu lassen,“ sagte er endlich, „Sie werden mir gewiss keine Ungelegenheiten machen wollen und weiter vorzudringen versuchen, wenn die Abfahrt erfolgt. Wachtmeister Blumicke“, rief er einem der Beamten zu – „lassen Sie den Herrn hier stehen.“ Er wehrte Dr. Marks Dankesworts ab und ging raschen Schrittes davon, die übrigen Absperrungsmannschaften zu inspizieren.
Der letzte Akt des Schauspiels dieses Tages nahte heran. Schon waren einige Minuten über die zur Abfahrt des Zuges bestimmte Zeit verstrichen. Da gesellten sich, rasch auf einander folgend, die Mitglieder des Kaiserlichen Hauptquartiers zu der Deputation des Halberstädter Kürassierregiments, die bereits eingetroffen war, um hier von ihrem neuen Chef sich zu verabschieden. „Generalleutnant von Hahnke!“ ging es leise durch die Reihen, als der Chef des Militärkabinetts die Halle betrat. Generalmajor von Plessen begrüßte ihn, immer mehr goldblitzende Uniformen zeigten sich. Nun war kein Zweifel mehr: „Der Kaiser kommt!“ „Der Kaiser selbst kommt!“ ging es leise rauschend durch die Reihen. Da trabte es auch schon drüben dumpf von Rosseshufen über die Moltkebrücke, die Ehreneskorte der Gardekürassiere sprengte heran, vor und hinter der Galakalesche, welcher der Kaiser mit dem Fürsten entstieg. Und nun gab es auf dem Bahnhof kein Halten mehr. Kopf an Kopf reckte sich aus den Coupéfenstern, trotz aller genau inspizierten Absperrungsmaßregeln waren, wie durch einen Zauberschlag herbeigerufen, Menschen überall, die der Abschiedsszene zwischen dem Kaiser und dem ersten Kanzler des Reiches ihre begeisterten Hurrah's darbrachten.
Wider seinen Willen und wider sein Versprechen war Dr. Mark von seinem Platze hinweggeeilt. Als der Galawagen hielt, die Kürassiere sich vor dem Hauptportal aufstellten, der Kaiser mit dem Fürsten im Innern des Bahnhofs verschwand, da folgte auch er, wie jeder in der Nähe, dem mächtigen Zuge, der ihn vorwärts trieb. Jetzt hielt die Kette der Absperrenden nicht mehr. Auf einen, dem sich der Beamte gegenüberstellte, kamen sechs, die an ihm vorübereilten, den Wartezimmern zu, vor deren Fenstern sich eine zehnfache Menschenmauer aufschichtete. Dr. Mark sprang auf einen Tisch und kam noch rechtzeitig genug, um den herzlichen Abschied zu sehen, welchen der Kaiser seinem Gast erwies. Die Maschine zog an. Den brausenden Hochs ließen die Passagiere des überfüllten Zuges den Gesang „Deutschland, Deutschland über alles“ folgen. – Immer ferner tönte der Gesang, still ward's im Bahnhof. – Der Kaiser und Prinz Heinrich kehrten zum Wagen, zurück, das Gefolge verschwand, die Kürassiere der Eskorte sprengten davon – fünf Minuten später war der Bahnhof wie ausgestorben.
„Vorbei!“ flüsterte Dr. Mark, als er in das Dunkel des Platzes vor den Bahnhof hinaustrat. – „Vorüber! War's mehr als eine Fata morgana? O, dass es mehr wäre, dies glänzende Gebild des heutigen Tages!“ Ihm war's heiß geworden. Er sehnte sich nach Aussprache mit einem gleichgesinnten Freunde. Nur einen besaß er, dem er diesen vertrauten Namen geben durfte. Härting, den knorrigen rauhen Bildhauer, den Mann, dessen kunstgeübte Hand die edelsten Formen schuf, während er selbst alles Formelle hasste, den Mann mit dem weichen Herzen in der starr erscheinenden Brust, mit der Wahrheitszunge des Kindes in dem Munde, der nie sich scheute das auszusprechen, was das Hirn dachte, das Herz bewegte.
„Zu Härting!“ Er rief eine leer vorüberfahrende Droschke an und bezeichnete das Café Bauer als Ziel der Fahrt. „Dort ist er immer um diese Zeit“, murmelte er einsteigend und seine Uhr prüfend. „Und ist er nicht da, um so besser, dann treffe ich den Bruder Isegrimm in seinem Bau. Er fehlt mir zum Beschluss des heutigen Tages!“ Das bekannte Café, dessen obere Räume Dr. Mark eilenden Schrittes aufsuchte, war überfüllt. Es kostete den jungen Schriftsteller Mühe, durch den Rauchschleier, der, vermischt mit dem Dunste der Menschen und Getränke, wie eine Wolke über den Gästen des Etablissements hing, nach dem Freunde Umschau zu halten. Der zwischen den Gästegruppen mit der Gewandtheit eines Aales herumgleitende Oberkellner begrüßte in Dr. Mark mit der freundlichvertraulichen Art dieser Leute einen Stammgast. „Gleich wird drüben ein Tisch frei, Herr Doktor – die Herrschaften haben schon gezahlt“. „Ist Bildhauer Härting schon da?“ Der Oberkellner warf einen suchenden Blick durch den Raum. – „Ich glaube nicht – ich habe ihn noch nicht bemerkt.“ „Dann weiß ich, wo ich ihn zu treffen habe.“ Er grüßte den devot sich verneigenden Kellner durch ein kurzes Kopfnicken und ging.
Cafe Bauer unter den Linden
Vor dem Hause in der Mittelstraße, wo wir Dr. Mark vorhin verließen, finden wir ihn wieder. Hier hatte im dritten Stocke Bildhauer Härting seine Künstlerklause eingerichtet. Härting mochte zehn Jahre mehr als Dr. Mark zählen. Er war Junggesell und die Rede ging von ihm, dass er die Frauen, deren köstliche Formen seine Hand gleichwohl nachzubilden strebte, hasse. Er hauste dort oben mit seinem Faktotum Friedrich zusammen, einem ehemaligen Modell, das in Akademiekreisen die bekannteste Persönlichkeit war. Wie kein Zweiter kannte Friedrich, der wegen seines langen Oberkörpers, auf dem ein ungewöhnlich kleiner Kopf saß, den Beinamen „der Obelisk“ erhalten hatte, die Schrullen und Absonderlichkeiten, die Neigungen und Liebhabereien seines Herrn und so hatten die beiden wohl ein Dutzend Jahre mit einander gehaust, trotz aller Absonderlichkeiten des Künstlers immer in gutem Einvernehmen, das auch gelegentliche kleine Gewitterstürme des polternden Härting nicht zu trüben vermochten.
Dr. Mark pochte an die Korridortüre, an welcher keine Klingel bemerkbar war. Härting hasste das Glockengeklingel wie Wallenstein den Schrei des Hahnes. Schlürfende Tritte näherten sich von innen der Tür. Der Deckel eines runden Guckloches schob sich zur Seite und schloss sich wieder. „Wer ist's?“ rief eine rauhe Stimme aus einem Zimmer. „Doktor Mark!“ gab der „Obelisk“ mit seiner dünnen hellen Stimme, die fast der eines zehnjährigen Kindes glich, zurück und zugleich schob sich der Riegel zurück und die Tür öffnete sich. „Mark?“ rief die Stimme des Bildhauers wieder. „Das ist bei allen Teufeln der Einzige, den ich an diesem vermaledeiten Abend sehen mag. Herein mit dem Mann!“ „Aha, Du hast Deine berühmte Isegrimm-Laune, Freund Härting,“ rief Dr. Mark, dem der „Obelisk“ dienstbeflissen und mit einem freundlichen Grinsen in dem lederfarbenen Kindsgesichts die Tür aufriss. „Schadet nichts – so oder so – ich musste heute Abend zu Dir!“
Es war ein großes, dreifenstriges Gemach, in welchem Härting auf einer mit bunten Decken belegten Ottomane längelang ausgestreckt lag und aus einer kurzen Holzmaserpfeife aromatisch duftenden Tabak schmauchte. Gipsabgüsse an den Wänden, dazwischen Stiche, Bilder von Wert, Skizzenmappen am Fußboden und auf Stühlen; auf dem Tische die Reste eines frugalen Abendbrotes, umrahmt von ein Paar leeren und einigen noch gefüllten Bierflaschen. Das Gemach eines Bohémiens, das in seiner ganzen Ausstattung trotzdem nicht abstoßend, sondern originell wirkte und über dem es wie ein Hauch echten Künstlertums lagerte. Härting hatte wie so viele seiner Kollegen Wohnung und Atelier nicht vereinigt. Das letztere lag in dem Garten eines benachbarten Hauses. Härting streckte dem Eintretenden die volle fleischige Rechte entgegen, während die Linke die Pfeife für eine Minute aus den Lippen nahm. „Setz Dich, Junge! Dorthin, in den Lehnstuhl, in dem Du gerne sitzt. Lass Dir vom Obelisken ein Glas geben und schenk Dir ein. Es ist anständiges Pschorr. Ich bin zu faul, um aufzustehen. Aber lieb ist mir's, dass ich heute wenigstens 'mal einen Menschen sehe!“ „Dann hat Dich wohl heute nichts aus Deinem Schmollwinkel hinausgetrieben,“ lachte Dr. Mark amüsiert, indem er sich auf den lederbezogenen Sessel niederließ, der vor dreihundert Jahren einem Nürnberger Patrizier als Ruhestätte gedient haben mochte, wenn das schwere Stadtregiment ihm eine Stunde der häuslichen Muße schenkte, – „Denn an Menschen war heute kein Mangel, Härting!“ „Weiß!“ knurrte dieser, indem er dichte Rauchwolken aus seinem Maserkopf sog und sie in die Luft blies. „Hab‘ heute wieder meine ganze Menschenverachtung aufwärmen können. Ist das ein Gesindel!“
„Oh,“ machte Dr. Mark betroffen – „meinst Du, weil sie dem alten Kanzler so überaus herzlich zujubelten? –“ „Unsinn!“ knurrte der Bildhauer. „Weil sie mit ihrem blöden Hurrah, das sie jedem goldbordierten Menschen, der ihre Neugierde reizt, zubrüllen, dem Alten von Friedrichsruh ihre Freude kundgeben wollen. Müsste mich in dem alten Herrn mächtig täuschen, wenn der nicht für den Enthusiasmuskrempel die richtige Verachtung hätte. Im Übrigen ist die Geschichte ja nun auch vorüber; morgen kommt ein neuer Tag und übermorgen ein anderer. Und wenn ein paar Dutzend Tage mehr in's Land gegangen sind, sieht der heutige Tag genau so grau und nichtssagend aus wie die Reihe der übrigen. Wenn sie nur zu all' dem Freudenrausch nicht noch einen gehörigen Katzenjammer kriegen!“ Er paffte heftig aus seiner Pfeife. „Das ist's ja, was auch mich bedrückt,“ sagte Dr. Mark. „Ich liebe den Kaiser doppelt seit dem heutigen Tage. Aber ich fürchte, der heutige Tag war am Himmel der Wünsche all derer, die es gut mit dem Vaterlande meinen, nichts als eine gleißende Sternschnuppe. Für wenige Sekunden scheint uns das seltsame Lichtbild da oben zu nahen, dann ist's vorbei damit, verloschen in Nacht.“ „So ist's und nicht anders,“ nickte Härting und schleuderte wie in plötzlich erwachendem Unmut einen der Pantoffeln von seinen Füßen. „Dann zerstiebt wie die Sternschnuppe am Nachthimmel wieder eine Hoffnung der Nation,“ seufzte Dr. Mark. „Die beiden Hände, die heute versöhnt ineinanderlagen, hätten sich nicht so schnell wieder trennen sollen.“
Härting richtete sich auf und nahm die Pfeife aus dem Munde. Ein tiefer Ernst zeigte sich in seinem Antlitz. „Ich höre aus Deinen Worten einen Vorwurf heraus, Freund Mark. Dein Herz bewahrt ihn immer noch, auch nach dem heutigen Tage, und das tun vielleicht hunderttausend und mehr Herzen mit dem Deinen. Aber Ihr irrt Euch alle in dem Einen! Ihr kennt den Kaiser nicht! Ihr sehet das Bild, das die Höflinge aus ihm machen. Und das reizt das kritische Auge – mag sein. Wer den Kaiser kennen lernen will, muss ihn mit dem freien Auge des Künstlers sehen, der sich den Quark um Eure ganze vermaledeite Politik und dergleichen Krimskrams kümmert. Ich sage Dir, der Kaiser ist ein Mann, vor dem die übrigen Monarchen sich verneigen dürfen. Es steckt die freie große Seele eines Künstlers in ihm. Wüsste er, wie er sein Volk glücklich machen könnte, sich selbst gäb er dafür hin. Ich kenne ihn, sag' ich Dir! Es ist etwas Elementares in ihm, das durchbrechen möchte und das sie einschnüren und eindämmen möchten mit all' ihren Zeremonienkram und in Äußerlichkeiten sich manifestierendem Gottesgnadentum! Sieh da sein Reliefporträt an der Wand. Als er seine Erlasse an das Volk richtete, dieselben, die Dein kluger, welterfahrener Bismarck nicht wollte, da hab' ich's von der Wand gerissen und geküsst. Ich wusste, dass die Erlasse dem Kaiser bei dem stupiden verhetzten Volk keinen Glauben, keine Freunde, kein Zutrauen erwirken würden. Aber ich hab' doch gejauchzt, als ich sie las. Das ist ein freier Herrscher, jubelte ich – der geht eigene Bahnen. Und geht er zehnfach verkehrte und falsche, einmal findet er die richtige!“
„Ein freier Herrscher!“ sagte Dr. Mark traurig. „Als ob ein Sterblicher die Eigenschaften eines Gottes hätte. Sieh, seit meiner hiesigen Tätigkeit hab ich allein getrachtet, festzustellen, wer die Augen des Kaisers auf falsche Bilder lenkt, wer seinen Ohren die Wahrheit zurückhält und immer auf's Neue trennende Schranken zwischen ihm und dem Volke aufrichtet.“ „Wer?“ unterbrach ihn Härting. „Nenn' einen Namen und Du triffst wahrscheinlich einen Unschuldigen. Zähl' fünfzig auf und sie sind alle mehr oder weniger schuldig. Es ist der Fluch der Herrscher, dass die Schmeichelei ihrem Thron die Nächste ist und dass die Schranzen das Beugen vor dem Throne nur durch Kriechen zu charakterisieren wissen. Und wenn sie wenigstens nur für den eigenen Nutzen kröchen und strebten und nicht zu gehässigen Zwischentreibereien ihre Zuflucht nähmen! Die Hofcamarilla ist zu allen Zeiten der Fluch der Regierungen gewesen, wehe dem Staate, an dem sie zur Geltung zu gelangen vermag. Immer mehr weitet sie die Kluft zwischen Fürst und Volk –“ Er paffte heftig aus seiner Pfeife. –„Volk, Volk!“ fuhr er grollend fort. „Was nennen wir Volk? Das da in den Volksversammlungen herumschreit? Ich kenn's und Du kennst es noch besser. Wer ihnen das größte Maul zeigt und seine Habgier am besten zu entflammen vermag, der ist der Ihre. Den heben Sie auf den Schild. Als ob die Windmacher jener Partei, die da nach Macht allein lüstern sind und sich den Kukuk darum scheren, ob Tausend in ihrem Höllenblendwerk von Zukunftsstaat zu Grunde gehen, das nicht wüssten! Ich danke für das Volk. Oder nennst Du mit diesen Namen die Lauten, die Vordringlichen, die Habsüchtigen, denen der Staat gerade gut genug ist, um mit ihm Schacher zu treiben, einerlei, ob Agrarier oder Industrielle oder Glaubenseiferer, denen der Machtkitzel in der Nase steckt, wie jenen der Geldkitzel. Volk hüben und Volk drüben und nur das, was in der Mitten liegt, was duldet und schweigt und hofft und harrt und sehnsüchtig ausblickt nach einem Kaisersohne, der es befreit von der goldenen und roten Internationale, das ist das Volk, wert und würdig, dass eines Kaisers Herz sich ihm erschlösse, wert, dass auf dieses sich das Volk stütze. Das deutsche Bürgertum, das seinem Kaiser treuer ist als die Edelsten der Nation, das verblutend noch in gläubiger Verehrung aufschaut zu ihm, das wollen sie den Kaiser nicht erkennen lassen in seiner ganzen kaisertreuen Kraft, die es entfalten kann.“
In Mark's Augen blitzte es sonnig auf. Er sprang auf und drückte Härting's Hand. „Das ist der Boden, auf dem wir zusammen stehen!“ rief er entflammt. „Das Bürgertum, das Deutschland groß und stark machte, das ihm seine Gelehrten gab, seine Künstler und es wappnete mit der Kraft seiner Jugend, das bedrängte Bürgertum, das man hinabziehen will in den Sumpf der Gleichheitsmacher, das man wirtschaftlich bekämpft in blindem Eigennutz – wer wird dem Kaiser das schlummernde Dornröschen der deutschen Bürgerkraft zeigen, auf dass er es erwecke!“ „Der Reichstag sicher nicht“, spottete Härtnig. „Wenn ich für irgend etwas unreine Buße auferlegen will, dann les' ich ein Dutzend Parlamentsberichte und wenn ich mich von einer Sünde befreien will, so geh' ich hinein und hör' ein paar Stunden zu. Aber mehr noch seh' ich. Und was ich da sehe, ist Fanatismus und Gleichgültigkeit.“ „Leider Gottes!“ rief Mark aufspringend, „Wenn eine ‚große Sache‘ dran ist, dann sieht man sie einmal beisammen, die Herren! Wenn aber das werktätige Volk und der Bürger zu schützen ist gegen Ausbeutung und Gott weiß was, dann fahren die Herren Abgeordneten ihre Mandate spazieren. Brr, Härting – hast Du keinen Trunk Bier mehr? Wenn ich an die pflichtvergessenen Mandatträger denke, steigt's mir schal in der Kehle auf!“ Härting untersuchte die Flaschen.
„Na ja –“, brummte er – „so geht's immer! Wenn man einen rechtschaffenen Durst bekommt, sind die Flaschen leer.“ Er warf einen seiner Schuhe gegen die Zimmertür, ein Signal, dessen Bedeutung der „Obelisk“ bereits zu kennen schien, denn er trat hastig ein. „Bier!“ Das Faktotum zog sein Ledergesicht in so komische Falten, dass Mark trotz seiner verdrießlichen Stimmung in ein lautes Lachen ausbrach. „Warum lacht denn der Obelisk?“ wandte er sich an seinen Freund. „Unsinn – das ist seine Trauermiene. Ich weiß schon, was sie sagen will. Er wird den Rest des Biers selbst ausgetrunken haben und wir sitzen da. Eingestanden, Friedrich!“ Das Faktotum nickte mit seiner kläglichen Miene. „Dann hilft das nichts, Freund Mark! Meine Quelle ist versiegt, aber ich kenne eine, die wir nicht leer trinken. Ich begleite Dich und wir trinken noch ein Liter miteinander.“ „Ich muß noch arbeiten“, erwiderte Mark. „Ich hindere Dich nicht daran und das Liter Pschorr im Bräuhause noch weniger. Im Gegenteil, mit dem Trank im Leibe wird Dir die Feder nur noch flüchtiger über das Papier tanzen. Im Übrigen lasse ich Dich vor elf Uhr aus meinen Klauen und Du weißt, ich pflege Wort zu halten in allen Dingen. Also?“ „Na, Dir zu lieb, Freund Isegrimm. Vielleicht ist's auch gut, wenn ich noch einen Bissen zu mir nehme. Der Tag hat mich hungrig gemacht.“ „Und das sagt der Mensch erst jetzt!“ raisonnierte Härting. „Dann aber doppelt schnell!“
Im Handumdrehen hatte Härting seine Joppe umgeworfen, seine Schuh an den Füßen und den Schlips geknotet. Jetzt drückte er sich den Kalabreser auf's Haupt, warf den Mantel um und zwirbelt den starken Schnurr- und Knebelbart. „Andiamo, amico!“ Beide gingen. Friedrich, der „Obelisk“ sah ihnen resigniert nach. Das war eine Lösung, die seinem Geschmack keineswegs entsprach. Ein Glück nur, dass er seinen Abendtrunk schon vorher fürsorglich bei Seite gebracht hatte.