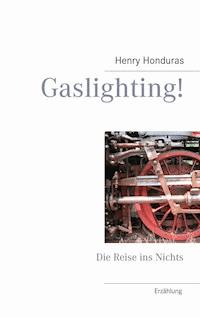
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Freunde betreten einen Zug. Sie treffen auf einen alten Mann und einen geheimnisvollen Fremden. Der Zug dampft ab, man kommt ins Gespräch. Ein seltsames Buch ist das alleinige Thema und eint die Vier auf eine unheimliche Weise. Erinnerungen werden lebendig, Ängste und Kriegserlebnisse. Es wird eine Fahrt in eine Welt des Grauens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinem Sohn Kai, dem ich etwas eigentlich Unmögliches wünsche: Einen guten Rat von einem schlechten gerade dann unterscheiden zu können, wenn er den guten Rat am meisten braucht.
Die Personen und Handlungen dieses Romanes sind frei erfunden. Dennoch mag es sein, dass der Eine oder Andere Bezüge zu seinem eigenen Leben finden wird.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
1
Die Menschen zur Zeit des ersten Weltkrieges kannten noch keinen Atomterror. Damals war das Gas der Inbegriff alles Schrecklichen. Lautlos, gestaltlos, unsichtbar und unfassbar kroch der Tod selbst in den letzten Winkel. Das Feld, die Straße, das Dorf, eben noch Sicherheit und Heimat, standen nun für einen heimtückischen Tod.
Es gibt einen Gaskrieg auch gegen die geistige Heimat.
Irgendwo auf einem Kleinstadtbahnsteig, der Ort ist nicht wichtig, erwarteten zwei Männer den einfahrenden Nachmittagszug. Unter wolkenlosem Himmel brannte die Augustsonne erbarmungslos auf den Bahnsteig hernieder. Hans Eisener, ein schlicht gekleideter Mann um die vierzig, sah die Lokomotive heranrollen. Langsamer und langsamer wurde sie, bis sie schließlich fauchend und zischend vor ihm hielt. Eisener war Ästhet. Er betrachtete mit Wohlgefallen das zur Ruhe kommende Spiel des Gestänges, spürte die Hitze und roch das Öl, mit dem jedes Gelenk reichlich versorgt war. Kraft! Jedes Mal aufs neue bewunderte er die Konstruktion und verharrte andächtig ob der Gesetze, die hier wirkten. Eisener dachte nach. Es war eine Ästhetik für den, der verstanden hatte.
In der Hand hielt er einen Hammer und ein paar Pflöcke, die sein Freund Hartmut ihm für ein paar Pflanzen in seinen Schrebergarten überlassen hatte. Einen Beobachter hätte dieses Werkzeug in den Händen Eiseners gewundert, ließ sein feingeschnittenes Gesicht in ihm doch eher einen Angehörigen der Ingenieursberufe vermuten denn einen Gartenarbeiter. Neben seinen klaren Gesichtszügen und seiner zerfurchten Stirn wies ihn auch seine schmächtige Gestalt eindeutig als Geistesarbeiter aus. Manch einer mochte ihn ob seiner energischen Kinnlinie für hart halten, doch sprachen aus seinem Blick Menschenfreundlichkeit und Wärme.
Neben ihm stand Hartmut Fecht, eine Umhängetasche an der Schulter. Nicht ganz so groß wie sein Freund, wirkte er deutlich kräftiger. Er pfiff sich eins auf Hebelgesetze und Gestänge, doch war er nicht etwa oberflächlich. Unter anderen Umständen hätte er diese Dampfwolken genossen, diesen Kohlengeruch, die Sonne, diese Menschen um ihn herum. Sein Haar war genauso kurz geschoren wie das Eiseners, jedoch erheblich dunkler. Auch war seine Gestik nicht so bedächtig wie die Eiseners, kurzum, man hätte ihn für einen Südländer halten können. Fechts Gesicht offenbarte einen Menschen, der gern und herzlich lacht. Er war so alt wie Eisener, seinem Aussehen nach hätte man ihn aber jünger eingeschätzt. Wer mit ihm zu tun hatte, mochte sogleich seine offene, herzliche Art. Dieser Umstand nützte Fecht in seinem Beruf schon oft, und er war sich dessen bewusst. Dabei war er keineswegs doppelzüngig. Nicht nur Fecht verdiente an Fecht, auch seine Kunden.
Heute aber wirkte der sonst so offene Mann abwesend, verschlossen, sah bleich und übernächtigt aus. Eisener spürte, dass nicht nur die Hitze Fecht zu schaffen machte.
Auf diesen Nebenstrecken fuhren keine neuen Züge, und man mochte sich wohl fragen, ob die Wagen erst einen oder schon zwei Kriege überstanden hatten. Es waren Wagen dritter Klasse, sowohl kraft Kennzeichnung als auch kraft ihres Zustandes. Schon lange schloss die Tür zum Abort nicht mehr richtig, war der Lack auf den Holzbänken rissig, musste man mit Kraft den Lederriemen ziehen, um eines der quadratischen Fenster öffnen zu können. Längst hatte man sich an das unvermeidliche Quietschen gewöhnt. Man nahm es gelassen. Die Vertrautheit mit all diesen Unzulänglichkeiten schien ein Gefühl der Ruhe zu erzeugen, dessen viele Menschen in dieser Zeit noch immer dringend bedurften. Wo heute Eisenbeton in aberwitzige Höhen strebte, sah der eine oder andere noch immer den Bombentrichter, das Haus, das es nicht mehr gab, oder gar die Überreste derer, die ihm teuer gewesen waren.
„Für Schwerbeschädigte" wies ein Schild über der Bank an der Tür zur Plattform aus. Eine ausgemergelte Gestalt mit ungewöhnlich blassem Gesicht saß dort, hieß Wilhelm Kort. Nach dem Kaiser hatte man ihn benannt. Er hatte ihn noch erlebt, den Kaiser. Und was danach kam, besonders das. Mit ausdruckslosen Augen starrte er aus dem gegenüberliegenden Fenster.
Als Eisener und Fecht den Wagen betraten, war dieser schon fast voll. Eisener hinkte ein wenig, ein Überbleibsel aus einer Kriegsverletzung. Sie stießen bis zu Kort vor und sahen neben ihm die einzige noch freie Bank. Fecht warf seine Umhängetasche auf die Gepäckablage, erfreut, sich endlich setzen zu können. Auch Eisener nahm Platz. Ihnen gegenüber saß ein Mann, der für einen Reisenden der dritten Klasse ungewöhnlich fein gekleidet wirkte. Dieser Mann, er sollte sich später als „Bigot" vorstellen, warf einen neugierigen Blick auf Eiseners ungewöhnliches Gepäck, fuhr dann aber fort, Kort zu mustern.
Kort war auffallend mager und hatte ein langes, ausgemergeltes Gesicht mit tiefen Zügen. Sein Blick wirkte derartig teilnahmslos, dass ein kleines Kind ihn einmal am hellichten Tag für tot gehalten hatte. Nun war Herr Kort nicht mehr der Jüngste. Wegen seines grauen Haares wirkte er aber noch beträchtlich älter als er war. In letzter Zeit ging es an manchen Stellen bereits ins schlohweiße über.
Die Lokomotive begann zu fauchen, der Zug ruckte an, in immer rascherer Folge kam das rhythmische „Klack-Klack" des fahrenden Zuges.
Es hatte etwas auf sich mit diesem Herrn Kort. Schon als Kind hatte man ihm eine schlechte Zukunft vorausgesagt. Er war im Sport weniger flink gewesen als die Brüder, tat sich im Rechnen schwer und hatte später lesen und schreiben gelernt als die anderen. Kaum ein misslicher Umstand, für den nicht er beschuldigt wurde. „Rohrkrepierer" war schon bald sein Spitzname. Es zeigte Folgen: Was immer er tat, tat er halbherzig, ohne innere Anteilnahme. Längst schien ihm klar, dass das Leben der Mühen nicht lohne, dass allem der rechte Sinn fehle.
Die Begegnung mit Martha hellte alles auf.
Der Sohn Karl kam.
Dann die zweite Schwangerschaft.
Der Weltkrieg schickte Kort weg. Eine Zeit, geprägt von Entsetzen, Entbehrungen und Abstumpfung begann, unterbrochen nur kurz vom märchenhaften Weihnachtsfrieden 1914.
Das nächste Jahr schickte ihn geradewegs in die Hölle.
Wochenlang im Unterstand. Mal brannte die Sonne, mal peitschte der Regen. Oft tagelang keine Verpflegung.
Das Trommelfeuer!
Die Fäkalien!
Das Blut, das Erbrochene, das Ungeziefer!
Dann kam die Nachricht: Totgeburt, und – Kindbettfieber!
„Gas, Gas!", ging wenig später gellend der Ruf durch die Reihen. Das Gas erreichte Korts Stellung nicht.
Bei den anderen aber erwiesen sich die Masken als unzureichend. Nur die Hälfte kehrte zurück, und Kort selbst wirkte um Jahre gealtert.
Die Zukunft hielt an. Eines Tages verheizten sie Geldscheine. Man bekam so mehr Wärme als über den Umweg eines Kohlenkaufes. Und man hätte ohnehin keine Kohlen bekommen.
Mit dem Führer kamen neue Kohlen. Kort lief mit, tat mit, schrie mit. „Sieg heil!" wie so viele andere. Gemeinsam mit dem Sohn zog er in den zweiten Krieg.
Die zweite Hölle hieß Stalingrad. Kort kehrte erst nach jahrelanger Gefangenschaft zurück.
Sein Sohn überhaupt nicht.
„Rudel soll kommen! Rudel mit dem Kanonenvogel!", so übermittelte Jahre später ein Kamerad Karls letzte Worte. Und Rudel war gekommen.
Rudel sieht.
Rudel stürzt.
Rudel trifft.
Zehn, zwanzig, oft mehr Panzer an einem einzigen Tag.
Der für Karl war nicht dabei gewesen.
Heute ging der Schaffner Krause durch die Reihen. Er stand kurz vor der Pensionierung und hatte sich mit den Jahren eine gute Menschenkenntnis erworben. So wusste er meistens recht gut, wen er in seinen Fahrgästen vor sich hatte. Eine Karte nach der anderen knipste er ab und kam so auch zu den Herren Kort, Eisener, Fecht und Bigot. Etwas ließ ihn stutzen, befremdete ihn. Dieser Herr im eleganten Zweireiher, er gefiel ihm nicht. Er gehörte hier nicht hin. Bigot jedoch war die Freundlichkeit selbst, als er seine Fahrkarte vorzeigte. Der Argwohn schwand so schnell, wie er gekommen war. Kort war an der Reihe, und etwas an Kort rührte Krause an.
Kort reichte seine Fahrkarte. Die Hand zitterte. „Man hat einiges mitgemacht.", setze er entschuldigend hinzu. „Natürlich!", pflichtete Krause ihm bei und sah Kort in die Augen. Kriegszitterer! Langsam, wie aus weiter Ferne knipste er ab. Als er zurückgab, zitterte auch seine Hand. „Verdun" setzte er in Gedanken noch hinzu.
Dass Kort vor einiger Zeit an das Buch geraten war, wusste er nicht.
Krause machte weiter, und Fecht war froh, sich wieder entspannen zu können. Sichtlich erschöpft saß er auf seiner Bank und lehnte dem Halbschlaf nahe an der Fensterwand des Wagens.
Wie Kort, so hatte auch er seine Geschichte. Zu seinen frühesten Kindheitserinnerungen zählte der Tag, an dem der Vater mit ihm ein Brot hatte kaufen wollen. Mit einer Schubkarre voller Geld waren sie zum Bäcker gegangen, und der Bäcker hatte ihnen das Brot verweigert.
Werte, über Nacht ins Nichts zerstoben.
Man verlor den Boden unter den Füßen.
Man musste sich etwas einfallen lassen, sofort.
Nicht nur in Sachen Brot.
Doch der kleine Hartmut hatte ein ebenso heiteres wie optimistisches Naturell. Schnell lernte er, bewies schon bald außergewöhnliche Findigkeit. Jeder Gegenstand wurde ihm wichtig, vom alten Kochtopf bis zur geflickten Socke.
Hartmut behandelte alles so sorgsam wie sein Vater, sah im Alltagsgerät fast schon kleine Persönlichkeiten. Er konnte tagelang traurig sein, wenn etwas schließlich doch weggeworfen werden musste, und er hatte allen Grund dazu. Mit der Zeit war das Material wichtiger geworden als die Menschen, denen es dienen sollte.
Mit dem Führer kam für die Familie Fecht auch der Volksempfänger. Kein Tag, an dem das Gerät nicht geplärrt, kein Aufmarsch, den man versäumt, auch keine Tageszeitung, die man nicht gelesen hätte. Keine Stimmung, keine Frage, kein Zögern, das nicht vom neuen Wind hinweggeweht worden wäre. Hartmut und seine Geschwister blieben sich selbst überlassen.
Die Hitlerjugend bot ihm Kameradschaft und Zuhause. Bald darauf rückte er als Fahnenjunker in die Luftwaffe ein und wurde schließlich Kampfflieger. Er überzeugte. Bei seinen Vorgesetzten durch seine Leistungen und bei den Kameraden durch sein Improvisationstalent.
„Es gibt kein ..."
„Wir brauchen ..."
„Woher bekommen wir ..."
„Frühestens in vierzehn Tagen und nur auf Bezugsschein!"
Fecht vergaß nie, dass auf nichts Verlass war.
Doch er lernte schnell, mit wem er sprechen musste.
Diese Zeit hinterließ ihre Spuren in ihm. Margarine statt Butter, Steckrübenschnitzel oder die verlängerte Leberwurst, all das hatte für ihn mehr noch als für manchen Anderen Erniedrigung bedeutet. Worte wie „Mangelware" und „Ersatz" ließen in ihm bis auf den heutigen Tag ein Gefühl der Bitterkeit aufsteigen, das man bei diesem sonst recht heiteren Mann nicht für möglich gehalten hätte.
Nur Fechts engste Freunde wussten, dass er ungeachtet seines heiteren Naturells von Jugend auf an einem Gefühl unterschwelliger Schwermut litt, das auch in den schönsten Augenblicken nie ganz von ihm wich. Es war dies für Fecht so selbstverständlich, dass er es bis in die jüngste Zeit nie in Frage stellte. Eisener war es gewesen, der ihn in auf diesen fragwürdigen Punkt hingewiesen hatte.
Fecht hatte nachgedacht.
Gegrübelt.
Erinnert.
Abgewägt.
Was mag die Ursache gewesen sein?
Ein falsch verstandenes Wort,
ein nicht eingelöstes Versprechen,
eine nie beantwortete Frage?
Eines Tages hatte seine suchende Hand nach dem Buch gegriffen.
Eisener fiel auf, wie eindringlich Bigot seine Mitreisenden beobachtete. Er versuchte seinerseits, sich ein Bild von Bigot zu machen, doch gelang es ihm nicht. Dessen Bewegungen, seine Art, mit dem Schaffner umzugehen, hatten etwas ältlich Erhabenes, das zu diesem jugendlichen Gesicht nicht passen wollte. Einzig ein paar tiefe Stirnfalten wiesen auf ein höheres Alter hin, als es auf den ersten Blick den Anschein hatte. Er wunderte sich plötzlich, dass ihn fröstelte.
Hans Eisener hatte es besser getroffen, als die beiden Herren Kort und Fecht. Wie Fecht war er noch zu klein gewesen für den ersten Krieg, im Gegensatz zu diesem war ihm dann aber ein besseres Schicksal beschieden. Der Vater hatte im und nach dem Kriege seinen Einfluss zum Wohle der Familie geltend machen können. Infolgedessen wurde die Familie Eisener von inflationsbedingten Nöten weitgehend verschont, und Hans erfreute sich einer glücklichen Kindheit. Wenn die Freunde nicht um ihn waren, bot so manches gute Buch ihm Ersatz für die nicht vorhandenen Geschwister.
Hans las Bücher oft mehrmals. Er prüfte, er verglich. Nicht nur auf literarischem Gebiet. So folgte dem Abitur ein Mathematikstudium, und wenig später begann er als Statiker in einem Flugzeugwerk.
Der zweite Krieg brach aus.
Die Front blieb Eisener erspart – zunächst.
Man befand ihn für unabkömmlich,
Wegen kriegswichtiger Berechnungen.
Eines Tages aber hieß es für ihn: Stalingrad!
Mit Stalingrad kam für Eisener auch der russische Winter. Der Winter brachte neben dem Frost den Hunger, den Mangel am Notwendigsten und schließlich auch die feindliche Kugel. Er kam ins Lazarett, sah Kranke, Todkranke und Sterbende.
Auf der Brust eines Bewusstlosen neben ihm auf der Bahre hatte eine jener Karten gehangen, die in diesen Tagen begehrt waren wie nichts sonst: die Berechtigung zum Flug aus dem Kessel. Der Sani ging herum. Sein prüfender Blick glitt über die Gesichter. An der Bahre blieb er stehen. „Schluss!", stellte er kurz fest. Dann griff er nach der Karte auf der Brust des Toten. Wie gebannt starrte Eisener auf das kleine gelbliche Stück Karton in der Hand des Sanitäters. Ohne ein Wort zu sagen befestigte der die Karte am Mantel Eiseners. Ein Blick des Dankes, doch der Sani hatte seine Runde bereits fortgesetzt.
Eine Berechtigung war eine Berechtigung, nicht mehr. Ob es noch eine Tante Ju für Eisener geben würde, war die Frage, um die sein ganzes Denken in jenen Tagen kreiste. Schon seit längerem mussten die Piloten den Kessel in einem großen Bogen anfliegen, um der feindlichen Flak zu entgehen. Jetzt hatte man auch noch Pitomnik aufgeben müssen. Die Ju für Eisener landete in Gumrak. Mit vereinten Kräften hob man ihn mit seinen zerschossenen Knien in die schon überfüllte Maschine. Es war die letzte Ju, die den Kessel verließ.
Eisener kehrte zurück als noch kranker, als gezeichneter, nicht aber als gebrochener Mann.
Nach dem Krieg ging er an die Universität zurück und begann dort, Rechenmaschinen zu programmieren.
Fecht schreckte hoch. Der Zug rüttelte die Fahrgäste ordentlich durcheinander, als er die Weichen an einem nahegelegenen Bahnhof passierte. Sein Buch fiel aus der Tasche auf der Ablage und landete vor Bigots Füßen.
„Darf ich?", fragte Bigot ehrerbietig und hob Fechts Buch auf.
„Mein Name ist übrigens Bigot, Yves Bigot."
„Angenehm, Fecht."
Auch Eisener stellte sich vor.
„Sie lesen Jankulescu?", ging Bigot dann auf den Buchtitel ein.
„Ja, Josif Jankulescu: ,Liebe – die Herausforderung'. Ich muss sagen, es hat mir in der letzten Zeit buchstäblich den Schlaf geraubt. Da steht so vieles drin, von dem ich nicht weiß, was ich davon halten soll."





























