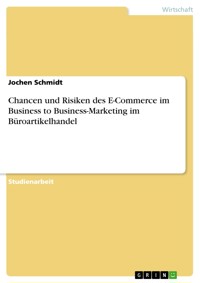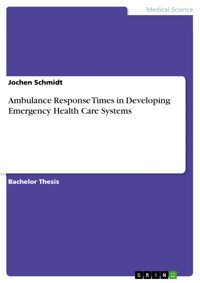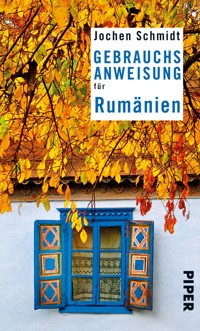
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vom Banat bis nach Bukarest, von Hermannstadt nach Transsilvanien, ins »Land jenseits der Wälder«: Der Autor erzählt von Schnaps, der auf Obstbäumen wächst, von Draculas Nachfahren und so wichtigen Erfindungen wie dem Düsenflugzeug oder dem Füller. Von einem Land, in dem ein prächtiges Haus »Villa Schmiergeld« getauft wird und der Alltagshumor allgegenwärtig ist. Das heute stolz auf die Überreste römischer Besatzung blickt und den Einfluss Moskaus verschmäht. Wo Baustellen wie Spielplätze aussehen und im Krämerladen an der Ecke neben Brot und Gemüse auch Fotokopien und Versicherungen zu kaufen sind. Von Constantin Brâncuși, der schon als Kind aus einer Obstkiste eine Geige gebaut haben soll. Und von der Poesie des Provisorischen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Anja
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
3. Auflage 2017
ISBN 978-3-492-96124-0
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2013
Redaktion: Margret Trebbe-Plath, Berlin
Karte: cartomedia Karlsruhe
Umschlagkonzeption: Büro Hamburg
Umschlaggestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de
Umschlagabbildung: plainpicture/arcangel
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
»In großen Gebieten scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.«
Rumänien, DuMont
»Es scheint, als sei in diesem Landstrich die Zeit stehen geblieben.«
Weltkulturerbe in Siebenbürgen, Schiller Verlag
»… scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.«
Rumänien, Baedeker
»In abgelegenen Dörfern scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.«
Rumänien, Beck’sche Reihe Länder
»Hier scheint an so manchen Orten die Zeit stehen geblieben zu sein.«
Rumänien, Ch. Links Verlag
»… wo in unseren Augen die Zeit stehen geblieben war.«
Living History im Museum, Waxmann Verlag
»Ein uriges Land, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.«
Romantische Vagabunden, BoD
»Hier scheint es, als wäre die Zeit stehen geblieben.«
Glamour, Condé Nast Verlag
»Es scheint, als wäre die Zeit dort stehen geblieben.«
Rumänien, Conrad-Verlag
Vorwort
Vielleicht ist es Einbildung, eine Macke, vielleicht aber auch eine Gabe, jedenfalls gerate ich auf Reisen durch Osteuropa immer irgendwann in einen fiebrigen Zustand vollkommenen Glücks. Worin dieses Glück genau besteht, das habe ich mir klarzumachen versucht, und davon handelt dieses Buch. Manchmal erlebe ich es, wenn in einem Dorf uralte Landmaschinen am Wegesrand stehen, wie von Jean Tinguely konstruiert, oder wenn hinter einer Biegung in einem Karpatental plötzlich eine gigantische Zementfabrik auftaucht mit einem »Club der Zementarbeiter«, oder wenn in einer Kleinstadt an einem Kulturhaus mit dem Chic der 70er die Tür offen steht und ich mich in den Saal mit der Originalmöblierung schleichen kann, die hier noch lange nicht wieder in Mode ist. Und wenn mich eine Stimmung in einer rumänischen Stadt an einen dieser Nachmittage zurückbringt, wenn im Ferienprogramm nur ein alter osteuropäischer Schwarz-Weiß-Film lief. Da waren die Kinder immer die Helden in einer von Erwachsenen verwalteten Welt. Alle meine Freunde sind verreist, und ich warte in meinem von der Sonne aufgeheizten Neubaugebiet jeden Tag auf Regen, weil ich mir ausrechne, dass sie dann aus dem Urlaub zurückkommen.
Osteuropa ist eine Bluttransfusion, es stärkt die Abwehrkräfte, sich hier ab und an aufzuhalten. Hinterher liest man nach, wo man eigentlich war und was man dort verpasst hat. Der Nonnensteinschmätzer? So nah bin ich ihm gekommen, und ich kannte ihn nicht einmal! Und ich soll mich zu Rumänien äußern? Den in den Ceaușescu-Jahren ins Exil gegangenen Rumänen wird vorgehalten, sie dürften sich kein Urteil über das heutige Rumänien erlauben, weil sie nie Sojasalami essen mussten. Ähnliche Vorbehalte gibt es in Ostdeutschland gegenüber Westdeutschen. Wie lange muss man dort gelebt haben, um über ein Land Aussagen treffen zu können? Manche Dinge fallen einem ja nur in den ersten fünf Minuten auf, zum Beispiel das Wasser von den Klimaanlagen, das mir in den ersten Tagen auf den Kopf tropfte. Es war für meine Wahrnehmung irgendwann verschwunden, weil ich den Pfützen automatisch auswich. Gibt es überhaupt ein für alle gültiges Rumänien? Zeigt eine Dokumentation von Wim Wenders mehr von der Wirklichkeit als eine einem Straßenhund umgebundene Kamera? Wie viel muss man gesehen haben? Ist »gesehen haben« überhaupt quantifizierbar? Wenn das, was man sehen könnte, unendlich ist, spielt es dann eine Rolle, wie viel man gesehen hat? Sieht man mehr, wenn man sich viel bewegt oder wenn man stehen bleibt und wartet?
Die Bedeutung eines Orts kann man nie vollständig erfassen, man müsste endlos Studien treiben und Menschen befragen; der Lernprozess hört nie auf, denn jede Generation verbindet etwas anderes mit denselben Plätzen. Aber auch wenn man noch ahnungslos ist, nimmt man die Orte auf eine bestimmte Art wahr, und die ist mir immer besonders wertvoll gewesen. Jeder Rumänienreisende macht seine eigenen Erfahrungen, selbst wenn er viel weniger weiß als ein Fachmann oder ein Einheimischer. Die wissen ja oft viel weniger Bescheid über ihre Heimat. Das für uns Spektakuläre ist ihnen aus den verschiedensten Gründen keinen Blick wert. Die Poesie des Provisorischen, das Abenteuer des Alltags, der Humor. In einem Bergdorf ein kleiner Lebensmittelladen mit einer Kneipe namens Ulița spre Europa (Straße nach Europa). Diese sehr rumänische Mischung aus Selbstironie und der Sehnsucht, von der Welt bemerkt zu werden.
Prolog
Der Zug von Lemberg zur ukrainisch-rumänischen Grenze ist ziemlich heruntergekommen, zudem ist es kalt. Aber es gibt bei der Schaffnerin heißes Wasser und Tee. Iwan und Pawel freuen sich über meine Gesellschaft im Schlafwagen. Sie verschwinden eine Weile und kommen mit einer Plastetüte voll Bier zurück, von der Schaffnerin haben sie Teegläser geholt. Iwan stellt fest, dass er wie ich heißt, von Jochen über Johann zu Hans und Iwan. Er sei Architekt und beweist es mir, indem er mir ein Nikolaushaus ins Notizbuch skizziert. Vom Russischen fällt er immer wieder ins Ukrainische, weswegen ich ihn kaum verstehe. Hitler habe 1941 in ganz Europa den Gral gesucht, das erkläre seine militärische Unternehmungslust. Dass Hitler vermutlich noch in der Antarktis lebt, glaubt er mir gerne. Und Walt Disney sei Ukrainer gewesen, sagt er, seine Ideen seien geprägt von der ukrainischen Nationalkultur und ihrer Liebe zur Natur. Schriftsteller sei ich? Davon könne man nicht leben! Das heiße nur, dass meine Frau für mich arbeite. »Schisn prekrasna no trudna«, sagt er immer wieder, das Leben ist schön, aber schwer. Pawels Fotos zeigen ihn mit seinem österreichischen Bauleiter in einem Kiewer Restaurant, in dem man sich mit Wehrmachtshelm und MG ablichten lassen kann. Dann sehe ich ihn in Solotwyno, der Endstation unseres Zugs, wo aus einem stillgelegten Bergwerk aus 300 Meter Tiefe Salzwasser gepumpt wird, in dem Kurgäste baden, mit schwarzem Heilschlamm eingeschmiert. Er serviert mir Zwieback zum Bier. Dass man im Zug kein Internet habe, sei schlimm, wie abhängig man doch von der Zivilisation sei. Ich hätte eher die Situation auf den Toiletten angesprochen. Die Russen seien viel schlimmer mit Trinken, gläserweise Wodka. Wenn Russen saufen, kommen sie zwei Wochen nicht zur Arbeit, sagt er. Es fällt mir immer noch schwer, diese neumodische Unterscheidung zwischen Russen und Ukrainern mitzumachen. Ob meine Ohren auch schon zu seien? Draußen in der Dunkelheit ziehen nämlich schon die Karpaten vorbei.
Nachts ist es kalt. Pawel hört Musik beim Schlafen. Die schweren Stahltüren, die man aufwuchten muss. In russischen Zügen fühlt man sich immer halb wie in einem Güterwaggon. An Haltestellen hasten schwer bepackte Menschen in die Dunkelheit. Das Schnarchen der anderen dringt nicht durch die Zuggeräusche. In Bukarest habe ich einmal in einem Hostel eine Sommernacht wach gelegen. Die Technobässe von der Terrasse nebenan und das laute Schnarchen eines Stuttgarters. Der dicke Mann war seit vier Jahren mit dem Fahrrad durch Europa unterwegs, weil er arbeitslos geworden war und ihm zu Hause die Decke auf den Kopf fiel. Er trug sein Hab und Gut in zahllosen Beuteln und Tüten mit.
Die Toilettenbrille ist eine Laubsägearbeit. Erstaunlich, dass es an diesem Ort, der wie der Umkleideraum eines Eisenwalzwerks wirkt, Seife in einer Seifenschachtel gibt. Am Morgen empfange ich im Radio schon einen rumänischen Sender, ein Kurs im Gulaschkochen. Ich lausche gierig auf die Stimmen, es ist so schön, die Sprache wieder zu hören. In Solotwyno merke ich erst gar nicht, dass wir angekommen sind, und steige als Letzter aus. Ich verabschiede mich von der Schaffnerin, die in Hausschlappen an der Tür steht. Jetzt muss ich den Weg nach Rumänien finden.
Die Gleise sind mit Unkraut überwuchert. Das kleine Bahnhofsgebäude. Verrostete Blechzäune. Berge am Horizont. Die Himmelsrichtung ist im Morgendunst kaum auszumachen. Im Zentrum der Ortschaft ein Park mit einem sowjetischen Ehrenmal, sogar blumengeschmückt. Ein Geschäft Sjurpris, mit chinesischen Gummitieren zum Aufblasen. Vom Café werde ich zur Toilette auf den benachbarten Markt geschickt, zwei Löcher im Beton, der Geruch erinnert mich an unsere Sommerurlaube auf dem Dorf. Beim Camping in Bulgarien sagte man bei diesen Toiletten, man gehe »zum Abfahrtslauf«. Es empfahl sich, das gleich morgens zu erledigen, weil nur einmal am Tag Wasser drübergekippt wurde.
Der Cafébesitzer spricht rumänisch mit seiner Köchin. Es gibt einen Schewtschenko-Boulevard, nach dem ukrainischen Nationaldichter, und eine Eminescu-Straße, nach dem rumänischen Nationaldichter. In der Ortsmitte steht ein neues, silbern lackiertes Ştefan-cel-Mare-Denkmal, mit Zepter und Kreuz. Eine Oma verkauft durch ein herausgenommenes Segment ihres Gartenzauns unter einer Plasteplane stehend Strümpfe. Ein Café Grind, das sicher etwas anderes bedeutet. Eine nur halb fertig gebaute Kirche, die Kirchturmuhr ist nur aufgemalt, sie zeigt fünf vor zwölf an. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Alte Leute wandern auf der Straße, die einen hin zur Grenze, die anderen zurück. Drüben liegt Sighetu Marmației.
Zum ersten Mal den Pass vorzeigen. Ist das wirklich die Grenze zur EU? Und man kann zu Fuß rübergehen? Werden sie die Hello-Kitty-Stempel stören, mit denen meine Tochter meinen Pass verziert hat? Eine Stahlbrücke führt über die Theiß. Ich folge einem Mann, der mit einem Behindertengefährt wie aus einem Kusturica-Film Klopapier transportiert. Andere haben drüben Pakete mit Mineralwasserflaschen gekauft, ist der Preisunterschied wirklich so bedeutend? Die Männer in der Schlange haben schon die Hüte in die Stirn geschoben, wie es Rumänen tun. Weil ich so aussehe, als könne ich nicht viel aushalten, oder weil man bei einem alteingesessenen EU-Bürger einen guten Eindruck machen will oder einfach, um sich etwas Abwechslung zu gönnen, werde ich vom rumänischen Zoll vorgewinkt. »Drogen? Haschisch? Nichts?« »Nein, ich rauche und trinke nicht.« »Und Frauen?« Wir sind im Land des derben Humors.
Mit der Schäferin durch Schulligulli
Sighetu Marmației. Die ersten mit abgeschnittenen Plasteflaschen bekrönten Zaunpfähle. Wahlplakate, ein unabhängiger Kandidat wirbt für sich: »Statt einer Partei lieber einen Menschen.« Der Palatul Cultural Astra, ein burgartiges Gebäude an einer Straßenecke. Einfach die Tür öffnen? Ein Ikarus-Wandgemälde, das war auch typisch für die DDR, der Kult um diesen Freiheitshelden: »Flieg, flieg, wie ein Falke, der das enge Erdenverlies verlässt.« Ich falle dem Personal auf, und der Direktor führt mich persönlich durch das Gebäude. Das Haus sei eine Stiftung eines reichen Ungarn aus den 30er-Jahren. Ein ofengeheizter Ballettsaal. In der Malerklasse lernt eine Frau die Technik der Hinterglasmalerei. Ich kaufe ihr zwei Ikonen ab, das Geld wäre schon der Rahmen wert. Die Künstlerin schreibt für ihren Unterricht einen Text aus einem großen Buch ab. Warum sie das nicht kopiere? Das gehe nicht, das Buch sei zu alt und wertvoll. Und so schreibt sie einen Text aus einem Buch ab, das kaum 100 Jahre alt ist.
Im Direktorenbüro hängt ein Neuschwanstein-Poster, davor steht ein Gummibaum, von einer ausrangierten Neonröhre gestützt, die in der Blumenerde steckt. Das sei kreativer Umweltschutz, sagt der Direktor grinsend. Ich liebe diese improvisierten Lösungen, wo so etwas möglich ist, atmet die Seele auf. Und wo geht es wieder raus? »Penultima la dreapta«, sagt er, die vorletzte Tür rechts. Penultima, ein griechischer Begriff aus der Metrik, so wird die vorletzte Silbe im Wort bezeichnet. Aber auf Rumänisch auch eine Tür. Wer da nicht Rumänisch lernen möchte!
Im Zentrum der Stadt das Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei (Gedenkstätte für die Opfer von Kommunismus und Widerstand). Es ist aus einer Privatinitiative hervorgegangen, die rumänische Politik hat sich um so etwas nach der Wende nicht gekümmert. Hinter jeder Zellentür ein anderes Thema für eine Doktorarbeit. Bürgerliche, Bauern, Politiker, Offiziere, Studenten, Ärzte sind hier gestorben, vor allem in den 40ern und 50ern. Ein gelbes Herz, 1950 aus dem Stiel einer Zahnbürste geschnitzt. Der Fall eines Gefangenen, der nach Misshandlungen gespürt hat, dass er nackt in einer kalten Betonzelle nicht überleben werde, und einen jüngeren die Nacht über auf sich hat sitzen lassen, um ihn zu retten. Ob es stimmt, dass der ehemalige Gefängnisdirektor seit Jahren versucht, dem Memorial den Hut des hier gestorbenen Politikers Iuliu Maniu zu verkaufen?
Ein Raum zeigt Alltagsgegenstände aus dem Kommunismus. Ceauşescu-Porträts in fast schon karikaturhafter Unähnlichkeit. Er besucht LPGs, gibt Bauern nützliche Hinweise und erläutert Ingenieuren den Bau von Kraftwerken. In zwei durchsichtigen Säulen haben sie Ostprodukte entsorgt, als sei es Müll: das Sparbuch, das alle hatten, Puppengeschirr, Kinderkameras, Pepsiflaschen, die orangeblaue Uniform der Jugendorganisation Şoimii Patrici (Falken). Es gibt bei den Vertretern der antistalinistischen Aufklärung noch kein Bewusstsein für den emotionalen Gehalt solcher Alltagsgegenstände. Mit einer Archäologie der Gegenwart, oder auch nur dem Archivieren der Alltagswelt, ist hier noch nicht begonnen worden. Dafür ist vieles aber auch noch in Gebrauch.
Am Busbahnhof komme ich genau rechtzeitig, um im Euro-Café Gara »Gordon blue« zu essen. Ich finde ganz hinten noch einen Platz im Minibus nach Vişeu de Sus, wo ich mit der letzten noch betriebenen Wald-Schmalspurbahn Rumäniens fahren will, einer sogenannten mocăniţa, was wörtlich Schäferin heißt. Ich habe Glück, andere müssen die Fahrt im Stehen hinter sich bringen. Eine Frau hat eine Schachtel mit durchlöchertem Deckel dabei, man hört die Kücken piepsen.
Bauernhäuser, geschnitzte Holztore, deren heidnische Symbolik einen nicht überrascht. Manche dieser Tore sind auch neu und als protziges Statussymbol gemeint. Quadratische, überdachte Heuschober auf den Feldern, Holzstangen zum Trocknen von Gras, das die Hauptressource zu sein scheint. »Kommt der Georg, kommt das Gras. Schlägt man’s mit dem Hammer nieder, kommt es dennoch immer wieder.«
Wundervolle Holzhäuser und daneben pinkfarbene Betonvillen mit Gipssäulen. Warum wird das nicht von der EU verboten?
In Vişeu de Sus suche ich das Depot der Kleinbahn. Kinder haben Adidas- und Nike-Logos an die Mauer gemalt. Wenn Graffiti so aussehen, hat es der Kapitalismus geschafft. Im Sägewerk werden Baumstämme gestapelt. Ich hatte eigentlich mit dem Touristenzug morgens um neun Uhr fahren wollen, aber als ich höre, dass man auch um fünf Uhr früh mit den Waldarbeitern fahren kann, siegt die Neugier. Ich buche eine Nacht im ausrangierten Schlafwagen, der auf dem Gelände steht: »Vereinigter Schienenfahrzeugbau der DDR. VEB Waggonausrüstungen Vetschau«.
Das kunstvoll verzierte Blech der Dachrinnen im Ort. Ein Friedhof, ob ich mich zur fröhlich zechenden Trauergesellschaft setzen soll? In der Kirche, die wieder nur eine aufgemalte Uhr hat, diesmal zeigt sie zehn vor zwölf, begrüßt mich ein Mann mit Handschlag. Ich überlege kurz, ob wir uns kennen. Auf dem Grabstein für Mihai und Ileana Bocsok steht »1942–20«, die letzten beiden Ziffern müssen bei Bedarf noch ergänzt werden, das Jahrhundert steht aber schon fest. Auf einem Grab von 2000 steht: »Wanderer, hier ruhe ich, und du liest diese Worte. Besser wäre es, du lägest hier, und ich würde das lesen.«
In einem Vorgarten ein großes, verziertes Holzkreuz, die Besitzerin freut sich, dass ich mich für ihre troiță interessiere, die hätten sie selbst geschnitzt. Hinten im Garten bedient der alte Großvater eine museumsreife Destillieranlage. Im Kessel brennt Feuer, ein langes Rohr führt zu einem zweiten Kessel, ein bisschen wirkt es so, als würde gleich alles in die Luft fliegen. Pflaume?, frage ich, Kompetenz vortäuschend. Nein, Äpfel. Vom letzten Jahr? Ja. Die Frau hat einen Bruder Romulus in Nürnberg, ob ich den kennen würde?
An einer Kreuzung eine blaue Bank, deren Sitz man aufklappen kann, wenn man eine Mutter von einer Schraube löst. Anschließend schraubt man sie wieder fest. Auf der Straße ist mit einem Stück Gartenzaun ein deckelloses Gullyloch markiert. Im Buchladen ein Buch über die Zipser, die deutschen Waldarbeiter, die hier von den Österreichern vor über 200 Jahren angesiedelt wurden. Sie kamen aus der Slowakei, wo sie auch schon eine Minderheit waren. Das Bild von einem »symbolischen Begräbnis« für Gheorghe Gheorghiu-Dej im Jahr 1965. Anscheinend hat man den Tod dieses ersten kommunistischen Regierungschefs von Rumänien überall im Land auf diese Art betrauert. Man erfährt von einem Möbelstück der ersten Kolonisten, dem »Radlbettl«, das tagsüber unter das andere Bett geschoben wurde. So eines hatten wir in unserer Neubauwohnung auch! Vom Vorstand des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, das sich im Januar 1990 gründen durfte, blieb bei der ersten Reise nach Westdeutschland im September 1990 die Hälfte dort. Heute kommen die Deutschen nur noch zu jährlichen Nostalgietreffen. Ihre Tänze und Gesänge werden dabei von jungen Rumänen aufgeführt.
In der Stadt hängen überall Wahlplakate. Ein unabhängiger Kandidat wirbt mit einer Vorher-nachher-Bilderserie für sich. Ich würde immer für »GEGENWART« optieren und nicht für seine Version unter »VIȘEU HAT EINE ZUKUNFT«, bei der uniforme Betongaragen gezimmerte Holzbaracken ersetzen, eine ungepflasterte Dorfstraße einem schnurgeraden Asphaltband weicht, ein Spielplatz mit einem schönen, alten Karussel einer grellbunten Plasterutsche.
In einer Pizzeria heißt das Bier in der Karte »Pilsener Ürkuell«. Es gibt auch »Bergenbier«, »Golden Brau«, »Burger«, »Dorfer«, »Albacher«. Während man sich für Parfüms französische Namen ausdenkt, hat man bei den Biersorten in Rumänien auf eine Art Deutsch zurückgegriffen. Flachbildschirme an allen Wänden. Ein Nachrichtensender zeigt eine Schlägerei unter Fußballern bei einem Spiel CFR Cluj gegen Universitatea Cluj. Der gemischte Salat ist eine zerschnittene Tomate mit einer zerschnittenen Gurke. Aber es gibt WLAN.
Auch auf dem Gelände vom Depot kann man ins Internet. Wegen des schlechten Telefonnetzes in Osteuropa haben sich Mobiltelefone und Internet hier schneller durchgesetzt als bei uns. Der Wachmann setzt sich neben mich und betrachtet interessiert meinen Bildschirm, als handle es sich um Fernsehen. Manchmal zuckt der Hund, wenn sich draußen jemand nähert. Ein ungewohnter Sternenhimmel, Geruch von Holzfeuer, der Fluss rauscht im Dunkeln. Im Zugabteil ein Waschbecken zum Aufklappen.
Morgens um fünf Uhr sehe ich den Arbeitern zu, die im Depot den Zug rangieren, Waggons, die später mit Holz beladen werden. Ganz nach hinten kommt ein Waggon mit Heu. Platz nehmen neben einem Kanonenofen, Holz liegt schon bereit. Bei mir ist leider ein Loch in der Scheibe, durch das es ziemlich kalt bläst. Langsame Fahrt, direkt an Vorgärten vorbei, Bohnenstangen, Wäsche hängt zum Trocknen. Arbeiter springen auf, Kaffeebecher in der Hand. Manche stehen vorne im Freien. Die Bahnstrecke schlängelt sich am Fluss entlang, eine Straße ins Tal gibt es nicht.
Zehn Arbeiter, zehn verschiedene Mützenlösungen. Einer will sogar meine gestanzte Pappfahrkarte sehen. Das Gerät, das er dafür benutzt, macht den Pufferküssern, die von weither für diesen Zug anreisen, sicher besondere Freude. Sie stellen sich an Kurven auf, um die Dampflokomotive in ihrer ganzen Länge zu knipsen, als handle es sich um ein Fotomodell. Fehlgeleitete männliche Zärtlichkeit.
Vor den Kurven pfeift die Lok. Treibholz und Müll im Fluss, man sieht, wie hoch er manchmal Wasser führt. Alte Holzhäuser mit Scheunen und Ställen und daneben rosa Neubauten. Die Würde von Holz als Material, gerade im Alter. Es gibt ja auch keine hässlichen alten Bäume. Die Gesichter der Arbeiter. Man reist nicht nur, um entlegene Landschaften zu entdecken, sondern auch, um solche Gesichter zu sehen. Im Kanonenofen wird Feuer gemacht, schnell breitet sich Wärme aus. Ich lege Weißbrot auf den rostigen Ofen, sofort ist es getoastet.
Șuligu, »Groß-Schulligulli«, einer der Orte, die man des Namens wegen besucht haben möchte, wie Schruns-Tschagguns. Dann nach 20 Kilometern Făina. Es ist kein Ort, nur eine Haltestelle mit ein paar Baracken. Auf dem Gleis steht ein Ford-Kleinbus ohne Räder, zur Draisine umgebaut. In den 20ern haben sie das schon mit Oldtimern gemacht. Ich begebe mich auf den zehn Kilometer langen Rückweg zur Haltestelle des Touristenzugs. Ich muss nur den Gleisen folgen. Ein Pferd kommt mir entgegen, von einem Hund geführt. Ein Stück von einer Schiene liegt in einem Busch, ich stecke es ein. Meine Erben werden es dann wegwerfen.
Einmal im Leben möchte ich eine Weiche verstellen, so oft hat man das im Western gesehen. Der schwere, schwarz-weiß gestrichene Stahlhebel, der mit seinem Gewicht die gut eingefettete Weiche verschiebt. Ein geniales System. Ein deutsches Polizeiauto nähert sich, für den Schienenbetrieb umgebaut. Besetzt mit winkenden Waldarbeitern.
Der Weg ist länger als gedacht. An einer Station mit drei Holzhütten ein Schild: »Eine Sekunde brauchst du, um ein Feuer zu entzünden, ein Jahrhundert dauert es, bis sich der Wald davon erholt.« Außerdem: »Attention to large carnivores«. Ich habe aber keine Angst, weil ich mir in Berlin in einem Outdoorladen eine Bärenglocke besorgt habe. Ein Waldarbeiter mit schwarzem Bart, der von sich sagt, er sei Ukrainer, legt gleich auf Ukrainisch los, mit wundervollem Akzent. Bären? Ob ich Angst hätte? Hier hinten im Wald wohne nämlich ein großer. Ob ich Arbeit in Deutschland für ihn wüsste? Sein Bruder ist in Italien, macht irgendwas mit Schrauben. Ob ich Zeuge Jehovas sei? Er zeigt auf die Stämme, die an der Bahnstrecke liegen, die hat er heute gefällt. Der Zug komme gleich, ich solle doch warten. Damit meint er den Zug, der in zwei Stunden zurückfährt.
Von 1930 bis 33 dauerten die Arbeiten an der 56 Kilometer langen Bahnstrecke. Die Dampfloks wurden mit Holz befeuert. Hoch ins Tal ziehen sie, zurück rollt der Zug von selbst.
Ich esse Sardinen und schlafe auf einer Holzbank, das Tuten der Wassertalbahn weckt mich. 50 Touristen nehmen den Rastplatz in Sekundenschnelle in Beschlag. An den Waggons hängen noch Schilder vom Jungfraujoch. »Kleine Scheidegg«, früher hätten wir zwei Buchstaben weggekratzt und uns diebisch gefreut.
Die Deutschen stehen sofort, grimmig auf Essen erpicht, in der Schlange. Die Rumänen picknicken eher etwas abseits auf eigene Faust. Ein dicker Deutscher will eine Flasche Bier. »No alcohol«, sagt die Verkäuferin. »Das ist alkoholfrei«, übersetze ich, und er bekommt einen Schreck und stellt das Bier wieder weg. Am Klo mehrere große Mistkäfer, die mit der ihnen eigenen Behäbigkeit, aber deutlich beflügelt von Gier, dem verlockenden Geruch folgen.
Der Zug vom Morgen rollt vorbei, ich erkenne die Gesichter der Arbeiter wieder, die, auf die Waggons verteilt, die Bremsen bedienen. 16 Waggons Holz rollen bergab, ausführlich geknipst von 50 Fremden. Auch die Dampflok, die qualmend rangiert, aus dem Combinatul Metalurgic Reșița von 1954. Wie wundervoll anschaulich Technik früher war.
Als großes Problem erweist sich, dass der Zug gedreht hat und die Sitzordnung durcheinandergewürfelt wurde, vor allem, weil ich ja dazugekommen bin. In solchen Fällen tut man einfach so, als verstehe man kein Deutsch. »Desch geht net uff da, weischte, Helmut«, gemeint ist das Fenster. Die Dame sei nur wegen ihrem Mann hier, der »beim Staat war«, sagt sie. »Wir habe uns g’sagt, wir mache desch mal mit, und isch muss sage, wir bereue es net.«
Auf der Hinfahrt habe es eine Entgleisung gegeben, berichten sie, das sei normal bei der Strecke. Nach einer halben Stunde war ein Reparaturtrupp da und bog die Schiene wieder gerade. Im Gästebuch am Bahnhof steht: »Motorschaden, Entgleisung, misslungener Verschub. Ein unvergessliches Erlebnis!«
Im höchsten Gebäude Rumäniens
Der Bus überholt ein Pferdefuhrwerk, dessen Kutscher eine Jacke vom »Karate Club Duisburg« trägt. Die Pferde mit roten Puscheln am Kopf, die wohl gegen Bremsen helfen. Neben mir sitzt ein Mann, »Scheiß auf die Ex«, steht auf Deutsch auf seinem T-Shirt. An den Haltestellen rufen ältere Frauen dem Fahrer zu: »Domnule, duceţi pachet la Baia Mare? Autogară? Asteaptă acolo baiat.« (Bringen Sie mir das Paket nach Baia Mare? Zum Busbahnhof? Da wartet dann ein Junge.) Einen Geldschein drückt man dem Fahrer dafür in die Hand. Das Kleinbusnetz macht dem sehr langsamen Postnetz Konkurrenz.
Es ist Sonnabend, alte Leute in weißen Hemden spazieren in den Dörfern mitten auf der Straße. Eine Mutter mit Töchterchen in weißen Strumpfhosen. Eine Schafherde blockiert die Straße. Häuser mit blauen, rhombenförmigen Mosaikmustern oder farbigen, geometrischen Stuckornamenten. Viele neu gebaute Kirchen der Zeugen Jehovas. Einzelne Gleise, sogar mit Schranke. »Poziţiă normă barierei deschisă« (Vorschriftsmäßige Position der geöffneten Schranke) steht auf einem alten Schild. Bahngleise wirken hier immer so, als seien sie schon lange außer Betrieb. Jeder weiß, dass man mit dem Auto bei Schienen auf mindestens 5 km/h abbremsen sollte, sonst droht ein Achsenbruch. Am Busbahnhof Sighet bleibt Zeit für ein Eis. »Napoca – Gustul copilăriei« (Der Geschmack der Kindheit) steht auf dem Holzstiel.
Den Gutâi erkenne ich, vor 20 Jahren habe ich mit meiner Wandertruppe auf dem Gipfel ein Gewitter erlebt, zu zwölft in einem Igluzelt. Danach gab es Milchpulversuppe mit selbst gepflückten Blaubeeren. Außer dem putzig klingenden drum bun (Gute Reise) konnten wir kein Wort Rumänisch. Ich starre in die Richtung und versuche, etwas von der Vergangenheit hervorzufischen. Ein Schäfer mit Schnurrbart und Mütze steigt zu, sein Söhnchen, noch ganz zart, aber die Hände sehen schon nach körperlicher Arbeit aus. Neugierig guckt er mich an. Im Rucksack trägt er Milchflaschen, es tropft auf meinen Schuh. Ob er mir seinen geschnitzten Wanderstock verkaufen würde? Eine gelbe Gasleitung folgt der Straße in absurden Windungen kilometerweit ins Tal.
In Baia Mare fragt der Fahrer ungläubig, wo ich denn hinwolle, weil ich an einem Zwischenhalt am Bulevardul Independenţei einfach rausspringe. Von meinem Hotel hat er noch nie gehört, er scheint sich Sorgen um mich zu machen. An der Kreuzung eine riesige Mall, mitten auf der Straße zieht eine Roma ihr Hemd hoch und zeigt sich den Autofahrern. Von Nahem erkenne ich, dass sie einen Tumor hat. Ich hoffe, das Hotel zu finden, aber ich sehe nur Fabrikruinen. Kurz bevor die Stadt zu Ende ist, steht es aber da, das Internet hat nicht gelogen. Die Frau vom Empfang führt mich nach oben, ich soll den Kopf einziehen, denn die Treppe ist so konstruiert, dass man, wenn man um die Ecke geht, direkt gegen eine Kante knallt, deshalb ist dort schon mit Tesa Watte festgeklebt worden. Als Begrüßungssüßigkeit gibt es Eukalyptusbonbons. Aus einem Loch in der Decke kommt ein Antennenkabel. Wenn man am Duschschlauch kräftig zieht, reicht er gerade bis zur Halterung. Auf dem Boden liegt eine Plastematte, die sich so mit Wasser vollgesogen hat, dass sie beim Betreten schmatzt. Der Lichtschalter vom Bad ist in Kniehöhe angebracht. Die Tür schließt nicht, die Scharniere sind mit einfachen Schrauben am Holzrahmen befestigt. Die Laterne vor dem Fenster ist auf einen Betonsockel geschraubt, und es sieht aus, als hätten sie sie vom leeren Laternenpfahl auf dem Bürgersteig abmontiert. Ich sitze alleine im großen Speisesaal, die Wände schmücken Arrangements aus Holzscheiben und Baumpilzen. Draußen rauscht ab und zu ein Auto vorbei. Als Saft bekomme ich eine Fanta. Ich wollte doch Orangensaft? Aber das sei doch Orangengeschmack …
Am Morgen ziehe ich mit Gepäck zum Bahnhof. Es ist heiß, ich trage kurze Hosen, was in Rumänien inzwischen nicht mehr automatisch bedeutet, dass man homosexuell ist. Wegen einer Umweltkatastrophe im Jahr 2000, der schlimmsten seit Tschernobyl, zählt Baia Mare laut Reiseführer zu den am stärksten verseuchten Städten der Welt. Internationale Konzerne gewinnen mit Zyanid aus alten Abraumhalden letzte Reste Gold. Ein Damm war gebrochen und das verseuchte Wasser war bis nach Ungarn geflossen.
Das runde Gebäude neben dem Bahnhof ist der alte Busbahnhof, ein reizvoll futuristischer Bau, leider am Verrotten. In der Bahnhofshalle ist auch am Sonntagmorgen ein Schalter besetzt. Eine nette, ältere Dame dreht mir den Bildschirm hin, damit ich mich für einen Nachtzug nach Bukarest entscheiden kann, ungefähr 630 Kilometer sind es bis dort. »Sex bărbătesc« (Geschlecht männlich) hat sie schon angekreuzt. Eine Gepäckaufbewahrung gibt es nicht mehr, ich soll um die Ecke kommen. Im rußigen Durchgang zu den Gleisen öffnet sich eine Tür, hinter der ich mein Gepäck abstellen kann. Ob sie denn um 18 Uhr noch da sein werde? Ja, sie arbeite von 6.30 Uhr bis 19.00 Uhr.
Ich gehe einfach geradeaus und orientiere mich an einem Schornstein, dem Kamin der ehemaligen Phoenix-Kupferhütte, mit 380 Metern das höchste Gebäude Rumäniens. Vielleicht kommt man ja bis dorthin? Aus einer Kirche, über deren Eingangstür zwei rumänische Fahnen hängen, strömen die Gottesdienstbesucher. Helfer halten bunte Plasteschüsseln mit Weißbrot hin, jeder greift sich ein Stück. Der Bulevardul Traian, eigenartig, seine Hauptstraßen nach einem römischen Eindringling zu benennen?
Es gibt kaum noch Reste von Beschilderung oder Werbung von früher. Ein Schriftzug »Magazin Alimentar« hat an einer Fassade überlebt, jetzt ist es ein Supermarkt. Das fanden wir immer komisch, dass Lebensmittel alimente hieß. Heute ist man schlauer und weiß, dass beide Worte von lateinisch alere kommen, »ernähren, füttern«.
Inzwischen bin ich in der Strada Progresului (Straße des Fortschritts), auf ein Stoppschild hat jemand unter das »Stop« geschrieben: lying. Vor der Polizeiwache ein schöner, alter Schaukasten, mit vier verrosteten Schlössern gesichert, ein Plakat der Antikorruptionshotline. An einer Laterne hängt ein Zettel: »Wer in der Nacht vom Montag zum Dienstag letzter Woche mein Fahrrad gestohlen hat, möge es unbeschädigt zurückstellen. Wenn das nicht geschieht, werde ich dich durch meine Gebete zerstören. Ich habe einen sehr starken Glauben!«
Man kann bei einer Stadt nicht vorhersagen, was interessant ist, es ergibt sich von selbst. Nichts, was mich hier in dieser Durchschnittskleinstadt, durch die ich ganz zufällig reise, fasziniert, würde in einem Reiseführer erwähnt werden, es ist ja gar nicht sicher, dass es in einer Woche noch da sein wird. Zu 99 Prozent hängt es von der geistigen Verfassung des Reisenden ab, ob er etwas interessant findet. Am schwersten fällt mir das an Orten von touristischem Renommee. Kein Rumäne würde die Dinge für sehenswert halten, die ich hier auf Schritt und Tritt entdecke. Stattdessen werde ich von allen nach Timişoara geschickt, weil es da fast so schön sei wie in Wien. Ich will aber Dinge sehen wie das auf einer Toilette mit Schnur festgebundene Seifenstück: »Wenn Sie sich die Hände mit Seife waschen wollen, dann klauen Sie nicht mehr die Seife«, stand daneben. Oder der Fitnessclub, bei dem die Klimmzugstange so weit oben angebracht war, dass sie ein Deckenelement rausnehmen mussten, damit man sich nicht den Kopf stieß. Leider habe ich von unserer ersten Wanderung nach Rumänien 1988 keine Fotos, weil ein Hirtenjunge, nachdem ich ihn geknipst hatte, den Film aus der Kamera gezogen hat, um sich das Bild anzusehen. Ich war kurz abgelenkt gewesen, weil ein Pferd mit unserem Klopapier im Maul weggelaufen war. Wir hatten es zum Trocknen auf ein Zelt gelegt.
Ein schlank aufragendes Hochhaus, der Sitz der Maramureşer Repräsentanz der Clujer Sektion der Uniunea Scriitorilor din România (Rumänischer Schriftstellerverband). An der Tür lehnt ein Reisigbesen. Durchs Fenster sehe ich in ein Büro, an der Wand ein Bild des Lyrikers Nichita Stănescu, der schon lange tot ist, ein Idol der 68er-Generation. Der Wachmann kommt gucken, was ich da mache. Überall stehen diese Wachmänner und warten sehnsüchtig darauf, dass jemand einzubrechen versucht. Ich sei ein deutscher Schriftsteller. Er holt mir eine Broschüre. Rein könne ich nicht, der Chef sei heute nicht da. Vor dem Gebäude eine klobige Skulpturengruppe, im Halbkreis, von den Büschen schon fast überwuchert. Bergmänner, Märchenhelden oder Bauern?
»Cafea cu lapte«, bestelle ich im Restaurant auf dem Marktplatz. Ist Kuttelnsuppe aus Eutern oder allgemein aus Innereien? Ich glaube durchaus, dass es gut für den Magen ist, Magen zu essen. In einer Broschüre, die im Regal mit den Flyern lag, lese ich etwas über Gheza Vida, den Bildhauer der Skulpturengruppe, die ich gerade gesehen habe und bei der es sich in Wirklichkeit um eine Gruppe Dorfältester bei der Beratung handeln soll. Solche Zufälle sind beglückend. Zum ersten Mal sei die Maramureş urkundlich erwähnt worden, weil der ungarische König Emeric 1199 bei der Jagd vom Pferd gefallen ist und daraufhin seinem Retter eine Urkunde ausgestellt hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg wäre die Maramureş von den Russen fast der Ukraine zugeschlagen worden. Ein junger Mann am anderen Tisch hat sich das Emaille-Grabstein-Porträt seiner Großeltern in die Wade tätowieren lassen. Ich habe einmal solch ein Grabporträt eines verstorbenen Paares gesehen, auf dem der Mann gerade eine Flasche Schnaps ansetzte.
Hinter dem Markt wird es dörflicher. Ich laufe immer noch auf den Schornstein zu. Ein Freund aus Ludwigsfelde hat sich als Kind immer vorgestellt, wie es wäre, einmal in Berlin zu sein und die Stelle zu sehen, an der der Fernsehturm aus der Erde kommt. Das Büro des »Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien«. Durchs Fenster sieht man einen Stapel der »Schwabenpost« und eine deutsche Fahne an der Wand. Es ist, wie mit einem Fernrohr nach Deutschland zu gucken, so sieht es da aus, ich erinnere mich mit Schrecken. Der Chef sei nicht da, sagt ein Nachbar: »Domani.« Da ich Ausländer bin, will er in irgendeiner Fremdsprache mit mir sprechen und versucht es mit Italienisch.
Ein Feuerwehrgebäude, »Inspektorat für eilige Situationen«, mit einem interessanten, burgartigen Turm. Über der Garage Fahnen Rumäniens, der EU und der NATO. Mit Blumen ist ins Beet die Abkürzung der Institution gepflanzt: ISU. Ich würde gerne auf den Wachturm steigen und frage den Wachmann, der kurz verschwindet. Im Wachhäuschen läuft der Fernseher weiter. Nein, der Chef sei nicht da, sagt er, als er wiederkommt. Wo sind denn nur die Chefs heute? Ist vielleicht der Welttag des Chefs, und sie machen alle zusammen eine Dampferfahrt?
Streunende Hunde kommen mir entgegen, oder sie bellen unter Metalltoren durch, als ich in eine staubige Straße einbiege, links und rechts Industrieanlagen, Kühltürme, und dann ein ausrangierter deutscher Kleinbus, »Theos Hähnchenbraterei«. Ein Regenguss, oben auf dem Balkon eines Wohnblocks freuen sich Kinder über das Gewitter, die Mutter holt sie nach drinnen. Anscheinend leben hier vorwiegend Roma, beim Block dahinter sind die Fensterhöhlen schwarz von einem Brand. Man hat ihre Hüttensiedlung aufgelöst und ihnen Wohnungen in Nachbarschaft der Fabrik zugewiesen. Ein Junge steigt aus einem Fenster und klettert an der Markise eines Magazin Mixt herunter. Kinder rennen durch den Regen über die Straße, barfuß und aufgeregt, glückliche Gesichter, das Gewitter ist eine Attraktion. Einer trinkt das Wasser, das vom Vordach des Magazin Mixt tropft, wo ich mich unterstelle. Ein Junge, vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, bewegt sich schon entschlossen wie ein Mann, zwei Brote hat er gekauft, die trägt er unter den Armen und überquert die Straße. So gehen deutsche Kinder nicht. Ein älterer Herr neben mir, unbeweglich bei Bier und Zigaretten, ein kleiner Haufen Sonnenblumenkernschalen liegt vor ihm. Ob er mich überhaupt bemerkt? Ich bilde mir nicht im Geringsten ein, nachvollziehen zu können, was die jahrhundertelange Verachtung, mit der den Roma hier begegnet wurde, mit den Seelen dieser Menschen gemacht hat. Bis ins 19. Jahrhundert lebten sie in Rumänien als Sklaven. Auf Fotos aus den 20ern sehen sie manchmal noch aus wie stolze Apachen.
Weiter komme ich nicht an den Schornstein heran, hinter dem hohen Zaun bellen Hunde. Ein Wachmann nähert sich, er könne mich nicht reinlassen, ich könne ja mal vorne beim Eingang fragen. Dort sitzt ein Dutzend uniformierter Wachmänner in einem Pförtnerhaus. Ich könne nicht rein, der Chef sei nicht da. Auch nicht für Geld, wie ich erfahre, nachdem ich mich getraut habe, etwas im Sinne von »Es soll ihr Schade nicht sein« zu sagen. An der Wand eine alte Wandzeitung, Ikonen und ein Dienstplan. Ob ich die Wandzeitung knipsen dürfe? Ich interessierte mich für alte Sachen. Und den trichterförmigen Stehaschenbecher draußen? Ein Wachmann kommt mir hinterher. Er habe auch viel alte Sachen in einem Schuppen. Ich könne ja von hinten über die Mauer steigen, da seien keine Kameras. Ich gehe um das Gelände herum, springe über den Straßengraben und bin bei der Mauer. Tatsächlich kommt er von innen mit einer Holzleiter, ich klettere an der Betonmauer hoch und über den verrosteten Stacheldraht. Die Stufen der Leiter sind wacklig, warnt er mich. Mehrere Hunde folgen uns durch die Schlammwüste mit grünlichen Brackwasserpfützen, es sieht aus wie in einem Tarkowski-Film. Ich solle ihn nicht knipsen. Wir nähern uns dem Schornstein, über Schrott und Aufschüttungen, einmal springen wir über einen Wassergraben und versinken im Morast. Das wird hier alles schwer kontaminiert sein, meine Füße werden dann wohl vor mir sterben.
Ende der Leseprobe