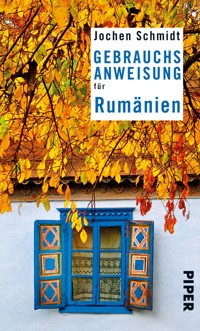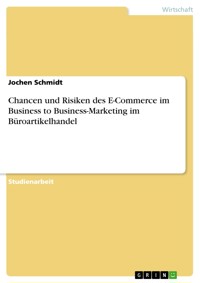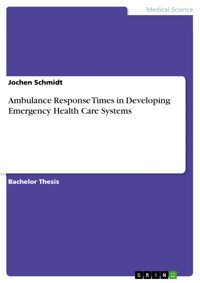7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Voland & Quist
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jochen Schmidts Interessen sind vielfältig, und er beobachtet genau. So entstehen Texte, die ebenso klug wie humorvoll sind: Kurzgeschichten für die Lesebühne Chaussee der Enthusiasten, Kolumnen, z.B. für die FAZ und die Süddeutsche, oder auch Comics (zusammen mit Mawil). Die besten Texte der letzten Jahre werden nun im vorliegenden neuen Buch "Weltall. Erde. Mensch." versammelt. Und zum ersten Mal wird die beim Bachmann-Wettbewerb vorgetragene Erzählung "Abschied aus einer Umlaufbahn" veröffentlicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
WELTALLERDEMENSCH
Jochen Schmidt
Verlag Voland & Quist, Dresden und Leipzig, 2010
© by Verlag Voland & Quistᅠ– Greinus und Wolter GbR
Umschlaggestaltung: Tim Jockel, Berlin
Gestaltung und PDF-Umsetzung: Tropen Studios, Leipzig
E-Pub-Erstellung: nimatypografik
ISBN 978-3-938424-75-9
www.voland-quist.de
Inhalt
Alternativen zum Schreiben
Abschied aus einer Umlaufbahn
Berlin, Ecke Schönhauser, Mittwoch um 11
Ich weiß nicht mal mehr, wie das Spiel ausgegangen ist
Meine Todesängste
Andere Kinder wären froh
Zweitälteste Frau der Welt
Geschäftsleben
Badewanne
Märkische Oderzeitung vom 10. September 2008
Mein Gehen
Danke, BRD !
Tocotronic haben jetzt einen vierten Mann, und die Wahl ist mal wieder nicht auf mich gefallen, obwohl ich alle ihre Lieder auswendig kann und sogar noch die von Udo Lindenberg
Die Aufkündigung der Gastfreundschaft ist eine extreme, aber manchmal unvermeidliche Maßnahme
Zu jung zum Sterben
Wie ich mal zehn überflüssige Informationen benötigte
Industriegeschichten
Zehn Minuten Zeit
Ideale Wohnungen
Der Lehrkörper und sein Gehäuse
Der große Schweiger
Die ideale Gutenachtgeschichte
Meine Unpünktlichkeit
Der Ironie-Man auf Hawaii
Wie ich mal wie Judith Hermann schreiben wollte
Fußball gucken mit Freunden
Wo ist Papa?
Trittschall
Erwartung – Angstaufwallung, die durch das Warten auf das geliebte Wesen ausgelöst wird, nach Massgabe kleiner Verspätungen ( Verabredungen, Telefonanrufe, Briefe, Heimkehrverzögerungen)
Die Stellen zwischen den Stellen
Ein Leben ohne Phlox ist ein Irrtum
Die ideale Kneipe
Liste der Erstveröffentlichungen
Alternativen zum Schreiben
Ich könnte ein Fitnessstudio leiten
Oder Rentner beim Sterben begleiten
Ich könnte Lebensmittel produzieren
Oder mit so einem Tuch rumwedeln vor Stieren
Ich könnte eine Girlgroup promoten
Oder Särge bauen für die Toten
Ich könnte jeden Abend beim Bowlen
mich von meiner Frau erholen
Ich könnte Sushi kochen lernen
Oder Graffiti von der U-Bahn entfernen
Ich könnte meine Dielen abschleifen
Oder theoretische Physik begreifen
Ich könnte die Regierung stürzen
Oder mein Essen selber würzen
Ich könnte nach Ägypten trampen
Oder vor einer atomaren Wiederaufbereitungsanlage campen
Ich könnte mich von meiner Freundin trennen
Oder ich lerne sie erst mal kennen
Wir könnten mal wieder ein Kind erzeugen
Eins, das nicht aussieht wie Günther Verheugen
Ich könnte mir einen Anzug kaufen
Und auf dem Weg dorthin rückwärts laufen
Ich könnte Haschisch inhalieren
Oder meine Stullen beidseitig schmieren
Ich könnte Schlittschuhlaufen üben
Das ist gut bei depressiven Schüben
Ich könnte mal mit einem Menschen reden
Die haben ja immer so komische Schäden
Ich könnte Strohhalme aufeinanderstecken
Und vom Balkon aus Passanten necken
Ich könnte mir Wachs auf die Brustwarzen träufeln
Und meinen Kummer im Alkohol ersäufeln
Ich könnte mal ins Grüne fahren
Und mich mit einer Grünen paaren
Ich könnte Fliegen zu Tode quälen
Oder meine Treppenstufen zählen
Ich könnte mich für Tennis interessieren
Oder für irgendwas mit Tieren
Ich könnte eigentlich so viel machen
Aber ich muss ja immer was schreiben zum Lachen
Abschied aus einer Umlaufbahn
Es gibt viele Gründe, die Erde zu verlassen, aber wenig Mittel. Das Schöne an der Schwerelosigkeit ist, dass man in ihr so wenig Menschen begegnet. Ich hatte schon immer vermutet, meine Gedanken erst im Weltraum ordnen zu können, seit jener Zeit im Leben, als ich zum ersten Mal das Bedürfnis hatte, mich flach ins Gras zu legen und den Blick in den leeren Himmel zu tauchen, um frei von jeder Ablenkung die wesentlichen Gedanken zu fassen, die ich in mir vermutete. Manchmal stelle ich mir vor, ich wäre in eine Zeit ohne bemannte Raumfahrt geboren worden, ich hätte ein falsches Leben geführt. Natürlich kann ich nicht wissen, ob ich nicht auch jetzt ein falsches Leben führe, weil meiner Zeit für das, was ich eigentlich bin, die Vorstellung fehlt. Wie jemand, der nie erfahren wird, dass er der Erfinder der Hängematte sein könnte, weil er in einer Gegend lebt, in der die Bäume nicht nah genug beieinanderstehen. Vielleicht irre ich durch mein Leben, wie ein Männchen durch ein Computerspiel, für das es nicht programmiert wurde und in dem es nicht einmal sterben kann? Wenn ich uns am Abend in den Verkehrsmitteln sah, wo wir nicht das Recht genossen, uns aneinanderzulehnen, kam es mir manchmal vor, als seien wir Entführungsopfer, die vergessen hatten, woher sie stammten. Ich begrüße es natürlich, wenn die Menschen zu erschöpft sind, mich zu beachten, mit allem anderen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Nicht umsonst erschrickt man, wenn man in der Einöde einem Menschen begegnet, auf ein Tier kann man sich eher einstellen. Man weiß ja nicht, ob dieser Mensch das eigene Niveau hat. Es ist erstaunlich, auf wie verschiedenen menschheitsgeschichtlichen Entwicklungsstufen wir nebeneinander existieren, und es ist eigentlich nicht ganz korrekt, aber natürlich von der Programmatik her verständlich, wenn wir uns alle als »Mensch« bezeichnen.
Wir wissen, dass es wegen der auf Langzeitflügen verzögerten Kommunikation zu depressiven Störungen kommt. Durch die Entfernung von Sender und Empfänger vergehen zwischen Aussage und Antwort mehrere Stunden, was die Neigung zum Monologisieren stärkt. Man ist deshalb angehalten, Aufzeichnungen zu machen, weil man beim Schreiben mit der Welt in Kontakt tritt, die einem über die Schulter sieht, auch wenn man nicht mit einer Veröffentlichung rechnet. Es gibt ja in Wahrheit keinen geschriebenen Satz, der sich nicht an die ganze Menschheit richten würde. Der Inhalt meiner Aufzeichnungen spielt allerdings keine Rolle, es geht mir lediglich darum, Veränderungen in meiner Handschrift festzustellen, wie sie bei Persönlichkeitsstörungen aufgrund von Extremerfahrungen vorkommen. Da ich mich nun schon so lange in der Isolation befinde, fehlt mir der Vergleich. Lediglich ein paar Dutzend Mäuse leisten mir Gesellschaft, aber dass ich mit denen gut auskomme, kann alles heißen. Es ist bedauerlich, dass ich so niedergeschlagen bin und wie viel Kraft ich darauf verwenden muss, die Einsamkeit zu ertragen und mich aufzuraffen, meine Experimente nicht zu vernachlässigen. Auf der Erde habe ich meine Stimmungsschwankungen mit Disziplin bekämpft, was mich ja letztlich zum Kosmonauten qualifiziert hat. Wenn man immer in allem der Beste ist, findet man sich zwangsläufig irgendwann in einem Raumschiff wieder. Große Leistungen haben mir deshalb immer Angst gemacht, weil ich an die Entbehrungen denken musste, denen sie sich verdankten. Dass ich so viel erreicht habe, bedeutet eben nicht, dass ich ein willensstarker Mensch wäre. Wenn bei mir zu Hause etwas zu Bruch ging, hat mich das immer so entmutigt, dass ich die Scherben nicht weggeräumt, sondern wochenlang einen Ausfallschritt gemacht habe. Es stand auch ein Foto im Regal, das jeden Tag von einem Luftstoß heruntergeweht wurde, wenn ich die Balkontür öffnete. Das hat mich immer enttäuscht, und ich musste mich mehr als einmal an die Wand lehnen, um nicht unter demselben Luftstoß zusammenzubrechen. Ich habe versucht, den Empfehlungen von auf emotionale Fragen spezialisierten Ratgebern zu folgen, an einem Grashalm zu riechen, ein Sternbild zu suchen oder das Gesicht unter eine Wasseroberfläche zu tauchen. Diese Übungen hatten aber nie den gewünschten Effekt, sondern gaben mir ein Gefühl von Hilflosigkeit. Meine Einsamkeit war ja kein Defekt, sondern eine Konsequenz der für meine wissenschaftlichen Aufgaben erforderlichen Konzentration. Es ist kein Zufall, dass sich für einen männlichen Kosmonauten üblicherweise nur Kontakte mit Kosmonautinnen ergeben, es scheint auf die Dauer praktikabler, wenn der Partner die eigenen beruflichen Sorgen und Nöte nachvollziehen kann. Ich will niemandem erklären müssen, warum ich das Weltall liebe. Die Frage ist, ob man Kosmonaut wird, weil einem menschliches Glück nicht genügt, oder ob einem umgekehrt menschliches Glück nicht genügt, weil man Kosmonaut ist. Tatsache ist, dass überdurchschnittlich viele meiner Kollegen als Alkoholiker geendet sind, sich das Leben genommen haben oder beim Versuch, sich unsterblich zu machen, auf mysteriöse Weise verunglückt sind. Wir eignen uns nicht als Vorbild. Man muss nur meine Labormäuse sehen, deren Verhalten in der Schwerelosigkeit ich beobachten soll. Meine Einsamkeit scheint sie anzuregen, sich noch hartnäckiger als auf der Erde fortzupflanzen. Die Bodenstation wäre begeistert und würde es auf die Mutationen zurückführen, die ich an ihnen vornehme, beziehungsweise auf die Zentrifuge, mit der für die Weibchen Gravitation simuliert wird, was die Befruchtung wahrscheinlicher machen soll. Dabei liegt es an mir. Ich hatte schon immer diese Ausstrahlung auf andere. Oft waren sich zwei Kollegen auf einer dieser dem Flirt unter kontaktarmen Wissenschaftlern geweihten Kongress-Partys unschlüssig, und erst mein Erscheinen löste bei ihnen die Spannungen und sie verliebten sich, während ich, um dem Gespräch mit einer Festkörperphysikerin länger standhalten zu können, damit beschäftigt war, Anagramme aus ihrem Namen zu bilden, der auf einem kleinen auf ihrer Brust befestigten Schildchen zu lesen war. Das Glück anderer Menschen ist schwer zu ertragen, auch wenn man weiß, dass es auf ihrer Beschränktheit beruht und mit dem Glück, das man selbst sucht, nichts zu tun hat. Der Idealzustand zweier bis in alle Ewigkeiten im selben Gravitationsfeld um einen Planeten kreisenden Monde, mehr Nähe zwischen zwei Menschen dürfte kaum zu erreichen sein. Eine Änderung meiner Wohnsituation hätte vielleicht eine Lösung sein können. Ich hatte, wenn jemand bei mir klingelte, ja immer das Bedürfnis, noch schnell etwas zu erledigen, einem Gedanken nachzugehen, ein Buch zu Ende zu lesen oder mein Archiv neu zu ordnen. Das wäre mir möglich gewesen, wenn ich in einem Turm gewohnt hätte, wo zwischen dem Klingeln an der Haus- und dem Klopfen an der Wohnungstür eine möglichst lange Zeit vergangen wäre, vielleicht sogar Jahre. Dann hätte man sich in Ruhe seiner Arbeit widmen können, man wäre ja nicht einsam, der Besuch war schon unterwegs. Und gerade noch rechtzeitig, bevor man stirbt, klopft der Freund an die Tür, den man die ganze Zeit im sicheren Gefühl seines Kommens erwartet hat. Man hat sein Leben in Gesellschaft verbracht und war doch ungestört.
Wir wissen, dass die psychische Belastung von Kosmonauten auf Langzeitflügen zunimmt, sobald sie die Erde nicht mehr sehen können. Es ist ein eigenartiges Phänomen, da die Evolution uns nicht auf das Bild des in der Ferne verschwindenden Heimatplaneten vorbereitet haben kann. Um mich dieser Stresssituation auszusetzen, hat man mich angewiesen, die der Erde zugewandten Bullaugen der Station zu verhängen, ich kann nur durch die Bullaugen gegenüber in die ewige Nacht sehen. Genau genommen wirkt es, als würden mich zwei schwarze Augen unentwegt anstarren. Eine der Überraschungen, mit denen man rechnen muss, wenn man für die Raumfahrtbehörde arbeitet, war, dass ich zwar auf der Erde ein halbes Jahr in einer originalgetreuen Kopie der Station zugebracht habe, um mich an ihre Dimensionen zu gewöhnen und irgendwann fähig zu sein, mich blind in ihr zu orientieren, aber bei meiner Ankunft im Orbit eine völlig andere Situation vorgefunden habe. Ich frage mich, wie man eine Operation dieses Ausmaßes vor mir geheimhalten konnte, aber ich habe mich tatsächlich in einer weitgehend originalgetreuen, wenn auch etwas kleiner dimensionierten Kopie meines eigenen Kinderzimmers wiedergefunden. Zwischen diesen Wänden bin ich damals vor Energie platzend ganze Nachmittage lang grundlos hin- und hergerannt. Diesen Grad von Einverständnis mit meiner Existenz habe ich nie wieder erreicht. In der Schreibtischschublade befindet sich mein Taschenmesser, und sogar das Modell des Apollo-Sojus-Projekts haben sie nicht vergessen, mit dem Docking-Modul, das nur einmal benutzt worden ist, als die Raumschiffe beider verfeindeter Nationen in Erinnerung an die Begegnung ihrer Truppen am Ende des Zweiten Weltkriegs genau über Torgau zusammenkamen. Wir konstruieren Module, mit denen Maschinen aus verschiedenen Gesellschaftssystemen kombiniert werden können, aber zwei Menschen kann niemand dauerhaft verbinden.
Ich bin in der Ausbildung auf jeden erdenklichen Zwischenfall vorbereitet worden, aber man hat mir nicht gesagt, wie ich den Monitor ausschalten kann, über den ich die Bilder von der Bodenstation empfange. Nicht, dass sie mich beobachten, stört mich, sondern die Durchschaubarkeit ihrer Versuche, mich emotional zu beeinflussen. Gestern waren zum ersten Mal meine Eltern zu sehen, die offenbar benachrichtigt worden sind, weil man sich Sorgen um meinen Zustand macht. Es war nicht leicht für mich, der Versuchung zu widerstehen, ihnen zu antworten, was keinem von uns helfen würde. Was steckt hinter dieser Hartnäckigkeit, mit der uns die Überlebenden am Sterben hindern wollen? Ist es eine so beängstigende Vorstellung, ohne uns weiterleben zu müssen? Wie kann man mir wünschen, auch nur einen Tag länger zu ertragen, was sich vor dem Start in mir abgespielt hat? Körperlich habe ich aufgrund des harten Kosmonautentrainings und meiner disziplinierten Lebensweise eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Doryphoros des Polyklet erreicht, nur dass ich mir nicht das Schamhaar frisiere. Ich kann meine Beine beim Klimmzug anwinkeln und minutenlang in der Waagerechten halten. Wenn es mich kennen würde, könnte mein Kind darauf Platz nehmen, um sich noch im Alter daran zu erinnern. Obwohl ich attraktiv bin, habe ich eine so unschuldige Seele, dass es mich selbst rührt. Mein ehrgeiziges Ziel war immer, mehr Kummer zu empfinden als diejenigen, denen ich Kummer bereitete. Sobald man seine Isolation verlässt, und sich einen Menschen sucht, betritt man eine Welt, in der es weder Gerechtigkeit gibt noch Unschuld, es ist wie in einem Bürgerkrieg, man ist gezwungen, sich zu einer Seite zu bekennen, sonst gilt man allen als Feind. Ich hätte mich für Janda entscheiden können, die mir aus nur ihr bekannten Gründen verfallen war, aber ich konnte den Gedanken nicht ertragen, in ihr das Ende meiner langen, entbehrungsreichen Reise zu sehen. Nach so langem Hoffen hatte die fiktive Figur der Erlöserin, auf die ich wartete, einen geradezu religiösen Charakter angenommen. Außerdem habe ich mich in der Zeit meiner Zweifel, wie mir später klar wurde, innerhalb von Sekunden in Lena verliebt, als mir durch bestimmte Nuancen in ihrer Wortwahl bewusst wurde, dass ihre Seele für mich verschlossen bleiben würde. Ich habe die Tatsache, dass die Menschen verschieden sind, nie ganz begreifen können und auch Lena falsch eingeschätzt. Bis dahin hatte ich sie für den Kummer bedauert, den ich ihr mit meinem Nachgeben auf ihr hartnäckiges Werben bereitet hätte. Plötzlich war ich Opfer einer quälenden Unruhe und musste immer wieder in die Zentrifuge steigen, um zu mir zu kommen. Es war nicht das erste Mal, dass ich nicht in der Lage war, meine Emotionen zu kontrollieren, selbst der Behörde war dieser Mangel in meiner Persönlichkeitsstruktur bekannt.
Es ist müßig, mir diese Gedanken zu machen, man wird nie eine befriedigende Lösung für unser emotionales Dilemma finden. Viele glauben, theoretische Physiker, Mathematiker, Schachspieler oder Latinisten wären emotional verarmte Menschen, weil sie Freude an Abstraktion und symbolischen Operationen empfinden, ich bin vom Gegenteil überzeugt, wir können unseren Gefühlen so wenig trauen, dass wir ein starkes Gegengewicht brauchen. Es ist ein Irrtum, den Dichtern eine besondere romantische Kompetenz zuzuschreiben, ein Irrtum, von dem sie natürlich profitieren. Menschen wie ich flüchten sich zu den Rätseln der Technik, um sich nichts anzutun. Ohne den sachlichen Rausch der Technik hätte ich längst aufgegeben. Will man die technischen Möglichkeiten seiner Epoche nutzen, muss man die Handbücher studieren, es erfordert Beharrlichkeit, sich das Leben zu erleichtern. Eine Brille erklärt sich ja noch von selbst, man setzt sie auf und ist ein Cyborg, halb Mensch, halb Maschine. Aber schon bei einem Taschenmesser ist es unwahrscheinlich, dass sein Besitzer im Lauf seines Lebens in genug Situationen geraten wird, dass alle Funktionen seines Messers wenigstens einmal erforderlich würden. Schon als Kind hat es mich irritiert, dass sich für den gelochten Dorn an meinem Schweizer Offiziersmesser, das mir mein Vater als Belohnung für meinen ersten Segelflug geschenkt hatte, keine Gelegenheit zur Anwendung ergab oder dass man sich ihrer nie bewusst wurde. Manche hielten ihn für eine Ahle zum Reparieren von Schuhwerk oder zum Einfädeln von Schnürsenkeln, aber meine Schuhsohlen waren geklebt und ich hatte Klettverschlüsse. Und im Westen hatte man längst Schnürsenkel entwickelt, die sich problemlos einfädeln ließen, weil ihre Spitzen mit einer wachsartigen Schicht oder einem kleinen Plasteröhrchen vor dem Aufdröseln geschützt waren. Die Evolution der beiden Gesellschaftssysteme hatte dazu geführt, dass sie in solchen Details divergierten, das System mit den präparierten Schnürsenkelspitzen hat sich als überlebensfähiger erwiesen.
Manche Menschen gehen nie an ihre Grenzen, sonst würden sie mich dort stehen sehen. Wenn eine Frau behauptet, mich nicht zu lieben, zweifle ich immer am Grad ihrer Selbsterkenntnis. Auch Lena konnte mir keinen plausiblen Grund dafür nennen, dass sie sich nicht für mich entscheiden wollte, für eine Astro-Physikerin drückte sie sich sogar ziemlich esoterisch aus, in einer von Begriffen aus der Meteorologie geprägten Sprache. Ihre Gedanken seien neblig, sie fühle sich emotional vereist und könne sich nicht öffnen, weil sie ihre letzte unglückliche Liebe, die wie ein Hurrikan über sie hinweggefegt sei, nie aufgearbeitet habe. Mein erster Impuls war, ihr die Hand auf die Stirn zu legen, um sie von ihrer Unfähigkeit zu erlösen, Gefühle für mich zu empfinden. Es war mir nie möglich, aus ihrem Anblick auf ihre Innenwelt zu schließen, ebenso gut hätte man versuchen können, in den Gesichtern der Urmenschen schon die Raumstation zu erkennen, die ihre Nachkommen einmal bauen würden. Lena hatte mich jahrelang aus der Ferne beobachtet und meine Publikationen über die psychischen Risiken von Langzeitflügen studiert, ohne zu wagen, mit mir in Kontakt zu treten, vielleicht auch, weil sie es genoss, mich unerkannt zu bewundern. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie Physikerin geworden ist, um in meine Nähe zu kommen. Aber sobald sie ihr Ziel erreicht und sich meine Nerven unumkehrbar auf sie eingestellt hatten, begann sie an ihren Instinkten zu zweifeln. Ich glaube, ich habe das schon im ersten Moment geahnt und eine fatale Sehnsucht hat mich in ihre Arme getrieben wie in eine unbekannte Galaxie. Man muss sich Ziele setzen, die man nicht erreichen kann, sonst bleibt man im Mittelmaß stecken, so bin ich leider erzogen worden.
Da die Bodenstation Erkenntnisse über Langzeitflüge gewinnen wollte, war ich informiert worden, dass man meine Körperfunktionen lückenlos beobachten würde. Warum erwarten sie, dass ich mit ihnen kommuniziere, wenn sie schon alle Daten haben? Der Dreck an unseren Schuhen enthält mehr Information als unser Reisetagebuch. Selbstverständlich würden Außerirdische sich bei einer Begegnung kaum für unsere Erfahrungen und Philosopheme interessieren, sondern eher für den Salzgehalt unserer Nieren, weil er dem des Urmeers entspricht, aus dem wir stammen. Anfangs war es mir unangenehm, meine sexuellen Regungen beobachtet zu wissen, die sich nicht unterdrücken ließen. Aber schließlich hat die Professionalität gesiegt, ich bin hier nicht als Individuum, sondern als Datensonde. Tatsächlich leide ich unter unkontrollierbaren Schüben von Begehren, die mich von meinen Aufgaben ablenken und meine Aufmerksamkeit immer wieder in Tagträume abgleiten lassen. Es ist immerhin tröstlich, dass sich damit in meinem Beruf ein wissenschaftliches Interesse verbindet, denn im privaten Bereich haben mir diese Zustände nie etwas genützt. Ich muss sagen, ich bin inzwischen nicht mehr sicher, ob ich wirklich dazu beitragen möchte, unser unstillbares Verlangen nach Dingen, die weit unter unserem geistigen Niveau sind, in die Weiten des Weltraums zu tragen. Was mir geholfen hat, war die Empfehlung eines Bekannten, der als Manager oft auf Reisen ist. Er hat mir verraten, dass viele seiner nomadisierenden Kollegen sich vor der Abfahrt ein Bein rasieren, das mindert die Einsamkeit langer Nächte in Hotels. Zum Glück sind unsere Empfindungen so leicht zu betrügen.