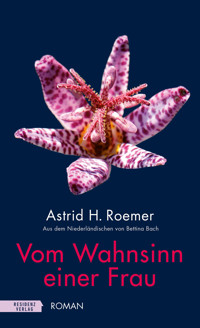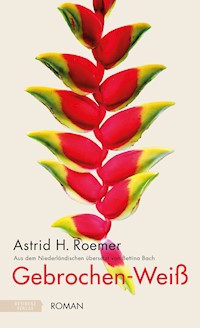
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem gewaltigen Buch voller Sinnlichkeit, Schmerz und Lebensfreude entfaltet "Gebrochen Weiß" ein Panorama weiblicher Biografien. In Surinam, der ehemaligen niederländischen Kolonie in Südamerika, mischen sich Sprachen und Religionen, Hautfarben und Ethnien. In Paramaribo leben die Frauen der Familie Vanta, drei Generationen, von der sterbenskranken Oma Bee bis zu Enkelin Imker, die sie liebevoll betreut, von Mutter Louise, die vier Kinder alleine großzieht, bis zu ihrer Tochter Heli, die wegen einer verbotenen Affäre in die Niederlande geschickt wird. Sie alle sind auf der Suche nach Zugehörigkeit, sie alle träumen von einem besseren Leben. "Gebrochen-Weiß" ist ein vielstimmiger Chor weiblicher Erzählungen, es wird geflüstert und geschrien, geweint und gejubelt. Astrid H. Roemers Sprache geht unter die Haut, eindringlich erzählt sie von Liebe und Tod, Familie und Trennung, Heimat und Verlust.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Astrid H. Roemer
Gebrochen-Weiß
Aus dem Niederländischen von Bettina Bach
Roman
Mit einem Nachwort der Übersetzerin
Residenz Verlag
Ich habe autobiografisches Material verwendet, um einen Roman, also Fiktion zu schreiben, und ich bitte meine Leser, die reale Privatsphäre möglicherweise »wiedererkennbarer Anderer« zu respektieren.
(Astrid Roemer)
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel
»Gebroken Wit« bei Uitgeverij Prometheus, Amsterdam.
© Astrid Roemer
© 2023 Residenz Verlag GmbH
Salzburg – Wien
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.com
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
Umschlaggestaltung: Sebastian Menschhorn
Typografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien
Lektorat: Jessica Beer
ISBN ePub:
978 3 7017 4698 9
ISBN Printausgabe:
978 3 7017 1767 5
Für Mutter H. L. C.
Inhalt
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Glossar
Nachwort der Übersetzerin
Eins
Großmutter wusste sofort, dass etwas Schreckliches geschah. Hellrotes Blut mit kleinen dunklen Klümpchen. Sie spürte, wie ihr Tränen in die Augen traten, als sie sich den Mund wieder und wieder mit Leitungswasser ausspülte, es in die glänzende Spüle spuckte, bis keine Spur mehr zu sehen war von dem Blut. Sie war doch schon so abgemagert. Niemand hatte etwas dazu gesagt auf dem Flughafen Zanderij. Nicht mal nach dem Abflug ihrer Enkelin. Niemand beachtete sie mehr. Kein Mensch sprach sie noch an auf der Straße. Sie, murmelnd zu der Heiligenfigur, vor der sie so lange kauerte, bis ihre Knie zu sehr schmerzten. Dann stand sie auf, steckte Münzen in den Opferstock, suchte eine Kerze aus, zündete sie an, stellte sie hin, sah in die Flamme und betete hörbar: Lass mein Blut anfangen zu fließen an diesem Ort und nicht mehr aufhören, bis ich gefunden werde. Die Christusstatue blickte auf sie herab. Blut auf der Brust. Blutstropfen an den Füßen. Blutige Wunden an den Händen. Um nicht wieder untröstlich weinen zu müssen, rückte sie weiter zur Statue des Heiligen Antonius von Padua, durch dessen Fürsprache alles Verlorengegangene wiedergefunden wurde. Bei ihm eine brennende Kerze für Heli, dazu ein Stoßgebet, und sie setzte sich auf eine Bank in seiner Nähe. Sie hörte die Schritte von Anderen, die, genau wie sie, ihre Not und ihren Dank bei einer der Heiligenfiguren abluden. Mit geschlossenen Augen saß sie. Falls ihr Leben an diesem Ort aufhörte, würde alles gut werden. Aber wenn der Tod sie zu Hause ereilte, fiele ihr lebloser Körper in die Hände von Wildfremden, die ihn aus der vertrauten Umgebung wegholen würden und an einen Ort bringen, wo keiner zu ihr dürfte. Und wenn sie dort wieder zu sich käme, weil ihr Körper doch noch nicht aufgab, wäre sie die Einzige, die sich schreien hörte. Und sobald sie diese Möglichkeit schmeckte wie Blut hinten in der Kehle, flossen ihre Tränen: fünf Kinder hatte sie zur Welt gebracht, alles gut geratene Erwachsene, die ihr sogar Enkel geschenkt hatten, warum, in Gottes Namen, saß sie also allein in der Kirche und war so gebrochen?
Dicht neben ihren Beinen stand eine Tasche, darin Brot, Schnittkäse, Butter und Tütchen mit getrockneten Zutaten für Hühnersuppe; Frisches war zu schwer geworden, um es bis zu ihrer Küche zu tragen. Ihr tägliches Leben hatte von jeher mit Essen zu tun gehabt: Lebensmittel beschaffen und ihre Lieben zu Hause versorgen. Es gab eine Zeit, da gingen Hausiererinnen herum mit ihrer Ware, und manche kamen regelmäßig an ihre Tür, um bei einem Glas Wasser einen Moment zu verschnaufen von den staubigen Straßen. Es waren Frauen aus Familien von Gärtnern und kleinen Viehzüchtern, sie wohnten außerhalb der Stadt. Über den Preis für einen kubi-Fisch, für ein schweres Huhn, eine Packung Eier wurde verhandelt, aber niemals über Obst, Gemüse, Milch. Große Freude hatte das Backen, Braten, Kochen ihr gemacht, denn alles, was aus ihrer Küche auf den Tisch kam, war jedes Mal wieder ein Fest für ihre Familie. Und dann waren Soldaten durch die Stadt gezogen, kreidebleich vor Erschöpfung oder knallrot von der Gluthitze, die sie nicht vertrugen. Irgendwo stand die Welt in Flammen. Vielleicht war Paramaribo ein Zufluchtsort. Nichts verstand sie vom Krieg, dabei hatte sie mit siebzehn einen Mann im Dienst des Militärs geheiratet. Bei ihr kam der Krieg in Form von Kastenbrot, Schokolade, Tabak ins Haus. Ihr Anton brachte keinen Schnaps von der Garnison mit, aber sie roch seine Fahne, wenn er redete. Sie weiß nicht mehr, wie es angefangen hat mit dem Entzweischneiden von Zigarren, und dann: abends, in der Abgeschiedenheit des Schlafzimmers, den Stumpen mit einem Streichholzflämmchen zum Brennen bringen, zwischen den Lippen daran ziehen, damit die Glut nicht erlischt, einatmenausatmen und zur Ruhe kommen. Der Nachttopf aus weißer Emaille war ihr Aschenbecher; ihr Spucknapf, als sie anfing, Tabak zu kauen, und nachts diente er ihnen oft als Pott: Der Vater ihrer Kinder ließ kurz vor Tagesanbruch noch geräuschvoll Wasser in den hohen Topf. Das war der Moment, in dem sie erwachte aus einem tiefen Schlaf und sofort aufstand, um den Nachttopf in die Kloschüssel auszuleeren, in einem abgetrennten Raum neben dem Badezimmer. So begann ihr Tag im Beinah-Morgenlicht der Tropen. Meistens blieb sie nach dem Ausleeren im gefliesten Gang zur Küche stehen, im Morgenmantel wartend, bis die Hähne im Stall krähten und ihre Tauben hingebungsvoll gurrten, und da: Auf dem Muschelsand unter den Kirschbäumen lagen einzelne dunkelrote Früchte. Kurz war sie in so einem Tag, Jahre-Jahre von da, wo sie jetzt vor sich hinträumte, und ein Anflug von Glück legte ihr ein Lächeln aufs Antlitz. Der Pfarrer, der sie ansprach und sagte, ihr Seelenfriede rühre ihn an, konnte nichts ahnen von den Schmerzen, die ununterbrochen an ihr nagten. Der Pfarrer wusste, dass sie dort sitzenblieb, ganze Zeitstunden lang. Er war stehen geblieben, nur kurz, um ihr einen »gesegneten Tag« zu wünschen. Sie hatte genickt, kurz zu ihm aufgesehen, um sich zu vergewissern, dass er es war: der neue Pater Overtoon, über den sich die Messdiener die ganze Zeit lustig machten, sogar bei der Familienmesse am Sonntag, zur schallenden Heiterkeit der Kinder. Er war weitergegangen, um auch anderen Betenden etwas zuzuflüstern, aber das Klappern seiner Holzpantinen auf dem Kirchenboden hallte nach in ihren Gedanken. Sie griff nach dem Rosenkranz um ihren Hals, wollte schon eine Perle fürs erste Gebet zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen. Erst kam ihr noch ein tiefer Seufzer über die Lippen, bevor diese wie von selbst murmelten: Gegrüßet Seist Du Maria Voll Der Gnade Der Herr Ist Mit Dir … Das Murmeln würde erst wieder aufhören, wenn die Sirene um zwölf Uhr die Stille zerschnitt. Dann würde sie aufstehen, die Einkaufstasche nehmen, sich aus der Bank schieben und mit dem Gesicht zum Altar tief verneigen, zur Außentür gehen. Dort würde der braune Küster sie erwarten und ihr die Tür aufhalten, um sie hinauszulassen, denn die Kirche bliebe geschlossen für den Rest des Dienstags.
Auf dem Nachhauseweg mied sie die Straßen, die Viertel, wo Bekannte von ihr wohnten. Sprechen konnte schmerzhaft sein und sie zum Bluten bringen. Außerdem war es so heiß, so mitten am Tag, so mitten in der Stadt, dass sie meinte, Dampf vom Asphalt aufsteigen zu sehen. Sie schritt rasch aus, die Tasche fest in der linken Faust, damit sie den rechten Arm wie ein Ruder benutzen konnte. Sie musste quer durch die ganze Stadt und danach noch vorbei an einem feinen Vorort, bevor sie ihren Bungalow sah, margarinegelb, neben anderen ähnlichen Häusern. In ihrer Tasche steckten ein gefalteter breitkrempiger Strohhut und ein in seiner Hülle zusammengeknülltes Regencape aus Kunststoff. Ledersandalen einer bekannten Sportmarke trug sie, ihr zugesteckt von Enkelin Heli, die ins Ausland gegangen war; in diesem Schuhwerk spürten ihre Fußsohlen die Kiesel und andere Unebenheiten auf dem Gehweg nicht. Sie war an geschlossene Schuhe gewöhnt, aber die brannten bei der Hitze und wurden feucht vom Schweiß. Weshalb sie nie einen der kleinen Wilden-Busse nahm, wusste sie selbst nicht. Sie geht lieber ihren eigenen Weg. Früher hatte sie immer andere Frauen getroffen, die auch vom Einkaufen kamen; dann blieben sie kurz stehen, um zu plaudern und die schweren Taschen abstellen zu können. Damals war die Innenstadt noch nicht so gepflastert und asphaltiert und es gab Kanäle, die für Abkühlung sorgten. Außerdem lag das Haus, wo sie ihre Kinder großgezogen hatte, näher am städtischen Fluss und nicht in einem entlegenen Stadtteil. Unter einem Blechdach, wo Obst und Gemüse verkauft wird, bleibt sie stehen. Eine junge Frau mit glattem langem Haar watschelt hochschwanger zu ihr. Sie zeigt auf das, was sie mitnehmen möchte: Mangos mit roter Schale voll schwarzer Pünktchen, Bananen, auch wilden Spinat und zehn Limetten. Die Verkäuferin zwingt ihr kein Gespräch auf, packt unbeirrt Obst und Gemüse in eine Tüte, tritt näher, sieht zu, wie alles in der Einkaufstasche verschwindet, und wartet auf ihr Geld. Als sie sich bedankt und bezahlt, fällt ihr etwas ein: Tochter Louise will bei ihr vorbeischauen nach der Arbeit. Inzwischen ist die Tasche schwer. Trotzdem versucht sie, größere Schritte zu machen, um schneller zu sein. Hunger hat sie, aber keinen richtigen Appetit. Das Schlucken ist immer schwieriger geworden, sogar beim Suppe-Essen. Ihre Kräfte hatten in den letzten Monaten immer mehr nachgelassen, ohne dass sie wusste, was da passierte mit ihrem Körper, außerdem hatte sie keine Worte für ihre Beschwerden, mit denen sie zu einem Arzt hätte gehen können, im Militärspital. Einen Moment blitzt das Gesicht ihres Mannes auf. Es ist eher der Gedanke an das Spital, in dem er, nach kurzem Leiden, als pensionierter Unteroffizier gestorben war. Sie hatte ihn dort nicht besucht. Aber als man sie geholt hatte, als er eingeschlafen war, und sie ihn still, lächelnd sogar, tot liegen sah, hatte sie nach Jahren wieder seinen Namen genannt und war wochenlang krank gewesen vor Reue. Sie waren kein Ehepaar mehr, lebten getrennt in verschiedenen Häusern. Anton, kein guter Koch, ganz allein im ehelichen Heim; sie in einem Zimmer, als Haushälterin bei ihrem Sohn Winston. Das Spital taucht auf. Weiß und hoch. Bekannt für die beste medizinische Versorgung in Paramaribo. KNIL-Witwe war sie geworden, bekam eine Rente von der Königlich Niederländisch-Indischen Armee und hatte Anspruch auf ärztliche Behandlung bis an ihr Lebensende. Kurz wirft sie einen Blick auf das Gebäude und wendet sich dann wieder ab, um ja gut voranzukommen. Immer mehr Fahrzeuge zuckeln oder sausen an ihr vorbei, und obwohl ihre Augen voller Tränen stehen, gelingt es ihren Füßen, die letzte, vielbefahrene Asphaltstraße sicher zu überqueren zu dem Viertel, wo sie seit vier Jahren ein eigenes Haus hat, und da: Enkelin Imker kommt ihr entgegen, lächelnd, nimmt ihr die Tasche mit den Einkäufen ab. Sie erschrickt. In der Tasche sind nicht nur Esswaren, sondern auch ihr Ein und Alles: ihre eigene alte Bibel und die Taschenbibel aus Leder mit Reißverschluss, in winzig kleiner Schrift, die sie nicht lesen kann, aber beides muss Tag und Nacht zum Greifen nah sein, seit Heli auf Zanderij schluchzend Abschied genommen hat von ihr. Gemeinsam gingen Imker und sie zur Eingangstür. Und Großmutter kramte ihre Schlüssel hervor und sprach heiser: Wo ist deine Mutter?
Imker antwortete nicht. Jemand hatte Mutter Louise erzählt, da laufe ein Hund herum, der genauso aussehe wie ihr verschwundener Wachhund Leika, und Mutter hatte sich auf die Suche gemacht und sie zu Oma geschickt. Eine Handvoll Informationen für später, beschloss sie, und sie griff nach ihrer Einkaufstasche. Mit ihrer Großmutter ging sie ins Haus, zog wie Großmutter die Sandalen aus, und hinter Oma her ging sie durchs Wohnzimmer in die Küche, barfuß, mit den Taschen voller Einkäufe. Die mandelgrünen Fliesen auf dem Küchenboden sprangen sofort ins Auge, wenn man lange nicht da gewesen war, und wie kühl sie sich anfühlten, hatte sie auch vergessen. Besondere Fliesen, die Sohn Winston für seine Mutter in Flur, Küche, Bad und auf der Küchenterrasse hatte verlegen lassen; in den anderen Wohnräumen ließ er teures Linoleum auf den Holzboden kleben, sogenanntes Marmoleum, das manche an Marmor erinnerte, Oma aber an Muschelsand. Großmutter hatte um grüne Teppiche gebeten; Winston war mit orangefarbenen angekommen, damit Oma ja nie vergaß, dass er und seine Frau Lya fortan zum Hause Oranien-Nassau gehörten: ein Scherz, über den herzhaft gelacht wurde. Sie sah sich noch einmal um, als wäre ihr alles neu, und setzte sich dann neben ihre Großmutter ins Wohnzimmer, auf das immer noch in eine Schutzhülle aus Plastik verpackte Zweiersofa. Beide hatten sich Hände und Gesicht mit Seife gewaschen, gebeugt über die Doppelspüle in der Granitplatte. Und statt Antwort zu geben auf Großmutters Frage nach Mutter Louise, sagte sie entschuldigend: Ich koche für dich, Oma, Mama hat mir frisches Hähnchen mitgegeben, Kartoffeln, Erbsen, Tomaten und sogar Djogo-Bier. Großmutter räusperte sich leicht und sagte bedächtig: Ist gut, Imker, und bring mir ein Glas Bier. Erneutes Räuspern, dann leiser: Koch alles richtig weich, ich kann es sonst nicht essen. Sie war schon aufgesprungen zum Bierholen, blieb sofort wieder stehen: Ihr war nicht entgangen, wie abgemagert Großmutter war, und die Berichte über den ungewöhnlichen Abschied zwischen ihrer Schwester und ihrer Oma, die hatten sie nicht mehr losgelassen. Mit dem Rücken zu Großmutter fragte sie: Hast du Schmerzen irgendwo, Oma Bee, oder hast du Probleme mit den Zähnen, du bist nämlich ganz schön dünn geworden, ehrlich. Sie drehte sich um und musterte die Frau vor ihr, als wäre sie nicht ihre Großmutter, sondern eine Wildfremde … Nein, nein, hatte Oma heiser gerufen, und: Mädchen, bring mir doch das Bier! Sie ging schnell in die Küche und blieb vor der Spüle stehen, blickte kurz zur mattverglasten Hintertür; dann schnell ein Trinkglas nehmen, ausspülen, abtrocknen und Bier einschenken mit einer schönen Schaumkrone. Sie war erst siebzehn, aber fasziniert von allem, was mit Essen und Trinken zu tun hatte. Ein Kompliment von Großmutter, die das Bier betrachtete und gierig anfing zu trinken, in kleinen Schlucken. Sie stand daneben und schaute gebannt zu. Sie konnte sehen, dass etwas Unwiderrufliches geschah mit dieser Frau, die als Quelle ihres Seins galt: Sie hatte Großmutter nicht oft besucht, weil ihre Schule zu weit weg war und die Hausaufgaben ihre ganze Zeit beanspruchten, aber ihre neue Ausbildung war nicht so weit von Oma entfernt. Was grübelst du, fragte Großmutter. Sie schüttelte den Kopf: Schmeckt das Bier, Oma? Und im selben Atemzug: Soll ich dir die Füße massieren, du läufst doch so viel, Mama sagt, du nimmst nie den Bus. Massieren, Füße massieren? Das war ihr durch den Kopf geschossen, weil es ihr schwerer gefallen wäre, ihre Gefühle zu äußern: Ich will dich berühren, Oma Bee. Und zu laut sagte sie: Ich kann dir auch die Zehennägel schneiden! Aber Großmutter trank das Glas leer und sagte leise: Mach die Fenster auf, zieh die Vorhänge ein Stück zur Seite und bring mir noch ein Djogo-Bier. Sie tat, worum sie liebevoll gebeten wurde. Es wurde heller im Wohnzimmer und frischer, und sie eilte zum Kühlschrank in der Küche, durch den Flur, wo die Sandalen ihrer großen Schwester standen; so ohne Großmutters Füße darin gehörten sie wieder ganz Heli. Sie hatte gebettelt um die Sandalen, aber Heli wusste genau, was sie wem geben wollte, und die teuren Gesundheitsschuhe waren für Großmutter, zusammen mit Helis Taschenbibel und zwei neuen Baumwollnachthemden. Großmutter hatte das Radio angemacht und die Nachrichten schallten durchs Haus; gut gelaunt nahm Oma das zweite Glas Bier und lächelte. Und während sie die Hähnchenstücke in einer Schüssel wusch, mit einer halben Zitrone als Bürste, kamen ihr die Tränen, denn nirgends war Trost: Ihr ganzes Leben hatte sie neben ihrer Schwester geschlafen, sich siebzehn Jahre lang ein Zimmer mit ihr geteilt, einen Kleiderschrank, einen Schreibtisch. Sie schreckt manchmal aus dem Schlaf auf, weil sie Heli wimmern hört wie beim letzten Mal, als die durch das Haus ging, weil sie nach Holland sollte, und das Auto am Tor wartete mit Großmutter; und mit Mutter Louise, die ungeduldig rief: Heli, komm schon, Heli! Sie hatte sich versteckt nach der Umarmung ihrer großen Schwester: Ich komme bald zurück, Imker, nicht traurig sein, Imker, nicht um mich weinen, Imker! Und Heli selber in Tränen aufgelöst. Wachhund Leika bellte fürchterlich. Schwester Babs und die Nachbarn hatten verbissen zugesehen, wie das Auto schließlich davongefahren war mit dem Mädchen. Sie hatte nicht einmal das übers Herz gebracht.
Sie tupfte die Hähnchenwürfel mit Küchenpapier ab. Fleisch hatte ihr noch nie besonders gut geschmeckt. Die Familie weiß, dass sie lieber für andere kocht, als selbst zu essen. Ihr Traum: ein kleines Restaurant, wo sie über die Speisekarte bestimmt. Heli hatte versprochen, immer da zu sein für sie, und sie hatte versprochen, den Abschluss als Vorschullehrerin zu machen und danach erst Kochenals-Beruf. Die Backsteinumfriedung, auf deren Krone Scherben eingemauert waren, glänzte in der Sonne. Niemand käme mit heiler Haut und heiler Kleidung über Großmutters Mauer. Außer den gelben Tagetes beim Tor zur Straße wuchs nichts auf Großmutters Grundstück. Eine dicke Schicht Muschelsand lag auf der dunklen Erde, damit nicht alles Mögliche kreuz und quer aus dem Boden spross, und auch wenn Großmutter immer gegärtnert hatte, in kleinem Maßstab und für den Eigenbedarf, war ihr die Lust darauf gründlich vergangen: Die Tagetes da vorne hielten Mücken fern und hielten die Erinnerung wach an Omas Kinderjahre auf der englischen Seite des Landes. Sobald jemand von ihrem kahlen Grundstück anfing, betonte Großmutter rechthaberisch, was in jedem Garten in der Stadt gut wuchs und stehen sollte: ein Mandelbaum für den Schatten, Limone und Zitrone zur Erfrischung, birambis als Essigfrüchte zu pikanten Gerichten, Tagetes gegen Fliegen und Rosensträucher für den Duft und das Glück der Familie! Während sie die Mahlzeit zubereitete, konnte sie es nicht lassen, auch in den Küchenschränken zu stöbern; von allen Dingen, die man unbedingt braucht, fand sie je vier: Trinkgläser, Suppenschüsseln, Tassen und Untertassen, Teller, verschiedenes Besteck und sogar vier leuchtend weiße Leinenservietten neben einem Stapel Geschirrtücher. Sie deckte den Küchentisch für zwei. Als alles auf dem Herd stand und der Tisch einladend aussah, ging sie zu Großmutter: Nach zwei Gläsern lauwarmem Bier war die auf dem Zweisitzer eingeschlafen, mit angezogenen Beinen wie ein übergroßer Embryo, tief schnarchend und regelmäßig atmend. Zusehen, wie Oma unschuldig und entspannt schläft wie ein Neugeborenes … Radio aus. Nichts durfte ihre Ruhe stören. Sie schlich aus dem Wohnzimmer zur Waschküche, suchte nach einer Aufgabe. Der Wäschekorb war nicht voll. Trotzdem die Maschine laufen lassen, dann alles schön nach draußen hängen an die Trockenspinne, die Großmutter kaum benutzte, weil sie zu hoch eingestellt war für sie. Und als sie die Waschmaschinentür öffnete, sah sie es. Ein blutiges Nachthemd. Sie breitete es auf dem Bügelbrett aus. Das Blut war getrocknet. Auf der Vorderseite. Auf Brusthöhe. Ihr Herz raste. Am liebsten wollte sie das Kleidungsstück sofort wieder so makellos sauber wie möglich bekommen, also steckte sie es wieder in die Trommel, zur anderen Wäsche. Sie wählte ein Programm, wollte gerade die Maschine einschalten, als sie Husten hörte. Schnell war sie mit einem Glas Wasser bei Großmutter. Das Husten hörte auf. Mach die Hintertür auf, sagte Oma. Der Nachmittagspassat brachte Seeluft ins Haus. Wie weit bist du mit dem Kochen? Sie: Es dauert noch eine Weile, bis alles schön weich ist. Großmutter nickte und sie flog in die Küche, drehte die Flammen runter und ließ die Wäsche endlich laufen. Großmutter kam in die Küche, als wollte sie zum Klo. Blieb stehen, als sie die Maschine laufen hörte, sah sie forschend an. Muss das sein, fragte Großmutter schroff, wartete die Antwort nicht ab, sagte, sie wolle sich frischmachen und den Mund mit Minzwasser ausspülen, um den Biergeschmack loszuwerden, ließ sich aber aufs Klo sinken und blieb eine Weile dort sitzen. Dachte Oma Bee an das Nachthemd, hatte sie es beiseitegelegt, um Tochter Louise zu zeigen, was sie dem Tod näherbrachte? Mit frisch gewaschenem Gesicht und feuchtem Haar an der Stirn setzte sich Großmutter an den Tisch. Sie wollte gerade die halbvolle Bierflasche zurück in den Kühlschrank stellen. Tust du mir auf, fragte Oma munter. Sie lachte erleichtert: Ja, Frau Vanta, was hätten Sie gern, nahm einen Porzellanteller und ging zu den Töpfen auf dem Herd. Ein bisschen Kartoffelpüree, ein Stück gedämpftes Huhn ohne Knochen, Bratensaft aus Butter und frischen Tomaten, den pürierten Spinat, den du mitgebracht hast, und für später weiches geeistes Mangomus. Sie zählte alles auf und stellte es hübsch angerichtet vor Oma. Schnell zurück zu den Töpfen für ihre eigene Portion und zurück zu Oma. Sie saßen sich gegenüber an dem schmalen Tisch, an dem Platz war für sechs. Sie konnten einander gut sehen und mit Leichtigkeit berühren. Zuerst ein gemurmeltes, aber verständliches Dankgebet, und auch ihr wurde für die Mahlzeit gedankt. Langsam und ohne zu sprechen, aßen sie. Aufmerksam musterte sie Großmutter, kamen die Blutflecke auf dem Nachthemd von einer Wunde an den Brüsten oder war es Blut aus ihrem Mund? Kummer, der sich mit Blut statt mit Tränen äußerte, war es sicher nicht: Der Sohn, bei dem Großmutter jahrelang gewohnt hatte, war schon vor ein paar Jahren mit seiner neuen Frau ausgewandert, hatte seine Mutter zurückgelassen wie einen Gebrauchsgegenstand, zu verschlissen, um ihn mitzunehmen in ein neues Leben. So heftig konnte Mutter Louise manchmal wettern, und überhaupt, Großmutter Bee, die hätte ihre Töchter nie wirklich geliebt, nur die Jungs: Augapfel Winston hatte sie sogar dazu gebracht, eheliches Heim und Ehemann zu verlassen, um ihn nach einer verheerenden Scheidung zu unterstützen in seiner Wohnung, und dann, dann hätte er sie zurückgelassen in einem sterilen Haus in einem ihr völlig fremden Viertel, in Zorg & Hoop – und Sorge & Hoffnung, das wäre für Oma doch mehr als nur ein Wahlspruch! Mutter Louise mochte recht haben, aber sie, Imker Vanta, saß einer Frau gegenüber, die ihren ganzen Besitz weggegeben hatte, und dann machte es keinen Unterschied mehr, an wen, fand sie. Die Haare um Großmutters Gesicht lockten sich beim Trocknen und sie wartete, bis sich ihre Blicke trafen: Schmeckts, Oma? Ein Nicken, ein scharfer Blick, direkt in die Augen. Sie verschluckte sich, trank ein paar Schlucke Wasser. Höre ich die Maschine laufen, fragte Großmutter plötzlich. Ja, ich habe die Schmutzwäsche reingetan, um gleich draußen die Trockenspinne auszuprobieren. Und sie fragte sich, ob der richtige Moment gekommen war für die Sache mit dem Blutfleck, jetzt vor den zwei leergegessenen Tellern. Dann hast du sicher mein Nachthemd gesehen? Oma schaute sie nicht mehr an. Trotzdem nickte sie. Du willst wissen, wo das Blut herkommt? Ein schüchternes: Ja, Oma Bee. Großmutter, erneut und entschieden: Erst noch den geeisten Nachtisch und dann will ich lernen, wie meine Trockenspinne funktioniert, liebe Imker. Sie sprang auf und überließ es ihren Händen, die Eisleckerei aufzutun, weil sie ganz woanders war mit dem Kopf. Beide löffelten das Mangomus und Oma schmatzte freudig. Sie hingegen freute sich nicht. Sie fürchtete den nächsten Augenblick. Sie hatte vorgeschlagen, erst noch abzuspülen und dann die Wäsche rauszuhängen. Großmutter brummelte, die Wäsche dürfe an der Trockenspinne flattern, aber sie müssten in der Nähe bleiben, hier werde so viel gestohlen. Trotz der hohen Mauer mit Glasscherben drauf? Bei Großmutter noch nicht, aber der alte Pfarrer der Zorg & Hoop-Gemeinde, der hätte ihr geraten, immer gut aufzupassen. Mit einem Schlag hielt die Waschmaschine an. Oma rührte sich nicht vom Fleck, blieb sitzen an dem Küchentisch aus Holz, auch als keine Sets mehr auf dem gelben, strahlend sauberen Wachstuch lagen. Soll ich das Plastik von deinem Zweisitzer abmachen, Oma? Durfte sie. In dem Wohnzimmer keine dunklen Holzregale mit glänzenden Messinggegenständen, keine eleganten Beistelltische mit Spitzendeckchen und nicht einmal ein Schaukelstuhl. Trotzdem war der Bungalow jetzt ein Zuhause, in dem Großmutter sich nicht beklommen fühlte: modern, beinah jugendlich. Strahlend vor Vitalität war, in ihrer Erinnerung, Muttersmutter immer gewesen: wunderschön gekleidet und unermüdlich damit beschäftigt, Leckerbissen zuzubereiten für eine hochbetagte Person irgendwo in der Stadt. Dass ihr Letztgeborener Kinderarzt werden wollte und deshalb nach Holland zog, hätte ihrer Eitelkeit sogar geschmeichelt, gab sie zu; aber als vor drei Jahren Sohn Winston weggezogen war, da hätte sie nicht mehr gewusst, wie sie durch den Tag kommen sollte, zischelte Mutter Louise manchmal bissig. Fehlen dir die Jungs, fragte Imker voreingenommen und fast grob. Statt zu antworten, stand Großmutter auf und ging in Hausschuhen zur Waschküche: Oma entriegelte die Waschmaschine, sagte im Befehlston: Imker, hol die Wäsche raus und häng sie auf; gleichzeitig nahm Großmutter aber selbst die gewaschenen Kleidungsstücke eins nach dem anderen aus der Trommel, schlug sie auf und ließ sie in einen leeren Wäschekorb fallen mit einer Schachtel Wäscheklammern darin. Die Trockenspinne? Auch ihr gelang es nicht, die Höhe zu verstellen. Mit ihren eins sechsundsechzig war sie ein ganzes Stück größer als Großmutter. Mühelos hängte sie auf, was ihr gegeben wurde. Neun Sachen, einschließlich einem Laken und zwei Kissenbezügen. Alles hing an bunten Klammern und die Spinne fing an, sich zu drehen. Großmutter sah dem Nachthemd hinterher. Sie auch. Es hatte die Farbe alten Papiers. Es flatterte leicht und unbefleckt. Auf der Terrasse setzten sie sich auf Plastikstühle und die Sonne war heiß, doch der Passat machte es erträglich kühl. Das Meer mochte nach menschlichem Ermessen weit weg sein, aber der Wind erinnerte sie daran, dass ihre Stadt an der Küste lag, an der Mündung eines Flusses, der in den Atlantik floss. Blauer als der Himmel gab es nicht. Stiller als um drei Uhr nachmittags bei Oma auch nicht. Großmutter und sie machten keinen Mittagsschlaf. Sie dösten vor sich hin. Ein kurzes Zögern, dann doch: Das Blut, Oma Bee, wo kommt es her? Großmutter sah zum Himmel, der so furchtbar leer war ohne Wolken. Ist es nachts passiert, hakte sie fordernd nach. Es passiert in den Morgenstunden, Imker. Es kommt aus meiner Kehle, glaube ich. Vielleicht noch tiefer. Ich verstehe das Bluten nicht. Ich habe nie Fieber. Omas Blick schweigend auf ihr. Soll ich mit dir zu einer Untersuchung im Spital? Großmutter hatte die Antwort parat und überfiel sie damit: Kommt nicht infrage, Imker; dann behalten sie mich da und ich komme nie mehr nach Hause; das weiß ich einfach. Ich will auch keine Tabletten. Nichts. Auch kein Rumgeschnippel an mir. Und du darfst keinem erzählen, dass ich blute. Großmutter keuchte unverhohlen. Auch nicht meiner Mutter, Oma Bee? Auch nicht deiner Mutter, Imker, nur ich darf es erzählen! Stille. Schweigender Blickkontakt. Versprich mir das, Kind! Imker sofort: Ja, ja, versprochen, Oma! Das Schweigen zog sich in die Länge. Großmutter hatte sich wieder an den Küchentisch gesetzt und sah ernst zu, wie die Wäsche an der Spinne in Windeseile trocknete. Nicht mehr lange, dann konnte sie als Bügelwäsche wieder ins Haus. Imker ging an der Grundstücksmauer entlang, einmal ganz um den Bungalow herum. Plötzlich wusste sie, was zu tun war. Wieder ins Haus ging sie. Beinah aufgeregt: Oma, ich gehe gleich nach Amora und komme sofort wieder zurück und schlafe dann bei dir. Ich bringe eine Decke mit. Ich lege mich zu dir ins Schlafzimmer auf den Teppich. Ich lasse dich nicht allein die Nacht und den Morgen durchstehen! Und während sie über die Worte stolperte, mit denen sie sich verständlich machen wollte, wurde sie von einem Weinkrampf gepackt. Die Tränen, die sie zurückgehalten hatte, als ihre Schwester nach Holland geflogen war und sie ganz allein die erste Nacht durchstehen musste in dem großen Bett, in einem Zimmer, das plötzlich wieder aus Ziegelsteinen bestand statt aus Helis Zuwendung. Großmutter sah ihr zu, schweigend, wusste, dass sie nicht aufzuhalten war. Sie machte sich frisch und brach ohne Rucksack auf. An ihren Füßen, dieses eine Mal, Helis Sandalen.
Es war keine Bitte. Es war eine Mitteilung, mit der sie den Mittagsschlaf ihrer Mutter störte: Mama, ich ziehe zu Oma Bee. Mutter Louise blieb liegen und erkundigte sich ernst nach der Gesundheit ihrer Mutter. Bekam keine eindeutige Antwort, außer, dass Oma wirklich nicht allein gelassen werden durfte, vor allem nachts nicht. Und schnell wie der Wind sammelte sie alles zusammen, was sie glaubte zu brauchen; stopfte Bücher, Kleidung, Decken, Waschzeug in einen Koffer von Schwester Babs und hörte Mutter Louise rufen: Lass unsere Zahnpasta und Badeseife da, kauf dir was auf dem Weg zu Oma, die Binden musst du auch dalassen, hörst du, Imker? Sie antwortete nicht. Was meinst du, wie lange du wegbleibst? Sie machte den Koffer zu, rief aus ihrem Zimmer: Ich weiß nicht, erst mal bis zum Wochenende und dann! Sie wusste wirklich nicht, wie es weitergehen würde. Mutter: Dann was, Imker? Es wurde seltsam still in ihr. Mutter Louise hatte oft gesagt, wie ähnlich sie Großmutter sehe: dieselben Gesichtszüge, dieselbe Hautfarbe, sogar dieselben Haare, äußerlich nur ein Größenunterschied. Mit dem Koffer zu Mutter. Sie setzte sich breitbeinig auf den Hocker der Frisierkommode und musterte sich und Mutter im Spiegel. Kann Oma Bee bei uns wohnen, Mama? Es klang aggressiv. Ich weiß, du bist vor langer Zeit ausgezogen aus dem Elternhaus, um auf eigenen Beinen zu stehen, Mam. Mutter Louise fuhr träge fort: Und inzwischen stehen vier fast erwachsene Kinder zwischen meiner Mutter und mir! Ein merkwürdiges Gespräch. Als würde sie an einem großen Wasser stehen und hinüberwaten wollen, ohne nass zu werden. Mam, was, wenn Oma krank wird, so krank, dass sie Hilfe braucht? Mutter war jetzt ganz wach und aufgestanden: Hier bei uns geht das nicht, das Haus ist zu klein, zu voll! Mutter setzte sich auf die Bettkante und sah ihr ins Gesicht. Fehlt dir Heli so sehr, dass du lieber bei Oma schläfst? Mutter gab dem Gespräch eine andere Wendung. Sie sprang auf und umarmte sie: Mam, es geht echt um Oma Bee. Und in der offenen Tür: Du wirst mir fehlen, Mam, aber vor der Dämmerung will ich bei deiner Mutter sein, Wiedersehn! Und weg war Imker. Bloß nicht stehen bleiben, dachte sie, und ihr wurde klar: Vielleicht wird es lange dauern, da in Zorg & Hoop.
Babs sah ihre Schwester mit einem Koffer stehen. Sie hatte sich aus ihrer gebeugten Haltung über einem Lehrbuch erhoben und schaute ihr vom Fenster des Arbeitszimmers aus nach. Sie schaute so lange, bis sie Imker nicht mehr sehen konnte. Ohne zu fragen, hatte Imker ihren roten Reisekoffer mitgenommen, Gott weiß wohin. Sie wusste, sie durfte nicht tun, was ihr sofort in den Sinn kam: zu Mutter rennen und eine Erklärung fordern. Schmollend blieb sie am Fenster stehen. Ihre Sachen interessierten keinen hier im Haus. Keine Streicheleinheiten für sie. Keine Schmeicheleien. Vielleicht dachten sie, sie wäre so verliebt in Aram, dass ihr nichts anderes wirklich etwas ausmachte. Überhaupt nicht. Das würden sie schon noch merken. Sie setzte sich wieder an den großen Schreibtisch und versuchte erneut herauszufinden, weshalb der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war und wo: Der Geschichtslehrer hatte ihnen eine schriftliche Aufgabe gegeben. Die Frage hatte mehr Bedeutung für sie, seit sie wusste, dass die Mutter ihres Vaters jüdisch gewesen war. Seither konnte sie leichter akzeptieren, dass sie mit ihrer Hautfarbe auffiel in der Familie, und mit ihrem Mittelschulabschluss in der Tasche ließ sie es sich nicht mehr bieten, dass andere ihr die Leviten lasen. Auch nicht Mutter Louise. Obwohl sie wahnsinnig neugierig war, wo Imker die Nacht verbringen würde – Mutter sollte es ihr erzählen, ohne dass sie danach fragte. Sie stand auf, ging zum Fenster, sah eine Fliege an einer Glaslamelle kleben, nahm ein Papiertaschentuch und fegte das Insekt nach draußen. Sie sah hoch. Ihr kleiner Bruder in seiner Pfadfinderuniform machte das Tor auf. Vielleicht sah er sie nicht, sie lächelte trotzdem. Sie hörte seine Schritte auf dem Muschelpfad knirschen. Die Hintertür zur Küche ging auf und zu. Er war drinnen. Wasserhahn auf. Hände waschen. Erst die Schuhe ausziehen, Audi, rief sie, während sie zu ihm ging. Er sah sie an, lächelte nicht. Seine Augen leuchteten klar und aufgeweckt: Ich habe so einen Hunger, sagte er leise, und: Wo sind alle? Mutter Louise kam zu ihnen, langsam und gedankenversunken. Ich mache euch was zu essen, es ist noch Suppe da, die wärme ich auf, und will noch jemand Brot? Mutter Louise sah erst sie und dann Audi leicht entschuldigend an und sagte, sie hätte keinen Appetit. Sie sah zu Mutter, ärgerte sich: Keinen Appetit, seit Helis Abreise? Mutter stand am Herd und tat, was sie versprochen hatte. Du bist so still, Mam, sagte Audi. Ja, es ist still, alles steht still hier drinnen, Junge. Ihre Stimme war vorwurfsvoll. Außer der Uhr, Babs, sagte Audi beschwichtigend, und: Mein Magen knurrt wie blöd. Lachen, das sich wie Wiehern anhörte. Mutter lachte nicht mit, sagte aber, seit keiner mehr das Radio anmache, sei keine Musik mehr im Wohnzimmer zu hören. Babs blaffte: Ja, Heli mag Musik und Radiohören, ich kann auf den Lärm verzichten! Mutter kicherte laut: Dann habe ich doch nicht unrecht, wenn ich sage, dass es so still ist ohne sie. Babs hatte keine Lust auf eine Diskussion und verschwand wieder im Arbeitszimmer. Dein Essen steht auf dem Tisch, rief Mutter ihr erstaunt hinterher.
Audi war ins Wohnzimmer gegangen und hatte das Radio angemacht. Die Stimme einer Frau, die eine Kindergeschichte vorlas. Er setzte sich auf den Platz, an dem seine Schwester sonst saß. Zog sein Set und sein Besteck bis dicht vor die Brust. Bei Helis Abreise war er nicht mal dabei gewesen. Er war wie immer zum Fußballspielen gegangen mit Jungen aus der Nachbarschaft. Er konnte sich nicht verabschieden von ihr. Als der Plan besprochen worden war, hatte er neben seiner Mutter gesessen: Heli sollte besser das Land verlassen als weiterhin: einem Mann, der wichtig sei für die Entwicklung des Landes, den Kopf verdrehen! Mutter und er hatten zugehört. Bei zwei fremden Männern mit Krawatte und einer Frau waren sie in einem Bürogebäude gesessen. Die Frau hatte die ganze Zeit das Wort: Heli müsse einen Schlussstrich unter diese Beziehung ziehen und zwar sofort, und notfalls könne Mutter Louise Geld bekommen, um ihre älteste Tochter in die Niederlande zu verfrachten! Auf dem Weg zurück nach Hause, über den Muschelpfad vom Gebäude des Ministeriums bis in die Innenstadt, konnte er seine Mutter weinen hören, leise und vielleicht, ohne eine Träne zu vergießen. Das Flusswasser glänzte und er hörte es plätschern. Kein Wort brachte er heraus. Auch nicht, als seine Mutter ihn bat, vorzugehen und beim Taxistand einen anständigen Wagen auszusuchen für die Fahrt zurück nach Amora. Er machte es mit Handzeichen. Seine Stimme war weg. So still war es in ihm geworden, schon Wochen vor ihrer Abreise. Als seine Mutter und Babs sich zu ihm setzten, fragte er, wie aus einem schrecklichen Traum gerissen: Wo ist Imker? Mutter gab den Topf weiter, hielt die Suppenkelle noch in der Hand: Zu Oma Bee gezogen für eine Weile. Leise war die Mitteilung. Ist Oma krank, fragte Babs. Vielleicht, antwortete Mutter, und gleich darauf lauter: Will jemand noch ein Stück Brot? Das Brot wurde ehrlich geteilt. Jeder am Tisch bekreuzigte sich und wünschte »guten Appetit«. Gerappel am Tor. Mutter ging zum großen Fenster. Wer ist das? Drinnen war deutlich zu hören, wie jemand rief: Frau Vanta, Ihre Tochter lässt ausrichten, sie ist gut bei ihrer Großmutter angekommen. Ich habe sie mitgenommen, wollte ich nur kurz sagen! Mutters Stimme: Danke, Umar! Und ein Moped wurde angelassen, fuhr davon. Es gab Erdnusssuppe. Der Geruch nach frischer Petersilie und gemahlenen Erdnüssen füllte das Wohnzimmer, wo der Esstisch stand. Das Brot wurde gebrochen, in die warme Suppe getunkt. Wortlos aßen sie. Im Radio die Neunzehnuhrnachrichten. Hörte jemand zu? Audi sah mit vollem Mund zu Mutter Louise und nickte anerkennend.
Ich bin aufgeregt. Als würde sich unsere kleine Welt verändern durch mich. Mutters Augen und ihre Stimme so nah bei mir bringen etwas in Bewegung: Ich bin am Lehrerseminar angemeldet und der erste Tag an der SKS nach viel zu langen und viel zu heißen Septemberferien ist angebrochen. Ich stehe vor dem großen Spiegel. Mein Kleid hat die beste Schneiderin in Paramaribo genäht. Mit Mutter in die Stadt, um Stoff auszusuchen. Mit Mutter zur Näherin, um in der Schnittmustersammlung zu stöbern. Mit Mutter zum Atelier, zeigen, aussuchen, anmessen. Ich betrachte mein Spiegelbild. Mutter steht schräg hinter mir und schaut womöglich mit. Ich bin wie neu. Schuhe, Unterwäsche, Kleidung und zum ersten Mal mein Haar, ein wenig geglättet, in einem Knoten, den ich im Nacken spüre. Mutter Louise hat ihr Parfümfläschchen in der Hand. Sie fragt, ob ich etwas davon möchte. Mit dem Zeigefinger tupft sie mir einen Tropfen auf die Handgelenke, die Ohrläppchen. Wellen aus Glück lassen mein Herz schneller schlagen. Sie schnuppert an meinen Achseln, ob ich das Deo verwendet habe. Ich sperre den Mund weit auf. Sie schaut, nickt auch meinen Atem ab. Auf einem Stuhl steht meine Schultasche, die neu ist und voller neuer Dinge, einem farbigen Kalender zum Beispiel, ein Geschenk von Oma Bee. Mutter strahlt zufrieden: Ich bin erst fünfzehn und zugelassen zu etwas, was in ihren Augen eine Traumausbildung ist, und um meine Zukunft zu sichern, ist Mutter mit Sack und Pack aus Nieuw-Nickerie weggezogen. Das Viertel von Paramaribo, in dem wir jetzt wohnen, ist ein Bauprojekt der Regierung im sogenannten Amora-Bezirk, der noch nicht fertig gebaut ist. Mutter hat eine Stelle an der öffentlichen Nachbarschaftsschule bekommen. Die Ferien gehen langsam zu Ende. Unser Mietkaufbungalow ist eingerichtet mit neuen Sachen. Mutter hat sich sogar einen Wachhund zugelegt und ihn Leika genannt. Für Imker, Babs und Brüderchen Audi geht die Schule erst in zwei Wochen los. Ich bin soweit, ich kann meinen Stundenplan holen gehen, meine Literaturliste, und vielleicht sogar meine zukünftigen Klassenkameraden kurz sehen. Mutter sieht mich an. Im Spiegelbild treffen sich unsere Blicke. Ich drehe mich zu ihr und lächle. Alles Gute, Heli. Ich nicke. In meinem Bauch reißt etwas. Es tut nicht weh. Warm läuft es an meinem linken Bein hinunter. Schon seit Tagen bin ich aufgewühlt. Ich rieche etwas und schaue auf meine Füße. Ein Fleck aus Blutstropfen. Mama, ich blute, flüstere ich. Ja, sagt sie zärtlich, und: Herzlichen Glückwunsch. Aber mir ist gar nicht feierlich zumute, denn aus dem Haus werde ich heute, morgen und übermorgen ganz bestimmt nicht gehen. Ich werde warten, bis das Bluten vorbei ist. Mutter hilft mir aus meinem Kleid. Dabei lächelt sie ein wenig, weil: Stell dir vor, es wäre dir außer Haus passiert. Sie kommt mit ins Bad und gibt mir eine Packung Binden. Sie erklärt mir, wie man damit umgeht und wie ich meinen Unterleib in diesen wiederkehrenden Tagen des Frauenleidens sauber halte. Sie sagt: Eine Frau bist du noch nicht, mein Kind, noch lange nicht! Unter der Dusche stehend, wasche ich mich erneut. Ich weine. Ich will das nicht. Bestimmt kann ich nicht gehen mit so einer Binde zwischen den Beinen, und wie soll ich mich hinsetzen und wie wieder aufstehen? Meine Unterwäsche wird ausgespült und weicht in Seifenwasser. Ich sehe zu. Mutter sagt: Ich gehe selber zum Lehrerseminar und sage ihnen, sie dürfen deinen Platz nicht weggeben, gleichzeitig hole ich deinen Stundenplan und deine Bücher. Aber ich will, dass Mutter bei mir bleibt, um meine Fragen zu beantworten. In einem medizinischen Lehrbuch habe ich über die Menstruation gelesen, sie sei gesund und gehöre zum Frausein, aber ich will mit einer Frau sprechen, die Erfahrung hat damit. Nein, sagt Mutter, und tief in die Augen sieht sie mir, während sie noch etwas sagt. Sie sagt: Ich gehe ein Geschenk kaufen für dich bei einem Goldschmied in der Stadt. Danach zu deiner Schule. Ich gebe nach: Ausbildung, nicht Schule, sage ich schmollend. Deine Ausbildung, stimmt sie nachsichtig zu.
Ich gehe im Wohnzimmer herum. Ich setze mich hin. Ich stehe auf. Ich hüpfe. Ich gehe immer wieder aufs Klo, um zu sehen, ob sich etwas geändert hat. Und ich erinnere mich an Nanda. Und ich sehe wieder vor mir, wie es bei Nanda war: Sie saß in der sechsten Klasse neben mir – sie sollte zur Tafel – sie wollte nicht aufstehen – sie sagte nichts – unsere Lehrerin wartete – die ganze Klasse wartete – trotzdem stand sie nicht auf – sie weinte plötzlich – sie schluchzte, bis die Pausenglocke alle auf den Schulhof scheuchte! Ich war neben Nanda sitzengeblieben. Unsere Lehrerin fragte, ob ich etwas wisse. Nanda gab selbst die Antwort: Ich blute, Frau Lehrerin, an meinem Rock ist Blut. Ich schaute auf die Bank, den Boden, sah kein Blut. Ich wollte raus, aber die Lehrerin bat mich, bei Nanda zu bleiben, und ging aus dem Klassenzimmer. Bist du krank? Nicht richtig, hatte Nanda gesagt, und dass sie sich einfach nicht daran gewöhnen könnte. Unsere Lehrerin, hochschwanger mit ihrem ersten Kind, ist eine Bekannte von Mutter, frisch verheiratet und wie wir aus der Stadt entsendet in den Distrikt, in dem wir mittlerweile schon ein knappes Jahr wohnen. Sie kam zurück, Frau Snow, und nahm Nanda mit. Ein seltsamer Blutfleck auf der Holzbank, und niemand wischte ihn weg! Nanda kam nicht mehr zurück an diesem Tag. Bis wir nach Hause durften, war der Fleck eingetrocknet. Es war ein heißer Freitagnachmittag und ich glaubte, Nanda werde sterben. Ein zwölfjähriges Mädchen, das aus dem Unterleib blutet?
Auf Mutters Bettüberwurf liege ich und denke nach, über meinen eigenen Körper und seine Geheimnisse. Gegen elf Uhr vormittags muss ich tief eingeschlafen sein, denn als ich aufwache, ist es vierzehn Uhr und Mutter Louise immer noch weg. Meine beiden kleinen Schwestern und mein kleiner Bruder waren für knapp zwei Wochen in ein Ferienlager gefahren und kämen vielleicht am Nachmittag zurück: müde, übellaunig, schmuddelig. In einer Woche würde ein Verwandter zu uns ziehen: Mutters jüngster Bruder, der Medizin studiert und lieber bei seiner Schwester wohnt als im elterlichen Haus in der Jacobusrust. Er hatte sich einen neuen Motorroller gekauft. Auch er war beim Campen. Sein Lernschlafzimmer hatte er schon eingerichtet. Durch das, was andere tun, begreife ich langsam, dass es im Leben möglich ist, seinen eigenen Weg zu gehen, und dass ich noch herausfinden werde, wie ich allein zurechtkommen kann, ohne die Hilfe der anderen. Auf Mutters Frisierkommode liegt eine große Bibel. Morgens hat sie einen Bibeltext gelesen mit mir. Mutter Louise sagt unumwunden, dass ihr Leben von Gott gelenkt wird. Und ich glaube ihr das. Mutter hat einen Bungalow zugewiesen bekommen an einer T-Kreuzung. Nicht gerade praktisch, weil abends das Scheinwerferlicht der Autos in unser Wohnzimmer fällt. Es ist keine vielbefahrene Straße hier im Bezirk, aber die Scheinwerfer stören mich. Mutter weigert sich außerdem, die schweren Vorhänge vor zweiundzwanzig Uhr zuzuziehen, wenn jeder von uns im Haus bleiben soll. Und dann gibt es noch halbfertige Straßen, zwischen den Häusern: Sandstraßen ohne Gehweg, dafür dicht an Grasböschungen, in denen es wimmelt von glitschigen Tieren. Der Bauarbeiter, den Mutter beauftragt hat, einen Teil des Gartens zu pflastern, den ganzen Garten zu umzäunen und ein solides Tor anzubringen, ist sehr schwarz und sehr attraktiv. Jedes Mal, wenn er Mutter sieht, macht er ihr schöne Augen. Er hat erzählt, die Kanalisation im Amora-Bezirk sei besonders gut und die Verstopfungen und Überflutungen, die die Innenstadt zur Regenzeit plagen, würde es in unserem Vorort nicht geben. Als Vorschullehrerin sollte Mutter in der Nähe ihrer Arbeit wohnen, hatte der Schulleiter gesagt, der einmal zu Besuch gewesen war, um auch ihre Kinder kennenzulernen. Mutter Louise hätte lieber in der Innenstadt gewohnt, in einem großen Haus mit blühendem Garten. Vielleicht reichen ihre finanziellen Mittel nicht aus dafür. Vielleicht will sie sich die Zeit nehmen, sich mit ihrer Familie von gut vier Distriktjahren zu erholen, in einer ruhigen Umgebung. Es ist eine Tagesreise von Nieuw-Nickerie nach Paramaribo und ich weiß noch, dass der Umzug höllische Arbeit war für eine Frau ohne Mann, mit drei jungen Mädchen und einem nicht mal zehnjährigen Sohn. Nur ein paar Kleider durften mit und andere persönliche Dinge, die wenig Platz brauchten. Keine Bücher. Nicht mein Fahrrad. Ein Blatt Schreibpapier, auf dem die Namen und Adressen meiner Freundinnen in ihrer eigenen Handschrift standen, hatte ich tagelang herumgetragen, tief in der Tasche meiner neuen Jeans. Verlorengegangen. Ich wusste weder wo noch wie. Womöglich in der Wäsche. So sehr ich mich bemühe, von der Straße zu träumen, wo wir in Nickerie gewohnt haben, es klappt nicht. Seit wir wieder in Paramaribo wohnen, beschleichen mich morgens Traumbilder aus der Jacobusrust. Die Gesichter von Familienmitgliedern, von Schwestern und Brüdern und Eltern, die sich bekriegten mit Worten. Und ich, die ich nicht vergessen konnte, was meiner Mutter an den Kopf geworfen wurde von Oma Bee, obwohl ich noch keine zehn war und nicht wusste, was »motyo« bedeutete, außer, dass das Wort weh tat, denn Mutter Louise weinte sehr. Weinen tust du, wenn du viel Blut verlierst, weil du dann vielleicht in Lebensgefahr schwebst. Aber Frauen bluten manchmal auch unsichtbar. Ungehindert laufen mir Tränen übers Gesicht. Meine Mutter kann jeden Moment wieder zu Hause sein. Und die Camper sind bestimmt auch auf dem Weg vom Ferienlager hierher. Ganze zwei Wochen, nur Mutter und ich und niemand anders als wir beide. Wir haben geredet, geschwiegen, gelacht, wir haben eingekauft, gekocht, gegessen, wir haben gesungen und gefaulenzt. Auch heute fließen die Tränen ungehindert. Mein Koffer liegt offen auf dem Teppichboden. Auf dem seidenen Innenfutter mein Name: Heli Vanta. Es ist mein erster Sonntagvormittag in den Niederlanden, im Gästezimmer von Winston und seiner Frau Lya. Sie wollen mich mitnehmen zur Sonntagsmesse.
Großmutter konnte Enkelin Imker atmen hören, ruhig und tief. Sie selbst konnte nicht schlafen, blieb aber reglos im Bett liegen; ihre Kehle, die setzte ihr zu. Außerdem sehnte sie sich so sehr nach dem Geschmack und Geruch einer Zigarre. In einem Küchenschrank, versteckt in einer Keksdose, lag eine Schachtel Zigarren einer guten Marke. Sie hatte solche Sehnsucht nach so einer großen, wie sie sie jahrelang geraucht hatte jeden Abend, sitzend auf ihrem Schlafzimmerschemel, breitbeinig, gebeugt über den Nachttopf: die Zigarre brachte Ruhe, das Rauchen Trost. Der Rauch, der sich an ihrer Nase entlang nach oben kräuselte und sie in eine Wolke hüllte: Alle Gedanken lösten sich auf und ganz leer wurde ihr Kopf, als wäre sie betrunken. Und dann, wenn ihr Leid nicht gänzlich in Rauch aufgegangen war und von der Zigarre nur noch eine dicke Kippe übrig, dann begann das Kauen. Kauen und Spucken und wieder Kauen und erneut Spucken, bis Zunge und Kehle brannten vom Bitteren des Tabaks. Dann spülte sie sich den Mund aus mit Leitungswasser voller Minzblätter, das in einer Karaffe neben ihr stand. Nichts wurde geschluckt. Alles landete im Nachttopf. Lange Zeit starrte sie auf die dunkle Flüssigkeit, legte dann den Deckel auf den Topf. Meistens gegen Mitternacht. Ehemann Anton schlief und auch die im Haus wohnenden Kinder waren nicht mehr auf. Es war so schwer geworden zu liegen neben dem Vater ihrer Kinder, ohne ihn zu spüren. Und ihn spüren wollte sie nicht. Sie wurde von derselben Unruhe erfasst wie vor vielen Jahren. Imker murmelte im Schlaf vor sich hin. Sie wollte aufstehen. Irgendetwas tun wollte sie, die Bügelwäsche holen, das Bügelbrett aufklappen, das Bügeleisen heiß, und Stück für Stück die trockenen Sachen glätten. Imker würde aus dem Schlaf schrecken, sie mit Fragen überschütten. Ihre Enkelin würde sich Sorgen machen. Sie griff nach der Silberdose, die an einer unzerreißbaren Kordel hing, um ihren Hals. In der Dose waren ein paar Milchzähne ihres letzten Kindes. Die Pillendose hatte er ihr geschenkt, sein Name neben denen seiner Eltern eingraviert. Er war gekommen, um ihr zu erzählen, er müsse in die Niederlande für seinen Facharzt. Sie war erschrocken. Darauf war sie nicht gefasst. Er war doch mit einem Mädchen zusammen, das sicher nicht ihre Familie verlassen wollte, um ins Ausland zu ziehen? Sohn Roger hatte gesagt: Nicht weinen, Ma, ich nehme meine Freundin mit, wir heiraten in Holland und wenn ich Kinderarzt bin, kommen wir zurück, aber dann mit Enkeln für dich zum Verwöhnen! Mit der Pillendose in der Hand hatte sie weiter genörgelt: Dein Vater ist noch kein Jahr tot und schon gehst du so weit weg von mir! Er hatte genickt. Er hatte auch gesagt: Pa hat nicht mehr als zehn Sätze mit mir gesprochen, Ma, er hat nie was gesagt. Er ging zur Arbeit in die Garnison. Er kam pünktlich zurück. Er saß in seinem Sessel. Er hörte Radio. Er aß. Er legte sich in die Wanne. Er las Zeitung. Er ging schlafen. Sie hatte ihn pikiert angesehen und ihm zugehört, geschwiegen, bis er fertig war. Sie hatte gewartet, ob noch mehr käme. Erwartet hatte sie, dass Sohn Roger aufzählte, wie fürsorglich sie immer gewesen war. Aber er war versunken in tiefes Schweigen, das sie nach einer halben Stunde unterbrach: Ich tue die Milchzähne von dir, die ich noch habe, in die Dose und lasse die Dose von einem Goldschmied zulöten, mit dem Gold unserer Eheringe. Ihr Sohn sagte nichts dazu. Gepflegt sah er aus in seinem weißen Hemd, der grauen Hose, den dunkelbraunen Mokassins; gesund schimmernde Haut, kurz geschnittene Haare. Wie alt bist du, fragte sie. Noch keine dreißig, aber jedes Jahr am 16. März werde ich älter, Ma. Fast wäre ihr entschlüpft, dass sie sich manchmal nicht gut fühle und dass das Schlucken ihr manchmal schwerfalle, aber stattdessen fragte sie mit zuckersüßer Stimme, wie ein kleines Mädchen: Warum bist du eigentlich zu Hause ausgezogen? Und er war gleich aufgestanden, ihr Sohn, weil er es nicht aushielt erinnert zu werden an seine Schwester Laura. In zehn Tagen reise ich ab, sagte er streng. Mit dem Flugzeug? Ja, Ma. Mit dem Flugzeug. Und wo wohnst du dann? In Utrecht bei Verwandten von meiner Freundin und später in einer eigenen Wohnung, Ma. Hast du da Geld zum Leben? Ich bekomme ein Stipendium, Ma, Suriname bezahlt für mein Studium. Schniefend: Du nimmst mir alles weg, wofür ich lebe, aber ich freue mich trotzdem für dich, Roger! Er hatte sie in die Arme genommen: Ich komme zurück, ich komme zurück zu dir, Ma, Ehrenwort! Und weg war er, aus dem Wohnzimmer nach draußen, zu seinem Roller. Sagst du mir noch auf Wiedersehen? Natürlich, Ma! Dieses Gespräch ging ihr wieder und wieder durch den Kopf, wenn sie nicht schlafen konnte. Wie versprochen war er gekommen, hatte sie umarmt und ihr sogar gedankt für alles, während seine Freundin beim Roller auf der Straße stand und zusah. Ist sie lieb zu dir? Ihr Vater hat mich gern! Warum bleibt sie da stehen, hatte sie noch gefragt, aber auch auf diese Frage bekam sie keine Antwort. Und sie weiß noch, was sie dachte, als er wegfuhr mit seiner Freundin hinten auf dem Roller, für den sein Vater bezahlt hatte: Sie ist noch schwärzer als dein Vater! Dieser Gedanke hatte sie sehr beunruhigt, und das ging nie mehr weg: das Gefühl, dass ihr Sohn in die falschen Hände geraten war. Tochter Louise fand ihre Angst unbegründet und sogar gemein. Aber ihre Unruhe blieb. Jeden Tag ging sie zu ihrer vertrauten Kirche in der Innenstadt, um eine Kerze anzuzünden für Roger und einen Rosenkranz zu beten für ihn. Nicht einen Tag hatte sie ausgelassen seit seiner Abreise – und sie musste doch eingeschlafen sein, denn als sie aufsah, war es hell und warm im Zimmer. Imker lag nicht mehr auf Teppich und Decken, eingemummt in den Schlafsack eines Freundes. Imker, wo bist du? Und ein fröhliches: Guten Morgen, Oma Bee, schallte ihr entgegen. Die Süße von warmem Kakao drang zu ihr und sie vergaß den nagenden Schmerz im Rachen. Obwohl die Sonne kräftig ins Schlafzimmer schien und es aussah, als tanzten die Sonnenblumen auf ihren Vorhängen – sie roch Blut. Sie schlüpfte in ihre Pantoffeln und lächelte, weil ihre Enkelin die Stelle, wo sie geschlafen hatte, schon von Decken, Schlafsack, Schlafmatte befreit hatte: So aktiv war Imker schon. Was machst du, liebes Kind, rief sie, während sie das Schlafzimmer verließ. Sie konnte es sehen. Imker bügelte die trockene Wäsche vom Vortag und sah hoch. Ihre Blicke trafen sich. In den Augen ihrer Enkelin schienen Tränen zu glänzen. Musst du nicht los? Doch gleich, Oma. Gehst du zurück nach Hause? Nein, Oma, samstags arbeite ich in einem Stoffladen in der Zwartenhovenbrugstraat für gutes Geld. Sie schob die Vorhänge beiseite, ließ noch mehr Tageslicht herein und murmelte: Gut so. Und kommst du zurück zu mir? Imker hielt kurz inne, stellte das Bügeleisen ab, kam näher: Ich arbeite bis um fünf, dann gehe ich ein paar Sachen zum Kochen kaufen, dann komme ich zurück. In Imkers Hand das Kleidungsstück, das voller Blutflecken gewesen war. Aber ihre Enkelin fröhlich: Oma, schau mal, so sauber, Heli hat ein Dutzend Nachthemden gekauft mit dem Aufdruck GEBROCHEN-WEISS und bei uns zu Hause hat jeder zwei bekommen, sogar Brüderchen Audi und die Nachbarin, und auch an dich hat sie gedacht! Sie hatte das Radio angemacht für den Morgensegen. Hast du gut geschlafen, Oma? Sie wusste, Imker wollte eigentlich über etwas anderes sprechen, etwas, was tiefer ging als eine gute Nachtruhe. Gebrochen-Weiß, das ist die Farbe von Bittermandeln und Süßmandeln, wenn du die dunkelbraune Haut abschälst, sagte sie freundlich, und: Ja, ich bin viel besser aus dem Bett gekommen als gestern. Und sie sah ihre Enkelin weiter an, während die das frisch gebügelte Nachthemd zusammenlegte: Ein Nachthemd habe ich Laura gegeben. Für einen Moment versteifte sie – beim Gedanken an ihr Kind. Lieb von dir, murmelte Imker. Ja, alles ist besser als gestern, Imker, wiederholte sie, ging von der Küche zum Bad, um sich zu waschen, aber vor allem, um Mund und Kehle so gut auszuspülen, dass sie den Geruch nach Blut loswurde. Oma, soll ich draußen harken? Da gab es nichts zu harken auf dem Grundstück, aber am frühen Morgen zu harken war auch eine Art, seine Gedanken zu sortieren, und erneut hörte sie Imker rufen und gleichzeitig sah sie frisches Blut im Waschbecken. Aus ihrer Kehle? Panik. Sie hörte Imker die Tür nach draußen entriegeln. Kühle Luft drang herein. Sie rief nach ihrer Enkelin. Ich blute wieder. Imker sah es. Unkontrolliert brach ihre Enkelin in Tränen aus.
Obwohl das Bluten unvermittelt wieder aufgehört hatte, die Spuren weggewischt waren mit warmem Wasser, Bürste und Seife: Der Samstag blieb blutig. Und obwohl sie langsam, aber entschlossen ein Schälchen Haferbrei ausgelöffelt hatte: Über dem Tisch schwebte weiter die Angst. Imker wurde nach draußen gescheucht zum Harken. Auch wurde ihr erklärt, das Bluten gehöre zu den Morgenstunden. Schon seit Monaten sei das so. Erst mit tagelangen, manchmal wochenlangen Pausen, aber dann plötzlich jeden Morgen. Nur selten habe sie Schmerzen beim Bluten. Starke Schmerzen, fragte Imker. Sie räusperte sich. Sie legte den linken Arm auf die Tischplatte, ausgestreckt ihrer Enkelin entgegen, die flache Hand geöffnet. Imker schaute still auf die flache offene Hand, zuerst ohne zu reagieren, bis sie sagte: Wo bleibst du? Und als sie dann die warme Handfläche des Mädchens auf ihrer spürte, sprach sie heiser: Die Schmerzen haben noch einen anderen Namen, frag deine Mutter, weil ich nämlich keine Mutter hatte zum Fragen, es fühlt sich an wie Feuer in der Kehle, weiter nichts! Und sie ließ Imkers Hand los. Zog ihre eigene Hand zurück. Und Imker trank einen Becher Kakao. Sie selbst trank ein Glas Wasser mit ein paar Tropfen von einem Hausmittel zum Desinfizieren. Langsam ging der Samstagmorgen über in einen Vormittag, prall voll Licht. Mit dem Passat kam eine Brise, die sich um ihren Hals kräuselte, die Wangen, den Kopf, die Beine. Ich bleibe bei dir wohnen, sagte ihre Enkelin leise. Sie wunderte sich: Besprich das erst mit deiner Mutter, Imker. Ihre Enkelin nickte vage. Großmutter sagte das Dankgebet. Imker nach draußen zum Harken, auch sie machte ihres. Eine Stelle aus der Bibel. Die Ave-Maria des Rosenkranzes. Kleider rauslegen. Das Bett machen. Nachdenken. Und gegen neun verließen Imker und sie gleichzeitig das Haus an der Marcussastraat. Imker nahm den Wilden-Bus in die Innenstadt.
Sie ging zur Zorg&Hoop-Kirche, wo sie samstags die Messing-Kerzenleuchter putzte für die Heilige Messe am Sonntag. Zur selben Zeit wie der Kaplan kam sie bei der Kirchentür an. Er hätte ihr Enkel sein können, dieser Hilfsgeistliche, so jung. Er begrüßte sie mit einem Händedruck: Ich will erst lüften, Frau Vanta, bleiben Sie noch kurz draußen an der frischen Luft. Sie nickte und wollte sich gleich setzen, auf die kühle Eingangstreppe, aber der junge Mann brachte ihr einen Klappstuhl und wartete, bis sie gut saß. Er kannte sie. Er wusste, dass ihre Söhne nach Holland gezogen waren. Er wusste von ihrem Kummer bei der Muttergottesstatue, wo er sie weinend angetroffen hatte, und sein Mentor Teloor, seit über zwanzig Jahren ihr Beichtvater, hatte ihn beauftragt, sich samstags um sie zu kümmern und die Messinggegenstände bereitzulegen für sie und Putzmittel und Putztuch dazu. Auf ihrem Klappstuhl dachte sie über ihn nach und über Pfarrer Overtoon: deren Gespräche mit ihr über die eigenen Familien, über ihre Mütter, ihre Heimat, die Dörfer ihrer Jugend in Holland. Die Hausbesuche halfen ihr selbst und ihnen zu ertragen, was unerträglich schien. Der Kaplan holte sie ab, begleitete sie zum Messdienerzimmer in der Nähe des Altars. Möchten Sie eine Tasse Tee? Danke nein. Und sie setzte sich an den Tisch zu den Messingarbeiten. Gut, bis später also, sagte der junge Mann in Schwarz freundlich und verschwand. Unweit von ihr war eine Glocke, mit der sie ihn rufen konnte. Auch waren in dem Zimmer eine Spüle mit Wasserhahn und eine kleine Anrichte, auf der Gläser standen. An Bügeln Gewänder in unterschiedlichen Größen für die Messdiener. Immer der Geruch nach Weihrauch. Irgendwo hoch oben über den Holzwänden Lamellenfenster, durch Gitter geschützt: Die Glaslamellen waren gekippt und frische Luft fiel ihr auf den Kopf. Sie nahm den Hut ab, zupfte ihre Haare ein bisschen zurecht, schob die Sandalen hin und her über den Parkettboden, als trommelte sie mit den Füßen. Sie machte sich an die Arbeit. Ließ den Messingreiniger beiseite, griff nach dem Putztuch und bearbeitete den Fuß eines riesigen Kerzenleuchters. Man gab ihr auseinandergeschraubte Teile schwerer Stücke, die nicht im Ganzen bewegt werden konnten. Sie wusste nie genau, was zusammengehörte. Es machte ihr Spaß, den Messing glänzend zu reiben. Die Wanduhr dicht neben ihr tickte und ihre Gedanken liefen rückwärts mit und rannten zurück in der Zeit und blieben stehen, bei der Verlobungsfeier. Mehr als hundert Eier waren zu Kuchen, Torten, kleinen Imbissen verarbeitet worden von mehr als zehn Köchinnen, die tagelang schlugen, quirlten, schöpften, rührten, um die »kleine Feier«, die Tochter Laura sich wünschte, immer weiter zu vergrößern. Laura hatte Bram das Jawort gegeben: endlich einer, für den sie Feuer und Flamme war. Und wenn Bram die Feierlichkeiten mit ihr und nicht mit ihrem Sohn besprochen hätte, dann wäre alles im Gleichgewicht geblieben, statt so aus dem Ruder zu laufen. Bram war beeindruckt gewesen von Winstons Kontakten und hatte ihm seine zweitausend Gulden in die Hände gelegt statt in die zuverlässigen von Anton und ihr. Kräftig rieb sie das Metall, stellte die Messingarbeit beiseite, griff nach der nächsten. Andächtig putzte sie, und hätte jemand sie bei der Arbeit gesehen, hätte er gedacht, sie wäre mit den Gedanken ganz bei den Kerzenleuchterteilen. Eine Stunde verging und noch eine. Schritte vom Kaplan. Ach nein, es ist der alte Teloor. Er stand neben ihr, noch bevor sie sich hatte losreißen können von den Gedanken an ihre Tochter Laura. Sie sieht Laura vor sich, als könnte sie sie berühren: In ihrem Verlobungskleid steht sie da und ach, wie wunderschön sie doch ist, in dem gebrochen-weißen Seidentaft. Mag sein, dass eine Mutter keine Vorliebe haben darf für eines ihrer fünf Kinder, aber wer könnte ihr schon erklären, wo Gefühle eigentlich herkommen und – ob es das, was Liebe genannt wird, auch wirklich gibt. Ihr alter Beichtvater stand bei ihr. Sie hörte ihn sagen, auch sie würde mit jeder liebevollen Tat – das Böse bekämpfen in der Menschenwelt. Sie erhob sich, holte sich ein Glas Wasser. Sie wusch sich die Hände. Sie nahm ein Glas, Wasserhahn auf, trinken. Beichtvater Teloor fragte, ob er wieder einmal mit dem jungen Priester vorbeikommen dürfe und wie es ihr gehe. Nach Gottes Willen, Pater! Ein Hausbesuch wurde in seinen Kalender eingetragen. Großmutter Vanta setzte den Hut auf. Verabschiedete sich.
Das Haus meiner Großeltern steht nicht mehr. Auch die Wohnungen der Nachbarn sind verschwunden. Ich kann kaum glauben, was ich vor mir sehe. Eine riesige Fläche, bedeckt mit Pflanzen, die am Boden wuchern, tut sich vor mir auf. Steinhaufen, nicht höher als meine Knie. Ich weiß nicht mehr genau, wo unser Haus stand, auch der große Mandelbaum ist verschwunden. Die Wohnungen auf der gegenüberliegenden Straßenseite gibt es noch; Holzhäuser, auch heute noch ordentlich gestrichen. Fast jede Nacht träume ich von dem Haus meiner frühesten Kindheit, das in dieser Straße stand: dunkelbraun gebeizt, mit armeegrünen Türen. In meinen Träumen bin ich nicht das sechsjährige Kind, das dort wohnte; ich bin so alt wie heute. Ich träume, dass ich von der Straße durch den Vorgarten auf die Terrasse gehe und ins Haus. Mehr passiert nicht. Außer, dass ich beim Aufwachen – überwältigt werde – von einem Gefühl heftiger Unruhe. Und ich bin wirklich