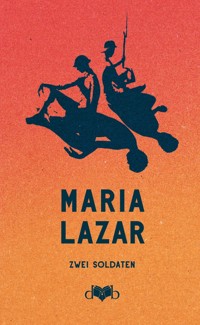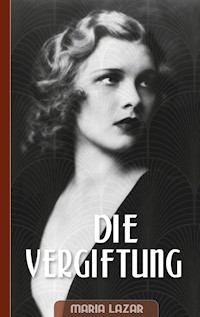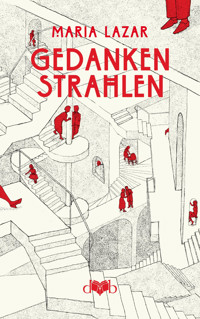
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVB Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
SCHWARZHUMORIGE GESCHICHTEN AM VORABEND DES ZWEITEN WELTKRIEGS… Die Erzählungen & Short Stories der nun auch im In- und Ausland auf der Bühne erfolgreich wiederentdeckten österreichisch-jüdischen Exilautorin Maria Lazar (1895–1948) sind ein literarischer Schatz, der jetzt erst gehoben wird. In ihren eigenwilligen, schwarzhumorigen Narrativen zeigt sich Lazar als scharfsinnige Beobachterin der menschlichen Seele. Mit prophetischer Klarheit beleuchtet sie gesellschaftliche Zwänge, politische Umbrüche und die inneren Kämpfe ihrer Figuren. Ihre Heldinnen und Helden kämpfen um Selbstbestimmung, stellen sich den Schattenseiten des Alltags und brechen immer wieder aus den Konventionen ihrer Zeit aus. Mit ihrer prägnanten, unverstellten Sprache und ihrem tiefen psychologischen Verständnis für die Abgründe des menschlichen Daseins zieht Lazar ihren „unbekannten Leser“ in ein bislang noch unbekanntes Kaleidoskop voller Begegnungen, Intrigen, Widersprüche, Sehnsüchte, Grenzgänge und unerhörter Erfahrungen am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Unter dem Titel "Gedankenstrahlen" versammelt dieser Band erstmals Meistererzählungen Lazars aus den späten 30er und frühen 40er Jahren, die zum Teil noch nie veröffentlicht wurden. Er eröffnet damit gleichsam einen neuen Blick auf eine virtuose Autorin, deren Werk zunehmend kanonisiert wird – gerade vielleicht weil es heute aktueller scheint als je zuvor. "Maria Lazar gehört zu den großen Wiederentdeckungen der deutsch-jüdischen Literatur." – Alexander Kosenina, FAZ „…voller witziger und origineller Gedanken…“ – MARTIN THOMAS PESL, BUCHKULTUR „Mascha Kaleko gleich […] brilliert Lazar mit Erzählkunst, Detailkenntnis und weiblichem Sarkasmus“ – ANDREA SEIBEL, DIE LITERARISCHE WELT „Maria Lazar kann wirklich erzählen!“ – DENIS SCHECK, SWR LESENSWERT QUARTETT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Erzählungen & Short Stories der erfolgreich wiederentdeckten österreichisch-jüdischen Exilautorin Maria Lazar sind ein literarischer Schatz, der jetzt erst gehoben wird. In ihren eigenwilligen, schwarzhumorigen Narrativen zeigt sich die unbeugsame Schriftstellerin als scharfsichtige Beobachterin der menschlichen Seele. Mit prophetischer Klarheit beleuchtet sie gesellschaftliche Zwänge, politische Umbrüche und die inneren Kämpfe ihrer Figuren. Ihre Protagonistinnen und Protagonisten kämpfen um Selbstbestimmung, stellen sich den Schattenseiten des Lebens und brechen immer wieder aus den Konventionen ihrer Zeit aus. Mit ihrer prägnanten, unverstellten Sprache und ihrem tiefen psychologischen Verständnis für die Abgründe des menschlichen Daseins zieht Lazar ihren »unbekannten Leser« in ein bislang noch unbekanntes Kaleidoskop voller Begegnungen, Widersprüche, Sehnsüchte, Grenzgänge und unerhörter Erfahrungen am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Unter dem Titel Gedankenstrahlen versammelt dieser Band erstmals Meistererzählungen Lazars aus den späten 30er und frühen 40er Jahren, die zum Teil noch nie veröffentlicht wurden. Er eröffnet damit gleichsam einen neuen Blick auf eine virtuose Autorin, deren Werk zunehmend kanonisiert wird – gerade vielleicht weil es heute aktueller scheint als je zuvor.
MARIA LAZAR
GEDANKEN STRAHLEN
Erzählungen & Short Stories
Ausgewählt, erstmals aus dem Nachlass herausgegeben und mit einem Nachwort von Albert C. Eibl
Die in diesem Band erstmals versammelten Erzählungen Maria Lazars, in den späten dreißiger und frühen vierziger Jahren entstanden, sind zum Teil noch nie veröffentlicht worden. Sie werden hier erstmals gesammelt aus dem Nachlass herausgegeben – auf Grundlage der in der Österreichischen Exilbibliothek im Literaturhaus Wien aufbewahrten Typoskripte letzter Hand.
Erstausgabe 2025
Das vergessene Buch | www.dvb-verlag.at
Copyright © by DVB Verlag GmbH, Wien
Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung des
Umschlaggestaltung: Lukas Spreitzer, Wien
Satz: Moritz Ahrens, philotypen
ISBN 978-3-903244-31-3
Maria Lazar in den 1930er Jahren © Österreichische Exilbibliothek – Literaturhaus Wien
MARIA LAZAR (1895–1948) entstammte einer jüdisch-großbürgerlichen Wiener Familie. Sie absolvierte das berühmte Mädchen gymnasium der Eugenie Schwarzwald, in deren Salon Oskar Kokoschka sie 1916 porträtierte und in dem sie mit zahlreichen prominenten Figuren der damaligen Wiener Kulturszene zusammentraf, darunter Adolf Loos, Hermann Broch, Elias Canetti und Egon Friedell. Seit den frühen 20er Jahren war sie als Übersetzerin tätig und schrieb für renommierte österreichische, skandinavische und Schweizer Zeitungen. Erst als sie 1930 zum nordischen Pseudonym Esther Grenen greift, stellt sich quasi über Nacht ihr verdienter literarischer Ruhm ein; ein Erfolg, der allerdings durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten ein jähes Ende findet. Aufgrund des repressiven Klimas verlässt sie schon 1933 mit ihrer Tochter Österreich und geht zuerst, gemeinsam mit Bertolt Brecht und Helene Weigel, ins Exil nach Dänemark. 1939 flüchtet sie nach Schweden und scheidet 1948 nach einer langwierigen, unheilbaren Krankheit freiwillig aus dem Leben. Ihr breitgefächertes und wagemutiges literarisches Œuvre geriet schon vor 1945 völlig in Vergessenheit. Im Verlag das vergessene BUCH werden ihre literarischen Werke seit Ende 2014 sukzessive wiederentdeckt:
Die Vergiftung. Roman (2014)
Die Eingeborenen von Maria Blut. Roman (2015)
Leben verboten! Roman (2020)
Viermal ICH. Roman (2023)
Zwei Soldaten. Novelle (2023)
An meinen unbekannten Leser. Gedichte & Photographien (2023)
Die vergessenen Theaterstücke. Dramen (2024)
INHALT
Gedankenstrahlen
Ehrlich währt nicht stets am längsten
Raskolnikow in der Pension
Es spukt im Hotel
Bescheidenes Glück
Die reine Stimme
Das Fiebermädchen
Ein ernsthafter Leser
Der Mitschuldige
Die Milchflasche
Der beste Mann der Welt
Der Nekrolog
Miss Links & Co.
Der Mann, der die Stimme Gottes hörte
Ein sehr bedauerlicher Irrtum
Ein dürftiges Herz
Das Parfum von Monsieur D.
Ein Kranker kommt ins Sanatorium
Liebe der Sorglosen
Liebe in höheren Kreisen
Das Erwachen des Doktor W.
Onkel Mackie
Herr Prinz kommt ins Gerede
Zu Gast auf dieser Welt
Die verwunschene Pension
Das Mädchendorf
Ein modernes Dornröschen
Die Stimme der Vergangenheit
Marjorie
Ein harmloser Mensch
Der Walzer im Hof [Novelle]
Nachwort
Editorische Anmerkung
Bibliographischer Anhang
Dank
Gedankenstrahlen
Es ist wenig angenehm für einen Fabriksdirektor und Familienvater, wenn er eines Vormittags unter der geschäftlichen Post auf seinem Schreibtisch folgenden Brief vorfindet:
Sehr geehrter Herr!
Wir werden Sie nicht erschießen. Wir werden Sie auch nicht hinterrücks erdolchen oder Gift in Ihre Speisen träufeln. Unsere Methoden entsprechen den Forschungen der modernen Metapsychologie. Ohne uns der groben Materie bedienen zu müssen, sind wir imstande durch intensive Gedankenstrahlen zu töten. Sollten Sie Ihrem Schicksal zu entrinnen suchen, so empfehlen wir Ihnen, die Summe von 10.000 (zehntausend) Kronen an der in beiliegendem Plan eingezeichneten Stelle, dritte Buche links, unter den dort bereitliegenden Stein zu legen. Wir erwarten, dass Sie dieser unserer Aufforderung bis spätestens 21. Juni entgegenkommen und zeichnen mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung
Statt einer Unterschrift ein gestempelter Totenkopf. Hässlich.
Der Direktor hätte beinahe den Brief in den Papierkorb geworfen, steckte ihn jedoch rasch in die Rocktasche. Dann stürzte er sich in seine Arbeit. Er war ein vernünftiger Mensch, obwohl er nicht gerade leugnen wollte, dass es Dinge gibt zwischen Himmel und Erde .....
Gesetzt den Fall, es wäre ein gewöhnlicher Drohbrief gewesen, so wäre er damit zur Polizei gegangen. Aber man kann doch nicht die Polizei alarmieren, um sich vor Gedankenstrahlen schützen zu lassen. Abgesehen davon, dass man an solchen Unsinn überhaupt nicht glaubt. Trotzdem war es eine Unverschämtheit, eine Lausbüberei sondergleichen, einen harmlosen Familienvater und Geschäftsmann auf diese Weise erschrecken zu wollen. Er beschloss, zu niemandem davon zu sprechen. Vor allem nicht zu seiner Frau.
Sie war ohnehin so nervös in letzter Zeit. Sprach gerne von Gott und der Nichtigkeit der irdischen Güter. Das kam vom Umgang mit der Baronin, der überspannten Person, die sich nach einem, wie man behauptete, abenteuerlichen Leben in die Kleinstadt zurückgezogen hatte, wo sie mit den Damen der besseren Kreise »stille Stunden« verbrachte. Sie war in ständiger Verbindung mit dem Geist ihres längst verstorbenen Gemahls, ohne dessen Ratschlag sie nicht einmal ein Los zu kaufen pflegte, gar nicht zu reden von wichtigeren Dingen. Dem Direktor war sie nicht sympathisch. Er hatte einen Widerwillen gegen magere Frauen. Auch ärgerte es ihn, dass man ihn zuhause plötzlich auf fleischlose Kost setzen und zu geheimnisvollen Atemübungen anhalten wollte. Seine Frau sprach öfters von der Macht der Seele über den Leib und wenn er sich recht erinnerte, so hatte er auch schon das Wort ›Gedankenstrahlen‹ irgend einmal von ihr gehört. Was jedoch nicht bedeuten sollte, dass er die Baronin und ihre »stillen Stunden« mit dem infamen Erpresserbrief in Verbindung brachte. Die Baronin stammte aus einer der besten Familien des Landes und war reich.
Der Direktor betrachtete sich, ehe er sein Kontor verließ, im Spiegel. Es fiel ihm auf, dass er schlaffe Wangen und dicke Säcke unter den Augen hatte. Er war alt geworden. Zu wenig Luft, zu wenig Bewegung. Er beschloss, einen Spaziergang zu machen. Es fiel ihm auf, dass die Sonne schien, dass die roten Dächer leuchteten, dass die Erde braun war und das junge Gras voll Saft. Er sah geblendet über den dunkelblauen bewegten Sund, über Inseln und Windmühlen. Es fiel ihm auf, dass die Welt etwas anderes war als eine Autofahrkarte, mit Straßen und Tanks, dass es abseits davon Wälder gab und verschwiegene Pfade.
Es ist wohl nur menschlich und wird niemanden erstaunen, dass der Direktor auf diesem seinem Frühlingsspaziergang zu der Stelle gelangte, die ihm die Gangster (denn es waren doch Gangster?) auf ihrem dem Briefe beigelegten Plan eingezeichnet hatten. Es war nicht weit von seinem Sommerhäuschen am Strand. Gleich am Eingang des Waldes stand eine Reihe mächtiger Buchen. Aber ach, von diesen Buchen, deren fröhliches Grün gegen den zarten Himmel strahlte, hingen gleich Kulissen der Trauer schwere schwarze Fischernetze herab. Der Direktor ging vorbei an der dritten Buche links, er berührte mit seinem Spazierstock den Stein, der dort lag (war es ein gewöhnlicher Stein so wie andere Steine?) der Direktor kehrte um. Ihn fröstelte.
Er fürchtete sich vor dem Mittagessen mit seiner Frau und den Kindern. Er fürchtete sich vor den darauffolgenden stillen Abendstunden. Er fürchtete sich vor der Nacht. Und so ging er in die Apotheke, um sich ein Schlafmittel zu holen.
Als er von dem grellen Marktplatz in den kühlen Laden trat, konnte er zuerst fast überhaupt nichts sehen. Er merkte nur, dass ungewöhnlich viele Leute in der Apotheke standen. An der Kasse lehnte mit einer Zigarette im Mund in ihrem weißen Arbeitsmantel Fräulein Minerva, die ihren Damenfrisiersalon über der Apotheke mit sämtlichen Kundinnen verlassen zu haben schien, denn mehrere frisch ondulierte Frauenköpfe drängten sich um den Apotheker, ganz abgesehen von dem Fleischhauer, dem Papierhändler, dem Omnibus-Chauffeur und ein paar neugierigen Knaben. Der Apotheker sagte eben etwas von der allumfassenden menschlichen Dummheit und der jetzt so modernen Verblödungskampagne, als er den Direktor bemerkte. »Sehen Sie doch«, rief er, »was ich heut Vormittag bekommen habe.« Und er hielt dem Direktor einen Brief hin. »Sehen Sie, diese Frechheit, diese Unverschämtheit. Das sind die Folgen.«
Der Direktor war wohl betäubt von zu viel Sonne und verwirrt von zu viel Menschen. Anders ist es nicht zu erklären, dass er, kaum dass er den Brief in die Hand genommen hatte, die Worte sprach: »Sie auch ......
Und somit wusste es die ganze Stadt. Die frisch ondulierten Frauenköpfe, die Knaben, der Omnibuschauffeur verbreiteten die Nachricht so rasch, dass der Direktor, als er eine halbe Stunde später nachhause kam, seine Frau bereits in Tränen schwimmend vorfand. Dem Apotheker, dem Schreihals, machte das gar nichts. Er war Witwer, seine Söhne lebten in Amerika, er musste niemanden beruhigen oder trösten. Er hielt jedem seiner Kunden den Brief unter die Nase und es schien erstaunlich, wie stark der Bedarf der Bevölkerung an Aspirin und Abführmitteln plötzlich gestiegen war. Es war ein sehr bewegtes Leben in der Apotheke.
Aber auch in dem Damenfrisiersalon »Minerva« hatte sich der Betrieb gesteigert. Denn ganz abgesehen davon, dass der Salon über der Apotheke lag, war es ein öffentliches Geheimnis, dass Fräulein Minerva (sie hieß natürlich gar nicht Minerva, sondern hatte einen gewöhnlichen Menschennamen) mit dem Apotheker abends spazieren zu gehen pflegte und sogar einmal einen Sonntag auf seinem Motorboot verbracht hatte. So war es kein Wunder, dass sie, mochte sie nun ondulieren, maniküren, pediküren oder mit einer Gesichtsmassage beschäftigt sein, immer wieder nach ihrer Meinung über die Gedankenstrahlen befragt wurde. Worauf sie immer wieder den gleichen halb unterdrückten Seufzer ausstieß. Die Damen tuschelten in den grell geblümten Zellen, der warme Dampf, vermischt mit starkem Shampoogeruch legte sich ihnen auf die Nerven. Sie glaubten zu beobachten, dass Fräulein Minerva dunkle Ringe unter den Augen bekam und einen schmerzlichen Zug um den Mund. Sie legten ihr nahe, sich einstweilen (was sie unter einstweilen verstanden, darüber äußerten sie sich taktvoller Weise nicht) eine Hilfe aufzunehmen und das kleine rothaarige Lehrmädchen fort zu schicken. Das Lehrmädchen war unbeliebt. Man wusste, dass es einmal sogar der Baronin den Kopf verbrüht hatte und dass es mit seinen henna-gefärbten Nägeln einen verderblichen Einfluss auf verschiedene Knaben der Stadt ausübte. Dabei war es hässlich und voll Sommersprossen.
Fräulein Minerva war nicht gesprächig. Der Mode und ihrem Beruf zum Trotz hatte sie kurzgeschnittenes aschblondes Haar ohne eine Spur von schimmerndem Platin. In ihrem weißen Arbeitsmantel, mit der Zigarette im Mund, sah sie aus wie eine Studentin im Laboratorium und gar nicht wie eine Friseurin. Doch verstand sie sich auf ihr Geschäft. Sie widersprach ihren Kunden nie, nickte freundlich zu allen Ratschlägen und gab selten eine Antwort. Als die Baronin kurz nach dem Eintreffen der verhängnisvollen Briefe bei ihr erschien, um sich die Haare waschen zu lassen, und in ihrer aufgeregten Art ausrief: »Was sagen Sie dazu, nun sollen diese Gedankenstrahlen plötzlich meine Erfindung sein, jetzt macht man mich wohl noch zur Mörderin!«, entgegnete Fräulein Minerva nichts anderes als: »Wir sollten doch einmal mein neues Birkenhaarwasser versuchen. Es wirkt so ausgezeichnet gegen Schuppen.«
Gesetzt den Fall, jemand hätte die Drohungen vergessen, die über zwei geachteten Mitbürgern schwebten (bis zum 21. Juni!), die Baronin hätte ihn daran erinnert. Sie veröffentlichte einen Artikel in der Zeitung über das Wesen der Gedankenstrahlen, ihre Beziehung zu Hypnose und Telepathie, ihre Verwandtschaft mit Licht- und Radiowellen. Sie erzählte jedem, der ihr in den Weg kam, dass es gegen dunkle, dämonische Gedankenstrahlen nur einen Schutz gäbe, möglichst viele Helle und Liebreiche, die den Gefährdeten wie ein Panzer umgeben müssten, ja, sie meldete sich sogar selbst bei der Polizei, um eine Untersuchung gegen ihr eigenes Haus zu beantragen, um zu beweisen, dass die bösartigen Erpresserbriefe nicht aus ihrer Feder stammten. Doch die Polizei erklärte sich als nicht kompetent für Gedankenstrahlen.
Es ging das Gerücht, dass der Apotheker die Baronin mit äußerst unfreundlichen Worten aus seinem Laden gewiesen hatte. Der Direktor konnte sich das nicht leisten. Erstens, weil er ein höflicher Mensch war und zweitens, weil er auf seine Frau Rücksicht zu nehmen hatte. Wer weiß, wie lange es noch dauerte und die Ärmste stand mit den Kindern allein in der Welt, angewiesen auf ihre Freunde und auf das bisschen Kapital, das er ihr hinterließ. Nicht, dass er mit seinem sicheren Tode rechnete, aber immerhin, er war nicht mehr jung, was konnte man wissen. Leicht fiel es ihm ja nicht, aus dieser Welt zu scheiden. Die Leute waren alle so freundlich zu ihm. In der Familie behandelte man ihn wie einen hoffnungslos Kranken, dem man die letzten Wochen erleichtern will. Im Geschäft suchte man ihm jede Schwierigkeit aus dem Weg zu räumen. Die Sonne schien, der Flieder blühte in wilder Pracht, er spürte den Frühling so wie noch nie, er spürte ihn wie süßes, berauschendes Gift.
Natürlich hätte niemand ihn hindern können, eines Nachts ganz heimlich zu der dritten Buche links zu gehen und 10.000 Kronen unter den Stein zu legen. Er dachte mehrmals daran. Aber kaum war er dem Entschluss in die Nähe gerückt, so überwältigte ihn ein unüberwindliches Schamgefühl. Nein, das denn doch nicht. Und außerdem, wer konnte es wissen, vielleicht hatte der Apotheker recht, vielleicht war das Ganze nur eine bübische Frechheit, ein Symptom unserer Zeit, die die Dummheit und den Aberglauben für ihre Gangsterzwecke benützt. (So nämlich pflegte der Apotheker sich auszudrücken).
Der Direktor nahm sich vor, den 21. Juni mit Haltung abzuwarten. Teilnehmende Anfragen nach seinen Gefühlen beantwortete er achselzuckend: »Ich bin ein Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts.« Was er damit meinte, sagte er nicht. Wahrscheinlich war er sich selbst nicht im Klaren darüber.Ungefähr zehn Tage, ehe der verhängnisvolle Termin ablief, verschickte der Apotheker (und das sah ihm wieder ähnlich) höfliche Einladungsbriefe an verschiedene Herren der Stadt, in denen er sie für den Abend des 21. zu sich bat. »Ohne Damen« stand dabei. Mündlich drückte er sich etwas drastischer aus: »Ohne hysterische Weiber. Lauter vernünftige Mannsbilder.«
Auch der Direktor bekam solch eine Einladung. Er nahm sie an, trotz des Widerspruchs seiner Frau. Er war sogar froh darüber. Denn in letzter Zeit fühlte er sich ganz seltsam hingezogen zu dem Apotheker. Ihm war, als könnte dieser hagere Kerl mit dem verkniffenen Gesicht ihn durch seine Grobheit vor Mächten schützen, an die zu glauben er sich selbst nicht eingestand.
Es war ein schwüler Abend, der Regen hing über den Dächern und aus dem Gärtchen hinter der Apotheke quoll dicker Jasmingeruch, als Fräulein Minerva noch rasch vor Ladenschluss gelaufen kam. Sie hätte solche Kopfschmerzen. Ach nein, dieses Pulver hätte sie schon umsonst versucht. Und dieses auch. Und dieses auch. Der Apotheker wurde ungeduldig. Die Gesellschaft sollte in seinem Sommerhaus am Strand stattfinden und er musste doch als Erster dort sein. Er beugte sich vor – das arme Ding sah wirklich schlecht aus und hatte ausnahmsweise keine Zigarette im Mund. Plötzlich hing sie ihm am Hals: »Nehmen Sie mich mit. Fahren Sie nicht allein zu dieser grässlichen Gesellschaft!« Er schob sie von sich, sie kam ihm jung vor und hilflos, obwohl eigentlich sie es war, die ihn beschützen wollte. Er hatte sie immer für eine kluge Person gehalten. In seiner Verlegenheit stellte er ihr ein ganzes Medikamentenkästchen voll Beruhigungsmitteln und abführenden Tees zusammen.
Dann fuhr er sehr vergnügt in sein Sommerhaus hinaus. Wenn eine Frau, eine wirklich gescheite Frau, den Verstand verliert, dann kann das nur eine Ursache haben. Seinen Gästen ging (wie sie später zu erzählen pflegten) seine gute Laune erst auf die Nerven. Über dem Sund blitzte es und die Räume in dem kleinen Sommerhäuschen waren überladen mit zu schweren Möbeln. Die Herren hatten das Gefühl, mit jeder Bewegung wo anzustoßen. Ihre eigenen Stimmen kamen ihnen unerträglich laut vor. Sie wussten selbst nicht wie, aber plötzlich waren sie alle, auch der Fabriksdirektor, der als Letzter erschienen war, (komm gut nachhause, hatte seine Frau gesagt) in Hemdsärmeln. Sie stürzten sich auf das eisgekühlte Bier, sie tranken Whisky, Schnäpse, alles durcheinander. Sie lachten, spielten Grammophon und versicherten einander unentwegt, dass dies ein außerordentlich geglückter Abend sei.
Nur der Direktor war schweigsam. Er saß gegenüber der Wanduhr in einem Klubsessel, er beobachtete mit müden Blicken den Apotheker, der ein wenig betrunken war – nicht mehr, als es einen gebildeten Menschen kleidet. Es war zehn Minuten vor zwölf (aber vielleicht ging die Uhr nicht ganz richtig), als er mit seinen langen Beinen auf den Tisch sprang, dem Direktor zutrank und eine flammende Rede hielt, auf das göttlich klare Licht der Vernunft, das allen sogenannten Gedankenstrahlen standzuhalten vermöge. Er sprach von der finsteren Nacht der Verdummung, in deren Schoß die blasse Furcht gleich einem Gespenst –
Weiter kam er nicht. Einer der Herren packte ihn beim Arm. Der Direktor war in seinem Klubfauteuil zusammengesunken.
Ein Arzt, der auch zur Gesellschaft gehörte, griff nach seinem Puls.
»Vorbei«, sagte er.
»Und die Todesursache?«, fragte jemand mit leerer Stimme. Der Arzt zuckte die Achseln.
»Angst«, sagte der Apotheker.
Der Fall erregte ungeheures Aufsehen. In- und ausländische Journalisten belagerten die kleine Stadt. Die Polizei nahm sich nun endlich auch der Sache an. Die Mörderbriefe (denn dass es sich um Mörder handelte, konnte nun wohl niemand mehr bezweifeln) wurden untersucht. Eine eigene Kommission bemühte sich zur dritten Buche links. Ernste Männer versammelten sich unter den düsteren Schatten der geteerten Fischernetze. Ohne Ergebnis. Was weder die Baronin noch die okkultistischen Freunde, die sie plötzlich zu Besuch bekam, Wunder nahm. Dass die Ärzte bei der Obduktion einen Herzschlag feststellten, war selbstverständlich. Denn was wissen schon Ärzte?
Das Begräbnis fand unter einer solchen Teilnahme der Bevölkerung statt, dass es auf dem Friedhof beinahe zu einer Panik kam. So sehr es auch regnete, die Leute konnten ihre Schirme nicht offenhalten, dazu war kein Platz. Nur ein Mann stand allein, weil niemand neben ihm stehen wollte. Das war der Apotheker.
Er hatte schon in den letzten Tagen zu bemerken geglaubt, dass man seine Apotheke mied. Man warf schiefe Blicke auf ihn. Man wich ihm aus, reichte ihm nicht die Hand. Man war wohl böse auf ihn, dass er sich nicht auch so wie der arme Teufel, der Direktor, zum angekündigten Termin in den Sarg legen ließ? Oder? Der Apotheker stampfte mit dem Fuß in die feuchte Erde, rutschte aus und wäre beinahe auf ein Grab voll blühender Vergissmeinnicht gefallen. Ein Glück, dass Fräulein Minerva eben neben ihn getreten war und ihn festhielt.
»Kommen Sie«, sagte sie und spannte dabei ihren Schirm auf. Unter diesem verließen beide noch während der Rede des Pastors das Begräbnis.
Als sie dann sehr allein auf der Straße zwischen den verregneten Feldern gingen, sagte Fräulein Minerva: »Sie dürfen sich das nicht zu Herzen nehmen. Solche Gerüchte verschwinden auch wieder.«
»Was für Gerüchte? Hab vielleicht ich ihn umgebracht?«
»Nein. Aber es besteht kein Zweifel, dass Sie ihre zehntausend Kronen rechtzeitig unter die Buche legten.«
Der Apotheker blieb stehen: »Donnerwetter! Jetzt wird es mir aber wirklich zu dumm. Und wer hat Ihnen den Unsinn erzählt?«
»Niemand. Doch wir hatten heute viele Damen. So ein Begräbnis, das gibt zu tun wie ein Ball. Und vor meinem kleinen Lehrmädchen genieren sie sich nicht.«
Sie gingen schweigend weiter. Erst als sie in die ausgestorbene Stadt kamen, sagte er: »Jetzt gibt es nur eines. Den wahrhaft Schuldigen zu suchen.« Fräulein Minerva hielt den Kopf gesenkt: »Wahrhaft schuldig bin ich.«
Und nun kam es heraus. Sie war so aufgeregt gewesen an jenem Abend, so unruhig, so besorgt, sie war die halbe Nacht am Strand herumgelaufen. Sie war knapp vor zwölf an sein Sommerhaus herangeschlichen, hatte durch ein hellbeleuchtetes Fenster geguckt, als er eben auf dem Tisch stand und seine Rede hielt, niemand hatte sie bemerkt, nur der Direktor war aufgefahren, hatte sie angestarrt wie ein Gespenst –
Sie weinte, so wie junge und hilflose Frauen manchmal weinen, und er legte den Arm um sie und tröstete sie und suchte ihr zu erklären, dass nicht sie die wahrhaft Schuldige sei, sondern nur ein zufälliges Werkzeug der verfluchten Mörder, dass eine vorüberhuschende Katze, ein flüchtiger Regenschauer dasselbe Erschrecken bei dem zu Tode Geängstigten hätten auslösen können.
Während die ganze Stadt, ohne sich weiter Gedanken zu machen (Gedanken sind anstrengend) den Apotheker als einen Feigling betrachtete, der sein Leben von einer obskuren Gangsterbande erkauft hatte und diese so geradezu zu neuen Erpresserbriefen ermunterte (wer wird das nächste Opfer sein?), war er selbst von einer fixen Idee besessen: Er musste den Briefschreibern auf die Spur kommen. Die Untersuchungen der Polizei erschienen wenig aussichtsreich. Als er den Beamten den Vorschlag machte, der Baronin und ihrer ganzen spiritistischen Blase ins Haus zu rücken, begegnete er kühler Ablehnung. Es blieb nichts übrig, als die Sache selbst in die Hand zu nehmen.
Er saß in einer der grellgeblümten Zellen des Frisiersalons, wo es jetzt kaum mehr nach Shampoo roch, denn die Damen blieben aus. Er versuchte, Fräulein Minerva seine Theorie über den Fall auseinanderzusetzen. Denn ein Fall sei es, ein Krankheitsfall der ganzen Stadt. Und die seelischen Bazillen, die die Leute verseuchten, kämen aus dem Umkreis der Baronin, weshalb es nötig sei, sich mit der Person der Baronin des Näheren zu befassen. Man müsse jeden Einzelnen aufs Korn nehmen, der mit ihr in Verbindung gewesen sei, jeden, dem sie von ihren idiotischen Gedankenstrahlen erzählt hätte, jeden, der –
Weiter kam er nicht, denn er merkte, dass sich hinter dem grellgeblümten Vorhang etwas bewegte. Er griff zu. Es war das Lehrmädchen. Ihre Sommersprossen lagen dunkel auf dem erbleichten Gesicht.
»Das ist ja reizend«, sagte Fräulein Minerva. »Pflegst du zu lauschen? Übrigens, wie war denn das damals, als du der Baronin den Kopf verbrühtest. Was hat sie da gesagt?«
»Nichts. Sie hat gar nichts gesagt. Ich weiß nicht mehr. Ich erinnere mich nicht.«
»Aber Kind. Du hast es doch am selben Abend noch den Jungens auf dem Marktplatz erzählt.«
»Nein, nein, ich hab nie was erzählt.«
»Jetzt lügst du.«
Fräulein Minerva erinnerte sich plötzlich genau: Die Baronin war sehr böse gewesen, als die Kleine ihr zu heißes Wasser über das Haar gegossen hatte, die Baronin hatte geschrien, sodass man es durch den ganzen Salon hören konnte, dies sei nicht nur ein Missgeschick und sie hätte schon längst die bösen Gedankenstrahlen gespürt, die von dem Lehrmädchen ausgingen.
Dieses wurde jetzt an beiden Handgelenken von dem Apotheker festgehalten. Es zitterte, es weinte, es versuchte in Ohnmacht zu fallen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Apotheker, eben noch ein frisch gebackener Detektiv, sah sich auf einmal in der Rolle des Untersuchungsrichters. Wem hast du das erzählt? Wann? Wo? Und was haben deine Jungens dazu gesagt? Und wie sind sie auf die Idee gekommen? Und wo habt Ihr die Briefe geschrieben? Wolltet wohl Gangster spielen? Und warum gerade der Direktor und ich? Nur weil wir als erste im Telephonbuch standen? Euch sollte man alle –Als der Apotheker am selben Abend hocherhobenen Hauptes mit Fräulein Minerva am Arm seinen Spaziergang machte, fragte sie ihn: »Glaubst du wirklich an seelische Bazillen?«
»Natürlich. Ich sah dich ja selbst von ihnen verseucht. Übrigens, es stand dir nicht schlecht.«
Und er küsste sie auf offener Straße.
Ehrlich währt nicht stets am längsten
Als Mr. G. P. Merlin durchnässt von seinem Spaziergang in das Hotel zurückkehrte, empfing ihn der Direktor mit einem verstohlenen Lächeln: »Sie haben doch nichts dagegen, dass ich Ihnen ein besseres Zimmer anweisen ließ?«
»Wieso? Ich brauche kein besseres Zimmer.«
»Wollen Sie es nicht erst einmal sehen?«
Es war nicht nur ein besseres Zimmer, es war ein großartiges Zimmer, mit Schlafalkoven und eigenem Bad, mit Aussicht auf den Markt des Städtchens.
»Ich denke nicht daran, ein so teures Zimmer zu nehmen.«
»Es kostet Sie nicht mehr als das andere.«
»Aber –«
»Es wird mir eine Ehre sein.«
Der Direktor verbeugte sich und Mr. G. P. Merlin, Angestellter der Versicherungsgesellschaft Brinx & Co, Cincinnati, blieb allein in einer ihm sonst ungewohnten Pracht. Der Spaziergang, den er hinter sich hatte, war nicht eben erfreulich gewesen. Er hatte ihn absolviert wie eine sentimentale und dabei doch lästige Pflicht. Aber da er nun einmal in die alte Heimat gekommen war (wegen einer Erbschaftsangelegenheit, die auch nicht viel mehr einbringen sollte, als die Reise über den Ozean kostete) hatte er die kleine Stadt besuchen wollen, in der er seine frühe Kindheit verbracht hatte. Auch ein vernünftiger Mensch kann auf solche Gedanken kommen, obwohl ein vernünftiger Mensch wissen sollte, dass alles sich auf dieser Welt verändert und dass aus den winkeligen Gässchen der Knabenspiele langweilige Straßen werden, nicht wiederzuerkennen, besonders im Regen. Damals, vor vielen, vielen Jahren hatte zwar auch nicht immer die Sonne geschienen, aber bei solchem Wetter hatte man die Kinder wohl im Hause behalten.
Mr. G. P. Merlin tat etwas, was mit seinen sonstigen Lebensgewohnheiten wenig übereinstimmte: Er bestellte sich mitten am Vormittag einen heißen Grog. Denn ihm war, als bekäme er einen Schnupfen. Er trank den Grog, zurückgelehnt in einen bequemen Fauteuil, und er trank den Grog mit schlechtem Gewissen. Hatte er doch überhaupt ein schlechtes Gewissen, sooft er einen Vormittag ohne geregelte Arbeit verbrachte, und schon gar heute, in einer Umgebung, die seinen Verhältnissen in keiner Weise entsprach.
Warum setzte man ihn in dieses Zimmer? Und was bedeutete das verstohlene Lächeln des Direktors? Und was bedeutete es, dass nun plötzlich das Stubenmädchen zur Tür hereinkam, um ihm mit schwärmerischem Augenaufschlag einen Strauß Veilchen zu überreichen, große, duftende Veilchen, um diese Jahreszeit. Beigelegt war eine Karte, auf der in veilchenblauer Schrift nur ein Wort stand: Margareta.
Mr. G. P. Merlin fühlte sich schwindlig. War es der Grog, der Schnupfen, die überheizte Luft im Zimmer? Er kannte keine Margareta. Und nie im Leben hatte eine Frauensperson ihm Blumen geschickt. Da lag ein Irrtum vor, eine Verwechslung. Sollte er den Direktor rufen lassen, Erklärungen abgeben? Er war zu müde dazu, nieste und legte sich ins Bett.
Und das war das Klügste, was er tun konnte. Denn kurz darauf meldeten sich verschiedene Besuche, Namen, die er nie gehört hatte. Ein Glück, dass er krank war. Als aber gegen Abend auch noch ein Korb mit kostbaren alten Weinen kam und mit dem Begleittext: »Kopf hoch, alter Bursche, du brauchst dich nicht zu verstecken«, wurde ihm die Sache zu dumm. Er ließ sich den Direktor holen.
»Ich muss Ihnen sagen, dass da bedauerlicherweise ein Irrtum –«
»Gewiss, gewiss, ich war schon darauf vorbereitet. Aber Sie sind es, bester Herr Merlin, der sich in einem Irrtum befindet.«
»Ich?«
Der Direktor lächelte wieder sein verstohlenes Lächeln. »Sie werden sehen. Haben Sie übrigens noch irgendwelche Wünsche? Wollen Sie einen Arzt? Limonade? Darf ich Ihnen was aus der Apotheke besorgen?«
Es war nicht der erste Schnupfen in Mr. G. P. Merlins Leben. Aber es war das erste Mal, dass jemand sich so sehr um einen Schnupfen von ihm kümmerte. Weshalb er sich in seinem Bett zur Seite wandte wie ein verwöhntes Kind und nichts mehr sagte als: »Nein, danke.«
Am nächsten Morgen versäumte er es, um die gewohnte Stunde aufzustehen. Obwohl der Schnupfen schon viel besser war. Er blieb im Bett und gab sich über einem überwältigenden Frühstückstablett völlig überflüssigen Gedanken hin. Wofür man ihn wohl halten mochte? Für einen Tenor? Einen Fürsten, der incognito reiste? Einen mächtigen Staatsmann? Einen Filmschauspieler? Natürlich war er entschlossen, dem ganzen Zauber ein Ende zu machen. Er war ein anständiger Mensch. Korrekt. Immer gewesen. Bezahlte stets, was man von ihm verlangte. Viel war es nie. Er hatte nie viel Geld gehabt. Und das wenige sauer verdient. Er dachte nicht daran, sich jetzt für einen großen Herren auszugeben.
Da brachte man ihm einen Brief. Herrn Peter Merlin. Peter? Wieso Peter? G. P., seit vielen, vielen Jahren nur G. P., Mr. G. P. War dieser Brief für ihn bestimmt? Nach seinem Inhalt sicher nicht. »Wenn Sie die Frechheit haben sollten, noch länger hier in unserer Stadt zu verweilen ..... etc.« Unterschrieben: »Ein paar empörte Bürger.«
Das war ja reizend. Ein Drohbrief oder so was Ähnliches. Mr. G. P. war jedoch gar nicht sehr erschrocken. Er betrachtete die Veilchen, die in einem Glase neben ihm standen, den Korb mit den Weinflaschen. Sollte es Leute geben, die ihn hassten, so gab es doch jedenfalls auch solche, die ihn liebten. Und beides war ihm neu. Wenn es auch, genau besehen, Gefühle waren, die einem anderen galten, sie kitzelten ihn, sie erregten ihn. Trotzdem raffte er sich endlich auf als vernünftiger Mensch, bestellte ein Bad, machte sorgsam Toilette. Sollte er nochmals mit dem Direktor sprechen? Oder, falls das nicht half, auf der Polizei seine Identität eindeutig feststellen lassen?
Da meldete das Stubenmädchen eine Dame. Eine Dame? Was für eine Dame? Ach, das konnte ja nur Margareta sein. War es nicht am klügsten, sie zu empfangen? Sie brauchte ja nur einen Blick auf ihn zu werfen – und außerdem, wie sie wohl aussehen mochte, diese Margareta?
Sie war sehr jung, sehr schlank, sehr aufgeregt, stürzte einfach auf ihn zu: »Wo ist meine Mutter?«
»Ihre Mutter?«
»Sie können sich wohl denken, wer ich bin.«
»Margareta.«
»Margareta? Ich heiße so wie meine Mutter. Harriet.«
»Und Sie erkennen mich?«
»Erkennen? Herrgott, ich lag doch noch in meinen Windeln, als –«
»Ja, für wen halten Sie mich dann?«
»Für das Ungeheuer, das Sie sind.«
Worauf sie beide Hände vor das Gesicht schlug und zu weinen begann. Noch nie in seinem Leben hatte eine Frau seinetwegen geweint. Er hob den Kopf, sah sich im Spiegel. Er lächelte. Oder lächelte ein anderer aus ihm heraus? Jedenfalls war es unpassend, in diesem Augenblick zu lächeln. Man musste schon so etwas wie ein Ungeheuer sein.
»Ich schwöre Ihnen, dass ich nichts von Ihrer Mutter weiß.«
»Dann haben Sie sie also auch im Stich gelassen.«
Sie stand auf und schien plötzlich ruhig. »Eigentlich hab ich es nicht anders erwartet. Ich wollte es nur wirklich wissen. So wie ich wissen wollte –«
Sie betrachtete ihn lange und eingehend. Und er verstand, dass hier ein junges Mädchen den Mann betrachtete, der ihm die Mutter genommen hatte, dem Vater die Frau. In ihrem Blick mischten sich Hass und Bewunderung. Was sollte er da viel erklären. »Es tut mir leid«, sagte er, aber er wusste selber nicht, was ihm eigentlich leidtat.
»Niemand darf von meinem Besuch erfahren. Mein Vater nicht und nicht mein Bräutigam. Aber wenn Sie mir vielleicht einmal von meiner Mutter was erzählen wollten –«
Damit verschwand sie. Sollte das heißen, dass sie wiederkommen würde? Hätte er sie dazu auffordern sollen?Jedenfalls, er war entschlossen, abzureisen. Es blieb ja gar nichts anderes übrig. Obwohl ihm graute vor der langweiligen Hafenstadt, wo er nun in seiner Einsamkeit abwarten sollte, dass das Schiff ging. Und obwohl er gerne noch in Erfahrung gebracht hätte, mit wem er hier verwechselt wurde.
Seine Familie war nach Amerika ausgewandert, als er ein Knabe war. Sollte es entfernte Verwandte seines Namens im Lande geben? Er wusste nichts davon. Aber als nun ein Herr Boman ihn unbedingt und dringend zu sprechen verlangte, hoffte er, vielleicht durch diesen nähere Auskünfte über den echten Peter Merlin zu bekommen.
»Mein Name braucht Sie nicht zu erschrecken, sagte Herr Boman.«
»Oh gewiss nicht.«
»Boman junior. Ich gebe Ihnen sogar die Hand.«
»Sehr freundlich. Darf ich fragen, ob Sie mich kennen?«
»Kennen? Herrgott, ich lag doch noch in meinen Windeln, als –«
Herr Boman unterbrach sich und warf eine Aktentasche auf den Tisch. Es war tatsächlich noch nicht besonders lange her, dass er in seinen Windeln gelegen hatte, sein Knabengesicht war ernsthaft und unbeirrbar. Zur Sache bitte. Aus der Aktentasche flogen Papiere, Berechnungen, Vorschläge in schwindelnden Summen. Da die Gründung einer neuen Aktiengesellschaft Merlin so gut wie sicher sei und da Herr Merlin der Firma Boman immerhin einigermaßen verpflichtet sei, die Firma habe sich von dem Krach zwar wieder erholt in alle den Jahren, der alte Herr sei allerdings noch etwas böse, aber wenn man wirklich das Elektrizitätswerk wieder errichten wollte, mit sicherem Kapital und nicht wieder mit Luftgeldern, und mit soliden Wasserkräften, statt der damaligen nebulosen Sonnenkräfte .....
G. P. Merlin, der echte Merlin (oder der falsche vielmehr) betrachtete den jungen Mann vor sich, wie der so weiterredete. War das ein losgelassener Dichter voll blühender Phantasie, ein künftiger Industriemagnat? Unmöglich, zu verstehen, was er wollte. Vor allem für einen Angestellten der Versicherungsgesellschaft Brinx & Co, die nur einfache Geschäfte kannte, nüchterne Zahlen. Was sollte man da nur entgegnen? Am besten war es wohl, bei der Wahrheit zu bleiben.
»Was immer Sie von mir erwarten, ich schwöre Ihnen, ich habe überhaupt kein Geld.«
»Geld? Ein Mann wie Sie braucht doch kein Geld. Übrigens, falls Sie augenblicklich in Verlegenheit sein sollten –« Und Boman junior zückte seine Brieftasche. Dann gab es eine lange Pause.
»Sie wollen also nicht?«
»Was soll ich wollen?«
»Dass die Firma Boman Teilnehmer Ihrer Gesellschaft wird.«
»Wenn ich Sie recht verstehe, so soll ich diese Firma ja schon einmal zugrund gerichtet haben. Und die Firma hat sich inzwischen erholt?«
»Ja, aber nur in bescheidenem Maßstab. Wenn wir jedoch von Neuem beginnen, die ganze Gegend wartet nur darauf. Sie sind doch auch deshalb zurückgekommen. Das weiß ein jeder.«
Jetzt wäre wohl der rechte Augenblick gewesen, um zu sagen: Es tut mir leid, aber ich bin nicht der, den Sie meinen. Ich bin G. P. Merlin aus Cincinnati, ein bescheidener Angestellter, ein anständiger Mann, ein kleiner Mann. Wenn man jedoch als anständiger kleiner Mann plötzlich vor unbegrenzten Möglichkeiten steht, und das alles nur, weil man für einen großen Schwindler gehalten wird, einen Hochstapler und Frauenverführer, so überlegt man sich die Sache.
Herr Merlin verabschiedete Herrn Boman junior mit dem Versprechen, sich die Sache zu überlegen.
Und damit begann für ihn eine aufregende Epoche. Wie ein Ertrinkender im letzten Augenblick sein ganzes Leben vorüberziehen sieht, sah er nämlich mit einem Mal, ertrinkend im Strom der unbegrenzten Möglichkeiten, seine ganze Vergangenheit, geregelt, ordentlich, erstickend brav, freudlos und mutlos. Was hatte ihm die Welt dafür geboten? Was bot sie jenem anderen, mit dem man ihn verwechselte?
Er ging hinaus auf die Straße, wo die Sonne grell und lustig schien. Kopf hoch, alter Bursche, du brauchst dich nicht zu verstecken. Um seinen Mund spielte das leichtsinnige Lächeln der Glücksritter: Erkennt Ihr mich? Erkennt Ihr mich nicht? Und natürlich erkannten sie ihn. Alte Freunde klopften ihrem Peter auf die Schulter. Ach, er hat sich ja gar nicht verändert. Kaum. Oder doch. Ein wenig. Amerikanisiert. Wer bleibt sich gleich in achtundzwanzig Jahren? Achtundzwanzig Jahre sind eine Zeit, lange genug, dass ein Mythos sich bilden kann. Und der Mythos des großen Peter Merlin war der ewige Mythos des goldenen Zeitalters. In seinen Tagen hatte man noch zu leben verstanden, rauschende Feste lösten einander ab, Geld spielte überhaupt keine Rolle. Ein ungeheures Elektrizitätswerk sollte errichtet werden, die Kräfte strömten aus der Sonne selbst. Paläste statt der Mietshäuser, jeder einzelne ein Millionär, die Kleinstadt wird zur Metropole, das Land ringsum zum Paradies. Und dann kam ganz so wie immer die Sintflut, der Untergang. War es die Schuld des großen Merlin? Was nützte es, darüber nachzudenken. Er verschwand und hinterließ einen Haufen unermesslicher Schulden, gebrochene Frauenherzen und den unverwüstlichen Glanz seines Namens.
Nun war er wieder da und es schien wie ein Wunder. Gleich einem von den Toten Auferstandenen ging es herum. Einem solchen misst man auch nicht die Nasenlänge ab oder die Schulterbreite. Peter Merlin war wieder da und ihn umflackerten die alten unerfüllten Träume. Eine Aktiengesellschaft sollte gegründet werden oder bereits gegründet worden sein, man sprach allgemein von dem Elektrizitätswerk, von der Firma Boman, die sich an erster Stelle dafür einsetzen wollte, man sprach von schönen Frauen, nächtlichen Gelagen, von Champagner, wildem Spiel und frecher Leidenschaft. Man sprach so manches .....
Und Peter Merlin, der nun gar nicht mehr ein bescheidener kleiner Mr. G. P. aus Cincinnati sein wollte, führte das Leben eines großen Mannes. Er war charmant und hochmütig und launenhaft, je nach Bedarf. Dass es auch weiterhin »empörte Bürger« gab, die ihn gern ins Gefängnis bringen wollten, störte ihn wenig. Er fühlte sich dadurch umso sicherer in seiner Rolle.
Bis es zum Fest beim Bürgermeister kam. Es sollte ein großes Fest werden, ein rauschendes, so wie in den gewissen goldenen Zeiten. Und Herr Merlin war selbstverständlich eingeladen. Als er in der Garderobe des Rathauses die Brieftasche öffnete, fiel sein Schiffsbillet heraus: Am nächsten Tag sollte er eigentlich reisen. Er schüttelte den Kopf und lächelte. Er war ja so zuhause hier in all dem Glanz, der Wärme und dem Überfluss. In jeder Ecke erwarteten ihn neue Freunde. Alte Freunde?
Herr Boman junior trat auf ihn zu: »Darf ich Sie mit meiner Braut bekannt machen?« Und Fräulein Harriet tat, als hätte sie den großen Mann niemals gesehen oder gar als Ungeheuer bezeichnet. Sie war eingeweiht in alle Pläne ihres Bräutigams, redete darüber mit einer entzückenden Leichtigkeit, nur dass sie sich dann plötzlich unterbrach, um Herrn Peter Merlin zu fragen: »Was will denn diese Veilchenblaue?«
Ohne diese Frage hätte er wohl kaum bemerkt, dass eine Dame in veilchenblauem Kleid, groß, üppig und mit grauem Haar, ihn verfolgte. Sie kam in jeden Raum, den er betrat, starrte ihn an mit durchdringendem Blick. Das konnte doch nur Margareta sein. Endlich! Sooft eine Frau sich ihm genähert hatte in letzter Zeit (und das war nicht selten gewesen), hatte er gehofft, es würde Margareta sein. Diesmal war er fast sicher. Und mit dem Siegerlächeln, das er sich kürzlich erst erworben hatte, trat er auf sie zu.
»Sie Schwindler«, zischte sie. Und wandte sich ab.
Das war alles. Oder? Wieso? Was meinte sie? War er ein Schwindler, weil er sie betrogen hatte? Oder? War er ein Schwindler, weil er vorgab, der zu sein, der sie betrogen hatte? Ach, sie sah aus, als hätte sie sich einmal auf die Kunst verstanden, geliebte Lippen mit Leidenschaft zu küssen. Und so geküsste Lippen vergisst man nicht.
Wenn sie ihn jetzt verraten wollte, wenn er gestehen musste, wer er wirklich war, kein Glücksritter, kein Abenteurer, sondern ein einfacher, bescheidener, ein anständiger kleiner Mann, ein guter Bürger, der jeden Ersten seine Monatsmiete zahlte, seine Steuern in Ordnung hielt, niemandem etwas schuldig blieb, sei es nun Geld, Treue oder Zärtlichkeit, wenn er gestehen musste, dass er niemals eine ganze Stadt betrogen hatte oder auch nur falsche Hoffnungen erweckt – die Schande war nicht auszudenken.
Mit unsicheren Schritten ging er durch die festlichen Räume. Seine Schultern wurden schmal, der Rücken krümmte sich. In jedem Blick, der ihn jetzt streifte, fürchtete er verstecktes Misstrauen. Aber das war doch Unsinn. Er war und blieb Merlin, der große Peter Merlin, er war nicht mehr der kleine G. P. aus Cincinnati. Wer sollte je das Gegenteil beweisen?
»Ein Gläschen, Herr Merlin?«
»Oh ja, ein Gläschen, viele Gläschen, so viele als der echte Peter Merlin getrunken hätte, von dessen Saufgelagen man heute noch nach sechsundzwanzig Jahren sprach. Das wärmte, das gab Mut. Prost, meine Herren! Das Leben ist nur kurz, die Hoffnungen sind alles. Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie mir blind. Denn nur auf das Vertrauen kommt es an. Prost!«
»Prost, alter Peter.«
Es war ein herrlicher Abend, eine großartige Nacht. Wenn er sich recht erinnerte, so saß Fräulein Harriet einmal auf seinen Knien. Oder war es eine andere? Er zerschlug ein Glas, küsste eine nackte Frauenschulter. Das Fest wollte kein Ende nehmen. Und als er dann in der Morgendämmerung vor dem Spiegel stand, den Zylinder schief auf dem Kopf und eine fette Zigarre im Mund, war er so ganz der große Merlin.
Nur störte es, dass hinter ihm jemand stand wie ein riesiger Schatten.
»Wünschen Sie etwas von mir?«
»Dass Sie sofort aus der Gegend verschwinden.« Und der Schatten packte ihn ganz einfach beim Kragen.
»Herr, Sie wissen wohl nicht, wer ich bin.«
Der Schatten lachte und war überhaupt kein Schatten, sondern ein großer dicker Mann. »Natürlich weiß ich es. Ein kleiner Vetter. Hab dich ja noch als Kind gekannt. Denn der große, der große Peter Merlin, das bin ich.«
Ach, dass man plötzlich so ungeheuer nüchtern werden kann. Und so in sich zusammenschrumpfen.
»Stopft sich da aus mit meinen Jugendsünden. Was fällt dir ein, du elendes Gewürm?«
»Ich dachte nur –«
»Dass es mich nicht mehr gibt. Aber da irrst du dich. Ich bin ein anständiger Mensch geworden. Name geändert, Leben geändert. Familienvater. Glaubst du, ich warte, bis dein plumper Schwindel auffliegt und man vielleicht den echten alten Hochstapler zu suchen beginnt?«
Und der große Merlin packte den ganz klein Gewordenen nochmals beim Kragen. »Zwölf Stunden bin ich gereist, um mir dein Affentheater hier zu betrachten. Und morgen bist du fort von hier.«
Ja, da war nichts zu machen. Mr. G. P. griff nach seinem Herzen, denn über diesem lag die Brieftasche mit dem Schiffsbillet. Am nächsten Tag war er verschwunden, ohne seine Hotelrechnung bezahlt zu haben und mit Hinterlassung vieler Schulden.
Raskolnikow in der Pension
Den ganzen Nachmittag waren wir auf der Suche nach einer Pension gewesen. Uns graute vor der standardisierten Traulichkeit, der wir überall begegneten, vor den wulstigen Lampenschirmen, den gestickten Deckchen. Schließlich blieb nur eine Adresse mehr übrig. Wir hatten sie bis zuletzt aufgehoben, denn der Preis war lächerlich billig. Was konnte das schon sein? Eine Studentenherberge bestenfalls.
Wir waren erstaunt, als wir bemerkten, dass wir uns in einem der vornehmsten Viertel der Stadt befanden. Noch mehr staunten wir, als wir das Haus betraten. Es glich einem alten Palais. Sollte das ein Irrtum sein? Nein, die Nummer stimmte. Wir trauten uns kaum zu klingeln und erschraken ordentlich, als ein altes Mädchen mit weißem Häubchen die Tür öffnete. Sie war von jener Feierlichkeit, wie sie nur hochherrschaftlichen Dienstboten oder Leichenbittern eigen ist.
Ach Gott, wir versuchten zuerst einmal uns zu entschuldigen. Wo war hier nur eine Pension, die in der Zeitung annonciert hatte?
»Eine Pension sind wir eigentlich nicht, aber wenn Sie bei uns wohnen wollen, die Baronin ist zu sprechen.«
Gleich darauf standen wir vor der Baronin. Sie saß in ihrem Lehnstuhl wie in einer Karosse, umgeben von Ahnenbildern an der Wand, eine Baronin aus den achtziger Jahren, in Szene gesetzt von einem übereifrigen Regisseur. Und sie empfing uns mit wohlwollender Herzlichkeit. Natürlich könnten wir ein Zimmer haben, ein schönes Zimmer sogar war zufällig frei. Emilia sollte uns das Zimmer zeigen und die Nebenräume und den Speisesaal, falls wir uns gleich entschließen möchten, für morgen schon ...
Das alte Mädchen zeigte uns das Zimmer und wir fühlten uns wie Jagdgäste auf einem Herrenhof. Wir sahen auch im Speisesaal eine gedeckte Tafel voll Silber und Porzellan unter einem überwältigenden Kristallluster. Das Ganze war, wenn überhaupt eine Pension, so eine Luxuspension, jedenfalls nichts für uns, und der Preis konnte nur durch Zufall in die Zeitung gerutscht sein.
Die Baronin, die weiterhin in ihrem Lehnstuhl saß – war sie gelähmt oder nur so schwerfällig in ihrer bleichen körperlichen Überfülle? – unterbrach uns, kaum dass wir stotternd über den Preis zu reden begannen. »Ich will es Ihnen gern auch billiger lassen.«
Wir starrten sie an. Nein, es war kein Druckfehler gewesen und der Preis stimmte, jener Preis, der uns auf eine Studentenherberge vorbereitet hatte.
Die alte Dame lächelte ein wenig von oben herab. »Ich habe eine Vorliebe für mittellose Leute. Sie sind doch nicht wohlhabend?«
»Oh, gewiss nicht.«
Und damit verabschiedeten wir uns mit dem Versprechen, morgen wieder zu kommen. Wir warfen noch einen Blick auf die gedeckte Tafel, ein sanfter Bratenduft zog durch die Räume, im Vorzimmer stand ein junges Ding, rothaarig, es legte eben den Mantel ab und flüsterte uns dabei zu: »Ich warne Sie.«
Emilia öffnete die Tür mit einer Totenwächtermiene, wir taumelten über die Treppen, hätte nicht jeder von uns die unheimlichen Worte gehört, wir hätten unseren Ohren nicht getraut.
Wir schliefen so unruhig, wie man nicht vor einer Übersiedlung in einen anderen Stadtteil schläft, sondern vor einer Reise in ein wildes und abenteuerliches Land. Kaum waren wir auf, so wurden wir auch schon ans Telefon gerufen. Man teilte uns mit, dass die Baronin uns punkt zehn erwarte, nicht früher und nicht später.
Wir kamen also zur Minute, packten unsere Koffer aus, wunderten uns nochmals über die gewaltige Vornehmheit, verschoben die Betten, stellten den Tisch vor das Fenster, wie das eben so ist, wenn man wo einzieht. Bis auf einmal nach kurzem Klopfen die Baronin persönlich ins Zimmer kam. Sie warf einen Blick um sich, lächelte dann, wenn auch nicht ganz so herzlich wie am Tag vorher, und verlangte die Miete. Für drei Monate.
Für drei Monate?
Ja, selbstverständlich. Die Baronin betrachtete uns voll mitleidiger Würde. Bei diesem Preis. Wo anders müssten wir das Dreifache zahlen. Für dieses Zimmer.
Sie hatte recht, vollkommen. Jedenfalls, wir zahlten alles, was sie verlangte, so wenig uns auch dann zurückblieb. Sie bat uns noch, rechtzeitig zum Lunch zu kommen, schob das Geld mit der Bewegung einer großen Katze in die Tasche ihres Schlafrocks und schlürfte hinaus. Da saßen wir nun in unserer herrschaftlichen Pracht, aber ach, die hohen Wände schienen einzuschrumpfen, wir fühlten uns gefangen wie in einer Zelle.
Allerdings, die Mahlzeit, die uns kurz darauf geboten wurde, schien nicht eben für Sträflinge bestimmt. Emilia servierte eine Auswahl von raffinierten kleinen Speisen auf Silber und Porzellan, die Baronin sorgte für höfliche Konversation und die übrigen Gäste beteiligten sich daran mit gedämpfter Stimme. Dabei sprach jeder nur zu der Baronin, die gleich einem Magneten jeden einzelnen Satz an sich zu ziehen schien. Wir kamen kaum dazu, unsere Tischgenossen näher zu betrachten, sie waren wohl alle bescheidene Leute, Ausländer, ein ältlicher Franzose, ein deutscher Doktor, ein düsterer junger Russe und das rothaarige Mädchen, dem wir tags zuvor begegnet waren. Es warf hin und wieder einen Blick auf uns und benahm sich im Übrigen wie ein Schulkind, das Angst hat, einen Teller zu zerbrechen. Nach seiner Aussprache war es eine Engländerin.
Wir wollten uns nicht recht eingestehen, wie verwirrend die ganze Atmosphäre auf uns wirkte. So gingen wir einmal spazieren. Und als wir zurück in unser Zimmer kamen, fanden wir Emilia eben im Begriff, alles umzuräumen. Warum? Die Möbel hätten so zu stehen, wie die Baronin es wünsche, war die Antwort. Warum? Emilia sah uns an, als hätten wir den Verstand verloren: »Das Zimmer gehört doch der Baronin.«
Ja, das Zimmer gehörte der Baronin, und das Telefon, das man bestenfalls drei Minuten lang unter ihrer Kontrolle benützen durfte, die Luft in der Wohnung, die durch Zigarettenrauch nicht verpestet werden sollte, unsere Schritte, die ja nicht zu laut sein sollten, ja, sogar unsere Gedanken, die nun abgelenkt von jeder vernünftigen Arbeit sich immerfort mit diesem merkwürdigen alten Frauen zimmer beschäftigten. Was wollte sie von uns? Wozu das alles? Wer waren die anderen, unsere Mitgefangenen?
Wir erwogen eben diese Frage, als es schüchtern an die Tür klopfte. Die kleine Engländerin schlüpfte herein, nicht ohne rasch noch einen Blick hinter sich zu werfen. Ob wir sehr traurig seien? Nun, man gewöhnt sich an alles und ewig dauert es ja nicht. Und sie wollte uns nur darauf aufmerksam machen, dass es um die Ecke rechts bei dem Autostand eine kleine Kaschemme gäbe –
Weiter kam sie nicht, denn es klopfte wieder, und diesmal erschien die Baronin in einem lila Schlafrock, voll strahlender Liebenswürdigkeit. Sie ließ sich bei uns nieder, eine Schlossherrin, die ihre Gäste beehrt, und sprach vom Wetter, der Teuerung, der Unzuverlässigkeit der Dienstboten und der Verderbnis der modernen Jugend. Sie bestellte Tee und Kuchen und Brötchen und Marmelade und wir verbrachten ein paar schaurige Stunden mit ihr. Die Engländerin hatte sich rechtzeitig mit einer verlegenen Entschuldigung gedrückt. Wo war sie nur? In der Kaschemme?
Am nächsten Abend suchten wir die Kaschemme jedenfalls auf. Und richtig, in einer Ecke dieser verrauchten Höhle, gedeckt von den guten breiten Rücken einiger Chauffeure kauerte unsere kleine Engländerin zusammen mit dem deutschen Doktor. Sie empfingen uns wie ein paar schon längst erwartete Verschworene.
Und wovon war die Rede? Von der Baronin, natürlich nur von der Baronin. Was wollte sie von uns? Der Doktor hatte seine eigene Theorie: Die Baronin stand im Dienst einer Geheimpolizei, sie sammelte Ausländer, um sie zu beobachten. »Unsinn«, sagte die rothaarige Engländerin, »sie sammelt Ausländer, weil die Eingeborenen ihr nicht auf den Leim gehen. In jedem Lande kennt man die eigenen Hexen. Übrigens«, und damit wandte sie sich an uns, »auf wie lange sind Sie verurteilt?«
Wir erfuhren, dass der deutsche Doktor nur mehr vier Wochen abzusitzen hatte, während Raskolnikow, der Unglückliche, einen Vertrag auf sechs Monate unterzeichnet hatte, aus Begeisterung über einen wunderbaren Renaissanceschreibtisch. Raskolnikow war der junge Russe, er hieß zwar nicht Raskolnikow, selbstverständlich nicht, sondern irgend etwas Unaussprechbares, man nannte ihn nur so, weil er –
Hier legte die Engländerin den Finger an die Lippen, denn hinter den Chauffeuren erschien soeben der Russe, bleich und unrasiert. Auf eine Erklärung seines Namens brauchten wir nicht länger zu warten, denn kaum saß er bei uns, so sprudelte er auch schon über von Mordgelüsten. Er war fest entschlossen, die Alte zu erschlagen, nicht vielleicht, weil er sich nicht beherrschen konnte, sondern, wie er immer wieder erklärte, aus Prinzip. Gegen Tyrannei, ob sie sich nun im Großen offenbarte, in Staaten oder Kontinenten oder in einer verrückten kleinen Pension, gäbe es nur ein Mittel: die Gewalt.
Wir wussten nicht, ob wir ihm widersprechen, wir wussten nicht, ob wir ihn überhaupt ernst nehmen sollten. War es nicht lächerlich, dass wir uns so völlig aus dem Gleichgewicht bringen ließen, nur weil unsere tägliche Freiheit einigen ganz unbeträchtlichen Einschränkungen unterworfen war? Ob der Tisch nun an dem Fenster stand oder nicht, war das so wichtig? War es nicht lächerlich, dass wir hier wie ein paar aufsässige Schulkinder beisammen hockten, anstatt uns wohl zu fühlen in der Pracht der fürstlichen Räume, die uns zur Verfügung standen? Und war es nicht lächerlich, dass wir spät nachts mit schlechtem Gewissen diese Räume endlich aufsuchten und dabei ordentlich erschraken, weil die Baronin in der hell erleuchteten Hall saß und uns mit strengen Blicken musterte? Wir hörten sie noch bis gegen Morgen durch die Gänge schlürfen, wir spürten, wie sie vor den Türen Halt machte, um zu lauschen.
Aber am nächsten Tag hatte Emilia verweinte Augen wegen eines verschwundenen Handtuchs, und wir waren dabei, wie dem kleinen Franzosen, der sich von Sprachunterricht ernährte, bedeutet wurde, dass er seine Schülerinnen nicht bei sich empfangen dürfe. Damenbesuch nannte man das. Wir wurden gebeten, sehr höflich übrigens, nachts nicht später als um halb zwölf nachhause zu kommen, um unsere Mitmenschen nicht im Schlaf zu stören. Wir wurden noch um einiges andere gebeten. Und es war nicht zum Aushalten.
Ständig gereizt und außerstande, überhaupt noch was Vernünftiges zu denken, gerieten wir in einen Zustand von Verlotterung. Wir lasen nur mehr Detektivromane, spielten Karten, schwänzten, sooft es anging, die kostbaren Mahlzeiten und knabberten Keks. Je mehr wir uns von der Baronin zurückzogen, desto mehr fühlten wir uns beobachtet. Und dazu kam, dass die rothaarige kleine Engländerin uns ständig in Atem hielt. War sie doch überzeugt, dass Raskolnikow aus seinen immer wilder werdenden Drohungen Ernst machen würde.
Wir verloren jede Distanz zu den kleinen Geschehnissen des Alltags, sie schienen riesengroß geworden und wichtig, wichtig genug, um Mord und Totschlag zu verursachen. Weshalb wir uns auf stundenlange und verworrene Diskussionen einließen, in denen wir Raskolnikow zu beweisen suchten, dass es weder in seinem eigenen noch im Interesse der Weltordnung unbedingt nötig sei, die Alte zu erschlagen.
Sonderbarerweise durfte er sich dabei mehr erlauben als wir anderen. Er ging mit schweren Schritten durch die Gänge, rauchte schamlos seinen groben Pfeifentabak und benützte das Badezimmer, sooft er sich die Hände waschen wollte. Die Baronin sagte nie etwas zu ihm. Sollte sie seine dunklen Absichten ahnen? Und er kam nur zufällig dazu, als sie dem hilflosen kleinen Franzosen mitten in der Marseillaise das Radio vor der Nase abdrehte.
Raskolnikow sprach kein Wort. Er nahm den alten Mann unter den Arm und zog ihn mit sich. Die beiden erschienen nicht zum Essen, ohne sich entschuldigt zu haben. Die Baronin redete die ganze Mahlzeit hindurch über den Wert von guten Manieren und gepflegten Lebensformen. Es sei doch merkwürdig, dass nicht einmal ein Milieu wie das ihre auf gewisse Leute abzufärben vermöge, wenn man sich ihrem seligen Vater gegenüber je so benommen hätte, er allerdings wäre nie auf den Einfall gekommen, Krethi und Plethi zu sich ins Haus zu nehmen, und einen Menschen wie diesen Franzosen hätte er in die Küche gesetzt, wenn nicht gleich in den Stall –
In diesem Augenblick ließ Emilia einen Teller fallen. Aus Ungeschicklichkeit? Sie stand vor uns und ließ den Teller einfach fallen. Die Baronin warf nur einen Blick auf sie. Und wir alle wussten: Heute passiert etwas.
Natürlich gingen wir nachher in die Kaschemme, wo wir Raskolnikow mit dem Franzosen fanden, bei Wurst und Bier. Der Franzose hatte seine Brieftasche offen vor sich liegen, mit Geld, gar nicht so wenig Geld, und war strahlend vergnügt. Er hatte seine Uhr verkauft, ein Erbstück, ein kostbares und zärtlich geliebtes Erbstück sogar, und war entschlossen, auszuziehen. Morgen schon. Vielleicht auch noch heute.
Raskolnikow war dagegen. Aus Prinzip. Dieser Bestie auch noch was schenken! Erschlagen sollte man sie, erschlagen und berauben. Und damit waren wir wieder bei unserem ewigen Thema angelangt: Was wollte sie von uns, warum, wozu das alles? Wozu holte sie sich, um ihren eigenen Ausdruck zu gebrauchen, Krethi und Plethi in ihr fürstliches Haus?
Wir waren mitten in der Debatte und der deutsche Doktor fabulierte von seiner Geheimpolizei, als wir plötzlich stockten. Hinter den Rücken der Chauffeure erschien ein Gesicht, bleich und starr – war es möglich, war sie ausgeschickt worden, um uns zu holen, oder – Aber auf einmal jubelten wir alle ihr zu und Emilia lächelte. Es war kaum zu glauben, dieser alte verbissene Totenkopf lächelte, worauf auch die Chauffeure ihr zuwinkten, als wäre sie ein reizendes junges Mädchen. Emilia wurde empfangen und begrüßt, und damit war der Aufstand der Sklaven eingeleitet.
Denn zu Sklaven waren wir geworden, sämtliche Eigenschaften dieser jämmerlichen Menschenkategorie hatten sich in uns entwickelt, wir waren boshaft und tückisch, schadenfroh, gehässig und feig. Wir trauten uns gar nicht mehr nachhause, wir hielten auch Raskolnikow zurück, der ab und zu erklärte, jetzt eben sei der rechte Augenblick für ihn gekommen. Als die Kaschemme geschlossen wurde, zogen wir durch die Stadt. Es war eine milde Nacht, die Straßenlampen schwebten gleich überflüssigen Attrappen in dem apfelgrünen nordischen Himmel, auf den Bänken kauerten Liebespaare, wir vertrieben uns die Zeit in einem Wartesaal und plötzlich waren wir so hoffnungslos übernächtigt wie Kinder auf einer Reise.
Als wir betäubt von einer Art Katzenjammer über die Treppen unseres vornehmen Hauses schlichen, waren wir alle nicht viel anders als Raskolnikow. Die Baronin sollte es nur wagen, uns mit einem Wort des Vorwurfs zu begegnen, sie sollte es wagen, uns überhaupt um diese Stunde zu begegnen. Wir stockten vor der Tür.
Und dann saß die Baronin in der Hall. Neben ihr in den hohen Leuchtern brannten zwei Kerzenstümpfchen, während eine weiße Sonne durch die Gardinen brach. Sie starrte vor sich hin mit einem Blick, so tot, so ausdruckslos, dass wir nicht wussten, ob sie wirklich lebte. Und schon wollten wir den kleinen Franzosen zurückhalten, als er mit vorsichtigen Schritten auf sie zutrat.
»Madame sollten schlafen gehen«, sagte er.
Seine Stimme klang voll Besorgnis. Ein Zucken überlief den bleichen schweren Körper der Baronin und in diesem Augenblick verstanden wir, weshalb, warum, wieso sie ihr groteskes Spiel mit uns trieb. Denn vor uns saß eine riesige Urmutter der Vorzeit, verlassen von ihren Kindern, von ihrem Hausstand und von ihrem Clan, den wir ihr zu bedeuten hatten. Neben den beiden flackernden Kerzenstümpfchen saß sie in all der Pracht ihres Reichtums, elend und arm und voll Grauen vor der eigenen Einsamkeit.
Wir gingen auf unsere Zimmer, während Emilia sich um die Herrin bemühte.