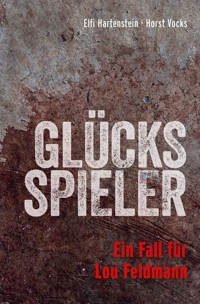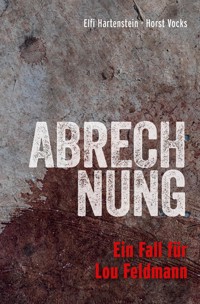7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der 12-jährige Sohn eines brandenburgischen Großgrundbesitzers und engagierten Naturschützers ist entführt worden. Zur Unterstreichung ihrer Lösegeldforderung schneiden die Entführer dem Jungen einen Finger ab. Da er Bluter ist und in Lebensgefahr schwebt, kidnappen die Entführer eine eng mit Lou Feldmann befreundete Ärztin. Dadurch wird Feldmann in die Mittlerrolle gedrängt. Bald begreift er, dass die Lösegeldforderung nur ein Vorwand ist für andere Geschäfte. Im Hintergrund agieren Neonazis, die scheinbar ein anderes Spiel spielen. Als Feldmann die Zusammenhänge aufdeckt, löst er eine Familientragödie aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
ELFI HARTENSTEIN, HORST VOCKS
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte sind die Autoren verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autoren.
© 2024 Elfi Hartenstein, Horst Vocks · elfi-hartenstein.de
2. komplett neu überarbeitete Auflage
Elfi Hartenstein, c/o easy-shop, Kathrin Mothes, Schloßstraße 20, 06869 Coswig (Anhalt)
Covergestaltung: Edgar Endl · booklab gmbh
Bildquellen: #100995507 | AdobeStock
Foto Autoren: Michael Bry
Satz u. Layout / E-Book: Büchermacherei · Gabi Schmid · buechermacherei.de
ISBN Print: 978-3-759-20789-0
ISBN E-Book: 978-3-759-20920-7
1
Lou Feldmann stieg die Treppe an der U-Bahnstation Schönleinstraße nach oben, hielt einen Moment inne und ließ seinen Blick den Kottbusser Damm hinauf in Richtung Hermannplatz wandern. Die Luft flirrte. Für Mitte September war es ungewöhnlich heiß. Feldmann betrachtete die Leute, die an ihm vorbeigingen. Sie waren anders. Es war ein anderer Stadtteil. Eine andere Welt in derselben Stadt. Ein anderes Leben. Ein anderer Geruch. Jedes Mal, wenn er hierherkam, fiel ihm das auf. Er liebte sein Friedenau, sein Viertel, liebte sein Haus, seine Kneipe, seine Freunde und Bekannten. Doch wenn er hätte wählen können, wäre er hierhergezogen. Nach Kreuzkölln, wie es bei den Kiezbewohnern hieß.
Hinter ihm kamen drei junge Leute aus der U-Bahn. Zwei Männer, eine Frau, alle Anfang zwanzig und vermutlich Studenten, wie Feldmann an den mit Wäsche vollgestopften blauen Ikea-Taschen, die sie mit sich schleppten, zu erkennen glaubte. Sie waren auf dem Weg zu dem nur zwei Häuser entfernten Waschsalon. Murats Waschsalon. Gut besucht, stellte Feldmann fest, als er vor der Glasfront stehen blieb. Er überquerte die Straße, holte sich einen Pappbecher mit Kaffee aus einer Bäckerei, stellte sich vor die Tür und schaute zum Waschsalon hinüber. Nach wenigen Minuten wurde er ungeduldig. Murat war überfällig, und Feldmann hasste es warten zu müssen. Vor allem jetzt, wo Murat ihn um eine Schlichtung gebeten, ihn angefleht hatte zu vermitteln. Feldmann hatte erst abgelehnt, schließlich aber doch zugestimmt. Weil er Murat gegenüber ein schlechtes Gewissen hatte. Denn in seiner aktiven Bullenzeit hatte er dazu beigetragen, Murats Sohn wegen Totschlags hinter Gitter zu bringen. Obwohl der Knast aus den Wenigsten bessere Menschen machte. Murat hatte, soweit Feldmann wusste, seinen Sohn dort kein einziges Mal besucht. Der war für ihn gestorben. Feldmann war froh, kein Bulle mehr zu sein. Er war froh, dass er hingeschmissen hatte. Wenn er die Armut um sich herum sah, die Täter produzierte, Täter, die er früher hatte verfolgen und festnehmen und Richtern überstellen müssen, die nicht einmal ihren eigenen Horizont überblickten. Diese reiche Gesellschaft, die andere Länder zur Sparsamkeit zwang und ruinierte, diese vom Volk und auch von ihm gewählten Politiker, die Wirtschaftsfürsten umarmten und mit immer neuen Vorteilen ausstatteten, damit sie noch mehr Gewinne im Ausland verschwinden lassen konnten. Froh und erleichtert war er gewesen, als er sich von dem Beamteneid, den er auf diesen Staat geschworen hatte, verabschieden konnte, seinen schriftlich fixierten Verzicht auf weitere Pensionsansprüche zu den Akten gegeben hatte.
Im Haus neben Murats Waschsalon stand ein Laden leer, Veranstaltungsplakate waren auf die Scheiben geklebt. Das musste der Laden sein, den Fred Klotz gemietet hatte, um Murat Konkurrenz zu machen. Eine verschleierte Türkin, bei der auch der viele schwarze Stoff nicht half, ihre Pfunde zu verstecken – ja, diese Seite des Kottbusser Damms war fest in türkischer Hand – war plötzlich stehen geblieben, starrte offensichtlich erschrocken durch die großen Glasscheiben in den Laden, ging schnell weiter. Vorher war sie geschlendert, jetzt rannte sie fast. Feldmanns alter Bulleninstinkt war sofort wieder wach. Er lief über die Straße, musste auf dem Mittelstreifen stehen bleiben, weil ihm ein Protzauto für geschätzte hunderttausend Euro mit einem jungen Türken am Steuer den Weg abschnitt. Er lief weiter. Die Tür zum Laden war nur angelehnt, er stieß sie auf. Drinnen, wo nur noch ein paar dringend restaurierungsbedürftige Stühle und Schrankwände standen, umkreisten sich Murat und Fred. Fred, ein stämmiger Vierzigjähriger und Murat, der um die Sechzig war, mit eisgrauem Haar und einem Stilett in der Hand. Vielleicht hatte Murat vor vierzig Jahren mal den Kampf mit dem Messer geübt. Aber seine Schnelligkeit hatte er inzwischen verloren. Er wechselte das Messer von einer Hand in die andere und wiederholte das Spiel immer wieder. Fred starrte auf das Messer, nicht auf Murats Augen, er war kein Kämpfer, aber er kämpfte um sein Leben mit einer Bierflasche in der Hand, der er den Boden abgeschlagen hatte. Die andere Hand hatte er mit einer Lederjacke umwickelt und benutzte sie als Schild. Sein Hemd war aufgerissen. Blut rann ihm die Seite hinab. Der ein oder andere Treffer war Murat also schon gelungen.
„Schluss. Aus. Feierabend“, schrie Feldmann, als er dazwischen ging. Er breitete die Arme aus, um die Wütenden am Kampf zu hindern – die eine Hand ausgestreckt gegen Fred, die andere gegen Murat. „Lass das Messer fallen“, sagte er drohend und sehr leise zu Murat. Sie sahen sich an. Murat brauchte eine Weile, um sich zu beruhigen. Er ließ das Messer auf den Boden fallen. Fred, den er dabei nicht aus den Augen gelassen hatte, warf seine Bierflasche gegen die Wand. Dann nahm er sich einen von den Stühlen und setzte sich. Er riss sein Hemd weiter auf, besah sich die blutenden Wunden an seiner Seite, presste dann das Hemd dagegen.
„Setz dich“, sagte Feldmann scharf zu Murat. Der zögerte, holte sich aber doch einen Stuhl, setzte sich. Feldmann nahm sich den, der umgekippt am Boden lag und platzierte ihn in die Mitte.
Er sah Fred an. „Wenn du die Polizei rufen willst, bitte“, sagte er. „Dann gehe ich.“
Fred musterte Lou, während er versuchte die Blutung oberhalb seines Bauches zu stoppen. Ein Waschbrettbauch war das schon seit zehn Jahren nicht mehr. „Ich weiß, wer du bist“, sagte er. „Lou Feldmann. Ich hab mit deinem Neffen Manu öfter mal Billard gespielt. Einmal bist du gekommen um ihn auszulösen.“ Er nahm den Hemdenstoff von seinem Bauch weg, die Blutung hörte nicht auf, er drückte weiter dagegen. „Nein, keine Bullen. Ich hab zwar keine Ahnung, was es hier zu schlichten geben soll, aber versuch es halt.“
„Wenn du damit ins Krankenhaus gehst, werden die wissen wollen, wie das passiert ist. Und dann kommen die Bullen.“
„Nochmal. Keine Bullen. Kein Krankenhaus.“
Feldmann nickte, holte sein Handy aus der Tasche und rief Sylvie Westphal an.
2
Für einen Wochentag hatte der fünfzehnte September in seltener Ruhe begonnen. Den ganzen Morgen schon wirkte der Savignyplatz wie ausgestorben. Die durch die Bäume flimmernden Sonnensprengsel zeichneten hübsche Muster aufs Pflaster. Nur wenige Fußgänger oder Radfahrer schienen unterwegs zu sein, von Autos ganz zu schweigen.
Wie Sonntag, dachte Dr. Sylvie Westphal, als sie die Fensterflügel ihres Wohnzimmers öffnete und auf den Platz hinunterblickte. Oder wie wenn alles den Atem anhält, bevor etwas passiert. Etwas, das man seit langem erwartet und von dem man annimmt, dass es jetzt jeden Moment passieren wird. Man weiß nur nicht, ob es sich als etwas Gutes oder etwas Schlimmes entpuppen wird. Aber egal, dachte sie, solange es nur weiter so ruhig bleibt. Mit einer Drehung um die eigene Achse wandte sie sich vom Fenster ab, ließ ihren Blick dabei kurz über ihr Spiegelbild in der Fensterscheibe schweifen und fuhr sich mit den Fingern durchs lockige Haar, das nach dem Duschen noch nicht ganz trocken war. Dann ging sie in die Küche, nahm die Tasse mit dem inzwischen durchgelaufenen Kaffee und trug sie auf den zum Hinterhof gelegenen Küchenbalkon hinaus, wo sie auf dem schwarzen Klapptisch schon Löffel, Zucker und den Tagesspiegel bereitgelegt hatte. Heute war ihr Geburtstag, zur Feier des Tages hatte sie sich den Vormittag frei genommen und konnte jetzt gemütlich Auge in Auge mit den Spatzen und Amseln in der Hinterhofkastanie frühstücken. Oder wenigstens Kaffee trinken. Essen würde sie später in der Kantine – falls der Betrieb in der Rettungsstelle es zuließ.
Sie überflog die Aufmacher auf der ersten Seite, blieb bei einer Meldung über den Aufmarsch einer Neonazigruppe namens „Der III. Weg“ vor einem Einkaufszentrum in einer brandenburgischen Kleinstadt hängen. Eine Kundgebung, deren Redner langjährige Naziaktivisten und NPD-Mitglieder waren. Mit Transparenten und Fahnen. Mit Hetzereien gegen Migranten und Flüchtlinge und mit lautstarken Drohungen gegen jeden Deutschen, der sich nicht klar von Ausländern abgrenzte und sich nicht eindeutig zum deutschen Volk bekannte.
Kopfschüttelnd faltete Sylvie die Zeitung ganz auseinander und blätterte auf Seite drei, wo über die Bürgerinitiative einer ländlichen Gemeinde unweit von Berlin berichtet wurde, die offenbar mit einem Großgrundbesitzer in Streit lag, der sich gegen einen geplanten Windpark auf seinen Ländereien verwehrte, aber sie kam nicht dazu, sich in den Artikel zu vertiefen, denn vor ihr in der Kastanie setzte ein Mordsspatzengezeter ein. Es klang als würde der dicke Nachbarkater es sich wieder einmal nicht nehmen lassen, sich vor der versammelten Vogelgesellschaft zu blamieren. Doch bevor Sylvie die Chance hatte, den Störenfried zu lokalisieren, klingelte ihr Telefon, das sie bewusst nicht auf den Balkon mitgenommen hatte. Ihrem ersten Impuls, das Läuten einfach zu ignorieren, folgte sie dennoch nicht. Zumindest wollte sie nachsehen, wer da versuchte, sie zu erreichen. Immerhin hatte sie Geburtstag …
„Lou?“
„Sylvie. Tut mir leid, dass ich dich störe. Aber …“
Also kein netter Geburtstagsglückwunsch.
„… du musst heute doch erst mittags …“
Sylvie Westphal kannte Lou Feldmann gut genug, um zu wissen, was hinter seinem Anruf steckte.
„Kugel?“, fragte sie.
„Messer.“
„Sehr dringend?“
„Nicht lebensgefährlich. Kommst du trotzdem? Kottbusser Damm, Höhe Haltestelle Schönleinstraße. Der Laden neben dem Waschsalon. Liegt für dich ja praktisch auf dem Weg.“
„Gute halbe Stunde, mindestens. Ich bin noch nicht wirklich vorzeigbar und kann immer noch nicht fliegen.“
Sie legte auf.
Kaum zehn Minuten später steuerte Dr. Sylvie Westphal, den Arztkoffer in der Hand, auf ihren in einer Seitenstraße geparkten roten Alfa Giuletta zu.
3
Murat warf Feldmann einen flehenden Blick zu. „Du musst verstehen, Lou. Ich bin vor vierzig Jahren hergekommen. Lange bevor die Mauer fiel. Hier war alles billig. Die Miete für meinen Laden auch. Aber jetzt – das Haus nebenan gehört inzwischen einem irischen Clan.“
„Einem englischen“, sagte Fred Klotz, „und das, in dem dein Waschsalon ist, vielleicht bald einem griechischen. Die müssen alle sehen, wie sie ihr unversteuertes Geld anlegen. Vielleicht kriegen die ja auch noch einen Bonus vom Senat.“
„Lou“, sagte Murat, „dieser Typ will mich fertigmachen. Der will direkt neben meinem Waschsalon einen Betrieb aufmachen mit neuen Maschinen, die ich mir nicht leisten kann. Eine Acht-Kilo-Trommel, wo die Leute Daunenbetten und Teppiche reinwerfen können. Da kann ich nicht mithalten.“
„Das ist Kapitalismus“, sagte Feldmann trocken, „das ist überall so. Leute erkunden, wo es einen florierenden Waschsalon mit Stammpublikum gibt, das sich der Besitzer über viele Jahre hin erworben hat, und dann machen sie daneben einen neuen auf, mit besseren Maschinen. Mit Dumpingpreisen. Hast du was auf der hohen Kante?“
„Du hast mich nicht verstanden“, klagte Murat. „Mein Laden ist meine Rente. Mein Leben, meine Heimat. Ich kenne die meisten, die zu mir kommen, wir reden, wir trinken einen Cai, vielleicht einen türkischen Kaffee vom Griechen gegenüber …“
„Hör auf zu weinen, Alter“, unterbrach Fred. „Geh auf Rente oder Hartz IV. Mir egal. Ich will hier meinen Laden aufmachen. Jetzt bin eben ich dran.“
„Du hast mir die Nazis geschickt“, sagte Murat.
„Welche Nazis?“, fragte Fred überrascht.
„Letzte Woche waren drei von denen da. Sie haben mir nahegelegt zu verkaufen, weil ich demnächst Konkurrenz bekäme.“
„Und? Haben sie dir was getan?“
„Noch nicht. Sie kommen wieder, haben sie gesagt. Und das war eine Drohung.“
Feldmann stand auf, ging zum Fenster, sah zwischen den aufgeklebten Plakaten hinaus auf die Straße. Diese Straße, in diesem Kiez, den er genau deshalb liebte, weil hier so viele Menschen aus so vielen Nationen nebeneinander und miteinander lebten.
„Wo hast du das Geld her?“, fragte er und drehte sich zu Fred um. „Du hast vor zwei Jahren mit deinem Malergeschäft pleite gemacht. Von einer Bank kriegst du keinen Kredit für die Maschinen.“
„Immer noch Bulle?“, fragte Fred misstrauisch.
„Nein“, sagte Feldmann, „nur informiert. Wie man das von einem Schlichter erwartet.“
Fred sah ihn wütend an. „Ich sag’s nochmal: Hier gibt es nichts zu schlichten, Lou Feldmann. Ich hab Murat nur zugesagt, herzukommen und dich anzuhören.“ Er deutete auf seine Wunden. „Und, siehst du, das hab ich jetzt davon.“ Sein Gesicht glühte. Lange würde er nicht mehr auf seinem Stuhl sitzen bleiben.
Feldmann hob beschwichtigend die Hand. „Hör zu, Fred. Am Südstern gibt es einen Laden, größer als der hier, direkt neben der U-Bahn, drum herum Wohngegend. Der wäre auch geeignet für dein Projekt. Die jetzige Ladenpächterin würde gerne mit dem hier tauschen. Friseurgeschäft, also keine Konkurrenz für Murat.“
„Ich will aber exakt diesen Laden hier. Gib dir keine Mühe. Ich habe mich schon mit dem Vermieter geeinigt. Und überhaupt …“ Er brach ab, weil die Tür aufging und Sylvie Westphal hereinkam.
Sie sah sich um, sah auf Freds blutende Stichwunden, blickte zu Murat und dann zu Feldmann.
„Danke, dass du gekommen bist“, sagte der.
Falls sie gekränkt war, weil er ihr nicht zum Geburtstag gratuliert hatte, ließ sie es sich nicht anmerken, stellte ihren Arztkoffer neben Fred, riss dessen Hemd weiter auf, sah die Wunden an, eine nach der anderen. „Nicht so schlimm, wie es aussieht. Gegen Tetanus geimpft?“
„Vor einem Jahr, nach einem Motorradunfall“, sagte Fred.
Sie machte sich an die Arbeit, desinfizierte, klebte, klammerte, pflasterte. Routine. Jeder Griff saß.
Feldmann hob das Messer vom Boden auf, klappte es zusammen und hielt es Murat hin. „Hier. Ich möchte, dass du jetzt gehst. Wir sprechen uns später. Ich komme bei dir vorbei.“
Murat steckte das Messer in die Tasche, blickte unschlüssig nochmal zu Fred, drehte sich dann um, murmelte ein „Danke“ in Feldmanns Richtung und machte sich davon. Feldmann schloss hinter ihm die Tür, blieb, mit dem Rücken dagegen gelehnt, dort stehen und sah Sylvie zu. „Heute Abend“, sagte er, als sie fertig war, „mache ich Kalbfleischpflanzerl mit Kartoffel-Gurkensalat. Kommst du?“
Auch wenn es sie offensichtlich kränkte, dass er nicht an ihren Geburtstag gedacht hatte, nickte sie. Lous Kalbfleischpflanzerl standen auf der Top Ten ihrer Lieblingsgerichte ganz oben, das wusste er. „Ja, aber nicht vor halb neun, eher schaffe ich’s nicht.“
Sie nahm aus ihrem Koffer eine Schachtel mit Tabletten, die sie Fred gab. „Penicillin. Für den Fall, dass es sich entzündet, aber nur dann, jeden Tag eine, eine Woche lang. Wenn Sie Schmerzmittel brauchen, besorgen Sie sich welche in der Apotheke.“ Sie schloss ihren Koffer, stand auf, ging zur Tür. Feldmann trat zur Seite.
„Wer bezahlt mich?“, fragte sie ihn.
„Murat“, sagte er, „ich gebe es dir heute Abend.“
Feldmann machte die Tür hinter ihr zu. Fred stand auf, nahm seine zusammengeknüllte Lederjacke vom Boden auf, hielt sie hoch, betrachtete die Schnitte. „Die kann ich in den Müll werfen“, sagte er verärgert. „Hat mich einen Tausender gekostet.“
„Überleg dir das mit dem Südstern“, sagte Feldmann. „Sieh dir den Laden wenigstens mal an“.
„Wozu? Ich will den hier.“
„Hier hast du fast nur türkische Nachbarn. Murat ist Türke, aber du kriegst hier Schwierigkeiten.“
„Vielleicht. Wird sich zeigen.“
4
Zwei Stunden später lehnte Fred Klotz an einem Motorrad auf einer Anhöhe fünfzehn Kilometer vor Berlin und blickte über die Landschaft, hinüber zu verlassenen Häusern mit zerfallenen Zäunen. Er sah hinunter auf die Landstraße, die an einem Bach entlangführte. Fred hatte eine neue Lederjacke an. Seine von Murat ruinierte war grün gewesen, flaschengrün, seine Lieblingsfarbe. Die er jetzt trug war oliv. Dickes, weiches Leder, gut zum Motorradfahren und auch sonst ein gutes Teil, um in Biker-Kneipen zu imponieren. Die Maßanfertigung einer Ledermanufaktur in Friedrichshain. Fred schaute auf seine gefälschte Rolex. Er holte ein Fernglas aus der Satteltasche des Motorrads, drehte sich nach der Sonne – er wollte vermeiden, dass die Gläser reflektierten und den Boten warnen konnten. Er nahm die Bushaltestelle an der Landstraße ins Visier. Fred konnte sich nicht vorstellen, dass dort um diese Zeit ein Bus hielt. Wahrscheinlich kam morgens und nachmittags ein Schulbus, aber er bezweifelte, dass es in dieser Gegend überhaupt noch Schulkinder gab. Jetzt tauchte ein Auto auf, kam näher. Ein Landrover. Ziemlich neu. Er hielt an der Bushaltestelle. Pünktlich, dachte Fred. Er stellte die Schärfe der Objektive nach. Eine Frau stieg aus. Ende dreißig. Elegant. Teurer Countrylook. Sie nahm einen Aktenkoffer vom Beifahrersitz, sah sich um, schaute zum Abfallkorb an der Haltestelle, ging mit dem Aktenkoffer hin, sah sich nochmal um. Dann versuchte sie, den Aktenkoffer in den Abfallkorb zu stecken. Es funktionierte nicht. Der Koffer war zu groß.
Sie sah sich wieder um. Schließlich stellte sie den Koffer unter dem Abfallkorb auf den Boden und stieg wieder ins Auto. Sie fuhr nicht weg.
„Fahr endlich, verpiss dich“, fluchte Fred leise vor sich hin. Aber sie fuhr nicht. Sie stieg wieder aus, hatte ein Kuvert in der Hand und einen Füller, schrieb damit etwas auf das Kuvert, nahm ihre Halskette ab, ihre Ohrringe, Armreifen, Ringe, steckte alles in den Umschlag, klebte ihn zu. Sie ging zum Aktenkoffer, öffnete ihn, warf den Umschlag hinein, schloss den Deckel und stellte den Koffer wieder unter den Abfallkorb. Dann ging sie zum Wagen zurück, stieg ein und fuhr los.
Fred wartete bis der Landrover aus seinem Blickfeld verschwunden war und er sicher sein konnte, dass kein anderes Fahrzeug in der Nähe war, schob das Fernglas wieder in die Satteltasche, setzte seinen Helm auf, startete sein Motorrad und lenkte es langsam über den teilweise vom Regen weggeschwemmten Weg nach unten. An der Haltestelle griff er sich im Vorbeifahren den Aktenkoffer unter dem Abfallkorb, kam dabei fast ins Schleudern, legte ihn vor sich auf den Tank und gab der Maschine Stoff. Er fuhr über die Feldwege und quer durch die Landschaft, er kannte den Weg, er war ihn probehalber ein paarmal gefahren, er genoss die Maschine unter seinem Hintern, bog in ein Waldstück ein, den Waldweg war er auch schon abgefahren, jetzt stürzte er jedoch fast über einen querliegenden Ast, der gestern noch nicht da gewesen war.
5
„Schau nicht dauernd auf die Uhr“, sagte Schuster zu Mahlmann. „Und geh von der Tür weg.“
Mahlmann kam herein, nahm seine Armbanduhr ab, legte sie auf den Küchentisch, an den Schuster sich gesetzt hatte. „Er ist schon eine halbe Stunde über der Zeit“, sagte er und lehnte sich an einen Küchenschrank. Die Küche war verdreckt, Ratten und Mäuse waren hier zu Hause. In diesem alten Bauernhof, der später zu einer LPG gehört hatte. In den neunziger Jahren hatte ein Westdeutscher Haus und Grundstück gekauft, um es mehr schlecht als recht instand zu setzen und zu bewirtschaften, bis er vor einigen Jahren plötzlich wieder verschwunden war. Seither stand die Immobilie leer und zum Verkauf. Der Makler war für die nächsten drei Monate auf den Bahamas.
Schuster hatte das alles ausgekundschaftet. Er war der Macher, er war der Chef. Mahlmann sah den Vierzigjährigen mit dem stoppeligen Military-Haarschnitt an und wurde die Angst nicht los, die er vor ihm hatte. Schuster lächelte sanft. Er hatte offensichtlich das bessere Gehör. Dann hörte Mahlmann es auch. Ein Motorrad kam näher, es fuhr auf den Hof.
Fred schloss das wacklige Gittertor hinter sich, schob die Maschine in eine Scheune, in dem auch zwei PKW standen, nahm den Aktenkoffer in beide Hände. Erfolg, dachte er. So muss Erfolg aussehen. Er trug den Koffer vor sich her, schob mit dem Fuß das Scheunentor zu, ging über den Hof zum Wohngebäude, trat stolz durch die offene Tür in die Küche. Er sah zu Mahlmann, der am Küchenschrank lehnte und ein Strahlen im Gesicht hatte, wie die Sonne, wenn sie morgens hinter dem Horizont hervorkroch. Er legte den Koffer vor Schuster hin, der am Küchentisch sitzen geblieben war und äußerlich nicht die geringste Reaktion zeigte. Milde, dachte Fred, er ist milde gestimmt. Er weiß, dass ich meinen Job gemacht habe. Jetzt ist Zahltag, jetzt kriege ich meinen Waschsalon. Wenn du dich nicht freuen kannst, ich tue es für uns alle.
Schuster nickte ihm zu, zog den Koffer zu sich her, öffnete ihn, blickte kurz auf den Inhalt. Er lächelte.
Fred erstarrte. Schusters Lächeln machte ihm Gänsehaut. Es war ein böses Lächeln. So böse, wie Fred es noch nie bei jemandem gesehen hatte.
„Hast du irgendwo unterwegs angehalten?“, fragte Schuster mit sanfter Stimme, „oder hat dich jemand ausgeraubt?“
Fred war sprachlos. Er verstand nicht.
Schuster nahm die Geldbündel, warf sie einzeln auf den Tisch, zählte dabei. „Zwanzigtausend“, sagte er kalt. „Wir haben zwei Millionen verlangt. Wenn du den Rest nicht beiseitegeschafft hast, Fred, dann will der Graf uns verarschen.“
Schuster stand auf. Er lächelte nicht mehr. Er ging auf Fred zu, der plötzlich die Angst im Nacken hatte. Der Mann war früher bei einer Spezialeinheit der Bundeswehr gewesen. Vermutlich hatte kein Gefangener je eines seiner Verhöre überlebt. Schuster legte beide Hände auf Freds Schultern, die Daumen bohrten sich in seine Nervenstränge. Fred zog sich vor Schmerz zusammen, sah Schuster dabei in die Augen. Der schüttelte nach einer Weile resigniert den Kopf und ließ Fred los, nickte, wandte sich wieder dem Koffer zu, holte das Kuvert heraus, kippte den Schmuck auf den Tisch. Er sah nur kurz hin, las, was auf dem Umschlag stand: Bitte.
„Sie hat ihren ganzen Schmuck hineingesteckt“, sagte Fred.
„Nur den, den sie dabei hatte“, entgegnete Schuster kalt. Er schob den Schmuck zusammen und warf ihn in den Koffer zurück, wedelte mit dem Umschlag. „Bitte.“ Er schaute vor sich hin, nickte wieder, sah Mahlmann und Fred an. „Ich habe mal in einem Restaurant am Nebentisch gesessen und beobachtet, wie sie einen Kellner fertiggemacht hat.“ Schuster schüttelte leicht und fast nachsichtig den Kopf. „Das Wort ‚bitte‘ kennt die nicht, diese arrogante Schnepfe. Aber vielleicht hat sie inzwischen in einem Wörterbuch nachgeschlagen.“
„Vielleicht sind die ja tatsächlich so pleite, dass sie ihren Schmuck geopfert hat, um uns gnädig zu stimmen“, warf Mahlmann vorsichtig ein.
Schuster schaute ihn an, als zweifle er an seinem Verstand. „Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich so eine Geschichte plane, ohne dass ich mich vorher genauestens über die Vermögensverhältnisse informiert habe? Ich habe euch doch nicht engagiert, um einem Nackten in die Tasche zu greifen. Die Gräfin hat es nur einfach mit Schmierentheater versucht.“ Er ging zur Arbeitsplatte beim Herd, griff nach dem Werkzeugkoffer, der neben einem Einkaufskorb mit Gemüse stand. „Das Licht im Keller, hast du das hingekriegt?“
„Klar“, sagte Mahlmann mit einem Anflug von Stolz, „unsere Stromversorgung läuft jetzt einwandfrei.“
Schuster öffnete den Werkzeugkoffer, nahm einen 180er Seitenschneider heraus, sah auf das Gemüse. „Schon wieder Gemüse. Ich hab gedacht, du hast außer Elektriker auch Koch gelernt.“ Schuster schnitt mit dem Seitenschneider eine Möhre durch.
„Ich hab nicht vor, hier ein Restaurant aufzumachen“, erwiderte Mahlmann. „Hauptsache unser Gast verhungert nicht.“
Schuster setzte sich eine Sturmhaube auf, ging zur Kellertür, schloss sie auf und stieg die Treppen hinab, den Seitenschneider in der Hand.
Fred starrte weiter auf die magere Beute im Aktenkoffer. „Scheiße ist das. Das sind nicht mal unsere Ausgaben.“
Mahlmann sah sich den Schmuck an. „Wenn das alles echt ist, dann muss sie ein Vermögen dafür hingelegt haben.“
„Sie nicht. Ihr Alter vielleicht. Aber bei einem Hehler kriegst du für die Klunker gerade mal ein paar Tausend.“
Ein Schrei gellte durch den Keller herauf in die Küche und ließ die beiden erstarren. Es hörte sich an wie ein Todesschrei. Die beiden sahen sich an.
„Nein“, sagte Mahlmann verzweifelt, „bitte nicht.“
Schuster kam aus dem Keller, nahm die Sturmhaube ab, warf den Seitenschneider in die Spüle und einen abgetrennten Finger in den Aktenkoffer zum Geld und dem Schmuck. Er sah Fred an. „Du warst doch mal Sani bei der Bundeswehr. Geh runter und verbinde unserem Gast die Hand. Er blutet wie Sau. Und vergiss deine Kapuze nicht.“
„Und wo nehme ich Verbandszeug her?“
„Ein Verbandskasten liegt im Kofferraum vom BMW. Und du, Mahlmann, fährst sofort mit dem Motorrad zum Grafen und stellst ihm seinen Koffer vors Tor. Und bist gleich wieder da. Vergiss den Helm nicht. Und denk an die Überwachungskameras.“
6
Polizeihauptkommissar Uwe Trantow informierte seinen Chef bewusst nicht über den Inhalt des Telefongesprächs, nach dessen Beendigung er sich in seinem zivilen Dienstwagen auf den Weg machte. Falls der Chef wissen wollte, womit er sich am Nachmittag rumgeschlagen hatte, würde er Recherchen vorschützen. Was nicht einmal gelogen war, denn dieser Fall war bislang noch nicht bei der Abteilung Delikte am Menschen beziehungsweise Organisierte Kriminalität gelandet.
Elmar von Steinfurt hatte ihn unter dem Siegel der Verschwiegenheit ins Vertrauen gezogen und ihn gleichzeitig unmissverständlich angehalten, alles zu vermeiden, was auch nur annähernd nach Polizeiaktion roch. „Ich regle das selbst, Uwe. Ich möchte dich nur informieren. Vielleicht brauche ich euch ja doch irgendwann. Jetzt aber noch nicht.“ Nicht einmal eine Telefonüberwachung hatte er sich abringen lassen.
Vor gut zwanzig Jahren, als Elmar von Steinfurt im Zuge der „Rückgabe vor Entschädigung“-Regelung den alten Familienbesitz bei Klein Marklin für sich reklamiert und bald darauf mit der Sanierung des Herrenhauses begonnen hatte, um mit seiner damaligen Frau Marga und den zwei halbwüchsigen Kindern Klaus-Rainer und Gloria so schnell wie möglich zu übersiedeln, hatte er Trantow des Öfteren gebeten, sich für ihn bei Behörden, in der Gemeinde oder bei Baufirmen stark zu machen.
Trantow kannte sich aus, er war in Klein Marklin geboren und aufgewachsen. Hatte noch kurz vor der Wende seinen Wehrersatzdienst bei einer der kasernierten Einheiten der VP-Bereitschaften angetreten. Eine Laufbahn innerhalb der Kriminalpolizei schien ihm vorstellbar. Als mit der deutschen Einheit die Volkspolizei aufgelöst und in die neuen Landespolizeien überführt wurde, bewarb Trantow sich um einen Studienplatz an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Er musste ein Auswahlverfahren durchlaufen, sich aber nicht auch noch, wie zu DDR-Zeiten, um studieren zu können, freiwillig für drei Jahre als „UaZ“, als Unteroffizier auf Zeit, verpflichten. Nach Abschluss der Ausbildung konnte er eine frei gewordene Stelle bei der Potsdamer Polizei übernehmen. Er war immer noch jung und hungrig. Und überglücklich, weil er das Gefühl hatte, angekommen zu sein und seine berufliche Laufbahn in die Zielgerade zu lenken.
Fester Bestandteil seiner sporadischen Wochenendbesuche im Klein Marklin’schen Elternhaus blieb auch dann nach wie vor, dass er sich beim sonntäglichen Frühschoppen sehen ließ. Hier hörte er zum ersten Mal von den wieder aufgetauchten Nachfahren der früheren Gutsherren. Und dass Elmar von Steinfurt, der Sohn des einst enteigneten Grafen, jemanden suchte, der ihn bei der Regelung seiner Angelegenheiten beraten konnte. Trantow war hilfsbereit und erbot sich. Außerdem war er neugierig auf den westdeutschen Spross dieser alten Familie und auch seltsam beeindruckt, dass es tatsächlich noch echte Grafen gab. Titel, die sich sogar noch in der Jetztzeit durch Grundbesitz ausweisen ließen. Elmar von Steinfurt, etliche Jahre älter als er, war umgänglich. Sie verstanden sich. Tranken ab und zu mal ein Glas miteinander, gingen zusammen auf die Jagd, redeten über früher und heute, das Leben vor und nach der Wende, hüben und drüben. Dass der Graf diplomierter Landwirt und seit Jahren schon im BUND aktiv war, sprach für ihn. Mehr aber noch, dass er diesen Grund und Boden, den er nur aus den Erzählungen seiner Eltern kannte, offenbar tatsächlich liebte. Großartige Mischwälder mit uralten Eichen, Platanen, Linden und Rosskastanien, ein riesiges Waldgebiet, das wegen seiner Wildbestände auch zu DDR-Zeiten den staatlichen Rodungs- und Aufforstungsarbeiten nicht zum Opfer gefallen war. Die rundherum üblichen Kiefernwälder – Telegrafenmasten-ähnliche Anpflanzungen – waren nichts als schnell verwertbares Nutzholz. Steinfurts Wälder dagegen waren alt, naturbelassen, naturgeschützt. Er dachte nicht daran, aus diesen Waldbeständen Profit zu schlagen.
Steinfurts Frau Marga allerdings hatte es nicht lange in der dörflichen Ruhe gehalten. Schon nach wenigen Jahren war sie mit den Kindern zurück in den Westen gegangen. Der Trennung folgte die Scheidung. Klaus-Rainer und Gloria tauchten nur noch in den Schulferien auf und wechselten erst wieder dauerhaft von West nach Ost, als sie in Berlin zu studieren begannen. Kurz zuvor hatte Steinfurt erneut geheiratet. Albert, der gemeinsame Sohn aus dieser zweiten Ehe, musste inzwischen elf oder zwölf Jahre alt sein. Und Hauptkommissar Uwe Trantow war nach wie vor ein Freund des Hauses. Freund des Hausherrn zumindest. Und deshalb jetzt auch ganz besonders bemüht, diese heikle Situation so schnell wie möglich zu entschärfen und möglichst ohne Komplikationen aufzulösen.
Abrupt trat er auf die Bremse. Nicht zum ersten Mal wäre er beinahe an der links vor ihm versteckt in den hohen Büschen liegenden Einfahrt zu Steinfurts Gut vorbeigerauscht. Das Tor zwischen den beiden gemauerten Pfeilern links und rechts des zum Herrenhaus führenden Wegs stand offen, wie immer, die Kamera auf dem rechten Pfeiler war eingeschaltet, wie immer. Trantow stieg aus, stellte sich davor, winkte hinein, wie immer. Rollte dann auf dem Sandweg zu dem von dichtem Gebüsch und Bäumen verborgenen Herrenhaus bis vor die Freitreppe. Forsch nahm Trantow zwei Stufen mit jedem Schritt und klingelte.
Steinfurt ließ ihn ein, ging voraus. Im kleinen Salon mit den Hirschgeweihen an den ziegelrot gestrichenen Wänden und dem eindrucksvollen Keilerkopf über dem Kamin roch es muffig. Abgestandener Rauch, verbrauchte Luft. Schräg durch die geschlossenen hohen Fenster fielen durch flirrendes Laub vielfach gebrochene Sonnenstrahlen und malten verwirrende Muster auf den Parkettboden. Der helle Nachmittag schien ausschließlich draußen vor der Tür stattzufinden. Hier herrschte Dämmerlicht. Erst als Trantow mit einem „Ich darf doch?“ den Lichtschalter betätigte, bemerkte er die Dame des Hauses in einer Sofaecke kauern. Sie hatte den Blick gesenkt, schien ihn gar nicht wahrzunehmen. „Verzeihen Sie, gnädige Frau, ich …“, stammelte er, aber Steinfurt winkte ungeduldig ab. „Wir haben jetzt keine Zeit für Formalitäten, Uwe. Und es bleibt dabei: äußerste Geheimhaltung.“
Trantow hob die Augenbrauen. Er würde Steinfurt jetzt keinen Vortrag darüber halten, dass er als Polizist dem Legalitätsprinzip unterlag und entsprechend, sobald er auf eine strafbare Handlung oder ein Verbrechen aufmerksam wurde, angehalten war, diese zu verfolgen und eventuelle weitere Straftaten zu verhindern. Auch wenn er eine Zeitlang verdeckt ermitteln konnte, durfte er nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, als ginge ihn das alles nichts an. Auch nicht, wenn er von einem Freund darum gebeten wurde. „Mir wäre wohler, wenn du einer Telefonüberwachung zustimmen würdest, Elmar“, sagte er.
„Unnützer Aufwand“, wehrte Elmar von Steinfurt ab. Er drehte sich missmutig um und starrte zum Fenster hinaus. „Sie rufen mich sowieso auf meinem Mobiltelefon an.“
Trantow versuchte es auf die ruhige Tour. „Werden sie nicht, Elmar, weil du es ausstellst. Dann müssen sie übers Festnetz gehen.“
Steinfurts letzte Bemerkung hatte seine Frau Ingeborg aus ihrer Lethargie aufschrecken lassen. Mit einem Ruck war die zierliche Frau in die Höhe geschnellt. „Unnützer Aufwand? Habe ich richtig gehört, du sagtest: unnützer Aufwand?“ Mit wenigen Schritten war sie neben dem Grafen und starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. „Es geht um das Leben unseres Kindes, Elmar! Und da redest du von unnützem Aufwand?“ Ihre Stimme überschlug sich. „Was bist du für ein Vater. Zu geizig, um das Lösegeld aufzubringen. Und jetzt willst du noch nicht einmal …“ Sie brach ab.
Trantow schaute verdattert zwischen Graf und Gräfin hin und her. Als Steinfurt nicht auf die Vorhaltungen seiner Frau reagierte, sagte er: „Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Von einer Lösegeldforderung war bisher nicht die Rede, Elmar.“
„Zwei Millionen“, heulte Ingeborg von Steinfurt auf, „hat er Ihnen das nicht gesagt? Der Übergabetermin war heute Mittag, aber …“
Weiter kam sie nicht, weil der Graf sie am Arm gepackt hatte und ihr ins Wort fiel: „Es reicht, Ingeborg. Erspar uns die Einzelheiten, bitte.“ Er sah Trantow an. „Wenn die glauben, ich zahle zwei Millionen, dann sind sie falsch gewickelt. Da können sie lang warten.“
„Ich verstehe nicht“, sagte Trantow noch einmal.
„Er ist zu geizig“, schluchzte Ingeborg, die Steinfurts Hand an ihrem Arm abgeschüttelt hatte. „Sein Sohn ist ihm das Geld nicht wert.“ Sie schluckte, holte tief Luft. „Wissen Sie, was er gemacht hat? Er hat zwanzigtausend eingepackt. Zwanzigtausend! Und damit bin ich zu dem angegebenen Ort der Übergabe gefahren. Ich habe mich so geschämt. Vor meinem eigenen Kind. Deshalb habe ich noch den Schmuck, den ich getragen habe, dazugelegt. Wertvoller Schmuck. Aber die zwei Millionen …“ Sie verbarg das Gesicht in ihren Händen, versuchte, ihr Schluchzen zu unterdrücken. Wenige Atemzüge später ließ sie die Hände sinken, hob, das Gesicht tränenüberströmt, den Kopf, ging zurück zum Sofa, setzte sich und sagte mit wieder fester Stimme: „Ich will mein Kind wiederhaben, Elmar, koste es, was es wolle, hörst du. Das bist du mir und ihm schuldig. Und ich verspreche dir, wenn sie Albert etwas antun, bringe ich dich um. Eigenhändig.“
„Mach doch kein solches Theater“, sagte der Graf. „Sie werden ihn schon nicht gleich massakrieren. Aber mit Hysterie kommen wir jedenfalls bestimmt nicht weiter.“
Noch bevor Trantow sich wieder dem Grafen zuwenden konnte, öffnete sich die Tür und Steinfurts ältester Sohn Klaus-Rainer kam herein. Ein dunkelhaariger Mittdreißiger mit Ray-Ban-Sonnenbrille in der Hand und schwarzem T-Shirt unter seinem knittrigen hellen Leinenanzug.
„Aha“, sagte er, ohne sich lange mit Begrüßungsformalitäten aufzuhalten, „Krisensitzung.“ Er ging zu einem der Fenster und öffnete es. „Jemand dagegen? Dicke Luft hier. Hat sich schon was getan?“ Als sein Blick über Ingeborg von Steinfurts verweintes Gesicht glitt, runzelte er die Stirn. „Ist Albert – ich meine, ist ihm … etwas … passiert? Ich meine, außer dass er entführt wurde?“
„Nein“, sagte der Graf kalt, „nichts. Ingeborg hat den Koffer am vereinbarten Ort abgestellt.“
„Aha“, sagte Klaus-Rainer erneut, „zwei Mio also. Und jetzt warten wir, dass sie ihn zurückbringen, oder?“
„Keine zwei Millionen“, sagte der Graf. „Zwanzigtausend.“
„Hast du nicht gesagt, sie wollen zwei Millionen?“
„Hast du zwei Millionen flüssig? Ich nicht.“
„Aber du könntest sie flüssig machen.“
„Das ist es ja“, schluchzte Ingeborg. „Er könnte. Aber er will nicht.“
„Wieso will nicht?“, fragte Klaus-Rainer. „Das geht doch nicht. Ich meine – Albert … Man lässt doch sein Kind nicht einfach …“
„Ich lasse mich nicht erpressen“, sagte Steinfurt. „Und außerdem kann ich keine zwei Millionen aus dem Ärmel schütteln. Meine Gelder sind langfristig angelegt.“
Alle schwiegen. Trantow wartete gespannt. Ingeborg von Steinfurt tupfte sich mit einem Taschentuch die Tränen von Augen und Wangen und schnäuzte sich die Nase. Der Graf stand neben Klaus-Rainer mit dem Rücken zum Fenster. Er rührte sich nicht, blickte vor sich zu Boden. Klaus-Rainer hatte sich abgewandt und schaute in den Garten hinaus. Schließlich drehte er sich um, sah seinen Vater an und sagte: „Du kannst Albert nicht hängen lassen. Der arme Junge. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken.“
Als Steinfurt nicht antwortete, fuhr Klaus-Rainer fort: „Ich könnte mit dem Bürgermeister sprechen. Du weißt ja, das Angebot steht nach wie vor. Die Gemeinde kauft dir den Grund lieber heute als morgen ab. Falls – was vorherzusehen ist – der Wert keine zwei Millionen erreicht, lässt sich der Rest sicher als Vorausdarlehen für künftige Anteilseinkünfte deklarieren. Du hast dann immer noch genug Land. Und der Windpark kann gebaut werden.“
Trantow hatte, nicht erst seitdem sich Bürgerinitiativen lautstark zu Wort gemeldet hatten, von diesen Plänen gehört. Klein Marklin wollte dem Beispiel einiger Schwarzwald-Gemeinden folgen und sich mit eigener Stromerzeugung von den Energieriesen abkoppeln. Energieversorgungsautarkie. Klang gut. Was anderswo Wasserkraftwerke und Sonnenenergie erreichten, sollte hier Windkraft ermöglichen. Trantow war kein Fachmann. Er wusste nicht, ob das wirklich funktionieren würde, ob die Berechnungen richtig waren, ob die Investitionen sich schnell genug amortisierten. Er hatte gehört, dass die Bürger bereits Anteile zeichneten. Sie waren ganz scharf darauf, den Windpark zu errichten. Langfristig, so hieß es, wolle Klein Marklin mit Ökotourismus punkten. Die Windräder mussten in ausreichend großem Abstand gebaut werden. Mindestens zwei Kilometer Abstand zu den Häusern. Lieber mehr, meinten die Bürger.
„Meine Wälder stehen unter Naturschutz“, sagte Steinfurt. „Da wird kein Windpark hineingebaut. Ich bin Umweltschützer. Die Gemeinde kann sich anderswo Flächen suchen.“
„Windenergie ist sauber. Die macht die Umwelt nicht kaputt.“
„Warum soll dazu ausgerechnet mein Land herhalten?“
„Weil der Hügel und die drum herum liegenden Anhöhen die Effektivität eines Windparks steigern.“
„Auf diesem Hügel haben meine und deine Vorfahren vor über dreihundert Jahren eine Kirche und einen Wachtturm errichtet, von dem aus man kilometerweit über Land schauen konnte.“
„Diese Kirche und dieser Wachtturm sind seit Generationen verfallen und verrottet. Man kann sie zwischen den Bäumen kaum mehr sehen.“
„Aber die Fledermäuse sehen sie. Und sie wohnen dort. Eine in unseren Breiten schon fast ausgestorbene Fledermausart. Du glaubst doch nicht, dass ich die für zwei Millionen verkaufe?“
„Könnt ihr endlich aufhören? Ich halte das nicht mehr aus.“ Ingeborgs Stimme.
„Außerdem gibt es sowieso keine Baugenehmigungen in Naturschutzgebieten“, fuhr der Graf unbeirrt fort.
„Kommt darauf an, wie der Antrag begründet wird“, sagte Klaus-Rainer.
Oder wieviel Schmiergelder über den Tisch gehen, dachte Trantow. Man müsste herausbekommen, wer in diesem Fall mit wem verhandelt. Trantow war noch nicht so lange aus Klein Marklin fort, hatte noch Bekannte, die er fragen konnte. Mit den Kollegen vor Ort sollte er jedenfalls Fühlung aufnehmen. Er durfte nicht ständig in fremden Revieren wildern. Die Sache mit Steinfurts Sohn war schon delikat genug.
Das Telefon klingelte. Graf und Gräfin versuchten beide, danach zu greifen, jeder wollte den Hörer abheben. Trantow hob abwehrend die Hand.
„Geh du ran, Elmar“, sagte Trantow.
Alle bemühten sich, so leise wie möglich zu atmen, alle blickten gespannt auf den Grafen.
Steinfurt meldete sich.
„Mit uns nicht, Herr Graf. Verarschen können wir uns selber.“ Eine kräftige Männerstimme. „Gehen Sie die Auffahrt runter zum Tor. Da wartet etwas auf Sie. Ich melde mich gleich wieder.“
Der Anruf war beendet. Noch bevor Steinfurt den Hörer aufgelegt hatte, war Ingeborg schon an der Haustür, stürzte hinaus ins Freie. Bis zum Tor hatte Trantow sie eingeholt. Den am Pfeiler lehnenden Aktenkoffer sahen sie gleichzeitig. Der Graf hielt seine Frau zurück, Trantow streifte sich weiße Einweghandschuhe über, packte den Koffer.
Ingeborg heulte auf. „Das ist er. Das ist der Koffer, den ich … Lassen Sie mich!“ Sie versuchte, ihn Trantow zu entreißen. „Gleich. Wir bringen ihn erst rein“, sagte er ruhig.
Oben auf der Freitreppe wartete Klaus-Rainer. Trantow in der Mitte zwischen Graf und Gräfin kam sich vor wie ein Ringrichter. Sie gingen alle zusammen zurück in den Salon. Hauptkommissar Trantow legte den Aktenkoffer auf den Tisch, klappte den Deckel auf und trat einen Schritt zurück, gab den Blick frei. Alle standen um ihn herum, starrten ungläubig und entsetzt auf den zuoberst auf den Banknoten liegenden Finger. Ingeborg durchbrach das Schweigen als Erste.
„Das ist doch … Sie haben Albert den kleinen Finger abgeschnitten! Aber er ist doch Bluter! Er stirbt, wenn er keine Medikamente bekommt!“ Flehend fasste sie nach Trantows Arm. „Tun Sie was, bitte!“
Trantow nickte. „Sobald die sich wieder melden. Wir müssen warten. Aber dann …“ Sein Blick wanderte zu Steinfurt, der mit bleichem Gesicht ins Leere starrte. Schließlich räusperte er sich. „Der Schmuck“, sagte er, „das ist der Schmuck, den ich dir geschenkt habe, Ingeborg. Den hast du einfach, ohne mich zu fragen …?“
„Wie du jetzt von Schmuck reden kannst!“, fauchte die Gräfin ihn an.
Steinfurt zog die Augenbrauen in die Höhe. „Hast du etwa gedacht, die wissen, was der wert ist?“ Er schüttelte den Kopf. „Keine zwei Millionen natürlich, aber immerhin. Wie du siehst: Perlen vor die Säue.“
Trantow hatte wortlos das Zimmer verlassen und sich telefonisch mit dem zuständigen Rechtsmediziner kurzgeschlossen. Jetzt kam er wieder herein. „Wenn der Finger innerhalb von vierundzwanzig Stunden, nachdem er abgetrennt wurde, wieder angenäht werden kann, besteht eine gewisse Hoffnung. Man muss ihn in einen Plastikbeutel wickeln und in einen Topf mit Eiswürfeln legen.“
„Großer Gott!“ Ingeborg hielt sich die Hand vor den Mund, als wollte sie sich daran hindern laut loszuheulen. „Ich kann nicht. Ich kann das nicht anfassen!“ Sie würgte. „Alberts kleiner Finger!“
Es war Hauptkommissar Trantow, der den Finger aus dem Koffer nahm und mit ruhiger Stimme fragte: „Vielleicht möchte mir mal wer zeigen, wo es hier einen Topf, Eiswürfel und einen Plastikbeutel gibt?“
Ingeborg stand schon an der Tür und ging ihm wortlos voraus.
Dann sagte niemand mehr etwas. Lähmende fünf Minuten lang war es so still im Raum, dass das Ticken der Uhr auf dem Kaminsims zu hören war. Bis das Telefon endlich Laut gab.
Die Durchsage war kurz und bündig: „Jetzt wissen Sie Bescheid. Es bleibt dabei: zwei Millionen. Morgen Mittag, selbe Zeit, selber Ort. Wenn nicht – der Junge hat noch mehr Finger.“
7
„Sagtest du, für sechs Personen decken?“
Lou Feldmann ließ das Messer sinken, die Zwiebeln auf dem Schneidebrett vor sich Zwiebeln sein und wandte den Kopf in Richtung Tür zur Gaststube, wo Hassan stand, der versuchte, gegen die schrägen Jan Garbarek-Töne aus dem CD-Player anzukommen, und ihn fragend ansah. Lou kniff die Augen zusammen. Richtig, heute machte Hassan die Theke. Nicht Remy. Heute war Dienstag.
„Ja“, nickte er und zählte an den Fingern ab, „Sylvie, Dimitri, Remy, Aydin, Ricardo, ich – sechs.“ Bevor er sich wieder seinen Zwiebeln zuwandte, fragte er: „Weißt du, wo Irina steckt?“
„Holt eben noch die Baguettes ab. Muss jeden Moment da sein.“
Lou nickte zufrieden. Es war Remys Vorschlag gewesen. In ihrer Eigenschaft als Geschäftsführerin hatte sie für Aushilfen zu sorgen. Irina kam für Aydin, Hassan für Remy. Zweimal die Woche, dienstags und donnerstags, ergänzten die jungen Stammgäste vom Billardtisch das Team. Zuverlässig. Bis Remy und Aydin gegen halb elf erschöpft aber zufrieden, dass sie diesen Sprung geschafft hatten, aus der Schule kamen. Mit dieser Regelung war allen geholfen: Irina sparte auf einen Motorroller, Hassan konnte sein Studium finanzieren. Und über den Tresen hinweg ausgiebig mit Anni flirten, die dann, wenn sie Feldmanns Bestellungen vorbeibrachte, die dieser bei Metzgermeister Schulz, ihrem etwas tyrannischen Vater, geordert hatte, gern noch eine Weile blieb, um sich damit vorübergehend der väterlichen Kontrolle zu entziehen.
In der Gaststube waren bisher nur zwei der kleineren Tische besetzt. Ein Pärchen mit Salattellern und Energydrinks vor sich, drei Bier trinkende Büromenschen jüngeren Alters. Im hinteren Teil machte Hassan sich daran, zwei Vierertische zusammenzuschieben und eine weiße Tischdecke darüber zu breiten. Als er sah, dass Irina, die Tüte mit den Baguettes im Arm, vor Dimitri Cordalis und Hund Rudi zur Tür hereinkam, winkte er sie zu sich heran. „Machst du hier weiter? Sechs Personen.“ Er wusste, Cordalis wartete nicht gern. „Wein? Ouzo? Whisky? Bier?“, fragte er ihn, als er an ihm vorbei wieder hinter den Tresen ging.
„Espresso, einen doppelten.“ Cordalis hievte sich auf einen Barhocker und fuhr sich mit den Fingern durch seine dichte weiße Mähne. „Wird noch lang genug, der Abend.“ Er nahm Rudi die Leine ab, legte sie vor sich auf den Tresen und deutete mit dem Zeigefinger auf den Boden neben seinem Hocker. „Setz dich hin.“
Rudi blieb mit dem Rücken zu ihm stehen und witterte in Richtung Küche. Was er von dort in die Nase bekam, gefiel ihm offensichtlich, denn er schnupperte intensiv, wandte den Kopf und sah Cordalis auffordernd an.
„Du bleibst hier“, Cordalis legte ostentativ die Hand auf Rudis Leine, „sonst …“ Rudi machte zwei vorsichtige Schritte auf die Tresenecke zu, schlug dann aber doch den Rückwärtsgang ein und sank mit einem resignierten Seufzer neben Cordalis’ Hocker zu Boden, wo er sich, den Kopf zwischen den Vorderpfoten, schlafend stellte.
Die Gerüche aus der Küche ließen auch Cordalis aufschauen und beifällig vor sich hin nicken. Bei Lous Kalbfleischpflanzerln langte auch er gern zu. Hassan, der vor der Espressomaschine darauf wartete, dass der Kaffee durchgelaufen war, beobachtete ihn. „Sylvies Lieblingsessen. Mit Kartoffel-Gurken-Salat“, sagte er, als er die Espressotasse und ein Glas Wasser vor Cordalis auf den Tresen stellte. Cordalis zog eine Grimasse, fuhr sich mit der Hand über den Bauch und seufzte. „Wird also wieder nichts mit Diät.“
Hinten in der Gaststube brachte Irina die Servietten auf dem fertig gedeckten Tisch in Position, trat einen Schritt zurück und begutachtete ihr Werk. Ganz zufrieden war sie nicht. Auf der Türschwelle zur Küche fiel ihr ein, was fehlte.
„Findest du nicht, Lou, dass zu einem Geburtstagsessen auch Kerzen gehören?“
„Unbedingt. Nimm die Tafelkerzen, Irina, und dann“, Lou zog den Topf mit den gekochten Kartoffeln von der Platte, „dann brauche ich dich hier zum Kartoffeln pellen.“
„Ist Manu immer noch nicht wieder da?“, fragte Irina, als sie mit Kerzen und Kerzenständern an Cordalis vorbei zurück an den Tisch ging.
„Dem hab ich für länger frei gegeben.“
„Wo ist er eigentlich?“
„Dubrovnik. Hatte überraschend eine Mitfahrgelegenheit gefunden. Und gemeint, ich sei ihm sowieso einen ganzen Jahresurlaub schuldig“, knurrte Cordalis. Erfreut schien er darüber nicht zu sein. Vielleicht, dachte Irina, beleidigt es seinen griechischen Stolz, dass Manu sich die „Perle der Adria“ als Urlaubsziel erkoren hat.