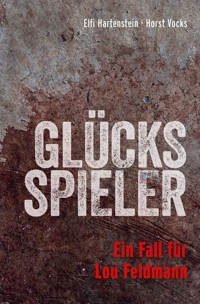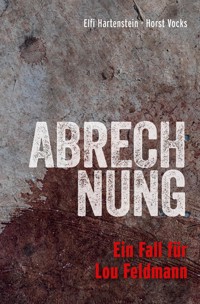2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Pia Ritter lebt seit kurzem als Deutschlehrerin in der moldawischen Hauptstadt Chişinau. Wolf, ihr Freund, ist weit weg, zu Hause in Deutschland. Sie telefonieren fast täglich, aber das ändert nichts daran, dass sie in diesem Land, in dem vieles nicht zu stimmen scheint, allein zurechtkommen muss. So fällt ihr eines Abends im Spielcasino auf, dass am Roulettetisch offenbar Geld gewaschen wird. Ein paar Tage nach einem Besuch in der berühmten staatlichen Weinkellerei Cricova meldet das Fernsehen, dass aus der Schatzkammer einige wertvolle Flaschen gestohlen wurden, die einst Hermann Göring gehörten. Kurz darauf wird Pia erpresst. Hinzu kommen nicht nur sprachliche Verständigungsprobleme und die Tatsache, dass die Menschen wegschauen – sie haben andere Sorgen, alltäglichere. Immer tiefer gerät Pia in den bis in höchste Regierungskreise hineinreichenden Sumpf aus Bestechung, Vetternwirtschaft, Autodiebstahl, Schieberei, Devisenschmuggel, Geldwäsche und politischem Mord. Zum Glück aber gibt es Tamara, Pias Kollegin – und Wolf, der zu Hause in Deutschland detektivischen Spürsinn entfaltet. Ein spannender, einfühlsamer Politthriller über das Leben und Überleben in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldawien fünf Jahre nach der Unabhängigkeit, noch heute einem der ärmsten Länder im Osten Europas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch:
Pia Ritter lebt seit kurzem als Deutschlehrerin in der moldawischen Hauptstadt Chişinau. Wolf, ihr Freund, ist weit weg, zu Hause in Deutschland. Sie telefonieren fast täglich, aber das ändert nichts daran, dass sie in diesem Land, in dem vieles nicht zu stimmen scheint, allein zurechtkommen muss. So fällt ihr eines Abends im Spielcasino auf, dass am Roulettetisch offenbar Geld gewaschen wird. Ein paar Tage nach einem Besuch in der berühmten staatlichen Weinkellerei Cricova meldet das Fernsehen, dass aus der Schatzkammer einige wertvolle Flaschen gestohlen wurden, die einst Hermann Göring gehörten. Kurz darauf wird Pia erpresst.
Immer tiefer gerät Pia in den bis in höchste Regierungskreise hineinreichenden Sumpf aus Bestechung, Vetternwirtschaft, Autodiebstahl, Schieberei, Devisenschmuggel, Geldwäsche und politischem Mord. Zum Glück aber gibt es Tamara, Pias Kollegin – und Wolf, der herausfindet, dass die Spuren einer international agierenden Mafia auch nach Deutschland führen.
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2004 by Elfi Hartenstein
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack GbR, Hamburg
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-919-0
facebook.com/EdelElements
www.edelelements.de/
I.
Siebenundvierzigster Breitengrad
1
Es ist kurz nach zwei Uhr nachts, als ein weißer Mercedes mit auf Standlicht gedämpften Scheinwerfern im Schatten der hohen Akazien langsam die Straße entlangfährt. Der Lichtschein der spärlich verteilten Straßenlaternen dringt nur an wenigen Stellen durch das Blattwerk bis zur Fahrbahn vor. Links und rechts überragen schwarze Häuserfronten die Baumwipfel. Nur hier und da ist noch ein Fenster beleuchtet.
Als er die Parkanlage vor der Poliklinik passiert, verlässt der weiße Mercedes sekundenlang den schützenden Baumschatten. Noch bevor er den nächsten Wohnblock erreicht, peitschen Schüsse durch die Nacht. Erst zwei, dann einer und dann noch einmal drei. Fast im selben Moment rast der Wagen mit aufheulendem Motor davon.
Die Schüsse und das Motorengeräusch haben mich hochfahren lassen. Mit klopfendem Herzen sitze ich im Dunkeln und weiß nicht, ob ich geträumt habe. Jetzt höre ich von der Straße her Stimmen. Knappe Zurufe, die ich nicht verstehe, dann das Geräusch sich rasch entfernender Schritte.
Die nun folgende Stille treibt mich ans Fenster. Die Akazienkronen wiegen sich sanft im Wind. Ihre Schatten zeichnen wirre Muster auf die Straße. Drüben, hinter der Grünanlage, sehe ich die oberste Etage der Poliklinik wie jede Nacht hell erleuchtet. Schräg links neben dem kleinen Park, im Haus mit den Polizistenwohnungen, gibt es in der vierten Etage zwei helle Fenster. Sekunden, nachdem ich sie in den Blick genommen habe, verlischt das Licht. Jetzt fällt nur noch aus dem obersten Stockwerk des Hauses rechts gegenüber ein Lichtschein.
Ein paar Minuten warte ich noch, dann gehe ich wieder ins Bett. Ein Blick auf den Wecker sagt mir, dass ich das vor genau einer Stunde schon einmal getan habe.
Im weiteren Verlauf der Nacht müssen sich in meinem Hals Reibeisen gebildet haben. Der Nachgeschmack der Lutschtablette treibt mir Tränen in die Augen. Ich habe zwei Möglichkeiten. Da ich den Patientenstatus ablehne, gehe ich in die Küche, gieße Kognak in ein Wasserglas, nehme auch noch Zigaretten und Aschenbecher vom Küchentisch und packe mich damit wieder ins Bett. Während ich die Decke über mir glatt streiche und mich zurechtkuschele, dringt wie aus weiter Ferne der Knall mehrerer Schüsse wieder in mein Bewusstsein. Erst zwei, dann einer und dann noch einmal drei. Dann heult ein Motor auf, jemand ruft etwas, Schritte hämmern über das Pflaster. Jetzt sehe ich mich wieder am Fenster stehen und im Nachtdunkel über die Akazien hinweg auf die andere Straßenseite starren. Die erleuchteten Fenster schräg gegenüber, die gleich darauf in undurchdringlichem Schwarz versinken, und im Haus rechts von der Grünanlage hoch oben im letzten Stockwerk die Lichter. Ich weiß, dass es kein Traum war, aber wahrscheinlich werde ich nie erfahren, was geschehen ist. Keine Zeitung wird davon berichten. Niemand außer mir wird etwas wahrgenommen haben, und falls doch, wird jedenfalls niemand ein Wort darüber verlauten lassen.
Ein seltsames Gefühl. So, als säße man in einer dunklen Holzkiste, an der die Menschen vorbeilaufen, während man selbst von innen nur durch die Ritzen zwischen den Latten und ab und an durch ein Astloch unzusammenhängende, schnell wechselnde Teilausschnitte wahrnimmt und, da man sich nicht bemerkbar machen kann, auch nicht die geringste Chance hat, einen der Vorbeieilenden anzuhalten und nach der Bedeutung einzelner Bewegungen zu fragen. Ohnmacht.
Ich wühle mich in den Kissen zurecht, nippe an meinem Kognak und zünde mir eine Zigarette an. Ich könnte es mir jetzt gemütlich machen. Es ist Dienstag. Zehn Uhr morgens. Weil die Studenten heute ihren Tag feiern, habe ich frei. Bei dem Gedanken hebt sich meine Laune allmählich. Wie immer, wenn ich mich aus einem geregelten Tagesablauf ausklinken und alles auf den Kopf stellen kann. Bei Gleichförmigkeit gehe ich ein.
Tage, die es mir gestatten, in Ruhe in Gang zu kommen, sind mir die liebsten. Sie dürfen dann gern etwas länger dauern. Ich habe nichts dagegen, auch mitternachts noch über meinen Büchern zu sitzen, nur wenn ich mich morgens schon ins Getümmel stürzen soll, bin ich ungenießbar. Freiwillig kann ich es tun, aber sobald man es mir abfordert, entwickele ich die seltsamsten Verweigerungsstrategien, die mich manchmal selbst ein wenig erstaunen.
Draußen vor dem Fenster hängt ein grauer Oktoberhimmel. Die Bäume an der Straße haben begonnen, ihr Laub abzuwerfen. In Kürze werden sie kahl sein. Seit einer Woche ist es kalt geworden. Als hätte jemand über Nacht die Temperatur um drei Stufen heruntergestellt, hatte die Sonne von einem Tag auf den anderen alle Kraft verloren. Sie lässt sich nur noch stundenweise sehen. Dass sie sich heute ganz versteckt, ist wie ein Omen. Ich werde es ihr gleichtun. Mit dem Bücherstapel neben dem Bett kann ich eine ganze Menge grauer Tage überstehen.
Dass ich unfähig bin, mich auf Dauer einem bestimmten Rhythmus anzuvertrauen, ist einer der Gründe, warum Wolf und ich immer noch nicht zusammenleben. Es würde nicht gut gehen. Ich springe, er ruht. Weil aber auch er zwischendurch ziemlich weit springen kann und ich immer wieder Ruhephasen brauche, treffen wir uns nicht nur zum Abendessen oder um ins Kino zu gehen. Dann dauert es drei oder vier Wochen, bis unweigerlich der Punkt erreicht ist, an dem jeder wieder nach der eigenen Gangart sucht. Und nach etwas Abstand – wenn auch nicht unbedingt in der Größenordnung, wie wir sie im Moment praktizieren. Als Wolf sich vor drei Tagen nach Hause aufmachte und ich ihn zum Flughafen brachte, hatte ich das deutlich vor Augen. Zweitausend Kilometer sind, auch wenn sie sich in zwei Flugstunden bewältigen lassen, ziemlich weit für eine Liebe.
Noch weiter scheint die Entfernung zu werden, sobald sie sich nach Osten erstreckt. Ich schwöre, wenn ich in Madrid oder Lissabon wäre, würde ich mich ihm um einiges näher fühlen. Ferne oder Nähe berechnen sich offensichtlich weniger nach Kilometern oder Luftmeilen als danach, ob man sich auf die gewohnten Zeichensysteme des Alltags verlassen kann.
2
Als ich im Frühjahr beschloss, diese Stelle an der Universität anzunehmen und für ein oder zwei Jahre hier zu leben, machte ich mir über alles Mögliche Gedanken, nur nicht darüber, dass ein Land, auch wenn es sich sogar ohne größere Probleme mit dem Auto erreichen lässt, trotzdem aus der Welt sein kann. Die Tatsache, dass die ADAC-Straßenkarten nur bis zu seiner Westgrenze reichen, hätte andere vielleicht stutzig gemacht und verunsichert. Mir passte es ganz gut ins Konzept, wollte ich doch eine Herausforderung. Seit Jahren schon war ich auf der Suche danach gewesen, hatte mich sogar in Auslandsschulen in Ecuador und Peru umgesehen, war jedoch schnell zu dem Schluss gekommen, dass das Leben in einem Miraflores-Reichenviertel nicht meine Sache ist. Bequem habe ich es auch zu Hause. Und Wolf, der weiß, wie stur ich sein kann, versuchte gar nicht erst, mich mit irgendwelchen scheinbar vernünftigen Erwägungen von diesem Sprung ins Ungewisse abzuhalten. Ich rechne ihm das hoch an. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass von den vielen Männern, die strahlende Augen bekommen, sobald von exotischen Abenteuern die Rede ist, nur wenige Verständnis dafür haben, wenn ausgerechnet die Frau, die sie lieben, sich für ein solches Abenteuer entscheidet.
Noch höher schätze ich allerdings, dass Wolf sich nicht nur einfach damit abgefunden hat, mich für die nächste Zeit nur hier oder dort besuchsweise zu erleben, sondern mich auch bei der Vorbereitung nach Kräften unterstützte. Seine Kooperation hatte ich bitter nötig. Von Amts wegen hatte man mir nämlich erklärt, mein Einsatz finde zwar im Rahmen des Kulturabkommens zwischen den Ländern statt, doch weil nähere Informationen über Land und Leute bedauerlicherweise nicht vorlägen, sei es nun meine Aufgabe, alles Nötige in Erfahrung zu bringen und Berichte darüber zu verfassen. Als ich wissen wollte, wo und wann der Vorbereitungsunterricht in Russisch oder Rumänisch stattfinde, erfuhr ich zu meinem Erstaunen, dass so etwas nicht vorgesehen war. Wozu auch? Ich würde doch ohnehin am Lehrstuhl für Fremdsprachen unterrichten. Das Semester beginne am 1. September. Die Adresse der Universität stand nicht in der Akte.
Ich hatte die Hoffnung auf irgendeine Art institutioneller Unterstützung schon aufgegeben, als das Wunder geschah: Praktisch in letzter Minute vor meiner Abreise schien sich doch einmal jemand einen halben Gedanken über meine Mission zu machen und versorgte mich noch schnell mit dem Namen und der Telefonnummer einer Kontaktperson. Mit besten Wünschen.
Ich kam mir vor, als hätte ich im Lotto gewonnen.
Dass sich aus diesem Kontakt eine Freundschaft entwickeln könnte, wagte ich nicht zu hoffen. Aber es ist tatsächlich so. Tamara und ich mochten uns auf den ersten Blick.
Die Ausbeute von Wolfs Internetrecherchen lieferte zumindest Basiswissen über das ehemalige Bessarabien und dessen spätere Funktion als »Gemüsegarten« der alten Sowjetunion. Richtige Reiseführer gibt es für diesen offenbar vergessenen Landstrich nicht. Als ich in »Gorki Park« las, wie Chefinspektor Arkadi Renko sich ausmalt, seine im Sinne der Moskauer Polizeihierarchie nicht ganz koscheren Investigationsmethoden könnten ihm Degradierung und – als Gipfel der Gemeinheiten – eine Strafversetzung nach Moldawien einbringen, lachten wir. Inzwischen denke ich, Renko hat das nicht als Witz gemeint. Auch vor der Wende war das Leben vermutlich sogar in Moskau leichter als hier.
Aber Artikel und Bücher helfen allenfalls, den Rahmen abzustecken. Wie der Alltag sich anfühlt, kann man ihnen nicht entnehmen.
Am deutlichsten wurde mir das, als Wolf Ende August zum ersten Mal nach Hause flog.
Bis dahin war alles wie Abenteuerurlaub: die Fahrt durch die Karpaten; die Warterei vor einem Schlagbaum an einer verwaisten Grenzstation, wo erst nach Stunden ein paar Uniformierte aus einer offenbar gemütlichen längeren Mittagspause auftauchten; die gestenreichen Verhandlungen wegen der angeblich für mein vieles Gepäck nötigen Zollgebühren, die wir mit zwei wohlweislich genau zu diesem Zweck mitgenommenen Sechserpacks Bier beendeten. Dann durften wir endlich über die Prut-Brücke fahren.
»Noch ungefähr 120 Kilometer«, sagte Wolf und machte es sich auf dem Beifahrersitz gemütlich. »Fahr schön langsam. Bevor es dunkel wird, sind wir auf jeden Fall da. Wenn du nicht mehr magst, löse ich dich ab.«
Die Landschaft war schlagartig flach geworden. Felder rechts und links der geraden, staubigen Landstraße. Ab und zu ein lang gestrecktes Straßendorf. Vor den zurückgesetzten Häusern am Straßenrand alle paar hundert Meter ein Ziehbrunnen mit buntem geschwungenen Dach.
»Irgendwie komme ich mir vor wie auf einem anderen Stern«, sagte ich. »Das sieht hier völlig anders aus als in Rumänien. Ist das nur so, weil wir aus den Karpaten raus sind, oder woran sonst kann das liegen?«
Wolf gab ein »Hm« von sich und überlegte: »Ehemalige Landwirtschaftskolchosen, oder? Ich meine, immerhin war das hier der so genannte ›Gemüsegarten‹ mit der berühmten schwarzen Erde, auf die sie so stolz sind.«
Ich grübelte weiter. Im dritten Dorf hatte ich es.
»Es sind die Blumen.«
»Wieso? Welche Blumen?« Wolf riss die Augen auf. »Wo bitte siehst du Blumen?«
»Das ist es ja. Es gibt keine.«
»Wirklich?«
»Wenn ich’s dir doch sage. Seit mindestens einer Stunde habe ich keine einzige Blume mehr gesehen.«
Wolf ist nicht gerade ein Spezialist in Sachen Feld-Wald-Wiesen- oder Zier-Blumen, doch jetzt fiel auch ihm auf, dass es in den Vorgärten ausschließlich Gemüsebeete gab. Nichts blühte.
»Die Leute müssen eben jeden Zentimeter nutzen. Sie bauen halt nur an, was man essen kann.«
»Na hör mal! In den rumänischen Dörfern hat es doch auch geblüht wie verrückt, da standen doch überall vor den Häusern und an den Zäunen Astern und Dahlien und Rosen und weiß der Himmel was. Die Leute dort sind ja wohl kaum reicher als hier. Aber hier wachsen noch nicht einmal Gänseblümchen im Gras neben der Straße.«
»Hm.« Mehr war ihm im Moment nicht zu entlocken.
Als wir das Dorf hinter uns hatten, versuchte ich es noch einmal.
»Schau mal, wenigstens auf den Wiesen müsste man doch Feldblumen sehen. Es kann doch nicht sein, dass man über eine Grenze fährt und plötzlich ist schlagartig alles, was blüht, komplett ausgerottet.«
Noch während ich sprach, wurde mir klar, dass es wohl doch so sein musste. Und Wolf, der es offensichtlich im selben Moment auch begriffen hatte, sagte: »Ich glaube, ich habe das sogar irgendwo gelesen. Die haben den Dreck von Flugzeugen aus übers Land verstreut. Chemische Düngemittel und Pestizide zur Produktivitätssteigerung.«
»Und der Wind treibt das Zeug dann überallhin. Da haben sie aber wirklich gute Arbeit geleistet. Glaubst du, das ist im ganzen Land so?«
Wolf grinste. »Das herauszufinden ist Ihre Aufgabe, Madame. Uns liegen darüber bedauerlicherweise keine Informationen vor.«
»Aber du weißt vielleicht wenigstens, wie lang es dauert, bis die Böden sich davon wieder erholen?«
Er zuckte die Schultern. »Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Bauern jetzt kein Geld mehr haben, um noch mehr von dem Zeug einzukaufen.«
Es war dann doch bereits dunkel, als wir in der Hauptstadt ankamen. Reichlich dunkel. Das Ortsschild mussten wir übersehen haben, doch die beleuchteten Fenster aus den Wohnblocks zu beiden Seiten der schlaglochübersäten Straße und der dichter werdende Verkehr sagten uns, dass wir da waren.
»Versprich mir, dass du abends nie ohne Taschenlampe aus dem Haus gehst«, sagte Wolf.
»Ich verspreche es. Aber trotzdem möchte ich bitte eine Wohnung in einer Straße mit funktionierenden Laternen.«
»Wenn die Löcher in den Fußwegen dort genauso tief sind wie auf der Fahrbahn, bleibst du nach Anbruch der Dunkelheit aber zu Hause.«
»Zu Befehl. Das lässt sich bestimmt machen. Vor allem im Winter.«
»Es gibt hier keinen Winter«, sagte Wolf streng. »Jedenfalls keinen schlimmen. Du befindest dich in einem Weinanbauland. Außerdem hast du ja auch gelesen, dass die Gasprom recht unzuverlässig liefert. Wenn die Leute halb erfrieren müssten in ihren Wohnungen, hätte es Streiks gegeben oder irgendwelche Aufstände.«
»Glaub ich nicht. Wetten, dass hier noch nie jemand gestreikt hat? Hier trinken sie lieber. Der Wodka ist billig. Der Konsum soll, seitdem die Gorbatschowkampagne rückgängig gemacht wurde, wieder extrem hoch sein, und hervorragenden Kognak stellen sie auch noch her.«
»Dann bist du hier ja vollkommen richtig«, sagte Wolf, »aber ich möchte trotzdem nicht, dass du abends im Stockdunkeln …«
»Was heißt hier im Stockdunkeln? Ist doch alles Hollywood – oder?«
Ohne es zu merken, waren wir während unseres Geplänkels in einer hell erleuchteten breiten Straße gelandet.
»Wow! Guck mal, da vorne links: das Siegestor.«
»Das ist der kleine moldauische Arc de Triomphe«, sagte ich. »Das heißt, wir befinden uns auf dem Bulvar Stefan cel Mare. Du – jetzt sind wir im Zentrum. Wir sind wirklich da!«
3
Endgültig vorbei war der Abenteuerurlaub, als Wolf eine Woche später nach Hause aufbrach.
Fünf Tage lang hatten wir im Hotel National zähneknirschend Ausländerpreise berappt, was uns zwar nicht den Luxus eines Kühlschranks oder eines Fernsehers mit Kabelanschluss einbrachte, aber zumindest die Sicherheit, dass das Auto mit meinen Habseligkeiten auf einem umzäunten bewachten Parkplatz stehen konnte. An der Universität, zu der wir uns am ersten Tag durchfragten, stellten wir fest, dass außer der Pförtnerin und ein paar Putzfrauen noch keine Menschenseele auf dem Posten war. Auch unter meiner Kontakttelefonnummer war niemand zu erreichen. Als wir zwei Tage später endlich Tamara, die gerade von ihrer Datscha in die Stadt zurückgekommen war und noch gar nicht damit gerechnet hatte, dass ich schon hier sein könnte, an die Strippe bekamen, hatten wir die Erkundung der Stadt weitgehend beendet und begriffen, warum die Vertreter der Tourismusbranche hier keine Goldgruben wittern.
»Möchte wirklich gern wissen, wer auf die Idee gekommen ist, ein verschlafenes Fünfzigtausend-Einwohner-Städtchen innerhalb von vierzig Jahren auf Metropolenmaß zu bringen«, hatte Wolf kopfschüttelnd gesagt. »Achthunderttausend Menschen in hässliche riesige Wohnblocks zusammenzupferchen – wer sich so etwas ausdenkt, sollte zur Strafe selbst lebenslänglich da wohnen müssen.«
Wir waren uns einig, dass ich mich unter keinen Umständen in eine Wohnung irgendwo an der Peripherie verfrachten lassen würde. Diese Tristesse zu ertragen, traute ich mir nicht einmal für die geplanten zwei Jahre zu. Obwohl anzunehmen war, dass die Wohnungen selbst nicht so verlottert waren, wie der äußere Eindruck es vermuten ließ.
Zum Glück hatte auch Tamara sich darüber Gedanken gemacht.
Über die Wohnung, die sie für mich auftrieb, kann ich mich nicht beklagen, auch wenn angesichts der hiesigen Einkommensverhältnisse eine Miete von 150 Dollar für zwei Zimmer krass überhöht ist. Doch dass man von Ausländern gern ein bisschen mehr nimmt, hatten wir ja bereits im Hotel erfahren. Immerhin aber haben die Häuser in dieser schmalen, von hohen Akazien gesäumten Einbahnstraße nur acht Stockwerke. Es gibt ein paar kleine Läden, eine Bushaltestelle, einen Taxistand und abends meistens auch Licht aus Straßenlampen. Und zur Uni kann ich, wenn mir danach ist, sogar zu Fuß gehen.
Einziehen konnten wir zwei Tage später. Und weil Wolf, vorausschauend, wie er ist, nicht nur Werkzeug, sondern auch Unmengen von Telefonkabeln eingepackt hatte, konnte er, während ich Möbel hin- und herrückte und meine Siebensachen verstaute, Telefon, Fax und Internetanschluss in Gang bringen. Dann machten wir uns auf den Weg zu Tamara, die zwei Straßen höher am Berg wohnt und es sich nicht hatte nehmen lassen, ein Abschiedsabendessen für Wolf vorzubereiten. Am nächsten Vormittag musste er los.
»Pass bloß auf«, sagt er, als wir uns im Flughafen zum letzten Mal im Arm hielten. »Ich meine, Tamara und Igor haben es ja sicher gut gemeint, aber dieser selbst gekelterte Wein … Ich behaupte gar nicht, dass ich Kopfschmerzen habe, aber so richtig wohl ist mir nicht unbedingt.«
Ich nickte gehorsam. Obwohl es wahrscheinlich nicht am Wein lag, warum auch ich mich im Moment nicht besonders wohl in meiner Haut fühlte.
»Aber bis ich in sechs Wochen wiederkomme«, sagte Wolf, »hast du bitteschön die nettesten Kneipen ausfindig gemacht.«
»Selbstverständlich«, sagte ich und hoffte, dass ich nicht allzu kläglich klang. Mitte Oktober schien Lichtjahre entfernt. Und dass es hier irgendwo nette Kneipen geben könnte, bezweifelte Wolf sicher genauso wie ich selbst.
Dann war er hinter der braunen Holzwand verschwunden und ich musste kräftig gegen den Kloß, der mir plötzlich im Hals saß, anschlucken. Mit gesenktem Kopf drängte ich mich an den hoffnungsvoll wartenden Taxifahrern vorbei und stakste zu meinem Auto zurück. Ich hätte einiges darum gegeben, mich jetzt in die Arbeit stürzen zu können. Doch die Uni war immer noch geschlossen, das erste Dozentenmeeting erst für übermorgen angesetzt. Ich hatte endlos viel Zeit und war plötzlich verdammt allein.
Daran hat sich auch in den vergangenen zwei Monaten nicht viel geändert. Nachmittags um zwei ist die Uni wie leer gefegt; dann haben sich die Kolleginnen zu ihren diversen Privatjobs oder nach Hause zu ihren Kindern aufgemacht und beneiden mich, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Was meistens darauf hinausläuft, dass ich mich über meine Bücher oder an den PC hocke. Da nicht abzusehen ist, wann die von mir angeforderten Unterrichtsmaterialien aus Deutschland geliefert werden, müssen meine Studenten vorläufig mit selbst gebastelten Arbeitsbögen vorlieb nehmen. Das ist aufwändig, aber keineswegs tage- und abendfüllend. Und weil mir auch nicht ständig der Sinn danach steht, Vokabeln zu pauken oder Redewendungen auswendig zu lernen, bleibt immer noch reichlich Zeit, mich mit anderem zu beschäftigen. Mit einer Art Spurensuche zum Beispiel, wie sie mir, als ich mich zu Hause mit der Geschichte des alten Bessarabien zu beschäftigen begann, als ferne Vision in den Kopf kam: Denn, so denke ich, da es zu Zeiten des Habsburger Reichs und auch später, solange der nationalsozialistische Vernichtungsfeldzug noch nicht über sie hinweggegangen war, in der angrenzenden Bukowina eine große Zahl deutschsprachiger Schriftsteller gegeben hat, ist wohl auch jenseits des Prut unter den deutschstämmigen Bewohnern Schrifttum entstanden. Es mag in den Wirren der Politik untergegangen sein, aber das heißt nicht, dass es nicht vielleicht doch noch irgendwo in Archiven schlummert. Wenn ich lange genug herumlese, werde ich Hinweise erhalten, Namen ausfindig machen.
Solange das Wetter es erlaubte, verzog ich mich nachmittags zum Lesen in Parks oder in eines der wenigen Straßencafés. Mit Einbruch der Dunkelheit macht die Stadt die Schotten dicht. Der Fernsehapparat in meinem Wohnzimmer liefert drei russische Programme und ein moldawisches. Ausländische Zeitungen gibt es nirgends. Das kleine Radio, das ich mitgebracht habe, ist die einzige Quelle, aus der ich erfahren kann, was sich in der übrigen Welt tut. Leider ist der Empfang weder besonders zuverlässig noch besonders gut.
Nach zwei Wochen hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass mir die Decke auf den Kopf fällt, und das dringende Bedürfnis, etwas dagegen zu tun. Kurz entschlossen kramte ich Wilhelms Telefonnummer in Odessa heraus, besorgte mir bei der ukrainischen Botschaft ein Visum, bat eine meiner Studentinnen, mir zu helfen, am Bahnhof eine Fahrkarte zu erstehen, und setzte mich für drei Tage ab. Als ich wiederkam, ging es mir besser. Das Kulturprogramm, das Wilhelm für mich vorbereitet hatte, war nur der eine Grund dafür. Das eigentlich Wichtige war, dass wir unbefangen miteinander reden konnten, ohne ein Blatt vor den Mund nehmen oder darüber nachdenken zu müssen, ob die vertrauten und gewohnten Konnotationen beim anderen auch so ankamen, wie sie gemeint waren. Wenn Wilhelm und ich nicht ohnehin bereits seit Urzeiten Freunde gewesen wären, in diesen Tagen wären wir es hundertprozentig geworden. Es ist ungeheuer beruhigend zu wissen, dass er jederzeit erreichbar ist.
Wir beschlossen, dass ich bald wiederkommen würde. Das nächste Mal im Oktober, zusammen mit Wolf. Und zwar, das stand fest für mich, mit dem Auto, denn diese unendlich langen acht Stunden Bahnfahrt für eine Strecke von gerade mal 180 Kilometern empfand ich – Lokalkolorit hin oder her – als unnötige Verschwendung kostbarer Zeit. Nicht zuletzt auch weil die Züge überfüllt und unbequem und die Fensterscheiben so schmutzig sind, dass man die Gegend, durch die man fährt, nur erahnen kann.
So schön ich Odessa gefunden hatte, so trist kam mir die moldawische Hauptstadt anschließend vor. Nun war ich wieder auf mich selbst zurückgeworfen und außerdem noch vom Weltgeschehen und von allen Nachrichten abgeschnitten.
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher standen denn auch ganz oben auf meiner Wunschliste, als Wolf vor seinem Oktoberbesuch anfragte, was er mitbringen sollte. Weil es nach wie vor, auch wenn ich mich inzwischen beim Einkaufen in der Landessprache verständigen kann, wohl noch einige Zeit dauern wird, bis ich wenigstens sinngemäß erfasse, was in den örtlichen Zeitungen steht. Dass ich ohnehin bezweifle, mit ihnen mein Informationsbedürfnis decken zu können, steht auf einem anderen Blatt.
Wolf jedenfalls schleppte daraufhin brav einen ganzen Koffer voll Lesestoff an. Und diesen Schatz plündere ich nun seit drei Tagen, systematisch und so sorgfältig wie daheim kaum je zuvor. Ich muss sparen. Nachschub gibt es erst wieder, falls ich noch einmal nach Odessa fahre. Oder überhaupt erst Weihnachten zu Hause. Bis dahin aber ist jetzt gerade mal Halbzeit.
Tamara sagt: »Da hast du es. Wir Frauen hier sind bescheiden. In unserem Land braucht es nicht viel, um uns glücklich zu machen.«
Ich nicke, aber das sieht sie durchs Telefon natürlich nicht. »Vielleicht ist es ja nur ein Probelauf«, sage ich. Sie lacht. »Schon möglich.«
Als ich den Hörer aufgelegt habe, gehe ich ins Bad und drehe den Wasserhahn ganz auf. Es dauert eine Weile, aber dann ist es tatsächlich wieder da: warmes Wasser. Direkt aus der Leitung. Und das, obwohl nach wie vor nicht geheizt wird. Ich komme mir vor, als hätte ich den Nordpol entdeckt. Tamara hat Recht: Das ist Glück. So einfach also. Wenn ich zu Hause erzähle, dass ich am Abend des 31. Oktober in einer ungeheizten Wohnung sitze und glücklich bin, weil seit Monaten zum ersten Mal warmes Wasser aus der Leitung kommt, werden sie mich für verrückt halten. Aber auch das gehört wohl dazu.
4
Ich habe Wörter im Lexikon nachgeschlagen und mir mithilfe meines Grammatiklehrbuchs zwei Sätze zurechtgelegt. Um den Deckel der schwarzen Kiste zu lüften, in die ich noch immer eingeschlossen bin. Zwar kann ich mich mit den Kolleginnen am Lehrstuhl auf Deutsch oder Englisch verständigen, aber schon dort komme ich mir, sobald sie untereinander Russisch oder Moldauisch sprechen, ziemlich überflüssig vor. Ausgeschlossen. Oder vielmehr eingeschlossen – in diese schwarze Kiste eben. Um am Leben außerhalb der Universität teilnehmen zu können, muss ich lernen, lernen, lernen.
Dass ich Fehler mache und meine Aussprache längst noch nicht korrekt ist, hält mich nicht ab, wenn ich ins Gespräch kommen will. Da ich genau zuhören kann, kann ich inzwischen schon ab und zu analysieren, wie andere ihre Sätze bauen, deren Einzelbestandteile ich mir, den Klang noch im Ohr, einverleibe, um sie später an anderer Stelle wieder in neuen Zusammenhängen zu reproduzieren. Learning by doing, erkläre ich den Studenten in meinen Kursen, und indem sie mich verbessern und mir Ausspracheregelungen und grammatische Konstruktionen erschließen und meine Fortschritte beobachten, verlieren sie die Scheu vor den eigenen Fehlern, die sie noch machen, wenn sie Deutsch sprechen.
Anfangs hat es sie überrascht, dass ich mich bemühe, ihre Sprache zu erlernen. Was wiederum mich erstaunte, denn ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand versuchen wollte, in einem Land zu leben, ohne zu verstehen, was um ihn herum gesprochen wird. Später habe ich begriffen, dass ihre Überraschung sich darauf bezog, dass ich Rumänisch lerne und nicht Russisch. Die meisten Ausländer, die sich für längere Zeit hierher verirren, versuchen lieber, sich mit Russisch durchzuschlagen. Ich kann mir das nur so erklären: Entweder – aber das glaube ich eigentlich nicht – machen sie sich keine Gedanken darüber, was in diesem Land angesagt ist, oder aber sie wissen nur zu genau, wer hier auch in Zukunft das Sagen hat.
»Komm mit ins Zentrum«, hatte Nadja mich am Tag vor Semesterbeginn in ihrem komischen Englisch aufgefordert, »da ist heute die Hölle los.« Die Hölle stelle ich mir zwar anders vor, aber dieses Volksfest, das sich da auf dem Bulvar Stefan cel Mare und dem Platz zwischen dem Ministeriengebäude und dem kleinen Triumphbogen abspielte, war auch ganz nett. Alles tanzte bunt durcheinander, Musikkapellen spielten, Gruppen fröhlicher Menschen zogen untergehakt und laut singend die Straße entlang; Berge von Blumensträußen zierten das Monument des großen Moldaufürsten, vor dem sich das Volk um einen hoch dekorierten Redner scharte, dessen lautsprecherverstärkte Stimme über das bunte Treiben hinwegdröhnte. »Heute Abend kann man ihn sich im Fernsehen noch einmal anhören«, sagte Nadja mit Blick zu den auf ihn gerichteten Kameras, »lass uns jetzt rübergehen zum Dom.« Wir schlängelten uns am Triumphbogen vorbei in die Rasenanlagen zu den heute dort aufgestellten Verkaufstischen, was in der Menge der tanzenden und singenden Menschen nicht ganz einfach war. Ich wusste nicht recht, wie mir geschah und was ich davon zu halten hatte, war ja noch keine zwei Wochen im Lande und noch nicht so weit akklimatisiert, dass ich mich einfach irgendwo mit einhängen und mithüpfen mochte, und dass der 31. August seit 1989 Nationalfeiertag ist, hatte ich überhaupt gerade eben erst gelernt. »Ja«, sagte Nadja stolz, »das war eine echte Revolution damals. Stell dir mal vor, wir haben schon zwei Jahre vor der Unabhängigkeit unsere eigene Sprache wieder zur Staatssprache deklariert und eine Alphabetisierungskampagne in den Schulen gestartet.«
»Eine Alphabetisierungskampagne? Wozu das denn?«
»Na – für das lateinische Alphabet. Wurde doch vorher alles in Kyrillisch geschrieben.«
»Rumänisch in kyrillischer Schrift?«
»Genau. Unsere offizielle Sprache war eben Russisch. Lateinische Schrift war verboten.«
Mein Staunen quittierte sie nur mit einem Schulterzucken. Rumms – der Knall, mit dem der Deckel der schwarzen Kiste sich wieder einmal über mir schloss, ließ mich zusammenzucken. Unsicher sah ich Nadja an, aber sie schien nichts davon wahrgenommen zu haben. Seelenruhig begutachtete sie handgehäkelte Spitzendeckchen, die vor uns zum Verkauf angeboten wurden. Und jetzt wusste ich endgültig, dass es mich einiges mehr an Anstrengung kosten würde, als bloß Vokabeln und Grammatik zu pauken, um mir dieses neue Umfeld zu erschließen.
Ich klingele bei der Nachbarin aus der Wohnung links neben meiner. Sie ist die Einzige auf der Etage, die ich fragen kann. Die anderen Nachbarn, die in den beiden Wohnungen rechts von mir wohnen, sprechen nur Russisch, und deshalb beschränken wir uns auf Grüße und Lächeln, wenn wir uns im Lift oder im Flur begegnen. Ich höre sie von innen an die Tür kommen und fragen, wer da ist. Erst als sie meine Stimme erkennt, öffnet sie zögernd. Obwohl es heller Nachmittag ist, trägt sie einen bunt gemusterten Schlafrock, den sie über der Brust zusammenhält, und an den Füßen dicke Wollsocken und Filzpantoffeln. Doch ich sehe sofort, dass ihr Haar gekämmt ist und sie Lippen und Augen geschminkt hat, und weiß also, dass ich sie nicht aus dem Schlaf geholt habe. Ich habe keine Ahnung, was sie von Beruf ist und wo sie arbeitet, aber ich habe bemerkt, dass sie häufig nachmittags zu Hause ist, und zu Hause, so viel habe ich schon im Umgang mit meinen Kolleginnen gelernt, trägt hier niemand die Kleidung, mit der man sich in der Öffentlichkeit zeigt.
Sie lächelt mich vorsichtig an.
Ob sie auch diese nächtlichen Schüsse gehört hat, frage ich. »Schüsse? Nein.« Ihr Gesicht zeigt keine Regung. »Nichts gehört. Wirklich Schüsse?«
»Ja«, sage ich, »mehrere Schüsse, und dann Stimmen, und dann ist ein Auto weggefahren.«
Sie hebt bedauernd die Schultern. »Tut mir Leid«, sagt sie, »aber ich schlafe nach hinten raus. Und vielleicht haben Sie sich ja getäuscht.« Sie spricht langsam und sehr deutlich, und ich bin ihr dankbar dafür, denn das ermöglicht mir, auch die Satzkonstruktion nachzuvollziehen.
»Ich glaube nicht«, sage ich und weiß doch, dass es zwecklos ist.
»Ein Traum«, sagt sie, »ein Albtraum vielleicht.« Coşmar. Ein Wort, das ich begreife, obwohl es mir bisher noch nicht untergekommen ist.
»Coşmar?«, frage ich zweifelnd.
»Wahrscheinlich.« Sie verzieht den Mund zu einem kleinen Lächeln. »Aber fragen Sie doch einmal Valera, ob der vielleicht was gehört hat.«
Valera ist der Nachbar rechts von mir.
»Unmöglich«, sage ich. »Ich meine, ich kann mich nicht mit ihm verständigen.«
»Ach so, ja.« Jetzt kommt sie auf den Flur heraus und geht resolut auf Valeras Tür zu. Sie klingelt zweimal, dreimal, doch niemand öffnet.
»Nicht zu Hause«, sagt sie. »Dann ein anderes Mal.« Und, wie um mich zu beruhigen: »Man hört hier öfter mal Schüsse. Es hat nichts zu bedeuten.« Sie nickt mir noch einmal zu, bevor sie wieder in ihrer Wohnung verschwindet. Ich höre, wie sie den Schlüssel zweimal im Schloss herumdreht.
5
Mitunter treibt es mich abends doch noch einmal nach draußen. Zumal da etwas ist, das ich mir, sooft ich mir das Bild auch wieder vor Augen halte, einfach nicht erklären kann. Es widerspricht jeder Logik. Dass ich in der Schule keine Leuchte in Mathematik war, lag eindeutig am Lehrer. Denn nachdenken, kombinieren und Schlüsse ziehen kann ich sehr wohl. Und es beschäftigt mich, dass auch Wolf, der Mathematiker und von daher viel systematischer ist als ich, mir die Sache nicht erklären konnte. Ich male mir also etwas Farbe ins Gesicht, vergewissere mich, dass meine Schuhe geputzt sind, stecke Geld, Zigaretten und Halstabletten ein und mache mich auf den Weg zu meinem Auto. Zehn Minuten später parke ich vor dem Seabeco.
In diesem Land gibt es einen feinen Unterschied zwischen den Menschen. Die einen sind die, die zwar irgendwie an Devisen kommen, sie jedoch nicht ausgeben, sondern als Notgroschen in Tüten und Kuverts zu Hause versteckt halten, die nur bei Bedarf hervorgeholt werden.
Die anderen tragen ihre Dollar- oder Euro-Scheine in der Tasche, um sie bei Gelegenheit als Zahlungsmittel einzusetzen. Im Seabeco machen sie den Großteil des Publikums aus.
Ich setze mich an die Bar, lege den Mantel auf den Hocker links von mir und bestelle ein Bier. Ich sitze seitlich zum Raum, so dass ich die getönte Glastür im Auge behalten und das Hin und Her der Gäste beobachten kann. Es ist noch früh, gerade mal zehn Uhr, aber in dieser Stadt scheinen ordentliche Menschen um diese Zeit längst zu Hause zu sein. Am Nachtleben nimmt nur teil, wer ein etwas ungeregelteres Leben führt und Devisen in Umlauf bringen kann. Weil Vorstellungen in Theatern, Konzerten und Kinos bereits um sechs – sonntags sogar schon um vier – beginnen, sieht es spätestens gegen neun Uhr so aus, als habe sich die einheimische Bevölkerung in Luft aufgelöst. Straßen und Fußwege, meist unbeleuchtet und dazu voller Unebenheiten und tiefer Löcher, lassen jeden Weg in der Dunkelheit zu einem Slalom zwischen Fußangeln werden. Dazu kommt die ständige Angst, man könnte überfallen und ausgeraubt werden. Wenn es nach Tamara oder Nadja ginge, dürfte ich mich nach Anbruch der Dunkelheit nicht einmal mehr einem Taxi anvertrauen, weil die Fahrer angeblich nur darauf warten, mich, als Frau und obendrein auch noch als Ausländerin, um den Inhalt meiner Handtasche zu bringen. »Und glaub bloß nicht«, warnen sie mich immer wieder, »dass du, falls dir so etwas passiert, irgendeine Art von Hilfe bei der Polizei bekommst. Die protokollieren deinen Fall, und damit hat sich das dann. Die machen höchstens noch gemeinsame Sache mit dem, der dich überfallen hat. Stecken doch alle unter einer Decke.«
Dem Gerücht, Polizisten seien die eigentlichen Verbrecher, bin ich schon öfter begegnet. Insgeheim lache ich darüber. Aber trotzdem kann ich mich der Erkenntnis nicht verschließen, dass sie anscheinend einer anderen Spezies Mensch angehören.
»Sie sind doch nicht böse, wenn ich frage, wo Sie herkommen?«
Ein Mann hat sich auf den Barhocker neben jenem gesetzt, auf dem ich meinen Mantel deponiert habe. Er trägt dunkle Hosen, ein hellblaues Hemd und ein graues Wolljackett. Keine Krawatte. Er hat schwarze Locken, ein schmales Gesicht und braune Augen. Dem Tonfall nach zu schließen ist er Österreicher. Ich schätze ihn auf Ende zwanzig. Einen Moment überlege ich, dann sage ich: »Deutschland.«
»Habe ich mir gedacht. Ich meine, dass Sie Ausländerin sind.« Er lächelt. »Und was hat Sie ausgerechnet in diese Stadt verschlagen?«
»Ich arbeite hier. Und Sie?«
»Ich bin Journalist. Man hat mich hergeschickt, damit ich einen Bericht über diesen Weinkeller schreibe. Sie haben vielleicht von ihm gehört.«
Ich nicke. Ich habe von ihm gehört. Genauer gesagt, wir waren dort, Wolf und ich. Letzte Woche. Ich habe nicht vor, ihm das zu erzählen. Vermutlich weiß er, dass normal Sterbliche nicht ohne weiteres Zugang haben. Man braucht Beziehungen. Oder zumindest ein offizielles Empfehlungsschreiben.
»Wer hat Sie hergeschickt?«
Er nennt den Namen einer Fachzeitschrift, den ich sofort wieder vergesse. Die Redaktion sitzt in Wien.
»Aha.« Es ist nicht das erste Mal, dass ich denke, Österreicher sind irgendwie neugieriger auf andere Länder als wir. Und eine Spur besser informiert.
»Allerdings muss ich erst noch herausfinden, wo er eigentlich ist.« Wenn er lacht, sieht er aus wie ein großer netter Junge, der sich auf ein Pfadfinderspiel freut.
»Wie viel Zeit hat man Ihnen dazu gegeben?«
»Zwei Tage. Aber ich bin gerade erst mit der Nachmittagsmaschine angekommen.«
Als er sein Bierglas zum Mund führt, fällt mir auf, dass er lange Finger und schmale Handgelenke hat.
»Ist es schwer, hier zu leben?«, fragt er.
»Anders.«
Seinem Gesicht sehe ich an, dass er damit nicht viel anfangen kann. »Vor allem, weil man sich daran gewöhnen muss, dass alles etwas länger braucht. Das kann manchmal ziemlich frustrierend sein. Man muss warten lernen.«
»Verstehe.«
»Das heißt«, schiebe ich trotzdem nach, »wahrscheinlich wäre es besser, wenn Sie sich darauf einstellen würden, dass Sie vielleicht etwas mehr als zwei Tage hier bleiben müssen.«
Das geht gegen seine Pfadfinderehre, aber er grinst freundlich. »Mal sehen.«
Ob er mir noch ein Bier bestellen darf, will er wissen. Ich werfe einen Blick zu der getönten Glastür hinüber, hinter der sich nicht viel zu tun scheint, beschließe, dass ich noch Zeit habe, und frage ihn, ob er etwas dagegen hat, wenn ich auf Kognak umsteige. Nachdem er bestellt hat, erzählt er mir, dass er im Cosmos abgestiegen ist. »Dieser riesige Bau, über zwanzig Stockwerke … Können Sie sich erklären, wozu man in einer Stadt, in der es keinen Tourismus gibt, so große Hotels braucht? Wer mietet sich da wohl ein?« Sein weicher Wiener Dialekt klingt mir angenehm im Ohr. Aber was das Cosmos angeht, muss ich passen. Vermutlich ist es einmal für irgendwelche Parteibonzen konzipiert worden, und nun wartet es wieder auf bessere Zeiten.
»Geschäftsleute«, sage ich, »Handeltreibende aus der Ukraine oder Weißrussland vielleicht, die noch nicht das ganz große Geld machen, um im Codru oder Dacia oder sogar hier, im Seabeco, zu logieren.«
Er nickt. Und nun will er natürlich auch wissen, welche Art von Arbeit mich hierher gelockt hat.
»Ganz einfach«, setze ich an, aber weil ich im selben Moment sehe, wie mehrere Herren hinter der Glastür verschwinden, stocke ich. Er folgt meinem Blick.
»Was ist das dort drüben?«
»Ein Casino.«
»Ach so. Seltsam.«
»Wieso?«
»Na ja, weil es hier offenbar an jeder Ecke ein Casino gibt. Jedes größere Hotel scheint ein eigenes zu haben.«
Nicht schlecht, denke ich. Zumindest dafür, dass er noch keinen halben Tag hier ist. Dieser Pfadfinder macht die Augen hübsch weit auf.
»Sind das richtige Casinos?«, fragt er. »Ich meine, wie bei uns? Roulette, Blackjack und so?«
»Schon. Spielen Sie?«
Er kneift die Augen zusammen. »Selten. Das heißt, zu Hause eigentlich nie. Aber«, er rutscht sich auf seinem Hocker zurecht, »ich würde es mir gern ansehen. Gibt es denn tatsächlich Leute, die dafür Geld haben?«
»Und ob.«
Er nippt an seinem Bier, schaut wieder zur Glastür hinüber, gibt sich schließlich einen Ruck. »Verzeihen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Pacher, Rudolf. Rudi Pacher.«
»Pia Ritter.«
Einen Moment zögert er noch. Dann fragt er endlich: »Haben Sie nicht Lust, mal mit mir da reinzuschauen?«
6
Wir treten durch die getönte Glastür und ich bemerke mit Genugtuung, wie mein Pfadfinder einen Moment stockt, die Augenbrauen in die Höhe zieht, schluckt, mich irritiert anlächelt und nicht so recht zu wissen scheint, wo er da hineingeraten ist. Dieses Zwischending aus qualmverhangener Spielhölle und Bordcasino-Noblesse hat er offensichtlich nicht erwartet. Der Großteil der Besatzung besteht aus coolen Maßanzugtypen mit undurchdringlichen Gesichtern, denen man ansieht, dass sie Handys, dunkle Brillen und genügend Scheine in den Jacketttaschen mit sich herumtragen. An der Bar hängen ein paar schrill gestylte Miezen herum – vermutlich Damen von der Sorte, wie der nächtliche Telefonservice des Hotels sie ausländischen Gästen offeriert. Es ist mehr Publikum da, als ich dachte.
Pachers Lächeln beantworte ich mit einer Kopfbewegung zur Kasse hin, wo man Dollars gegen Chips tauschen kann. Wir gehen zusammen hinüber, und während er darauf wartet, dass der Kassier sein Gespräch mit einem breitbeinig vor seinem Schalter stehenden, Russisch sprechenden Gast beendet, merke ich, wie sich in meinem Magen wieder dieses Kribbeln breit macht, das mich in den ersten Wochen immer erfasste, wenn ich ins Auto stieg und mich durch den Stadtverkehr zu kämpfen suchte. Dieses fast bodenlose Staunen, dass ich doch immer heil an meinem jeweiligen Ziel ankam, obwohl die Autofahrer sich mit einer an Tollkühnheit grenzenden Unbefangenheit fortbewegen, die kaum vermuten lässt, es habe sich bereits herumgesprochen, dass jemand einmal so etwas Nützliches wie das Fahren in der Spur erfunden hat. Irgendwie scheinen Mittelstreifen vor allem dazu da zu sein, dass jeder ausprobieren kann, wie lange es ihm gelingt, mit dem Wagen möglichst genau über sie hinwegzufahren, ohne sich abdrängen zu lassen. Und alle spielen mit. Dass man hier in Einbahnstraßen auch in umgekehrter Richtung fährt, habe ich schnell gelernt, und die Verkehrspolizisten mit ihren breitkrempigen schwarzen Cowboyhüten, den strahlend weißen kurzärmeligen Hemden und den schwarzen Hosen und Stiefeln sehen aus, als kämen sie geradewegs aus einem für die Ausstattung von Westernsaloons zuständigen Kostümverleih. Ebenso weiß ich mittlerweile, dass sie mit Selbstverständlichkeit davon ausgehen, Besitzern von Wagen mit ausländischen Kennzeichen ohne wortreiche Dispute ein paar Lei mehr abnehmen zu können, als die Regeln es vorsehen. Seitdem ich die Preise kenne und mein Wortschatz ausreicht, um gegen überhöhte Forderungen protestieren zu können, machen mir meine unvermeidlichen Rencontres mit den staatlichen Ordnungshütern beinahe Spaß. Immerhin werde ich regelmäßig, kaum dass sie mich hinter dem Lenkrad entdeckt haben, von ihren Trillerpfeifen an den Straßenrand geholt, weil sie meine Papiere kontrollieren wollen. Frauen am Steuer gehören hier immer noch ins Raritätenkabinett.
Was mir in etwa so fremd ist wie das, was momentan hier hinter der getönten Glastür passiert.
Ich sehe es sofort, als wir uns dem am dichtesten belagerten Spieltisch nähern: Der Dicke ist wieder da. Er schwitzt. Zielsicher deckt er den grünen Tisch vom unteren Ende her mit roten Chips ab. Immer mindestens drei übereinander. Er setzt sie in die Felder und auf die Zwischenlinien und Knotenpunkte. Unaufhörlich. Kein Rien ne va plus hält ihn auf. Rot steht für zwanzig. Zwanzig Dollar. Ich habe keinen Überblick, wie viel Geld er der Bank zum Fraß anbietet. Doch die Bank schluckt es nicht. Die Kugel rollt, und wenn sie anhält, werden dem Dicken blitzschnell hohe Chip-Türme zugeschoben, die er vor sich zu Bergen anhäuft, um sie dann wieder neu in Dreier- und Vierergruppen ins Spiel zu bringen. Er verliert nie. Als Wolf und ich zusammen hier waren, standen wir mindestens eine Stunde lang völlig gebannt am Tisch.
»Das war doch die Null«, entfuhr es mir einmal.
Wolf nickte.
»Aber auf die Null hat er doch gar nicht gesetzt.«
»Hm.«
Er zog die Schultern in die Höhe und legte mir die Hand auf den Ellbogen. Ich verstand zwar nicht, was da vorging, aber ich hielt den Mund. Dass um den Roulettetisch herum nie geredet wird, hat mich schon immer gestört. Ich mag Spiele nicht, die so ernst sind, dass sie die Spielenden daran hindern, miteinander zu kommunizieren.
Wieder waren zwei Drittel des Einsatzes zu dem Dicken hinübergewandert. Und noch drei weitere rote Zwanziger-Türme.
»Mensch!«