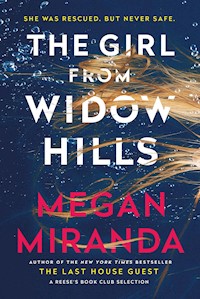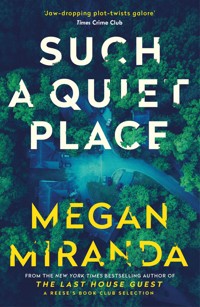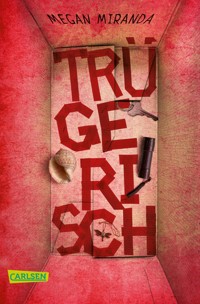9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Überall lauert Gefahr! Das weiß die 17-jährige Kelsey nur zu gut. Denn ihre Mutter hat das Haus seit Kelseys Geburt nicht verlassen – seit sie mehreren Kidnappern entkommen konnte. Zu ihrem Schutz verhält Kelsey sich möglichst unauffällig. Doch ein Autounfall, bei dem sie von einem Mitschüler gerettet wird, löst ein wahres Medienfeuer aus. Als Kelsey wenig später abends nach Hause kommt, ist ihre Mutter verschwunden. Und auf dem Gelände verstecken sich Fremde. Aber das Böse wartet nicht im Dunkeln, sondern in der Vergangenheit. --- Aufregend, atemlos und voller Überraschungen - der perfekte Thriller von New-York-Times- und Spiegel-Bestseller-Autorin Megan Miranda ---
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Carlsen-Newsletter: Tolle Lesetipps kostenlos per E-Mail! Unsere Bücher gibt es überall im Buchhandel und auf carlsen.de. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt. Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert Deutsche Erstausgabe Veröffentlicht im Carlsen Verlag Januar 2018 Originalcopyright © 2016 by Megan Miranda Published by arrangement with Rights People, London. Originalverlag: Crown Books for Young Readers, an imprint of Random House Children’s Books, a division of Penguin Random House LLC, New York Originaltitel: »The Safest Lies« Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe: 2018 Carlsen Verlag GmbH, Hamburg Aus dem Englischen von Birgit Maria Pfaffinger Lektorat: Brigitte Kälble Umschlaggestaltung: formlabor Umschlagfoto: shutterstock.com © Aleshyn_Andrei Satz und E-Book-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-646-92933-1
Für Luis
1. KAPITEL
Früher war mir das schwarze eiserne Gittertor das Liebste am Haus.
Als ich noch jünger war, erinnerte es mich an geheime Gärten und versteckte Schätze, an all die großen Rätsel, die ich aus Kinderbüchern kannte.
Der ganze Zaun war wie aus dem Märchen. An manchen Stellen kletterten Pflanzen empor, Efeu und Unkraut umrankten die Stäbe, und wenn er bei Gewitter rings um das Haus aufleuchtete, bildete er einen scharfen Kontrast zur Dunkelheit.
Und wir waren drinnen.
Es war besser, den Zaun von dort aus zu betrachten, auf dem Weg nach draußen. Als ich älter wurde, begann ich ihn mit anderen Augen zu sehen. Von der anderen Seite, durch einen anderen Filter. Wenn ich im Hinausgehen einen Blick über die Schulter warf, sah ich nur die Kameras über den Eingängen. Die sterilen, kompakten Mauern des dahinterliegenden Hauses. Den Schatten hinter dem getönten Fenster.
Lange war mir nicht klar, dass genau darin das Geheimnis lag.
Trotzdem hatte der Eisenzaun etwas Vertrautes, und wenn ich morgens an ihm vorbeiging, musste ich ihn unwillkürlich berühren, ein banaler Abschied, wenn ich in den Tag aufbrach. Im Sommer waren die Stäbe heiß von der Sonne. Und im Winter, wenn ich meinen Wollmantel trug, spürte ich manchmal einen Funken unter der Kälte, als könnte ich den Strom fühlen, der oben hindurchfloss.
Aber meistens gab er mir ein Gefühl von zu Hause.
Als ich heute die Hand zurückzog, war sie feucht vom Morgentau. Alles glitzerte in der Sonne, die hinter den Bergen aufging.
Da ich mich jetzt jenseits des Zauns befand und weil ich am Fenster den Schatten meiner Mutter sah, galt es einen strikten Ablauf einzuhalten:
Vor dem Aufschließen der Autotür einen Blick auf die Rückbank werfen.
Den Motor starten und bis zwanzig zählen, damit er gleichmäßig lief.
Meiner Mutter winken, die mich aus dem Fenster beobachtete.
Mit beiden Händen am Steuer von der Kiesauffahrt rollen und dann über die gewundenen Bergstraßen in die Schule fahren.
Der Rest des Tages bestand aus abzuhakenden Stunden, einem altbekannten festen Ablauf. Man konnte diesen Mittwoch gegen jeden anderen tauschen, niemand hätte es bemerkt. Meiner Mutter zufolge bedeuteten feste Abläufe Sicherheit, aber ich sah das etwas anders. Feste Abläufe ließen sich lernen, sie waren vorhersehbar. Aber so etwas durfte man nicht aussprechen. Man durfte es noch nicht mal denken.
Der Rest meiner Mittwochsroutine ging so:
Früh genug in der Schule ankommen, um einen Parkplatz neben einer Straßenlaterne zu ergattern, da ich erst spät wieder losfahren würde. Den vollen Flur meiden und hoffen, dass Mr Graham das Klassenzimmer schon früh aufsperrte. Vor dem Matheunterricht auf meinem Platz in der letzten Reihe sitzen und weitgehend unbemerkt durch den Tag gleiten.
Weitgehend.
Ich hatte meine Bücher schon ausgepackt und war gerade mit den morgendlichen Aufgaben durch, als Ryan Baker ins Klassenzimmer rauschte.
»Hey, Kelsey«, sagte er und rutschte genau mit dem Läuten auf seinen Stuhl.
»Hi, Ryan«, erwiderte ich. Auch das gehörte zur Routine. Ryan sah aus, wie er immer aussah, nämlich: braune Haare, die jeden Tag anders fielen; Beine, die für sein Pult zu lang waren, sodass er sie nach vorne oder in den Gang zwischen uns streckte (heute: Gang); Jeans, braune Schnürstiefel, T-Shirt. Herbst in Vermont hieß für mich Sweatshirt-Wetter, aber für Ryan war es offensichtlich noch zu früh dafür.
Heute trug er ein dunkelblaues T-Shirt, auf dem FREIWILLIGER stand, und er merkte, wie ich die Aufschrift anstarrte. Ich wusste nicht, ob es ironisch gemeint war.
Er trommelte mit den Fingern auf der Tischplatte. Wippte mit dem Fuß im Gang.
Ich hätte ihn beinahe danach gefragt, aber dann rief Mr Graham mich zum Vorrechnen an die Tafel, und Ryan fing an mit blauer Tinte auf sein Handgelenk zu malen, und als ich auf meinen Platz zurückkehrte, war es zum Fragen zu spät.
Die ersten beiden Stunden verliefen meistens ruhig und weitgehend leise. Alle gähnten und streckten sich, manchmal legte jemand den Kopf auf den Tisch und hoffte, dass Mr Graham es nicht merkte. Im Laufe der neunzig Minuten erwachten alle langsam zum Leben.
Aber Ryan war das genaue Gegenteil – er sprühte schon um acht Uhr früh vor Energie. Er stürmte ins Klassenzimmer, wippte in einem fort mit dem Bein und kritzelte ständig irgendwelche Muster. Seine Energie war ansteckend, denn wenn es endlich klingelte, sprang ich jedes Mal wie von der Tarantel gestochen auf. Ich winkte zum Abschied, ging durch den Flur zum Englischunterricht und tat so, als hätten er und ich nicht einst das peinlichste Gespräch meines Lebens geführt.
Der Rest der täglichen Routine: Englisch, Mittagessen, Naturwissenschaften, Geschichte. Gesichter, an deren Anblick ich mich im Lauf der letzten zwei Jahre gewöhnt hatte. Namen, die ich gut, Leute, die ich flüchtig kannte. Der Tag verging angenehm gleichförmig. Einmal zu lange blinzeln, und schon hätte man ihn verpasst.
Mittwoch hieß auch, dass ich nach der Schule Nachhilfe gab, um auf die für den Abschluss nötige Stundenzahl Freiwilligenarbeit zu kommen. Da ich den meisten aus meiner Stufe weit voraus war und hauptsächlich Leistungskurse besuchte, war das der einfachste Weg.
Heute hatte ich meine erste Stunde mit Leo Johnson – einem Zwölftklässler, der in Naturwissenschaften einen Grundkurs belegte. Ich kannte ihn mehr oder weniger aus der Lodge. Mehr oder weniger, weil Leo (a) zu den Leuten gehörte, die jeder mehr oder weniger kannte, und (b) mit Ryan befreundet war, mit dem ich im Sommer zweimal die Woche in der Lodge Dienst geschoben hatte. Das hieß, dass Leo mir, wenn er dort vorbeikam, manchmal zugenickt und mich noch seltener mit Namen begrüßt hatte.
Er warf sein Notizbuch auf den Tisch und setzte sich mir gegenüber. »Hi, ich bin Leo und falle durch.« Er lächelte.
»Hi, ja, wir kennen uns schon.«
Er lehnte sich zurück und kniff die Augen zusammen. »Ja, aber wusstest du auch, dass ich durchfalle?«
»Da du an einem Mittwoch nach der Schule hier aufkreuzen musst, hab ich mir das fast gedacht. Und noch aufschlussreicher ist, dass du keine Bücher dabeihast.«
Er legte den Kopf schief und kaute auf der Unterlippe, als würde er etwas überlegen.
Ich schaute auf die Uhr. Es waren erst zwei Minuten vergangen. Er hatte nicht mal einen Stift. »Hör zu, ich bekomme meine Punkte, egal ob ich dir Nachhilfe gebe oder wir nur dasitzen und uns anstarren. Sag mir einfach, was dir lieber ist.«
Er unterdrückte ein Lachen. »Okay, Kelsey Thomas. Ich hab’s kapiert.« Er deutete auf meinen Bücherstapel. »Legen wir los. Man hat mir gesagt, dass ich den Kurs für meinen Abschluss brauche.«
Wie sich herausstellte, war Leo nicht der schlechteste Schüler aller Zeiten, aber vielleicht der am schnellsten ablenkbare. Er redete mit jedem, der am Eingang der Bibliothek vorbeilief, und schaute ungefähr alle fünf Minuten auf die Uhr.
Als er nach einer Stunde Schritte auf dem Gang hörte, hob er sofort den Kopf und schrie: »Hey, Baker!«, ungeachtet der Tatsache, dass wir in der Bibliothek saßen und seine Stimme widerhallte. Leo war so jemand, dem es nichts machte, aufzufallen – positiv oder negativ.
Ryan wurde langsamer, blieb aber nicht stehen. »Ich hab’s eilig. Wir sehen uns später.« Dann trafen sich unsere Blicke und er hob kurz die Hand. »Mach’s gut, Kelsey.«
Ich winkte schüchtern zurück.
Leo kicherte leise. Als ich ihn ansah, grinste er immer noch.
»Was ist?«
»Nichts.«
Ich spürte, wie ich rot anlief, also packte ich den Bleistift fester, klopfte damit aufs Papier und wartete, dass Leo sich wieder auf die Aufgabe konzentrierte.
Dank meiner Mutter war ich dem Unterrichtsstoff weit voraus, in allem anderen dagegen hinkte ich gnadenlos hinterher. Wahrscheinlich ging es Leo bei diesen Aufgaben so ähnlich: Sie kamen ihm vor, als wären sie in einem unbekannten Code geschrieben.
Ich dagegen hatte Mühe, den Code der Highschool zu knacken.
Leo und ich ließen unsere Scheine von der Bibliothekarin unterschreiben, die es genauso eilig hatte wegzukommen wie wir und hinter uns abschloss.
»Es war mir ein Vergnügen, Kelsey«, sagte er und machte sich aus dem Staub, einer Windbö gleich, während ich in meiner Tasche nach dem Handy kramte.
Die abendliche Routine: Mom anrufen, mir was zu trinken holen und schnurstracks heimfahren.
»Bin auf dem Weg«, sagte ich, als sie abhob.
»Bis gleich.« Ihre Stimme war wie Musik. Ein Zielsuchgerät. Das Klappern der Teller im Hintergrund verriet mir, dass sie schon mit dem Abendessen angefangen hatte. Sie hatte auch ihre Routine.
Als ich auflegte, war Leo verschwunden. Die Bibliothekarin ebenfalls. Die Gänge lagen leer und stumm da, nur die Getränkeautomaten in der Ecke brummten. Ich zog einen glatten Dollarschein aus der Geldbörse und steckte ihn in einen Automaten. Das Getriebe setzte sich ratternd in Bewegung und in der Leere stellte ich mir vor, was ich nicht sehen konnte.
Ich merkte, dass ich im Kopf die Ausgänge durchging, eine alte Angewohnheit: die Doppeltür im Foyer, die Notausgänge am Ende jedes Flurs, Fenster in den Klassenzimmern, die nicht abgeschlossen waren …
Ich schüttelte den Gedanken ab, schnappte mir mein Getränk und trabte mit hallenden Schritten durchs Foyer zur Eingangstür; die Schlüssel in meiner Tasche klimperten. Erst als ich auf dem nahezu leeren Parkplatz den Lichtkegel um mein Auto erreichte, wurde ich langsamer.
Es dämmerte, aus den Bergen drückte kalte Luft herab, und im Schein der Straßenlaternen ähnelten die Schatten der umstehenden Bäume denen unseres schwarzen Eisenzauns, wenn er von einem Gewitter erleuchtet wurde.
Ich wiederholte die morgendliche Routine: die Rückbank prüfen, den Motor starten und warm werden lassen. Das Handy in der Tasche, die Tasche neben mir, im Scheinwerferlicht nur Mücken und Nebel.
Heute war ein guter Tag. Ein normaler Tag. Er verschwamm mit vielen anderen, die so ähnlich abgelaufen waren.
Während der Fahrt leuchteten die Reflektoren der gelben Doppellinie in der Straßenmitte in regelmäßigen, fast schon hypnotischen Abständen auf.
Der Oktober brachte nächtliche Kälte mit sich, und ich wünschte, ich hätte meinen Mantel dabei. Ich beugte mich vor, stellte die Heizung an, lehnte mich in meinem Sitz zurück und lauschte dem Luftstrom aus dem Gebläse.
Ein Hitzestoß.
Ein Lichtblitz.
Die Welt in Bewegung.
Ich wusste nicht, dass die Luft schreien kann.
2. KAPITEL
Keine Angst.
Die Stimme klang weit entfernt, als müsste sie erst Wasser oder Glas durchdringen, bevor sie mich erreichte. Und dann war da dieses Rauschen – ein Funkgerät? Weißes Rauschen, das wie Elektrizität knisterte und meine Nerven reizte.
Alles ist gut.
Warme Finger an meinem Hals, die Stimme, deutlicher als vorhin. Meine Glieder fühlten sich zu schwer an, als wäre ich mit einem Arm und einem Bein aus dem Bett hängend eingeschlafen, und jetzt kribbelte alles wie tausend Nadelstiche – taub und wie losgelöst. Ich versuchte mein Gewicht zu verlagern. Meine Augenlider flatterten, während ich nach den Wänden meines Zimmers suchte.
»Hörst du mich?« Eine Stimme, die nicht mir gehörte, oder meiner Mutter, oder Jan. Trotzdem kam sie mir bekannt vor. Die Stimme eines Jungen. Also nicht mein Zimmer.
Ich öffnete die Augen, aber nichts ergab Sinn – weder das Gefühl, dass mein Blut in die falsche Richtung schoss, noch das Fehlen der Schwerkraft oder mein dunkles Haar, das mir wie ein Wasserfall ins Gesicht fiel. Auch nicht mein Atem, der in meinem Kopf widerhallte, oder der Geruch nach brennendem Gummi, oder das dumpfe Pochen hinter meinen Lidern, die ich wieder geschlossen hatte.
Aber.
Keine Angst. Alles ist gut.
Gut.
»Ich hol dich hier raus. Dir passiert nichts.«
Mir passiert nichts, sprach ich die Worte nach, wie meine Mutter es getan hätte. Aber selbst während ich mich an ihnen festklammerte wie an einer weichen Decke, die jemand über mich gelegt hatte, spürte ich, wie die Angst allmählich in mir aufstieg.
»Wo bin ich?«, fragte ich. Mein Kopf schmerzte, Nacken und Schultern waren steif, und es kribbelte in meinen Armen und Beinen, die langsam wieder zum Leben erwachten.
»Gott sei Dank.« Die Stimme kam von irgendwo hinter mir. Vage vertraut. Aber bevor ich sie einordnen konnte, setzte in einiger Entfernung ein hohes, mechanisches Surren ein. Wieder das Rauschen – deutlicher und durchdringender.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Alles ist gut. Keine Panik.«
Was wohl hieß, dass (a) vermutlich nicht alles gut war, und (b) vermutlich durchaus Grund zur Panik bestand.
Ich versuchte mich umzudrehen, aber ein Riemen spannte sich quer über meine Brust und über den Schoß, und Metall bohrte sich schmerzhaft in meine Seite. Als ich mir das Haar aus dem Gesicht streichen wollte, sah ich nur weißes Gewaber, wie ein Leintuch. Ich war gefangen.
Nicht gut.
Grund zur Panik.
Raus. Ich muss hier raus.
Mein Atem wurde immer schneller und ich drückte verzweifelt gegen das Metall.
Der Besitzer der Stimme zog scharf die Luft ein und legte seinen Arm um den Sitz, um mich ruhig zu halten. »Und bitte«, sagte er, »nicht bewegen.«
Sein Arm zitterte. Ich zitterte.
Jetzt waren noch andere Stimmen zu hören, weiter weg, und das Werkzeugsurren wurde lauter. »Ich komme runter!«, rief jemand.
»Okay«, rief die Stimme hinter mir zurück. Und dann an mich gewandt: »Hör zu, alles ist gut, du hattest einen Unfall, aber wir holen dich jetzt raus. Es wird nur ein bisschen laut.«
Einen Unfall? Die Kurve und die Reflektoren auf der gelben Doppellinie. Scheinwerfer, ich reiße das Lenkrad herum, das Geräusch von Metall –
Oh Gott, wie lange saß ich schon hier fest? Hatte Mom versucht mich anzurufen? Bekam sie bereits Panik, weil sie mich nicht erreichte? Ich schob mir erneut das Haar aus dem Gesicht und stopfte es unter meinen Kragen. Dann tastete ich nach meiner Tasche. Soweit ich es beurteilen konnte, hing ich – schräg und vornüber – im Gurt, und meine Tasche hatte auf dem Sitz neben mir gelegen. Das hieß also …
Ich streckte die Arme über den Kopf, aber das Metall war zu nah, eingedellt und verbogen, und ich konnte keine Tasche finden. »Es ist mein Ernst«, sagte er. »Nicht bewegen.«
»Ich brauch meine Tasche. Ich brauch mein Handy. Ich muss meine Mom anrufen.« Mein Atem ging stoßartig. Der Besitzer der Stimme begriff nicht. Ich musste Mom sagen, dass alles gut war. Alles ist gut.
»Wir rufen sie gleich an. Aber jetzt musst du erst mal stillhalten. Wie heißt du?«
»Kelsey.«
Eine Pause, dann: »Kelsey Thomas?«
»Ja.« Es war also jemand, der mich kannte. Jemand aus der Schule. Oder der Lodge, vielleicht auch aus der Nachbarschaft. Ich versuchte mühsam, einen Blick in den Rückspiegel zu werfen, der viel näher war, als er sein sollte. Die Welt schien aus den Fugen geraten.
Der Spiegel war schief und zerbrochen – ich sah Zweige, die Felsen am Berghang, nur nicht das Gesicht meines Retters. »Ryan«, sagte er, als hätte er begriffen, dass ich nach etwas zum Festhalten suchte. Dann fügte er hinzu: »Baker.«
»Ryan aus meinem Mathekurs?« Ich hätte alles Mögliche sagen können, aber das war das Erste, was mir einfiel, und das Erste, was aus mir herausplatzte.
Ein langsamer, ruhiger Atemzug. »Ja. Ryan aus deinem Mathekurs.«
Ich war von Metall und weißen Kissen umgeben und hing wahrscheinlich kopfüber da, aber ich konnte mit den Zehen wackeln, ich konnte atmen, ich konnte denken, und ich unterhielt mich mit Ryan Baker aus meinem Mathekurs, also hakte ich die Dinge ab, die ich nicht war: gelähmt, dem Erstickungstod nah, bewusstlos, tot. Meiner Mutter half es, die Dinge aufzulisten, die sie war – immer angefangen mit in Sicherheit –, ich dagegen belegte meine Sicherheit lieber mittels Ausschlussverfahren.
»Was ist mit dem anderen Auto?«, wollte ich wissen.
Er holte tief Luft. »Kelsey, ich schneid dich gleich aus dem Gurt frei, aber erst müssen sie die Rückscheibe rausnehmen. Das dauert nur eine Minute.«
Eine Minute. Der Airbag drückte gegen mein Gesicht, und ich spürte den ersten Anflug von Panik – dass ich hier ersticken oder das Auto jeden Moment explodieren würde. Ich versuchte mich an Ryans beruhigende Worte zu klammern – alles ist gut –, aber es war zu spät. Der Gedanke hatte sich schon in meinem Kopf festgesetzt. Eine Explosion. Ein Feuer. Alle möglichen Arten zu sterben rasten an meinem inneren Auge vorbei.
»Schneid mich sofort frei.«
»Nein, das ist keine gute Idee.«
Irrationale Ängste, würde Jan, die Therapeutin meiner Mutter, sagen. Nichts, was tatsächlich passieren würde. Mach dir den Unterschied bewusst. Ich könnte den Airbag zur Seite schieben und schon ginge es mir besser. Ryan aus meinem Mathekurs würde den Gurt durchschneiden und mich aus dem Auto befreien. Dann könnte ich mein Handy suchen und meine Mutter anrufen, und sie würde alles aufzählen, was gut war, bevor sie zu der Tatsache kam, dass ich das Auto zu Schrott gefahren hatte.
Um es mir zu beweisen, drückte ich gegen den aufgeblasenen Airbag und schob ihn tiefer, weg von meinem Gesicht.
»Nein, Kelsey. Warte.«
Aber zu spät – ich hatte schon gesehen, was ich nicht sehen sollte, und alle Luft wich aus meinen Lungen.
Es war überhaupt nichts gut.
Die Windschutzscheibe war weg. Und unter mir war nichts. Kein Asphalt, keine Steine, kein Gras, kein Ausblick auf eine sich hinabwindende Straße. Nichts. Ich hing in der Luft. In der Luft und irgendwo entfernt gab es Felsen und Nebel –
»Oh Gott«, sagte ich. Und plötzlich hatte ich die volle Orientierung.
Hinter mir waren Felsen. Neben mir konnte ich gerade so die raue, dicke Borke eines Astes erkennen. Auf dem Airbag lag ein Blatt, die Spitzen vom Wechsel der Jahreszeiten braun und gewellt. Ich hörte etwas knarzen.
»Hängen wir über dem Abgrund? So ist es doch, oder? Wir hängen in einem Baum über dem verdammten Abgrund!« Mit zitternden Fingern tastete ich nach der Gurtschnalle, während sich der leichte Anflug von Panik zu einer ausgewachsenen Hyperventilation ausweitete.
»Ich hab doch gesagt, du musst ruhig bleiben!«
»Hol mich raus!«
Seine Hände umfassten von hinten meine Arme. Er drückte gegen den Sitz und durch das Polster hörte ich seine leise flehende Stimme: »Bitte halt still. Bitte. Tu nichts, was das Auto zum Wackeln bringt.«
Und wenn ich vorher noch nicht panisch war, dann war ich es spätestens jetzt.
Ich ließ mir wieder die Haare übers Gesicht rutschen, schloss die Augen, biss die Zähne zusammen und versuchte an etwas – irgendetwas – anderes zu denken als den Umstand, dass ich in der Luft hing, an einem Ast, über einem Abgrund.
Jan würde das als berechtigte Angst bezeichnen. Im Gegensatz zu der Vorstellung, dass ein Meteorit in unser Haus einschlug, ich in den Gefrierschrank im Keller eingesperrt wurde oder gezwungen war mit Cole zu sprechen – lauter Dinge, bei denen so gut wie ausgeschlossen war, dass sie je passieren würden, und somit irrationale Ängste. Aber das hier, das war eine berechtigte Angst: Es konnte passieren. Ich hing kopfüber in einem Auto, das in den Ästen eines Baumes über einem Abgrund hing. Das Einzige, was mich festhielt, war ein dünner Stoffgurt.
»Wie komm ich raus?«, schrie ich über das Surren im Hintergrund hinweg. »Wie zum Teufel komm ich hier raus?«
»Sie sägen die Heckscheibe auf. Dann schneide ich deinen Sicherheitsgurt durch und zieh dich raus. Ich hab einen Rettungsgurt dabei.«
Einen Rettungsgurt. Oh Gott, wir brauchen einen Rettungsgurt.
»Und das machst du allein?«, fragte ich.
»So ist es am sichersten«, murmelte er.
Ryan aus meinem Mathekurs war wahrscheinlich der letzte Mensch auf Erden, dem ich unter diesen Umständen mein Leben anvertrauen wollte. Ryan Baker, der sich nicht mal den Unterschied zwischen Sinus und Kosinus merken konnte. Der mit Kugelschreiber nichtssagende, komplizierte Muster auf die Innenseite seines Unterarms tätowierte, statt im Unterricht mitzuschreiben. Meine Zukunft lag in den Händen eines Typen, der die Grundlagen der Trigonometrie nicht beherrschte. Was, wenn er sich im Winkel vertat? Sich im Timing verschätzte? Wie konnte ich jemandem vertrauen, der die Geometrie eines rechtwinkligen Dreiecks nicht verstand?
Der Sicherheitsgurt spannte sich in einem rechten Winkel über meine Brust. Die Äste und das Auto und die Felswand – lauter Winkel. Hier war praktische Anwendung gefragt, verdammt.
Angst: Ich könnte heute sterben. Ich könnte schon in einer Minute sterben.
Noch schlimmer: Wenn ich mich bewegte, würde ich womöglich auch Ryan Baker töten.
»Was zum Teufel machst du eigentlich hier?«, fragte ich.
»Ich bin freiwilliger Feuerwehrmann.«
»Ich will einen richtigen«, sagte ich mit hoher, angespannter Stimme.
»Ich bin ein richtiger.«
»Einen anderen!«
»Glaub mir, das wäre mir auch lieber. Aber ich bin der Leichteste von uns. Bei mir ist die Gefahr am geringsten, dass das Auto aus dem Baum stürzt.«
Jetzt war es draußen: Das Auto konnte fallen. Und das wussten sie auch. Sie mussten es einkalkulieren. Fallen, sterben – diese Dinge konnten wirklich passieren, genau jetzt.
»Du bist doch gar nicht so leicht«, sagte ich. Er war deutlich größer als ich, breitschultrig, eher drahtig als stämmig – aber definitiv nicht leicht. Ich merkte, wie mir Tränen in die Augen stiegen, und versuchte es mit Beten. Bitte, bitte, bitte. Aber der Ast unter uns knarzte noch immer.
»Uns passiert schon nichts«, versicherte Ryan mir. Aber er klang, als müsste er sich selbst überzeugen.
Ich ging zu der Tiefenatmung über, die Jan meiner Mutter beigebracht hatte und meine Mutter mir.
Das Auto sackte nach unten und ich stemmte die Hände gegen das Lenkrad. Mein Magen beruhigte sich, als das Fahrzeug zum Stillstand kam, stülpte sich jedoch erneut um, als es kippte und in einem steilen Winkel über dem Abgrund hängen blieb.
Ich hörte, wie Ryan nach Luft schnappte.
»Ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt zu kündigen«, sagte ich.
Falls er antwortete, hörte ich es nicht, denn die Säge, oder was auch immer sie benutzten, fraß sich in den Rahmen, und das Geräusch von Werkzeug auf Metall vibrierte bis in meine Backenzähne. Ryan umklammerte meine Arme noch fester – entweder um mich zu beruhigen oder um mich zum Stillhalten zu zwingen, ich war mir nicht sicher.
Ich bin nicht gelähmt, ich bin nicht bewusstlos, ich verblute nicht, ich ertrinke nicht.
Dann verstummte der Lärm. Ryan griff über meine Schulter und hielt mir einen mit einer Schnalle versehenen Gurt hin. »Leg dir den um die Hüfte. Vorsichtig.« Unsere Hände zitterten, und ich musste lachen, an der Schwelle zur Hysterie. Alles an dieser Situation war absurd: von Ryan über den Gurt, der mich retten sollte, hin zu dem blöden Blatt auf dem Airbag, das teilweise noch saftig grün glänzte – als wüsste es nicht, dass es bereits tot war.
Ich befolgte seine Anweisungen und versuchte mich dabei so wenig wie möglich zu bewegen. Wo die Riemen vorne zusammenliefen, befand sich ein kleiner Metallclip. »Okay«, sagte Ryan. »Los geht’s.« Er reichte mir ein Seil, das ebenfalls mit einem Clip versehen war. »Hak das ein.«
Ich gehorchte.
Aus dem Augenwinkel sah ich die Messerklinge. »Gut, ich schneid dich jetzt los, aber du bist mit mir verbunden, und ich mit der Leitplanke am Hang, dir passiert also nichts, selbst wenn du in der Luft hängst. Aber wir müssen schnell machen.«
Das Auto sackte und ich schrie. Ich hatte das Gefühl, dass mir sehr wohl etwas passieren würde, wenn das Auto jetzt abstürzte. Und Ryan ebenfalls. Denn die Kraft des Autos war vermutlich größer, als die Kraft des Seils, das uns hielt. Bestimmt stand eine mathematische Gleichung dahinter, die er nicht durchschaute.
»Los!« Eine autoritäre Stimme von draußen. Älter. Erfahren. »Raus! Sofort!«
Ryan packte mit einer Hand meinen Arm und durchtrennte mit der anderen den Sicherheitsgurt. Ohne den Halt des Stoffbands rutschte ich zu der Lücke zwischen den Sitzen, dabei drehte ich mich zu Ryan um. Wir waren durch ein kurzes Seil verbunden, das an der Vorderseite unserer Rettungsgurte befestigt war. Er packte es mit beiden Händen.
»Siehst du?«, sagte er. Ich schwang leicht hin und her und griff nach seiner Schulter. Er öffnete den Mund, um etwas hinzuzufügen.
Im selben Moment knirschte es irgendwo unter uns und das Auto kippte mit einem langen Quietschen nach vorne. Ich sah es in Ryans Augen, als meine Hand seine Schulter berührte.
Ein plötzliches Schnalzen, und ich spürte, wie die Spannung des Seils über uns nachließ. Ich fiel nach hinten und konnte mich nicht mehr an Ryan festhalten. Er streckte die Hand nach mir aus, aber es war sinnlos. Wir waren nicht mehr mit der Leitplanke verbunden.
Wir stürzten ab.
3. KAPITEL
Ich fasste verzweifelt ins Leere, griff nach irgendetwas. Meine Finger krallten sich in den Airbag, als ich durch die offene Windschutzscheibe raste – aber ich stürzte weiter, Arme und Beine schrammten über Metall, und dann spürte ich einen brennenden Schmerz, als meine Ellbogen sich in einer Rille verkeilten. Mein Körper kam unvermittelt zum Halt, meine Beine baumelten unter mir, ich war von kalter Nachtluft umgeben.
Eine Sekunde der Erleichterung, ein halber Atemzug, dann sah ich verschwommen eine Gestalt an mir vorbeisegeln, die Hände wild tastend, Fingernägel und Haut streiften Metall und mich, und als sein Gewicht das Seil zwischen uns spannte, war der Zug an meinen Hüften so unglaublich heftig, dass meine Ellbogen aus der Rille rutschten.
Entsetzt schlug ich die Hände gegen das Armaturenbrett und suchte verzweifelt nach Halt, während ich erneut abwärtsrutschte – bis meine Finger schließlich die Rille unter der Windschutzscheibe erwischten.
Ein Teil meines Gewichts lastete noch auf der Motorhaube, aber meine Beine hingen, zusammen mit Ryan, über dem Abgrund.
Nicht nach unten schauen. Eigentlich hatte ich nie unter Höhenangst gelitten. Angst vorm Sterben hingegen … Ich starrte auf meine Hände. Das Einzige, was unser Abstürzen verhinderte, waren meine Finger, die Kraft meiner Knöchel.
Ryan ruckte immer wieder am Seil, weil er hin und her pendelte, und ich spürte, wie mir die Metallkante in die Finger schnitt, wie ich abrutschte. »Hör auf dich zu bewegen! Ryan! Halt still!«, schrie ich.
Er wurde ruhiger und ich versuchte langsamer zu atmen. Ich schloss die Augen und konzentrierte mich auf die Muskeln in meinen Händen, Armen, Schultern.
Liste auf, was du nicht bist. Los: Ich falle noch nicht, ich bin noch nicht tot.
Ich riskierte einen Blick zur Seite, sah den Radkasten zu meiner Linken und bewegte vorsichtig mein Bein dorthin, bis ich einen Teil meines Gewichts auf den Reifen verlagern konnte. Ich verhakte den Fuß und zog mich näher, sodass ich auch mit dem anderen Bein herankam. Jetzt, da nicht mehr alle Last an meinen Fingern hing, schob ich sie langsam am Rand der offenen Windschutzscheibe entlang, obwohl der Gurt um meine Hüfte und Ryans Gewicht jede Bewegung schmerzhaft und anstrengend machten. Dann endlich konnte ich beide Füße sicher auf den Reifen stellen. Ich verkeilte die Ellbogen wieder in der Rille unter der Windschutzscheibe. »Okay«, rief ich. »Schaffst du das?«
Er sagte nichts, doch an der Spannung des Seils merkte ich, wie er sich Zug um Zug zum Auto hochhangelte. Schließlich stand er auf dem Reifen, einen Arm um meine Hüfte gelegt, den Kopf auf der Motorhaube, das Gesicht mir zugewandt. Er atmete schwer, seine Augen waren weit aufgerissen. Wir sahen uns schweigend an, bis die Stimme eines anderen Feuerwehrmanns die Nacht durchschnitt. »Baker! Alles okay bei euch?«
»Alles okay!«, schrie er zurück.
Ein weiteres Seil wurde herabgelassen, das Ryan an seinem Gurt befestigte. Dann legte er seine Arme um mich und ich meine um ihn, und er rief: »Alles bereit!«
Ich spürte, wie seine Muskeln von den Schultern bis in die Fingerspitzen zitterten. Er ließ mich nicht aus den Augen, während wir nach oben in Sicherheit gezogen wurden.
Ryan zitterte noch schlimmer als ich. Ein Feuerwehrmann klopfte ihm auf die Schulter. »Gut gemacht, Kleiner. Gönn dir eine Verschnaufpause.«
»Kelsey«, sagte Ryan. »Du kannst jetzt loslassen.«
Ich umklammerte immer noch seine Schultern und presste mich eng an ihn, obwohl ich auf festem Boden stand.
»Ja, klar«, erwiderte ich. Seine grauen Augen sahen mich unverwandt an, als ich mich löste. Er trug dieselbe Kleidung wie seine Kollegen: weite Hosen und ein blaues T-Shirt, darüber Hosenträger. Aber neben den anderen wirkte er jünger, als hätte er sich verkleidet, und ich verspürte den Drang, ihm das unordentliche braune Haar aus der Stirn zu streichen.
»Hey, wir sind nicht tot«, sagte ich, die mit Abstand dümmste Bemerkung in diesem Moment.
Seine Mundwinkel bogen sich nach oben, dann lächelte er übers ganze Gesicht. »Nein, sind wir nicht.«
»Komm mit.« Eine uniformierte Frau zeigte auf den Rettungswagen. »Du solltest dich untersuchen lassen.«
Ich blickte mich um – auf beiden Seiten der Straße standen Autos, daneben Leute mit ihren Handys, die Polizei hielt alle zurück. »Wo ist der andere Wagen?«, fragte ich. »Sind alle okay?«
Die Frau legte den Kopf schief, eine Hand auf meinem Rücken, und schob mich weiter. »Es gibt kein anderes Auto«, entgegnete sie.
Der Hitzestoß, ein Aufblitzen von Scheinwerfern, und ich riss das Steuer herum –
»Doch, da war eins«, sagte ich.
Sie blieb kurz stehen, sah mir in die Augen und kam mir dabei so nah, dass ich mein eigenes Spiegelbild in ihren Pupillen sehen konnte. »Es gibt keins.«
»Sind Sie sicher?« Ich dachte an die hohen Bergwände, den steilen Abhang.
»Sind wir.«
Im Weitergehen hörte ich, wie der zweite Feuerwehrmann Ryan fragte: »Kennst du das Mädchen?«
»Ja«, antwortete er. »Sie ist in meinem Mathekurs.«
Na gut.
Bevor Ryan Baker zu Ryan aus meinem Mathekurs wurde, war er der Junge, mit dem ich im Sommer in der Lodge gearbeitet hatte. Wir hatten gemeinsam am Empfangsschalter gestanden, Gäste eingecheckt, Ausrüstung hin und her geschleppt. Dabei hatten wir eine Geheimsprache entwickelt: ein Klopfen auf die Schulter, um den anderen abzulösen, ein Winken zum Abschied, gleichzeitiges Umdrehen beim Anblick des Typen in Skihosen, damit der unseren Lachkrampf nicht mitbekam. Und ein Ritual, wenn unser Chef weg war: Dann setzte Ryan sich auf die Theke und erzählte drauflos, stellte mir Fragen, lachte – es war das Highlight meines Sommers, etwas, worauf ich mich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit freute.
Am Ende der Saison, an unserem letzten Tag meinte er: »Hey, hast du Lust, mal was zusammen zu machen?«
Ja, dachte ich. »Ja«, sagte ich.
»Okay.« Er lächelte übers ganze Gesicht und ich hörte jemanden pfeifen. Leo, AJ und Mark standen nicht weit von uns entfernt an der Eingangstür.
Weil ich mir plötzlich nicht sicher war, worauf ich mich da gerade eingelassen hatte, sagte ich: »Moment. Was heißt das?«
Ryan drehte sich zu seinen Freunden um, die auf ihn warteten, und sagte: »Was hättest du denn gern, dass es heißt?«
»Ist das eine Fangfrage?«
Es fühlte sich an wie eine Fangfrage.
»Nein. Äh.« Hinter ihm brummte Leo etwas Unverständliches. »Hör mal«, sagte Ryan mit undurchschaubarer Miene. »Es muss gar nichts heißen.«
»Oh. Okay.«
Und dann ging er einfach. Ohne Nummern auszutauschen, ohne etwas zu verabreden. Als dann eine Woche später die Schule wieder begann und ich in Mathe auf dem Platz neben ihm landete, taten wir beide einfach so, als wäre das Ganze nie passiert.
Wahrscheinlich gab es irgendwelche gesellschaftlichen Regeln, die mir fremd waren, irgendein Highschool-Balzritual, das ich nie gelernt hatte – oder vielleicht hieß mal was zusammen machen ja wir treffen uns nach der Arbeit im Besenschrank.
Jede Wette, dass er mit mal was zusammen machen nicht gemeint hatte, sich in mein über einem Abgrund hängendes Auto abzuseilen, mich aus dem Sitz freizuschneiden und dann von einem an meiner Hüfte befestigten Gurt zu baumeln, statt in den Tod zu stürzen.
Hey, weißt du noch, als wir mal was zusammen gemacht haben? War toll.
»Ich will einfach nur nach Hause. Ich muss zu meiner Mom«, erklärte ich der Frau, die mich untersuchte. Sie schien kaum älter zu sein als ich. Wo waren hier eigentlich die zuständigen Erwachsenen?
»Du warst bewusstlos, Kelsey. Wir müssen uns das im Krankenhaus näher ansehen. Deine Mom kann dorthin kommen.«
»Nein, kann sie nicht.« Konnte sie auf keinen Fall. »Ich muss sie anrufen. Ich brauche mein Handy.«
Die Lichter der Autos um uns herum waren zu hell, ihre Scheinwerfer blendeten. Ich kniff die Augen zusammen und merkte, dass ich langsam Kopfschmerzen bekam.
Ryan schlängelte sich zwischen den wahllos geparkten Autos und Rettungsfahrzeugen hindurch. Sein Arm hing schlaff herab, offenbar musste er sich ebenfalls untersuchen lassen. Bei mir angekommen blieb er stehen und gab mir mit dem gesunden Arm sein Handy. »Tut mir leid«, sagte er. »Aber ich glaube, deins hat’s nicht geschafft.« Ich nahm ihm das Telefon aus der Hand und wählte unsere Nummer, während er von einem Fuß auf den anderen trat und den Unbeteiligten spielte. Wegen meiner zitternden Hände musste ich es zweimal versuchen, bis die Nummer stimmte, was ihm mit Sicherheit nicht entging.
Es klingelte vier Mal, wie erwartet, ehe die roboterhafte Stimme des Anrufbeantworters mich aufforderte bitte eine Nachricht zu hinterlassen.
»Mom, ich bin’s«, sagte ich leise. »Geh ran.«
»Kelsey?« Ich hörte förmlich, wie ihr Gehirn auf Hochtouren lief: Tochter ruft von einem Handy an, das nicht ihr gehört. Wo liegt die Gefahr?
»Mir geht’s gut, aber ich hatte einen Autounfall. Tut mir leid, ich muss ins Krankenhaus und mich untersuchen lassen. Aber es ist wirklich alles in Ordnung.«
Sie schnappte nach Luft. »Ich rufe Jan an.«
»Nein«, entgegnete ich. »Es ist alles in Ordnung, ehrlich. Ich muss nur irgendwie nach Hause kommen. Wenn ich fertig bin, rufe ich mir ein Taxi. Oh, und ich glaube, ich habe mein Handy verloren.«
Ich hörte, wie sie langsam ausatmete, konnte sie vor mir sehen, wie sie die Augen schloss, während sie ihre Atemübung machte und sich mich vorstellte, lebendig und in Sicherheit und zu Hause. »Dir geht’s gut«, sagte sie. »Du bist in ärztlicher Betreuung. Und bald zu Hause.« Das Gute vor dem Schlechten.
»Das mit dem Auto tut mir leid.«
»Nicht so schlimm. Hauptsache, du bist in Sicherheit. Reden wir nicht über das Auto.« Eine Pause. »Aber ich glaube, ich muss Jan anrufen.«
Ich gab Ryan sein Handy zurück und die viel zu jung aussehende Sanitäterin zeigte nach hinten in den Krankenwagen.
»Hey, warte«, sagte Ryan.
Ich hielt inne, die Hand am Türgriff, die Füße auf der Metallrampe, sodass ich ihn überragte. Ryan sah aus, als hätte er mir tausend Dinge zu sagen. Ich hatte ihm auch vieles zu sagen. Aber wo anfangen? Wo in aller Welt anfangen?
»Brauchst du wen, der dich vom Krankenhaus nach Hause fährt?«
»Ich kann mir ein Taxi rufen.« Die Telefonnummer des Taxiunternehmens war eine der ersten, die ich als Kind auswendig gelernt hatte.
»Ich bin ohnehin da. Also …«
Also … Kommunikation: nicht gerade unsere Stärke.
»Okay. Wenn wir uns dort sehen …«
Er nickte. »Ich komm zu dir, wenn ich fertig bin.«
Als ich im Rettungswagen davonfuhr, sah ich durch die Rückscheibe, wie er mit den anderen Feuerwehrmännern redete. Aber das Bild, das sich mir eingebrannt hatte, war sein Gesicht in dem Augenblick, als ich die Hand nach ihm ausstreckte. In dem Augenblick, als ihm klar wurde, dass wir abstürzen würden.
Keine Angst, hatte er geflüstert, ohne zu wissen, ob ich noch am Leben oder bei Bewusstsein war.
Alles ist gut, hatte er gesagt, ohne zu wissen, ob das auch stimmte.
An diesen Worten hatte ich mich festgehalten, sie in etwas verwandelt, an das ich glauben konnte. Aber im Nachhinein fragte ich mich, ob er vielleicht nur mit sich selbst gesprochen hatte.
4. KAPITEL
Bilder von Vermonts Green Mountains zierten die Wände der Notaufnahme des Covington City Hospitals – das sollte wohl beruhigend wirken. Nur leider war ich gerade in ebendiesen Bergen von einem Abhang gestürzt. Und zwischen den Landschaftsaufnahmen forderten Gesundheitshinweise von allen, die sich krank fühlten: Bitte tragen Sie einen Mundschutz.
Die Sanitäterin hatte darauf bestanden, mich im Rollstuhl hineinzubringen – angeblich war das Vorschrift –, aber sobald wir sicher in der Eingangshalle waren, erhob ich mich und ignorierte den Blick, den sie mir zuwarf. Ich musterte den Raum voller Fremder, die mich ebenfalls musterten.
Ich hörte regelmäßiges Piepen, Lautsprecherrauschen, ein weinendes Baby. Alles war mir fremd – die schrägen Wände, die Geräusche, der Geruch nach Desinfektionsmittel –, und ich hielt mich in der Nähe der Sanitäterin, die mich durch die Eingangshalle führte. Ich warf einen Blick über die Schulter, sah die Doppeltüren, durch die wir hereingekommen waren. Aber es gab keine Fenster, keine anderen Ausgänge, nur noch mehr Türen, die in noch mehr Flure führten. Durch die Glasscheiben war das Leuchten der Neonlampen zu erkennen. Ein Labyrinth aus Räumen, aus dem ich niemals alleine herausfinden würde.
Außerdem konnte ich nirgends Ryan entdecken – vielleicht wurde er schon behandelt. Vielleicht war er in einem anderen Stockwerk. Vielleicht würde er mich zwischen all den Fremden niemals finden. Ich folgte der Sanitäterin vorbei an ein paar Leuten, die aussahen, als sollten sie auf alle Fälle einen Mundschutz tragen, vorbei an den Polizisten, die in der Nähe der Gangtüren standen, zu einem schmalen, von blauen Vorhängen umgebenen Bett. Seit ich aus dem Auto gezogen worden war, zitterte ich ununterbrochen.
»Das kommt wahrscheinlich vom Adrenalin«, sagte die Frau, als sie merkte, wie ich auf meine Hände starrte. Ich ballte sie zu Fäusten.
»Wahrscheinlich«, erwiderte ich. Nicht davon, dass meine Hände mich gerade so vor einem Sturz in die Tiefe gerettet hatten, oder von der Angst, die mir aus allen Poren drang, mich einschüchterte und lähmte.
Es ist nur das Unbekannte, würde Jan sagen. Das hatte mich letztes Jahr durch den ersten Monat auf der Highschool gebracht, nachdem nachdrücklich empfohlen worden war, dass ich die örtliche Schule besuchte, statt weiterhin von meiner Mutter zu Hause unterrichtet zu werden. Nachdrückliche Empfehlungen waren etwas, das Mom sehr ernst nahm. Und dass ich regelmäßig das Haus verließ, war eine der Hauptbedingungen, damit sie das Sorgerecht für mich behalten durfte. Aus demselben Grund hatte Jan mir auch den Sommerjob besorgt.
Die Sanitäterin klopfte mir unbeholfen auf die Schulter, ehe sie ging und eine Frau im Arztkittel die Vorhänge beiseitezog.
Ich sitze nicht mehr im Auto fest; ich hänge über keinem Abgrund; ich bin nicht in Gefahr. Und langsam ließ das Zittern nach.
Die Ärztin leuchtete mir in die Augen und wies mich an, ihrem Finger zu folgen, obwohl ich gleichzeitig von einem Polizisten verhört wurde. Ich hatte keine Beule am Kopf und konnte mich auch nicht erinnern ihn mir gestoßen zu haben. Dennoch war ich bewusstlos gewesen, als Ryan Baker zu mir ins Auto kletterte. Ich fragte mich, wie lange ich wohl weg gewesen war.
»Warst du am Handy?«, fragte der Polizist.
»Mein Handy lag in meiner Tasche.« Und beide waren in den Abgrund gestürzt.
Die Ärztin tastete vorsichtig meinen Kopf ab, was keineswegs unangenehm war – im Gegensatz zu den Fragen des Polizisten.
»Hast du was getrunken?«
»Außer Koffein? Nein.«
»Also warst du müde? Bist am Steuer eingeschlafen?«
Natürlich war ich müde. Ich hatte acht Stunden Schule hinter mir und zwei Stunden Chemienachhilfe mit Leo Johnson. Aber das war die Art von Fragen, die meine Mutter immer beantworten musste, und sie hatte gelernt im Zweifel auf Nummer sicher zu gehen und zu lügen. Es gab stets zu viel zu verlieren.
»Nein«, erwiderte ich. »Cola ist einfach das Billigste, was der Getränkeautomat in der Schule hat. Mir ist ein Auto entgegengekommen, auf meiner Seite. Deshalb bin ich von der Straße abgekommen.«
»Und wie sah dieses Auto aus?«
Es war dunkel gewesen. Ich schloss die Augen und versuchte mich zu erinnern. Ein kurzer Blick zur Seite. Die anspringende Heizung. Das Aufblitzen von Scheinwerfern, und ich reiße das Lenkrad herum … »Ich hab nur die Scheinwerfer gesehen.«
Die Ärztin bewegte vorsichtig meinen Kopf vor und zurück.
»Es gibt nichts, was auf ein anderes Auto hindeutet«, sagte der Polizist.
Ich schloss die Lider und rief mir alles erneut vor Augen – vielleicht kam das blendende Licht auch von meinen eigenen Scheinwerfern, die vom Mittelstreifen reflektiert wurden. Was hatte ich wirklich gesehen? Es hatte nur einen Sekundenbruchteil gedauert. Jetzt, wo ich versuchte es zu rekonstruieren, begann ich an meiner Erinnerung zu zweifeln.
»Haben Sie im Abgrund nachgesehen?«, fragte ich.
Er schaute mich an, als hätte ich einen schlechten Witz gemacht, dabei war es mein Ernst. Er nickte der Ärztin zu. »Das war alles, Kelsey. Schreib mir bitte dein Geburtsdatum, deine Telefonnummer und deine Adresse auf. Falls wir noch Fragen haben.«
»Klar.« Ich nahm das Klemmbrett, das er mir hinhielt.
Im Gehen zog der Polizist den Vorhang zur Seite, und ein Stückchen weiter entfernt stand Ryan, an den Empfangsschalter gelehnt. Ich musste unwillkürlich lächeln und er antwortete mir mit einem zaghaften Winken. Er strahlte etwas Vertrautes aus und gab mir ein überraschendes Gefühl von Sicherheit, und ich musste an unsere Zeit in der Lodge denken, bevor alles komisch geworden war, an die vielen Male, als er auf der Theke gesessen und gelächelt hatte, während ich redete.
Jetzt hatte er einen Verband um den Oberarm, der bis unter den Ärmel seines T-Shirts reichte. Ich fragte mich, ob er sich verletzt hatte, als er zu mir ins Auto geklettert war, oder beim Sturz. Die Ärzte plauderten mit ihm und klopften ihm auf die Schulter – er trug immer noch seine Uniform und schien völlig in seinem Element zu sein.
»Da ist wohl jemand gekommen, um nach dir zu sehen«, sagte meine Ärztin.
»Er bringt mich nach Hause«, erwiderte ich. Und als sie eine Augenbraue hob, fügte ich hinzu: »Er ist in meinem Mathekurs.«
Sie tastete meine Arme, meine Seiten und meinen Rücken ab. Als sie meinen linken Arm drückte, zuckte ich zusammen, und als ihre Finger meine Ellbogen streiften, versteifte ich mich. »Das wird Blutergüsse geben«, sagte sie.
Sie ließ den Blick über meinen Körper gleiten, dann drehte sie meine Hände herum und öffnete sanft meine Fäuste. »Autsch.« Sie sah mir kurz in die Augen und wieder nach unten. »Weißt du, wie das passiert ist?«
Der tiefe Einschnitt zog sich über alle Finger, die Haut war komplett abgeschürft. Ich widerstand dem Drang, sie wieder zu Fäusten zu ballen. Ein Geheimnis – wie knapp es wirklich gewesen war.
»Nein«, antwortete ich. »Keine Ahnung.« Eine harmlose Lüge. Eine erlernte Gewohnheit.
Sie presste die Lippen zusammen, während sie meine Hände versorgte und verband. »Kommen deine Eltern?«, fragte sie. »Es gibt noch einige Formulare auszufüllen, bevor wir dich entlassen können. Außerdem brauchen wir deine Versicherungsdaten.«
»Nein, aber …« Ich verstummte, als zwei Teenager sich dem Empfangsschalter näherten, an dem Ryan lehnte. Ich hörte, wie der Junge meinen Namen sagte, während das Mädchen den Blick durch den Raum schweifen ließ. Als sie mich sah, tippte sie ihren Bruder an und alles in mir zog sich zusammen.
Cole und Emma. Jans Kinder. Beide Verflossene von mir, wenn auch auf unterschiedliche Weise.
Jans Sohn, Cole, war gleichzeitig mein erster fester Freund, auch wenn er damals gerade mal fünfzehn gewesen war und ich vierzehn und er sich wahrscheinlich nur mit mir eingelassen hatte, weil er es eigentlich nicht durfte. Oder vielleicht einfach bloß, weil ich immer da war.
Jan hatte mich ständig zu sich nach Hause geholt, damit ich mit ihren Kindern »Zeit verbrachte« – das sei gut für mich, erklärte sie meiner Mom. Es sei ein Schritt. Ein sicherer Schritt. Jahrelang schleppte sie mich zu den Geburtstagspartys oder mit auf Ausflüge. Bis ich vierzehn war und plötzlich nicht mehr nur ein Mädchen, mit dem sie auf Anweisung ihrer Mutter abhängen mussten.
Cole hatte mir erklärt, dass er meine Sommersprossen mochte, und ich sagte, die hätte ich schon immer gehabt, ob ihm das nicht aufgefallen sei. Er zuckte mit den Schultern. Er küsste mich. Einen Monat später kam Jan dahinter und befahl Cole, Schluss zu machen. Als ich ihn darauf ansprach, zuckte er wieder mit den Schultern und es war Schluss. Erst dachte ich, er sei ein Feigling, der seiner Mutter nicht die Stirn bot. Dann wurde mir klar, dass es ihm wahrscheinlich egal war. Er zuckte mit den Schultern. Schluss.
Seitdem hasse ich Jungs, die mit den Schultern zucken.
Gerüchten zufolge hatte er sich von seiner letzten Freundin per SMS getrennt, und bei ihrer Vorgängerin hatte er das Schlussmachen ganz vergessen, bevor er sich der Neuen zuwandte. Ich hätte es also schlimmer erwischen können.
Eine traurige Nebenwirkung der Trennung von Cole war, dass aus Emma meine ehemalige beste Freundin Emma wurde. Und leider gab es nie jemanden, der ihre Stelle einnahm. Am ehesten vielleicht noch meine Nachbarin Annika – wenn sie nicht gerade im Internat war.
Cole hatte mich wenigstens relativ unmissverständlich wissen lassen, dass es aus war. Das Schulterzucken. Mit Emma war es mehr ein Auseinanderdriften. Es gab keinen großen Streit; sie ging einfach nicht mehr ans Handy. Unsere Freundschaft verlöschte wie eine Wunderkerze, die bis zu den Fingern abbrennt. Wenn du merkst, dass es wehtut, ist es schon zu spät – der Schaden ist angerichtet, der Funken erloschen.
Emma hatte sich in eine andere verwandelt – neue Freunde, andere Clique –, während ich zurückblieb, schmerzhaft unverändert. Ein im Entstehen begriffenes Projekt, wie Jan mich nannte. Immerzu ein Projekt.
Ich nahm an, dass Jan mit Emma und Cole ein ernstes Gespräch über Privatsphäre und so weiter geführt hatte, denn soviel ich wusste, hatte keiner von ihnen je etwas über meine Mutter herumerzählt. Und als ich letztes Jahr zum ersten Mal durch die Schulflure irrte, waren ihre Gesichter die einzigen, die ich kannte – unsere Blicke hatten sich kurz getroffen, dann hatten sie schnell wieder weggeschaut. Drei Jahre waren vergangen, und es fühlte sich an, als hätten wir uns nie gekannt.
Was mich betraf, waren die beiden trotzdem tickende Zeitbomben. Ich konnte ihnen nicht in die Augen schauen, ohne mich darin reflektiert zu sehen – in den Erzählungen ihrer Mutter beim Abendessen, in Jans Publikationen. Mir gefiel nicht, was ich sah.
Cole machte als Erster den Mund auf. »Mom hat einen Kurs. Und Dad ist auf Geschäftsreise. Darum sind wir hier.«
»Danke«, sagte ich. Das erste Wort seit über drei Jahren. Gar nicht so schwer. Als würde man ein Pflaster abziehen.
Aber dann zuckte er mit den Schultern. Keine große Sache. Nichts dabei. Das war’s. Such dir was aus.
Cole hatte die medizinische Vollmacht dabei, die Jan schon früher benutzt hatte, um mich behandeln zu lassen. Die für meine Entlassung benötigt wurde. Denn ich war siebzehn und daher nicht in der Lage, für mich selbst zu entscheiden.
Emma war sechzehn und ihre weit auseinanderstehenden Augen hatten sich in ihr erwachseneres Gesicht eingefügt, außerdem hatte sie Kurven entwickelt und eine fiese Ader, wenn man den Gerüchten glauben durfte. Cole war nur größer geworden und vom Football- und Lacrossespielen hatte er Muskeln bekommen. Er konnte sich seine Freundinnen aussuchen, wechselte sie mit erschreckender Geschwindigkeit.
»Was macht Ryan Baker hier?«, fragte Emma, als wären wir noch Freundinnen – als hätte sie mich nicht systematisch ignoriert, bis ich schließlich aufgab. Sobald Ryan sich bei der Erwähnung seines Namens umdrehte, stemmte sie die Hand in die Hüfte, hob das Kinn – eine perfekte Flirtpose – und sagte: »Alles okay?«
»Ja. Nur ein paar Stiche«, antwortete er.
»Wie lange dauert es noch?«, fragte Cole die Ärztin, ohne mir in die Augen zu sehen.
»Danke für die Vollmacht. Aber ich hab schon eine Mitfahrgelegenheit«, sagte ich.