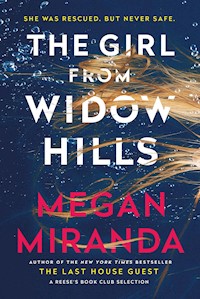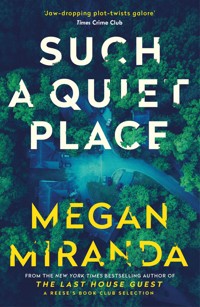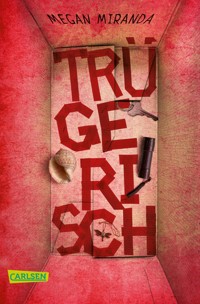2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der packende Bestseller der Thrillerkönigin Megan Miranda jetzt im Taschenbuch!
Sie wohnt bei dir. Du denkst, du kennst sie. Doch du weißt nicht, wozu sie fähig ist ...
Die Journalistin Leah flieht vor ihrem alten Leben: Sie lässt ihre Heimat und ihren Job hinter sich und zieht mit ihrer besten Freundin Emmy in ein altes Haus auf dem Land. Das Zusammenleben klappt gut. Leah arbeitet tagsüber in der Schule, Emmy nachts an einer Rezeption. Doch dann stellt Leah eines Nachts fest, dass sie ihre Freundin seit Tagen nicht gesehen hat. Noch bevor sie Emmy als vermisst melden kann, wird in der Nähe eine brutal misshandelte junge Frau gefunden. Doch die Frau ist nicht Emmy – stattdessen sieht sie Leah zum Verwechseln ähnlich … Muss Leah nicht nur um Emmys, sondern auch um ihr eigenes Leben fürchten?
»Spannung bis zur letzten Seite!« Freundin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
MEGANMIRANDA hat am Massachusetts Institute of Technology Biologie studiert und ist heute hauptberuflich als Autorin tätig. Sie hat bereits mehrere Jugendromane veröffentlicht und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in North Carolina. Ihr erster Thriller Tick Tack wurde in Deutschland und den USA sofort ein riesiger Erfolg. Mit Little Lies beschert sie ihren Lesern erneut atemlose Spannung bis zur letzten Seite.
Little Lies in der Presse:»Megan Mirandas unheimlicher Thriller – ein cleveres Spiel um Wahrheit und Identität.« New York Times
»Als Leser ist man von der fieberhaft erzählten Geschichte so perplex wie die Figuren selbst.« Publishers Weekly
»Ein brillanter Psychothriller.« Booklist
Außerdem von Megan Miranda lieferbar:Tick Tack – Wie lange kannst du lügen?
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Megan Miranda
LITTLE LIES
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Cathrin Claußen
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel The Perfect Stranger bei Simon & Schuster, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2017 by Megan Miranda
All Rights Reserved. Published by arrangement with the original publisher, Simon & Schuster, Inc.
Copyright © 2020 Penguin Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlag: Favoritbüro
Umschlagmotiv: © Sandra Cunningham/Trevillion Images; elegeyda/Shutterstock
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel GmbH, Köln
ISBN 978-3-641-22206-2V001
www.penguin-verlag.de
Für Luis
Prolog
Die Katze war wieder mal unter der vorderen Veranda zugange. Ihr Kratzen an den Holzbohlen übertrug sich auf meine Schlafzimmerdielen. Wetzte sich die Krallen, markierte ihr Revier – unermüdlich in finsterer Nacht.
Ich saß auf der Bettkante, stampfte mit den Füßen auf den Boden und dachte, bitte lass mich schlafen, mein wiederholtes Stoßgebet an alles Belebte außerhalb meiner vier Wände, an die Natur da draußen, die sich dort bemerkbar machte.
Das Kratzen verstummte, und ich schlüpfte wieder unter die Decke.
Nun andere, vertrautere Geräusche: das Knarzen der alten Matratze, Grillengezirp, der Wind, der heulend durchs Tal fegte. Das alles wies mich auf mein neues Leben hin – das Bett, in dem ich schlief, das Tal, in dem ich lebte, ein Flüstern in der Nacht: Du bist hier.
Ich war in der Stadt aufgewachsen und für das Leben dort gemacht, hatte mich an die Geräusche der Menschen unten auf der Straße gewöhnt, an das Hupen, die Bahn, die bis Mitternacht die Gleise entlang rollte. Wartete schon auf die Schritte über mir, die zuknallenden Türen, Wasser, das durch die Leitungen lief. Das alles hielt mich nicht vom Schlafen ab.
Die Stille in diesem Haus jedoch beunruhigte mich manchmal. Aber sie war immer noch besser als die Tiere.
An Emmy könnte ich mich gewöhnen. Sie schlüpfte einfach so herein, der stotternde Motor ihres Wagens in der Auffahrt war ein Trost, ihre Schritte im Flur begleiteten mich in den Schlaf. Doch die Katze, die Grillen, die Eulen und der Kojote – für die brauchte es etwas Zeit.
Vier Monate, und endlich veränderte sich etwas, so wie die Jahreszeit.
Wir waren im Sommer angekommen – Emmy zuerst, ich ein paar Wochen später. Wir schliefen jede auf einer Seite des Flures in gegenüberliegenden Zimmern, bei geschlossenen Türen und voll aufgedrehter Klimaanlage. Als ich damals im Juli das erste Mal mitten in der Nacht den Schrei gehört hatte, war ich sofort senkrecht im Bett hochgefahren und hatte gedacht: Emmy.
Es war ein ersticktes, tiefes Stöhnen, so wie wenn etwas mit dem Tod ringt, und meine Fantasie füllte bereits die Lücken: Emmy, wie sie sich abkämpfte, sich röchelnd den Hals hielt oder ohnmächtig auf dem staubigen Boden lag. Ich rannte über den Flur und hatte schon die Hand an ihrem Türgriff, als sie von innen die Tür aufriss und mich mit großen Augen anstarrte. Im ersten Moment sah sie aus wie an dem Tag, an dem wir uns das erste Mal getroffen hatten, beide gerade mit der Schule fertig. Doch es war nur die Dunkelheit, die mir das vorgaukelte.
»Hast du das gehört?«, flüsterte sie.
»Ich dachte, du warst das.«
Sie packte mein Handgelenk, das Mondlicht hinter den unverhängten Fenstern ließ das Weiße in ihren Augen aufleuchten.
»Was war es dann?«, fragte ich. Emmy hatte schon in der Wildnis gelebt, war ein paar Jahre beim Friedenskorps gewesen und hatte sich an das Unbekannte gewöhnt.
Noch ein Schrei, und Emmy machte einen Satz – der Laut kam von direkt unter uns. »Ich weiß nicht.«
Sie war ungefähr so groß wie ich, aber dünner. Vor acht Jahren war das umgekehrt gewesen, doch nachdem sie weggegangen war, hatte sie ihre Rundungen verloren, und die vielen Jahre waren ihr anzusehen. Ich hatte das Gefühl, dass ich nun diejenige war, die sie beschützen, sie gegen jegliche Gefahr abschirmen musste, denn Emmy bestand in diesen Tagen aus nichts als scharfen Kanten und blasser Haut.
Doch sie setzte sich als Erste in Bewegung, lief geräuschlos den Flur entlang, ihre Hacken berührten kaum den Boden. Mit vorsichtigen Schritten und flachem Atem folgte ich ihr.
Ich legte die Hand auf das Telefon, das ein Kabel hatte und an die Küchenwand gehängt war, für alle Fälle. Aber Emmy hatte andere Pläne. Sie schnappte sich eine Taschenlampe aus der Küchenschublade, schob langsam die Vordertür auf und trat nach draußen auf die Holzveranda. Das Mondlicht ließ sie sanfter wirken, ihre dunklen Haare bewegten sich in der Brise. Sie richtete den Lichtkegel auf den Waldrand und wollte die Stufen hinuntergehen.
»Emmy, warte«, sagte ich, aber sie lag schon bäuchlings auf der Erde und ignorierte mich. Sie leuchtete unter die Veranda, und da schrie wieder etwas. Ich klammerte mich an das Holzgeländer, während Emmy sich auf den Rücken rollte, von einem leisen Lachen geschüttelt, das sich dann laut Bahn brach und in den Nachthimmel schallte.
Ein Fauchen, dann schoss ein Streifen Fell unter dem Haus hervor und verschwand im Wald, gefolgt von einem zweiten. Emmy setzte sich auf, ihre Schultern bebten immer noch.
»Wir wohnen über einem Katzenpuff«, sagte sie.
Ich musste lächeln, was für eine Erleichterung. »Kein Wunder, dass die Miete so günstig ist«, sagte ich.
Ihr Lachen erstarb langsam, als etwas anderes ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. »Oh, guck mal«, sagte sie und zeigte mit einem dünnen Arm auf den Himmel hinter mir.
Vollmond. Nein, Supermond. So hieß das doch. Gelb und zu nah, so als könne er die Schwerkraft beeinflussen. Uns alle in den Wahnsinn treiben. Katzen durchdrehen lassen.
»Wir könnten Betonblöcke verlegen«, sagte ich, »um die Tiere fernzuhalten.«
»Genau«, sagte sie.
Aber natürlich taten wir das nie.
Emmy mochte schon die Vorstellung von Katzen. So wie sie auch die Vorstellung von alten Holzhütten und einer Veranda mit Schaukelstühlen mochte; außerdem: Wodka, während des Wodkatrinkens Dartpfeile auf Karten zu werfen, das Schicksal.
In Letzterem war sie ganz groß.
Deshalb war sie auch so sicher gewesen, dass es richtig war, hier gemeinsam herzuziehen, ohne noch einmal groß darüber nachzudenken, ohne Zweifel. Das Schicksal hatte uns wieder zusammengeführt, unsere Wege hatten sich in einer schummerigen Bar gekreuzt, acht Jahre nachdem wir uns das letzte Mal begegnet waren. »Das ist ein Zeichen«, hatte sie gesagt, und in meiner Trunkenheit war mir das vollkommen logisch erschienen, meine Gedanken verschwommen mit ihren, Hirnwindungen kreuzten sich.
Die Katzen waren vermutlich auch ein Zeichen – wofür, dessen war ich mir nicht sicher. Aber außerdem: der Supermond, Glühwürmchen, die im Rhythmus ihres Lachens aufleuchteten, von Feuchtigkeit schwere Luft, die uns umfing wie eine Hülle.
Wann immer wir danach ein Geräusch hörten, ich von dem durchgesessenen braunen Sofa oder meinem Platz am Vinylküchentisch hochschreckte, zuckte Emmy mit den Schultern und sagte: »Nur die Katzen, Leah.«
Trotzdem träumte ich wochenlang von größeren Geschöpfen, die unter uns lebten. Jeden Tag, wenn ich das Haus verließ, nahm ich die Stufen mit einem einzigen großen Schritt, wie ein Kind. Ich stellte mir zusammengerollte oder sich duckende Kreaturen vor, in der Dunkelheit, im Dreck, nichts als gelbe Augen, die einen anstarrten. Schlangen. Waschbären. Streunende und tollwütige Hunde.
Gerade gestern hatte ein Lehrerkollege erzählt, ein Bär sei in seinem Garten gewesen. Einfach so: ein Bär im Garten. Als wäre das etwas, was man so eben im Vorbeigehen bemerkte oder auch nicht. Graffiti auf der Überführung, eine kaputte Straßenlaterne. Nur ein Bär.
»Mögen Sie keine Bären, Miss Stevens?«, hatte er mit einem breiten Grinsen gefragt. Er war schon etwas älter und hatte weiche Konturen, die Haut um seinen Ehering wölbte sich auf beiden Seiten wie im Protest, er unterrichtete Geschichte und schien sie der Realität vorzuziehen.
»Wer mag denn bitte Bären?«, sagte ich und versuchte, mich im Flur an ihm vorbeizuschieben.
»Wenn man in ein Bärengebiet zieht, sollte man sie wohl besser mögen.« Seine Stimme war lauter als nötig. »Es ist ihr Zuhause, auf dem Sie alle sich immer weiter ausbreiten. Wo sollten sie sonst sein?«
Der Nachbarshund fing an zu bellen, und ich starrte auf die Lücke zwischen den Vorhängen, wartete auf die ersten Anzeichen von Tageslicht.
An Morgen wie diesem sehnte ich mich trotz meiner ursprünglichen Hoffnungen – der Duft der Natur, der Charme von Holzhütten mit Schaukelstühlen, das Versprechen eines neuen Anfangs – nach der Stadt. Sehnte mich danach wie nach dem Kaffee, der mir ins Blut schoss, der Jagd nach einer Story, meinem Namen schwarz auf weiß.
Als ich im Sommer hierhergekommen war, hatte es eine lange Phase der Ruhe gegeben, in der mich die ausgedehnten Tage mit einer gesegneten Abwesenheit von Gedanken begrüßt hatten. Ich war morgens aufgewacht, hatte mir einen Kaffee eingeschenkt und war die hölzernen Verandastufen hinuntergetreten, hatte mich für einen kurzen Moment der Erde ganz nah gefühlt, verbunden mit etwas, das ich zuvor vermisst hatte: Meine Füße standen fest auf der Erde vor unserer Veranda, ein paar Grashalme lugten zwischen meinen Zehen hindurch, als würde dieser Ort selbst mich in sich aufnehmen.
Doch an anderen Tagen verwandelte sich die Ruhe in Einsamkeit, und ich fühlte, wie sich etwas in mir regte, als würden meine Muskeln sich erinnern.
Manchmal träumte ich, dass ein verrückter Hacker das gesamte Internet gelöscht, uns alle reingewaschen hatte und ich zurückgehen könnte. Noch einmal von vorn anfangen. Die Leah Stevens sein, die ich hatte sein wollen.
Kapitel 1
Das Haus habe Charakter, hatte Emmy gesagt und damit seine Macken gemeint: der nicht vorhandene Wasserdruck in der Dusche, die unlogische Ausrichtung. Unser Haus hatte zwei große gläserne Schiebetüren, durch die man von der Veranda aus direkt ins Wohnzimmer und die Küche kam, vom Flur dahinter gingen zwei Schlafzimmer und ein gemeinsames Bad ab. Der Haupteingang lag am anderen Ende des Flurs und ging zum Wald hinaus, als hätte man es zwar mit den richtigen Maßen gebaut, aber in die falsche Richtung.
Das Netteste, was ich über das Haus sagen konnte, war wohl, dass es meins war. Aber auch das stimmte nicht ganz. Mein Name stand im Vertrag, mein Essen im Kühlschrank, es war mein Glasreiniger, mit dem man den Blütenstaub von den Schiebetüren wischen konnte.
Trotzdem gehörte es jemand anderem. Ebenso die Möbel. Ich hatte nicht viel mitgebracht. Wenn man es genau betrachtete, besaß ich kaum etwas, was ich beim Auszug aus meiner Einzimmerwohnung im Zentrum von Boston hätte mitnehmen können. Barhocker, die an keinen normalen Tisch passten. Zwei Kommoden, eine Couch und ein Bett, dessen Transport mehr gekostet hätte als ein Neukauf.
Manchmal fragte ich mich, ob es nur die Worte meiner Mutter in meinem Kopf waren, die bewirkten, dass ich diesen Ort und meine Entscheidung, hier zu leben, geringer schätzte, als sie es waren.
Bevor ich Boston verlassen hatte, hatte ich versucht, mir in Gedanken eine Geschichte für meine Mutter zurechtzulegen, in der ich diese große Lebensveränderung als eine aktive Entscheidung ausgab, die ihren Sinn für Wohltätigkeit und Anstand ansprechen würde – sowohl zu ihrem als auch zu meinem Besten. Ich hatte mal gehört, wie sie meine Schwester und mich ihren Freunden vorstellte: »Rebecca hilft denen, die man retten kann, und Leah gibt jenen einen Stimme, für die es keine Rettung gibt.« Und so stellte ich mir vor, wie sie das jetzt für ihre Freunde zusammenfassen würde: Meine Tochter macht gerade ein Sabbatjahr. Um bedürftigen Kindern zu helfen. Wenn jemand das verkaufen konnte, dann sie.
Erst einmal ließ ich es so aussehen, als sei das Ganze meine Idee gewesen und nicht der Plan von jemand anderem, an den ich mich einfach gehängt hatte, weil ich nirgends anders hinkonnte. Weil ich das Gefühl hatte, das Netz um mich schloss sich umso enger, je länger ich stillhielt.
Emmy und ich hatten bereits die Kaution bezahlt, und ich schwebte durch die Wochen und träumte von der neuen Welt, die auf mich wartete. Doch sogar da wappnete ich mich für den Anruf bei meiner Mutter. Plante ihn für einen Zeitpunkt, von dem ich wusste, sie wäre dann schon auf dem Sprung zu ihrer Stehkaffeeverabredung mit »den Mädels«. Übte meine Rede, wobei ich vorsorglich Gegenargumente für alle Kritikpunkte bereithielt: Ich habe meinen Job gekündigt und verlasse Boston. Ich werde in der Highschool unterrichten, ich habe schon ein Angebot. WestPennsylvania. Bestimmt weißt du ja, dass es große ländliche Gebiete hier in Amerika gibt, wo Hilfe gebraucht wird, oder? Nein, ich werde nicht alleine sein. Erinnerst du dich an Emmy? Meine Zimmergenossin während meines Praktikums nach dem College? Sie kommt mit mir.
Das Erste, was meine Mutter sagte, war: »Ich erinnere mich an keine Emmy.« Als wäre das die wichtigste Tatsache. Aber so machte sie es immer, sie rüttelte an den Details, bis das Große und Ganze schließlich nachgab, vollkommen unerwartet. Und dennoch war ihre Fragemethode auch der Beweis dafür, dass wir unsere Pläne nicht auf einem Traum aufbauten, dass wir ein sicheres Fundament hatten, das unter Druck nicht unweigerlich bröckeln würde.
Ich klemmte das Telefon zwischen Schulter und Ohr. »Ich habe nach dem College mit ihr zusammengewohnt.«
Stille, aber ich konnte sie denken hören: Du meinst, nachdem du den Job nicht bekommen hast, von dem du dachtest, er wäre dir nach deinem Abschluss sicher, stattdessen ein unbezahltes Praktikum gemacht hast und keine Wohnung hattest?
»Ich dachte, du hast da mit … wie hieß sie noch, zusammengewohnt? Das Mädchen mit den roten Haaren? Deine Mitbewohnerin aus dem College?«
»Paige«, sagte ich und sah nicht nur sie, sondern auch Aaron vor mir, wie immer. »Das war nur kurz.«
»Verstehe«, sagte sie langsam.
»Ich bitte dich nicht um Erlaubnis, Ma.«
Nur dass ich es doch irgendwie tat. Sie wusste das. Ich wusste das.
»Komm nach Hause, Leah. Komm nach Hause und lass uns darüber reden.«
Unter ihrer Führung waren meine Schwester und ich seit der Mittelstufe mit unseren Leistungen immer auf der Überholspur gewesen. Sie hatte ihre eigenen Fehltritte als Beispiele herangezogen, um uns vor ihnen zu bewahren. Und zwei unabhängige, erfolgreiche Töchter großgezogen. Einen Status, den ich nun wohl gefährdete.
»Also, wie jetzt?«, fragte sie und änderte die Marschrichtung. »Du bist also einfach eines Tages zur Arbeit gegangen und hast gekündigt?«
»Ja«, sagte ich.
»Und warum genau?«
Ich schloss die Augen und malte mir einen Moment lang aus, wie es wäre, jemand anderes zu sein, wenn wir beide Menschen wären, die Dinge sagen konnten wie: Weil ich Probleme habe, Riesenprobleme, bevor ich mich dann aufrichtete und ihr meine Ansprache hielt. »Weil ich etwas verändern will. Nicht nur Fakten sammeln und darüber berichten. Bei der Zeitung tue ich nichts, als mein Ego zu streicheln. Lehrer werden gebraucht, Mom. Ich könnte wirklich etwas bewirken.«
»Ja, aber in West Pennsylvania?«
Die Art, wie sie das von sich gab, sagte mir alles, was ich wissen musste. Als Emmy den Vorschlag gemacht hatte, war mir West Pennsylvania wie eine andere Version der Welt erschienen, die ich kannte, mit einer anderen Version von mir selbst darin – was damals genau das gewesen war, was ich gebraucht hatte. Aber die Welt meiner Mutter hatte die Form eines Hufeisens. Sie erstreckte sich von New York City nach Boston und umfasste in einem Bogen ganz Massachusetts (sparte aber Connecticut vollkommen aus). Sie war das Epizentrum in West Massachusetts und hatte je eine Tochter erfolgreich in beide Enden des Bogens entsandt, und die Welt war richtig und vollständig. Jeder andere Ort würde im Vergleich dazu immer nur mehr oder minder großes Versagen bedeuten.
Meine Familie war eigentlich nur eine Generation von einem Leben entfernt, das so aussah: ein Mietshaus mit maroden Leitungen, notgedrungen einem Mitbewohner, eine Stadt, deren Namen man leicht vergessen konnte, eine Arbeit, aber ohne Perspektive. Als mein Vater uns verließ, war ich nicht wirklich alt genug, um die Auswirkungen zu verstehen. Aber ich erinnerte mich, dass es eine Zeit gegeben hatte, in der wir völlig planlos waren und abhängig von der Großzügigkeit der Menschen um uns herum. Das waren die Höllenjahre gewesen – diejenigen, über die meine Mutter nie sprach, eine Zeit, von der sie jetzt so tat, als hätte sie nie existiert.
Für sie klang das hier bestimmt sehr nach einem Rückschritt.
»Gute Lehrer werden überall gebraucht«, sagte ich.
Erst erwiderte sie nichts und ließ sich dann zu einem langsamen und schleppenden »Ja« herab.
Ich legte auf, fühlte mich bestätigt, doch dann kam der Stich. Sie hatte gar nicht zugestimmt. Gute Lehrer werden überall gebraucht, ja, aber das bist du nicht.
Genau genommen meinte sie das nicht böse. Meine Schwester und ich waren beide Abschlussrednerinnen gewesen, hatten beide ein Stipendium erhalten, waren beide in jüngerem Alter als üblich jeweils an den Colleges unserer Wahl angenommen worden. Es war nicht verwunderlich, dass sie diese Entscheidung hinterfragte – besonders, weil sie aus heiterem Himmel kam.
Ich habe gekündigt, hatte ich gesagt. Das war keine Lüge, sondern Formsache – die Wahrheit war, dass es der sicherste Weg gewesen war, sowohl für die Zeitung als auch für mich. In Wahrheit hatte ich keinen Job in dem Beruf, den ich erlernt hatte, ich hatte auch keinen in Aussicht. In Wahrheit war ich froh, einen so nichtssagenden Namen zu haben, einen Namen, den ich als Jugendliche nicht hatte ausstehen können. Ein Mädchen, das sich in der Masse verstecken konnte und nie hervorstach. Ein x-beliebiger Name.
Emmys Auto war noch immer nicht zurück, als ich zur Schule aufbrechen wollte. Das war nicht ungewöhnlich. Sie hatte Nachtschicht, und sie ging mit einem Typen namens Jim aus – der am Telefon so klang, als wären seine Lungen ständig in Rauch gehüllt. Ich fand nicht, dass er gut genug für Emmy war; fand, dass sie in gewisser Weise einen Rückschritt machte, so wie ich. Doch ich sah es ihr nach, denn ich verstand, wie es hier draußen sein konnte, wie die Ruhe sich manchmal wie eine Leere anfühlte – und dass man ab und zu einfach von jemandem wahrgenommen werden wollte.
Außer an Wochenenden verpassten wir uns manchmal tagelang hintereinander. Aber es war Donnerstag, und ich musste die Miete bezahlen. Normalerweise ließ sie mir Geld auf dem Tisch liegen, unter dem bemalten Gartenzwerg aus Stein, den sie gefunden hatte und als Tischdeko benutzte. Ich nahm den Zwerg an seiner roten Mütze hoch, nur um sicherzugehen, entdeckte aber nichts als ein paar Krümel.
Dass sie die Miete zu spät zahlte, war allerdings auch nicht so ungewöhnlich.
Ich hinterließ ihr eine Nachricht auf einem Klebezettel neben dem Telefon, der Stelle, die wir dafür auserkoren hatten. Ich schrieb MIETEFÄLLIG in großen Buchstaben auf den Zettel und klebte ihn an die holzvertäfelte Wand. Sie hatte alle Nachrichten von dieser Woche abgenommen – SIEHERECHNUNGELEKTRIKER, MIKROWELLEKAPUTT, MIKROWELLEREPARIERT.
Ich öffnete die Schiebetüren, drückte auf den Lichtschalter neben dem Eingang, wühlte in meiner Tasche nach meinem Autoschlüssel – und merkte, dass ich mein Handy vergessen hatte. Ein Windstoß wehte hinein, worauf der gelbe Zettel – MIETEFÄLLIG – herunterflatterte und hinter einen Holzständer rutschte, in dem wir die Post stapelten.
Ich hockte mich hin und sah das Chaos, einen Haufen Klebezettel. JIMANRUFEN mit der Aufschrift nach oben, aber halb verdeckt von einem anderen. Einige weitere, umgedreht. Also doch nicht von Emmy entfernt, sondern verloren gegangen zwischen Wand und Möbelstück, während der letzten Wochen.
Emmy hatte kein Handy, denn ihr Vertrag lief immer noch über ihren Ex-Freund, und sie wollte nicht, dass er sie so leicht ausfindig machen konnte. Beim Gedanken daran, kein Handy zu besitzen, fühlte ich mich fast nackt, aber sie fand, es sei großartig, nicht mehr ständig auf Abruf und erreichbar zu sein. Das erschien mir damals so typisch Emmy – skurril und liebenswert –, aber nun kam es mir eher irrational und egoistisch vor.
Ich ließ die Nachrichten auf dem Küchentisch. Lehnte sie gegen den Gartenzwerg. Versuchte, mich zu erinnern, wie viele Tage es her war, seit ich sie zuletzt gesehen hatte.
Ich fügte noch eine Nachricht hinzu: RUFMICHAN.
Beschloss dann, die anderen Klebezettel wegzuwerfen, damit meiner nicht in dem Haufen unterging.
Kapitel 2
Auf dem Weg zur Schule kam ich an einer Straßensperre vorbei, am Ende der Hauptstraße, die zurück zum See führt. Ein Auto mit Warnlicht, ein Polizist, der den Verkehr um die Kurve dirigierte. Ich nahm den Fuß vom Gas, mein Herz machte einen mir nur allzu vertrauten Satz.
Als Reporterin waren mir die Anzeichen für traumatische Szenen vertraut, auch abgesehen von den Krankenwagen: die abgesperrte Zone, die offenen Münder der Schaulustigen, Fremde, aneinandergedrängt, mit respektvoll geneigten Köpfen. Aber es war noch mehr als das: ein Knistern in der Luft. Etwas Fühlbares wie statische Elektrizität.
Es zog mich an, dieses Knistern.
Fahr vorbei, Leah. Fahr weiter.
Doch das hier war nur ein paar Kilometer von unserem Haus entfernt, und Emmy war immer noch nicht zurückgekommen. Falls sie einen Unfall gehabt hatte – würden sie wissen, wen sie anrufen sollten? Wie sie mich erreichen konnten? Konnte sie jetzt gerade in einem Krankenhaus liegen, ganz allein?
Ich fuhr an dem Polizisten vorbei und hielt an der nächsten Ecke, in der Eile ließ ich mein Auto unabgeschlossen auf dem Parkplatz des halb fertigen Klubhauses am See stehen und lief von da aus zur Straßensperre zurück. Ich hielt mich nah an den Bäumen, ging dem Verkehrspolizisten aus dem Weg, damit er mich nicht wieder wegschicken konnte.
Das Land fiel zum Wasser hin ab, das Seeufer war schlammig und von hohem Gras bewachsen. Am Fuß des Hanges stand eine Handvoll Leute stocksteif da. Sie blickten alle auf einen Punkt weiter hinten im Gras. Jedoch kein Auto. Kein Unfall.
Ich rutschte die Böschung hinunter, Matsch verkrustete meine Schuhe, ich bewegte mich schneller.
Trotz des Adrenalins, des schleichenden Grauens, das mich packte, als ich mir vorstellte, was hier alles passiert sein konnte, wurde das Bild deutlicher.
Seit meinen Anfangsjahren als Reporterin war ich geübt darin, Distanz zu bewahren, weil der Schock beim Anblick von Blut zu groß geworden war, weil ich zu sehr mitfühlte, tausend verschiedene Möglichkeiten im schlaffen Gesicht eines Fremden sah. Nun konnte ich das nicht mehr ablegen – es war eine meiner besten Fähigkeiten.
Nur so konnte ich bei echten Verbrechen überleben, die rohe Kraft des Hasses, die Psychologie der Gewalt. Zu viel Gefühl in einem Artikel bewirkte allerdings, dass der Leser nur noch dich sieht. Du musst aber unsichtbar sein. Du musst Augen und Ohren sein, das Instrument der Geschichte. Die Fakten, die fürchterlichen, schrecklichen, glühenden Fakten, müssen gegliedert werden. Und dann musst du weitermachen, zum Nächsten gehen, bevor es dich einholt.
Nun handelte und dachte ich ganz automatisch. Als ich durch das hohe Gras ging, zerfiel Emmy in Fragmente, eine Liste von Fakten: vier Jahre beim Friedenskorps; im Sommer hierhergezogen, um einer kaputten Beziehung zu entfliehen; arbeitete nachts in einer Motellobby, ging tagsüber manchmal putzen. Ledig, weiblich, 1,65 groß, schlank, dunkle schulterlange Haare.
Licht fiel schräg durch die Bäume und spiegelte sich in der glatten Oberfläche des Wassers dahinter. Die Polizei durchsuchte das Gebüsch in der Umgebung, doch ein Polizist stand ganz in der Nähe mit dem Rücken zu einer Gruppe Schaulustiger und hielt sie davon ab, näher heranzukommen.
Ich ging zum Rand der Gruppe. Niemand sah mich auch nur an. Die Frau neben mir trug einen Bademantel und Hausschuhe, graues Haar löste sich aus einer Klammer, mit der sie es aus dem Gesicht hielt.
Ich folgte ihrem gezielten Blick – eine Spur getrocknetes Blut an den Gräsern neben dem Polizisten, markiert mit einer orangefarbenen Flagge. Darüber schwirrten die Mücken im Morgenlicht. Ein Kreis aus Signalkegeln dahinter, darin nichts als plattgedrückte Leere.
»Was ist hier los?«, fragte ich und wunderte mich, dass meine Stimme zitterte. Die Frau sah mich kaum an, die Arme immer noch verschränkt, ihre Finger gruben sich in ihre Haut.
Wenn man Menschen nach einer Tragödie interviewt, sagen sie: Es ging alles so schnell.
Sie sagen: Alles ist verschwommen.
Sie picken Details heraus, lassen uns die Lücken füllen. Sie vergessen. Sie erinnern sich falsch. Wenn du schnell genug bei ihnen bist, zittern sie sogar noch.
So waren diese Leute hier jetzt auch. Sie hielten sich an den Ellbogen fest, hatten die Arme vor den Bäuchen verschränkt.
Aber wenn ich an einem Tatort bin, verlangsamt sich alles, es siedet, platzt auf. Ich werde mich an die Mücken über den Gräsern erinnern. An den Blutfleck. An das hinuntergetretene Gras. Doch hauptsächlich sehe ich die Menschen.
»Bethany Jarvitz«, sagte sie, und die Enge in meiner Brust löste sich auf. Dann war es nicht Emmy. Nicht Emmy. »Jemand hat sie niedergeschlagen und hier liegen gelassen.«
Ich nickte und tat so, als wüsste ich, wer die Frau sei.
»Ein paar Kinder haben sie gefunden, als sie hier an der Bushaltestelle spielten.« Sie nickte in Richtung der Straße, von der ich gerade gekommen war. Keine spielenden Kinder mehr. »Wenn sie nicht …« Sie presste die Lippen zusammen, sodass alle Farbe daraus wich. »Sie lebte allein. Wie lange hätte es gedauert, bis jemand sie vermisst hätte?« Sie erschauerte. »Da war einfach so viel Blut.« Sie sah auf ihre Hausschuhe, und ich folgte ihrem Blick. Die Kanten hatten rostbraune Flecken, als wäre sie mitten durchgelaufen.
Ich sah weg, wieder zur Straße. Hörte das Knistern eines Funkgeräts, die Stimme eines Polizisten, der Befehle gab. Das hatte nichts zu tun mit Emmy oder mir. Ich musste weg, bevor ich ein Teil davon wurde, jemand aus der Menge, den die Polizei unweigerlich genauer befragen würde. Mein Name verbunden mit einer Kette von Ereignissen, die ich verzweifelt versuchte, hinter mir zu lassen. Eine einstweilige Verfügung, ein drohender Prozess, die leise Stimme meines Chefs und die Blässe in seinem Gesicht: Mein Gott, Leah, was hast du getan?
Ich machte einen Schritt rückwärts. Noch einen. Drehte mich um und ging zu meinem Auto zurück, behindert vom Matsch an meinen Schuhen.
Auf halbem Weg hörte ich ein Rascheln hinter mir. Ich schoss herum, meine Nerven zum Zerreißen gespannt – und roch eine schwache Spur von Schweiß.
Ein Vogel flog auf, sein Flügelschlag durchschnitt die Stille, doch sonst sah ich nichts.
Ich dachte an die Geräusche mitten in der Nacht. Den bellenden Hund. Den Zeitpunkt.
Ein Tier, Leah.
Ein Bär.
Nur die Katzen.
Ich kam fast zu spät an der Schule an. Der Unterricht hatte zwar noch nicht begonnen, aber ich war angehalten, möglichst zu kommen, bevor es klingelte. Am Haupteingang stauten sich die Autos der Schüler, und so fuhr ich heimlich über den Busparkplatz (was nicht gern gesehen wurde, aber auch nicht verboten war), parkte auf dem Lehrerparkplatz hinter meinem Flügel und benutzte meinen Schlüssel, um durch den Notausgang hineinzugehen (ebenfalls nicht gern gesehen, ebenfalls nicht verboten).
Die Lehrer standen zusammengerottet in den Eingängen zu den Klassenräumen und flüsterten. Sie mussten Wind von der Frau am See bekommen haben. Hier war es nicht wie in der Stadt, wo es jeden Tag ein neues Gewaltverbrechen gab, wo Sirenen zum Hintergrundrauschen gehörten und es nichts bedeutete, wenn sie nah dran waren. Dort hätte ich nie eine gute Story über eine Frau in die Zeitung bringen können, die am Ufer eines Sees gefunden worden war – nicht, wenn sie noch lebte.
Kapitel 3
Es waren nicht nur die Lehrer.
Die ganze Schule tuschelte. Es hallte von den Fluren wider, rollte mit den Schülern heran, wurde lauter und drängender, während sie auf ihren Stühlen herumrutschten. Sich eine Hand vor den Mund schlugen, oh mein Gott. Nach Luft schnappten, ihre Köpfe von einem zum anderen drehten. Bestimmt sprachen sie über die Frau, die am See gefunden worden war.
Es würde also einer jener Tage werden. Unmöglich, die erste Stunde ordentlich über die Bühne zu bringen.
So war die Schule manchmal, ein Summen lag in der Luft, aber es war, als würde man einem Gespräch in einer unbekannten Sprache zuhören. Klatsch, geschrieben in geheimer Kurzschrift, ein Gekritzel, das ich schon lange vergessen hatte.
Langsam bekam ich den Eindruck, dass es nicht nur das Alter war, was uns trennte. Die Schüler waren eine Spezies in Verwandlung: Sie kamen noch als Kinder, mit Stimmbruch und eckigen Konturen, aber sie gingen als etwas vollkommen anderes. Kurven und Muskeln übernahmen mit unbekannter Kraft die Oberhand; und die anderen Teile, die zu ihnen gehörten, versuchten verzweifelt aufzuholen.
Benehmt euch, sagten wir ihnen. Und sie saßen an ihren Tischen, in Deckung, abwartend, irgendjemand im Raum tippte in manischem Rhythmus mit den Zehen auf den Boden. Beim Klingeln sprangen sie von ihren Stühlen und schossen zur Tür, waren so schnell weg, als hätte die Wildnis sie gerufen, und der Raum roch noch nach Minze und Moschus, lange nachdem sie gegangen waren.
Ich verstand nicht, wie irgendjemand ernsthaft erwarten konnte, dass ich mehr erreichte als ihre bloße Anwesenheit. Das hier war nichts als eine zeitweilige Verwahrstätte.
War ich auch mal so gewesen? Ich glaubte nicht. Ich konnte mich nicht wirklich erinnern. Auch damals hatte ich mich, glaube ich, schon ganz und gar auf ein Ziel konzentriert und nur darauf hingearbeitet.
Es klingelte zum Stundenbeginn, doch das Summen hielt an.
Ich zog einen Stapel benoteter Textinterpretationen aus meiner Tasche, und da hörte ich es …
Verhaftet.
Mein Magen zog sich zusammen. Das Wort rasiermesserscharf, eine ständige Bedrohung. Der Hauch einer Möglichkeit blieb, war immer da: Mein Ex, Noah, hatte mich gewarnt, ich solle vorsichtig sein mit dem Artikel – aber das war ich doch, zumindest hatte ich es geglaubt.
Ich erinnere mich an einen Professor im College, der mich mitten in seiner Vorlesung fixierte, als hätte er schon da, während er erklärte, dass im Journalismus eine Lüge Verleumdung war, etwas in mir erkannt.
In Wahrheit war es jedoch mehr als das. Mehr als ein Rechtsbegriff, im Journalismus ist die Lüge der Bruch mit dem heiligsten Gebot.
Steig jetzt aus, hatte mein Chef gesagt. Und bete, dass die Geschichte einschläft.
Genau das hatte ich getan – ich hatte sogar ein ganzes Gebirge zwischen uns gebracht. Aber im Informationszeitalter bedeutete Entfernung nichts. Ich dachte, ich wäre entkommen, aber vielleicht war ich das gar nicht.
Nein. Das war Blödsinn. Eine Frau war vor wenigen Stunden zusammengeschlagen aufgefunden worden; darum ging es.
Ich ging durch die Bankreihen und legte die Aufsätze umgedreht vor den Schülern auf die Tische. Beugte mich zu ihnen, nach Informationen heischend. Eine alte Angewohnheit.
Die großen Augen von Connor Evans fixierten mich, und ich spannte die Schultern an. Jemand aus diesem Raum?
Ich zählte die Klasse durch – wer fehlte? JT, aber JT kam nie pünktlich.
Doch da war noch ein leerer Platz in der dritten Reihe, am Tisch neben dem Fenster: Theo Burton.
Er hatte vor ein paar Wochen sein Heft abgegeben, in dem ein neuer Aufsatz stand, der mir Gänsehaut verursacht hatte – aber es war Fiktion, und ich hatte gesagt: Alles geht. Doch trotzdem schrieb er mit einer Sicherheit und einem Selbstbewusstsein, die größer waren als seine Fantasie. Zu nah an der Wirklichkeit. Ich schloss die Augen, und seine Worte tanzten durch meine Gedanken:
Der Junge sieht sie, und er weiß, was sie getan hat.
Der Junge denkt an verdrehte Gliedmaßen und die Farbe Rot.
Wenn Theo nun etwas getan hatte, wenn dieser Text eine Warnung gewesen war – mein Gott, was für eine Verantwortung.
Ich könnte mir eine Geschichte für mich ausdenken, eine Rechtfertigung: Ich habe den Text nicht genau gelesen. Habe nur die Teilnahme benotet. Ich wusste es nicht.
Aber dann kam Theo Burton durch die Tür, und die Anspannung fiel von mir ab. Auf dem Weg zu seinem Tisch blieb er kurz vor der Klasse stehen. »Die Polizei durchsucht das Hauptbüro«, sagte er, als wäre er zuständig. Sein Kragen stand hoch, die Schuhe makellos. Zu zivilisiert, Theo Burton im wahren Leben.
Wenn dies die Schüler meiner zweiten Unterrichtsstunde gewesen wären, hätten sie mir ungefragt alles erzählt, was passiert war. Das waren alles Neulinge, die mich wie eine Vertraute behandelten. Die Klasse in der dritten Stunde hätte jede Möglichkeit, vom Thema abzulenken, willkommen geheißen, sodass ich sie hätte ausfragen können, ohne mich im Nachteil zu fühlen. Aber diese Klasse der ersten Stunde hatte schon zu Beginn des Jahres beschlossen zu rebellieren, und davon hatte ich mich nie erholt. Wenn ich sie für klug und organisiert genug gehalten hätte, hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass sie das gemeinsam geplant hatten. Ein gezielter Angriff.
Den Fehler hatte ich mir allerdings selbst zuzuschreiben, ebenso wie die Geschichte meines derzeitigen Lebens. An meinem ersten Unterrichtstag hatte ich mich vorgestellt und ihnen erzählt, dass ich gerade aus Boston hergezogen war. Ich dachte, dass Jugendliche an einem Ort wie diesem – in einer Stadt im Abschwung, die plötzlich zu neuem Leben erweckt wurde – davon beeindruckt wären. Ich dachte, ich hätte sie alle durchschaut.
Ein Mädchen in der hintersten Reihe hatte gegähnt, und so fügte ich hinzu: Ich war Journalistin, in der Annahme, das würde mir Autorität verleihen. Da schnellte der Kopf dieses Mädchens, das gegähnt hatte, hoch, und sie grinste wie eine Katze mit einem Kanarienvogel zwischen den Zähnen. Ihr Name, so erfuhr ich bald, war Izzy Marone, und sie fragte: »Ist das Ihr erstes Jahr als Lehrerin?«
Ich war kaum drei Minuten da und hatte schon einen Fehler gemacht. Es gab keinen Grund für sie anzunehmen, dass ich mit dreißig noch eine frischgebackene Lehrerin war; dass ich ein neues Leben anfing, nachdem ich in der ersten Hälfte versagt hatte.
Es gab vier Neunzig-Minuten-Blöcke an einem Schultag, aber die erste Stunde fühlte sich immer doppelt so lang an wie die restlichen.
Izzy Marone hielt gerade Hof um ihren Tisch, Stühle waren zu ihr herangezogen, Jungs rückten näher. Theo Burton beugte sich über den Gang zu ihr, legte ihr einen Finger an die Wange und sprach direkt in ihr Ohr. Ihr Gesicht war ernst.
Ich beschloss, mich an Molly Laughlin zu halten, die zum Außenbezirk gehörte, sowohl tatsächlich als auch im übertragenen Sinn, und hoffte, alle anderen wären zu beschäftigt mit ihrem Geflüster, um es zu bemerken. »Was ist passiert?«, fragte ich sie. Ich war stolz darauf, dass ich immer Quellen fand und sie zum Sprechen brachte, und sie war leichte Beute. Wie es aussah, wirkte bei ihr wohl der Schock – weil ich sie einfach so fragte.
Sie öffnete gerade den Mund, als die Gegensprechanlage im Klassenraum knisternd ansprang.
»Miss Stevens?« Die Stimme des Konrektors sorgte für Stille im Raum.
»Ja, Mr. Sheldon?«, antwortete ich.
Ich hatte ein paar Wochen gebraucht, um mir diese merkwürdige Art anzueignen, wie Lehrer hier miteinander sprachen, egal ob es über Lautsprecher war, wenn die Schüler zuhörten, oder allein in den Fluren. Ich konnte mich nicht daran gewöhnen, dass Erwachsene sich mit Nachnamen ansprachen, so antiquiert und förmlich.
»Sie werden kurz im Hauptbüro gebraucht.« Mitch Sheldons Stimme dröhnte durch den Raum.
Die Stille und Starre hinter mir war deutlich spürbar, vierundzwanzig Ohrenpaare, lauschend, begierig.
Die Polizei war im Hauptbüro, und sie brauchten mich.
Ich hielt mir die Hand vor den Mund und wunderte mich, dass meine Finger zitterten. Dann holte ich meine Tasche aus dem abgeschlossenen Schrank an der Seite des Raumes. Ich ließ mir Zeit. Alle wussten offenbar etwas, was ich nicht wusste.
Das Schloss klemmte zweimal, bevor die Schublade aufging.
Izzy drehte sich zu mir, runzelte die Stirn beim Anblick meiner zitternden Hände. »Haben Sie es schon gehört?«, fragte sie.
»Was gehört?«, sagte ich.
Auch wenn sie alles tat, um genügend Ernst auszustrahlen, war am Zucken ihrer Lippen abzulesen, wie sehr sie sich darauf freute, mir das Folgende zu erzählen. Als wüsste sie, dass ich keine Ahnung hatte. Ich wappnete mich noch einmal.
»Coach Cobb ist gerade wegen Körperverletzung verhaftet worden«, sagte sie.
Oh. Scheiße.
Sie hatte mich erwischt.
Kapitel 4
Davis Cobb war der Grund, warum ich angefangen hatte, mein Telefon nachts stumm zu schalten. Ich ignorierte alle seine Anrufe – immer nach elf Uhr abends, immer wenn er, so nahm ich an, aus der Kneipe kam und nach Hause ging. Immer das Gleiche.
Davis Cobb gehörte der Waschsalon in der Stadt, und nebenbei trainierte er das Basketballteam der Schule, beides wusste ich jedoch nicht, als ich ihm das erste Mal begegnete, auf dem Bürgeramt, wo ich ein paar Formulare auszufüllen hatte.
Ich hatte angenommen, er sei ein Lehrer. Jeder schien ihn zu kennen. Jeder schien ihn zu mögen. Sie sagten: Hey, Davis, hast du Leah schon kennengelernt? Ihr werdet ab kommendem Herbst zusammenarbeiten,und er lächelte.
Er lud mich zu einem Drink in einer Bar in der Nähe ein – er trug einen Ehering, es war mitten am Tag, Du kannst mir hinterherfahren. Es hatte auf mich wie eine freundliche Einladung gewirkt, um mich in der Stadt willkommen zu heißen. Er wirkte ganz normal – bis er eines Nachts vor meiner Tür stand.
Kate (Miss Turner) kam mir auf dem Flur entgegen. Sie hatte die Stirn gerunzelt und bemerkte mich zuerst gar nicht. Aber dann hielt sie an, fasste mich am Arm, als wir aneinander vorbeistrichen, und verriet mir ein schnelles Geheimnis: »Sie wollen wissen, ob Davis Cobb je etwas Ungehöriges bei uns versucht hat. Es ging schnell. Wirklich schnell.«
Mir drehte sich der Magen um, als ich an die Beweise dachte, die sie vielleicht bereits hatten und die mich in die Sache hineinzogen. Die letzten Anrufe. Die Liste seiner Telefonate. War das der Grund, warum der Lautsprecher meinen Namen geknistert hatte?
»Alles okay?«, fragte sie, als könne sie in meinem Schweigen etwas lesen. Sie unterrichtete im Klassenraum mir gegenüber, und während der letzten Monate war sie zu einem freundlichen Gesicht im Chaos der Tage geworden. Nun befürchtete ich, dass sie mehr sah, als mir lieb war.
»Seltsam, das Ganze«, sagte ich und versuchte, ihr verwundertes Gesicht zu imitieren. »Danke für die Info.«
Mitch Sheldon war im Büroflur vor der Konferenzzimmertür postiert, die Arme wie ein Wachmann verschränkt, die Füße trotz kurzer Hosen und Sandalen breitbeinig in den Boden gestemmt. Er ließ die Hände sinken, als er mich kommen sah. Mitch war hier für mich derjenige, der am ehesten einem Mentor gleichkam, und auch ein Freund, aber gerade wusste ich nicht, wie ich seinen Gesichtsausdruck deuten sollte.
Die Tür hinter ihm stand offen, und mein Blick fiel auf zwei Männer in dunklen Jacketts. Sie saßen an dem ovalen Tisch und tranken Kaffee aus Styroporbechern. »Was ist passiert?«, fragte ich.
»Meine Güte«, sagte Mitch, senkte die Stimme und beugte sich näher zu mir. »Sie haben heute Morgen Davis Cobb wegen Körperverletzung festgenommen. Höre auch das erste Mal davon. Die Presse und die Eltern rufen schon an, seit ich hier angekommen bin.«
An der Rezeption mit den Fenstern zum Schuleingang wimmelte es von Polizisten, wie Theo gesagt hatte. Doch es gab keine anderen Lehrer hier vorn oder auf dem Büroflur hinter der Rezeption, wo wir gerade standen. Nur Mitch und mich.
Mitch nickte zur Tür. »Sie haben nach dir gefragt.« Er schluckte. »Sie befragen alle Frauen, aber nach dir haben sie mit Namen gefragt.«
Eine Frage, die fast wie eine Beschuldigung klang. »Danke, Mitch.«
Ich betrat den Raum und schloss die Tür hinter mir. Ich hatte falschgelegen – es waren drei Leute im Raum. Zwei Männer in Anzügen, die so ähnlich waren, dass sie wohl Dienstkleidung sein sollten, und eine Frau in Zivil.
Der Mann, der mir am nächsten war, stand auf und musste offenbar zweimal hingucken. »Leah Stevens?«, fragte er. Seine Marke hing sichtbar an seinem Gürtel.
Ich spannte die Schultern an. »Ja«, antwortete ich, fühlte mich unwohl, wie zur Schau gestellt.
Er streckte eine Hand aus. »Detective Kyle Donovan«, sagte er. Er war der jüngere von beiden, aber eleganter, und irgendwie wirkte er reifer. Erweckte den Eindruck, dass er der Zuständige war, unabhängig vom Alter. Vielleicht lag es auch nur daran, dass er attraktiv war und Blickkontakt hielt, und deshalb war ich voreingenommen. Er war ganz mein Typ.
Ich schüttelte ihm die Hand und lehnte mich dann über den Tisch, um auch dem älteren Mann die Hand zu geben. »Detective Clark Egan«, stellte der sich vor. Graue Schläfen, eine weichere Statur, trübe Augen. Er neigte den Kopf zur Seite, wechselte dann einen Blick mit Detective Donovan.
»Allison Conway.« Ihre Rolle war immer noch unklar, sie trug ein Kostüm, das blonde Haar fiel in Wellen über ihre Schultern.
»Danke, dass Sie zu einem Treffen bereit waren«, sagte Donovan, als hätte ich eine Wahl gehabt. Er zeigte auf einen Stuhl gegenüber.
»Natürlich«, sagte ich, setzte mich und versuchte, die Situation zu deuten. »Worum geht es hier?«
»Wir haben nur ein paar Fragen. Davis Cobb. Kennen Sie ihn?«
»Sicher«, sagte ich und schlug die Beine übereinander, um entspannter auszusehen.
»Seit wann?«
»Ich habe ihn im Juli kennengelernt, im Bürgeramt, als ich mich hier gemeldet habe.« Fingerabdrücke, Drogentest, Überprüfung meines Hintergrunds. Lehrer und Polizisten – die letzten unbefleckten Berufe. Sie überprüfen das Vorstrafenregister, aber nicht die Zivilklagen. So etwas zählt fast nicht. Bauchgefühl noch weniger. Es gab so viele Lücken, durch die man entkommen konnte. So vieles, das man nicht an einer Reihe von erfassten Verstößen und Rauschmitteln ablesen konnte.
Davis Cobb hatte das geschafft.
»Haben Sie sich angefreundet?«, fragte Detective Donovan.
»Nicht wirklich.« Ich bemühte mich, nicht zu zappeln, mit mäßigem Erfolg.
»Hat er Sie je direkt kontaktiert? Sie angerufen?«
Ich räusperte mich. Und da war er. Der Beweis, der Grund, weswegen sie mich aus der Klasse geholt hatten. Sei auf der Hut, Leah.
»Ja.«
Detective Donovan sah auf, meine Antwort war ein Funke. »War der Kontakt willkommen, hatten Sie ihm Ihre Nummer gegeben?«
»Die Schule hat ein Sekretariat. Wir alle kommen an diese Informationen heran.« Daran und an unsere Adressen, wie ich gelernt hatte.
»Wann hat er Sie zuletzt angerufen?«, mischte sich Detective Egan ein und kam gleich auf den Punkt.
Ich nahm an, wenn sie so fragten, wussten sie es sowieso schon und warteten nur auf meine Bestätigung, um zu prüfen, ob ich vertrauenswürdig war. »Letzte Nacht«, sagte ich.
Detective Donovan ließ mich nicht aus den Augen, sein Stift schwebte in der Luft, er hörte zu, machte aber keine Notizen. »Worüber haben Sie gesprochen?«, fragte er.
»Wir haben nicht gesprochen«, sagte ich. Ich presste die Lippen zusammen. »Mailbox.«
»Was hat er gesagt?«
»Ich hab es gelöscht.« Das war Emmys Idee gewesen. Vor ein paar Wochen hatte sie das Telefon in meiner Hand böse angestarrt und gefragt, ob es wieder dieses Arschloch Cobb war. Nachdem ich genickt hatte, meinte sie: Du weißt schon, dass du dir das nicht anhören musst, oder? Du kannst es einfach löschen. Zuerst erschien mir das so merkwürdig, dieses einfache Nichtbeachten von Informationen, aber es war auch etwas unerklärlich Verlockendes daran – so zu tun, als hätte es die Nachrichten nie gegeben.
Detective Egan öffnete den Mund, aber nun schnitt ihm die Frau – Allison Conway, Rolle unbekannt – das Wort ab. »Passiert das häufiger?«, fragte sie. Aus seiner Handyabrechnung wussten sie, dass es so war.
»Ja«, sagte ich. Ich legte die Hände auf den Tisch. Änderte meine Meinung. Nahm sie wieder unter den Tisch.
Detective Donovan lehnte sich vor, verschränkte die Finger, senkte die Stimme. »Warum ruft Davis Cobb Sie jede Nacht an, Miss Stevens?«
»Ich habe keine Ahnung, ich gehe nie ran.« Ja, es war eine gute Idee gewesen, die Hände unter dem Tisch zu behalten. Ich fühlte, wie meine Knöchel weiß wurden, als ich sie zu Fäusten ballte.
»Warum sind Sie nie rangegangen?«, fragte Donovan.
»Weil er mich jede Nacht betrunken anruft. Würden Sie rangehen?« Es war für Cobb zu einer lieb gewonnenen Angewohnheit geworden. Schweres Atmen, die Geräusche der Nacht, der Wind – daraus hatten die Nachrichten bestanden, als ich sie mir noch angehört hatte, um die Details zu entschlüsseln, als könne Wissen allein der Weg sein zurückzuschlagen. Stattdessen war ich hinterher immer verunsichert gewesen. Hatte das Gefühl, er wolle mich glauben machen, er sei auf dem Weg zu mir. Er beobachte mich.
Mitch Sheldon war direkt vor der Tür, und ich wusste, dass er wahrscheinlich zuhörte.
»Welcher Art war Ihre Beziehung?«, warf Egan wieder ein.
»Er rief mich spätnachts betrunken an, Detective, das beschreibt im Wesentlichen unsere Beziehung.«
»Hat er Sie je bedroht?«, fragte er.
»Nein.« Bist du allein zu Hause, Leah? Fragst du dich nie, wer dich sonst noch sehen kann? Seine Stimme so leise, dass ich mir das Telefon ans Ohr drücken musste, um ihn zu hören, und mich fragte, ob er wohl auch näher kam, auf der anderen Seite der Wand.
»Wusste seine Frau davon?«, fragte er und meinte noch etwas anderes.
Ich hielt inne. »Nein, ich denke, man kann sicher davon ausgehen, dass sie nichts davon wusste.«
Lange vor den Anrufen hatte es jenen Samstagabend gegeben: plötzlich der Motor eines Autos vor dem Haus, weicher und leiser als Jims. Emmy schlief, ich las im Wohnzimmer ein Buch. Schritte auf der Veranda, und dann erschien dort Davis Cobbs Bild aus heiterem Himmel, wie ein Geist. Er klopfte an die Scheibe und sah mich direkt an.
Als ich die Tür einen Spalt aufschob, sagte er »Leah«, als hätte ich ihn eingeladen. Sein Atem roch nach Alkohol, er beugte sich zu weit vor, der Geruch wehte mit einem Schwall Nachtluft herein. Ich musste die Hand hochhalten, um ihn daran zu hindern, die Tür ganz aufzuschieben.
»Hey«, sagte er, »ich dachte, wir sind Freunde.« Nur dass Freundschaft ganz und gar nicht das war, was er im Sinn hatte.
»Es ist spät. Du hast da wohl etwas missverstanden«, sagte ich, und da war dieser Moment, in dem ich den Atem anhielt und wartete, dass die Situation in die eine oder andere Richtung kippte.
»Glaubst du, du bist zu gut für uns, Leah?«
Ich schüttelte den Kopf. Das glaubte ich nicht. »Du musst gehen.«
Irgendwo hinter mir knarrte eine Diele, tief im Schatten des Flurs, und Davis trat endlich den Rückzug an, verschwand in die Nacht. Ich blickte in die Dunkelheit, bis das Geräusch des Autos in der Ferne verstummt war.
Als ich mich umdrehte, lugte Emmy aus dem Schatten ihres Zimmers hervor, erst jetzt sichtbar, wo er verschwunden war. »Ist alles okay?«, fragte sie.
»Nur ein Typ von der Arbeit. Davis Cobb. Er ist jetzt weg.«
»Er sollte nicht mehr Auto fahren«, hatte sie gesagt.
»Nein«, hatte ich geantwortet, »das sollte er nicht.«
Es war warm im Konferenzzimmer. Egan rutschte auf seinem Stuhl herum, flüsterte Conway etwas zu, aber Donovan betrachtete mich konzentriert.
»Hat er der Frau etwas getan? Der, von der sie alle reden – Bethany Jarvitz?«, fragte ich und sah Donovan direkt an.
»Würde Sie das wundern?«, fragte er, und nun hatte ich wieder die ungeteilte Aufmerksamkeit.
Ich schwieg. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, bevor ich Emmy kennengelernt hatte, da hätte ich Ja gesagt. »Nein.«
Eine Andeutung von Mitgefühl lag in seinem Blick, und ich war mir nicht sicher, ob mir das gefiel. »Gibt es einen Grund dafür, dass Sie das sagen?«, fragte er.
Davis Cobb, verheiratet, respektables Mitglied der Gesellschaft, Kleinunternehmer, Highschool-Basketballcoach. Ich war vor langer Zeit brutal auf den Boden der Realität geschleudert worden und hatte so gelernt, dass nichts davon eine Rolle spielte. Nichts überraschte mich mehr.
»Keinen bestimmten«, sagte ich.
Er beugte sich ein wenig vor, musterte mich kurz und ausgiebig. »Kennen Sie Bethany Jarvitz, Miss Stevens?«
»Nein«, sagte ich.
Detective Donovan nahm ein Foto aus einer Mappe, klopfte mit dessen Kante auf die Tischplatte, als würde er überlegen. Am Ende traf er seine Entscheidung und ließ das Foto fallen, Gesicht nach oben. Er drehte es mit den Fingerkuppen so, dass es zu mir zeigte.
»Oh.« Der Laut entwich mir wie ein Keuchen – das war also der Grund für das mehrmalige Hinsehen, die Blicke. Es schien, als hätte auch Davis Cobb einen bestimmten Typ Frau, und der sah so aus: braune Haare und blaue Augen, breites Lächeln und schmale Nase. Ihre Haut war etwas gebräunter als meine, vielleicht lag das aber auch nur an der Jahreszeit, ihr Haar war länger, und sie hatte eine kleine Zahnlücke, aber es gab weit mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede. Wenn ich zwei einander so ähnelnde Schülerinnen in meiner Klasse hätte, müsste ich mir eine gedankliche Notiz machen – Bethany braucht eine Zahnspange –, um sie auseinanderzuhalten.
»Sie wurde weniger als einen Kilometer von Ihrem Haus entfernt im Dunkeln gefunden.«
Im Dunkeln, auf den ersten Blick, könnten wir dieselbe Person sein.
Irgendjemand ließ unter dem Tisch seine Knöchel knacken. »Wir hätten gern eine Stellungnahme von Ihnen«, sagte Egan zu mir und wies in Richtung der Frau neben ihm. Und nun wurde Allison Conways Rolle deutlich. Sie war diejenige, die die Stellungnahme aufschreiben würde. Sie war eine Frau, die Anwältin eines Opfers, und würde vorsichtig mit dem sensiblen Thema umgehen.
»Nein«, sagte ich. Ich musste mich da raushalten, mehr als alles andere. Musste den Neuanfang bewahren, meinen Namen als unbeschriebenes Blatt. Ich musste besser aufpassen, wem ich mich anvertraute, musste sicher sein, wem ich glauben konnte.
Bevor ich Boston verlassen hatte, bevor die Kacke so richtig am Dampfen gewesen war, ging ich seit mehr als sechs Monaten mit Noah aus und war vorher schon lange Zeit mit ihm befreundet gewesen. Wir arbeiteten zusammen bei derselben Zeitung, und der Konkurrenzkampf hatte uns angeheizt. Aber dennoch hatte es sich als Fehler erwiesen zu glauben, dass wir ebenbürtig waren. Es war Noah gewesen, der mich angezeigt hatte. Noah, der meine Karriere ruiniert hatte. Obwohl er sicher behaupten würde, ich hätte das selbst zu verschulden.
Wenn ich mich jetzt in diese Sache verwickelte, brächte ich das fragile Gleichgewicht in Gefahr, das ich in Boston zurückgelassen hatte. Es war für alle besser, wenn ich verschwand, meinen Namen aus der Presse fernhielt, aus allem, das irgendwie mit dem Gesetz in Berührung kommen konnte.
»Es würde bei dem Fall helfen«, sagte Donovan, und Conway warf ihm einen Blick zu.
»Nein«, wiederholte ich.
»Wenn Davis Cobb Sie gestalkt hat …«, fing sie an. Ihre Stimme sanft und einfühlsam, wahrscheinlich hätte sie sogar versucht, meine Hand zu halten, wenn sie näher dran gewesen wäre, »… dann würde Ihre Aussage uns helfen. Sie könnte Bethany und Ihnen helfen. Sie könnte andere davor bewahren.«
»Kein Kommentar«, sagte ich, und sie sah mich irritiert an.
Das hieß im Klartext: Lassen Sie mich verdammt noch mal in Ruhe. Sie dürfen meinen Namen nicht drucken. Suchen Sie sich einen anderen Aufhänger. Aber anscheinend kam das hier nicht rüber.
Ich schob meinen Stuhl zurück, das schien die Botschaft dann doch verständlich zu machen.
»Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Miss Stevens.« Kyle Donovan stand auf und gab mir seine Karte. Früher mal hätte ich aus der Art, wie er mich ansah, geschlossen, dass wir gut zusammenpassen würden. Das wäre sicher schön gewesen.
Ich wandte mich zum Gehen. Blieb an der Tür noch mal stehen. »Ich hoffe, es geht ihr den Umständen entsprechend gut.«
Ich hatte recht. Mitch wartete vor der Tür. »Leah«, sagte er, als ich an ihm vorbeiging. Es musste eine ernste Sache sein, wenn er meinen Vornamen in der Schule benutzte.
»Ich muss zurück in die Klasse, Mitch«, sagte ich. Ich ging weiter, zum Hinterausgang hinter den Büros hinaus, von dem man direkt in den Flügel mit den Klassenräumen kam.
Während des Unterrichts kam mir die Schule wie eine andere Art von Bestie vor. Ein Bleistift fiel irgendwo am Ende des Flurs herunter und rollte langsam den Boden entlang. Eine Toilettenspülung ging. Meine Schritte hallten.
Ich ging zurück in den Klassenraum mit dem Gefühl, einer Kugel ausgewichen zu sein. Bis ich wieder für Kate Turner übernahm, die anscheinend zwischen ihrer und meiner Klasse, der sie eine Stillarbeit gegeben hatte, hin- und hergesprungen war. Alles okay?, mimte sie. Sie musste herübergekommen sein, als sie bemerkt hatte, dass meine Befragung wesentlich länger dauerte als ihre.
Ich nickte dankend, tat gelassen. Kein Problem.
Izzy Marone meldete sich, sobald Kate weg war. Der Rest der Klasse blieb still und wartete gebannt.
»Ja, Izzy?« Die Uhr hinter mir tickte. Draußen vor dem Fenster heulte ein Motor auf. Eine Biene flog gegen die Scheibe.
»Wir haben uns gefragt, Miss Stevens, warum sie gerade mit Ihnen über Coach Cobb reden wollten.«
Und da wurde mir klar: Ich war ganz und gar nicht entkommen.
»Arbeitet weiter«, sagte ich. Ich spürte alle Augen auf mir. Nun endlich war ich so interessant für sie, wie ich es mir immer erhofft hatte. Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und ihre Ehrfurcht waren spürbar.
Ich setzte mich an meinen Tisch, öffnete meine Schulmails, löschte sie alle mit einem Klick meiner Maus. Das war einfacher, als nach seinen Nachrichten zu suchen, die sowieso immer gleich lauteten. Mit Sicherheit existierten sie noch irgendwo im Äther, doch es war trotzdem besser, sie von der Oberfläche zu wischen.
Als Emmy und ich hier ankamen, befand sich die Stadt gerade im Wandel, so wie ich mich auch, und ich hatte eine schwer zu greifende Verbundenheit mit dem Ort gefühlt. Die Schule war brandneu, alles war frisch gestrichen, die Klassenräume mit der neuesten Technik ausgestattet. An unserem ersten Tag während der Orientierungsphase hatte Kate gesagt, es sei wie ein Traum, verglichen mit ihrer vorigen Schule. Hier musste man sich nicht den Drucker teilen oder eine Woche im Voraus den Fernseher reservieren. Es war für alle ein Neuanfang.
Schüler- und Lehrerschaft setzten sich sowohl aus Alten als auch aus Neuen zusammen: aus den Menschen, deren Familien hier schon immer gelebt hatten, seit Generationen – ehemalige Minenarbeiterfamilien, jene, die auch in der Wirtschaftskrise hiergeblieben waren; und aus dem »neuen Geld«, das mit dem Tech Data Center hierhergezogen war und versprach, der Wirtschaft wieder Leben einzuhauchen. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich Teil dieses Lebens werden könnte, zusammen mit der Schule, die gerade eröffnet hatte, um die wachsende Bevölkerung aufzunehmen. Wir saßen alle im selben Boot. Bauten uns wieder auf, zu etwas Neuem.
Doch so war es nicht. Die neuen Jobs waren nicht für die Menschen gedacht, die hier lebten. Die neue Firma brachte ihre eigenen Arbeiter mit. Die Größe der Schulen verdoppelte sich, sie wurden geteilt und anderen Zonen zugeordnet, Linien wurden neu gezogen, Lehrer wurden gebraucht. Mit meinem Abschluss in Journalismus, echter Lebenserfahrung und dem Wunsch, mitten im Nirgendwo neu anzufangen, wurde auch ich gebraucht.
Izzy Marone ließ eine Kaugummiblase platzen, hauptsächlich weil Kaugummi kauen verboten war, und sie wusste, dass niemand sie daran hindern würde. Sie drehte einen Bleistift in der Hand und betrachtete mich eingehend.
Izzy gehörte zu der zweiten Gruppe, der des neuen Geldes. Als ob das monströse Haus in dem unpersönlichen Wohngebiet und ihr Status hier mitten im Nirgendwo etwas wären, mit dem man angeben könnte.
Manchmal musste ich all meine Kraft aufbieten, um mich nicht zu ihr zu beugen, sie an den Schultern zu packen und ihr ins Ohr zu flüstern: Du gehst auf eine staatliche Schule mitten im verdammten Nirgendwo. Du wirst nicht mehr existieren, sobald du auch nur einen Schritt hinter die Stadtgrenze machst. Du wirst nirgendwo sonst klarkommen.
Na ja. Ich hatte gut reden.
Kapitel 5
Ich verließ die Schule absichtlich früh. In der vierten Stunde hatte ich frei, und auch wenn ich eigentlich verpflichtet war, bis mindestens fünfzehn Minuten nach Schulende zu bleiben, nahm ich an, das würde heute niemanden stören. Emmy hatte immer noch nicht angerufen, und ich wollte sie erwischen, bevor sie zur Arbeit musste. Etwas hatte sich in meine Gedanken gegraben, beunruhigend und nicht mehr abzuschütteln. Ich musste sie sehen.