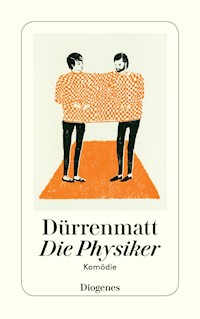29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Der Ausdruck »Geisteswissenschaftler« evoziert das Bild von einsamen Menschen am Schreibtisch, deren ganze Aufmerksamkeit der versunkenen Auseinandersetzung mit komplizierten Texten gilt. Aber stimmt dieses Bild? Nein, sagen Steffen Martus und Carlos Spoerhase, die in ihrem Buch im Rückgriff auf zahlreiche unpublizierte Quellen die Praxis der Geistesarbeit am Beispiel Peter Szondis und Friedrich Sengles untersuchen. Sie zeigen, was Forschen, Lehren und Verwalten im akademischen Alltag tatsächlich bedeuten, vor welchen Herausforderungen die Geistesarbeit jeden Tag steht und was sie leistet. Gegen die abstrakte Rede von der »Krise der Geisteswissenschaften« plädieren sie für eine Neujustierung des Blicks, und zwar darauf, was an einem geisteswissenschaftlichen Arbeitsplatz wirklich geschieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 953
Ähnliche
Titel
3Steffen Martus Carlos Spoerhase
Geistesarbeit
Eine Praxeologie der Geisteswissenschaften
Suhrkamp
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschebuch wissenschaft 2379
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-77284-3
www.suhrkamp.de
Motto
»Intelligent practice is not a step-child of theory.« (Gilbert Ryle)
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Motto
Inhalt
Einleitung: Weshalb über die Praxis der Geisteswissenschaften nachdenken?
1. Geisteswissenschaftliches Arbeiten
2. Soziale Praktiken
3. Delegieren und Zuarbeiten
4. Individualisieren und Kollektivieren
5. Spezialisieren und Generalisieren
6. Publizieren als Kollaborationspraxis
7. Die Regeln der Praxis
8. Die Verbindlichkeit der Praxis
9. Die Vielfalt von Normen
10. Die Moderation von Normen
11. Theorie in der Praxis
12. Theoretisieren
13. Theoretisieren und Publizieren
14. Theoretisieren und Transferieren
15. Gegenstände des Theoretisierens
16. Epistemische Dinge
17. Interobjektivität
18. Problematisieren
19. Seminararbeiten schreiben
20. Lektürepraktiken koordinieren
21. Der Lehrstuhl als Praxiszusammenhang
22. Dienste versehen
23. Arbeiten in Teams und Gruppen
24. Institutionalisieren und Inkorporieren
25. Räume der Praxis
26. Lehrveranstaltungen als Praxisgefüge
27. Praxis und Präsenz
28. Konferieren
29. Die Vielfalt des Teilnehmens
30. Kommunikation unter Anwesenden
31. Praktiken der Soziabilität
32. Das langsame Entstehen einer Praxis
33. Kollegiale Papierpraktiken
34. Praktiken der Selbstdarstellung
35. Das unmerkliche Ende einer Praxis
Nachwort: »… denn sie wissen nicht, was sie tun«
Dank
Nachweis
Anmerkungen
Abbildungsverzeichnis
Unveröffentlichte Quellen
Literatur
Informationen zum Buch
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
333
332
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
9Einleitung: Weshalb über die Praxis der Geisteswissenschaften nachdenken?
Dramedy des Geistes
Im Sommer 2021 war es so weit: Mit The Chair haben es die Geisteswissenschaften zu Netflix geschafft. Bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler,1 die zuvor in Greys Anatomy (Sandra Oh), Transparent (Jay Duplass) oder 13 Reasons Why (Nana Mensah) als Ärztinnen, Musikproduzenten oder Krankenschwestern aufgetreten waren, geisterten nun durch das English Department der Pembroke University. Die Vorfreude war groß: Endlich würden wir dem Geist bei der Arbeit zuschauen dürfen. Die Handlung der Serie war dann geprägt von dem Tenure-Verfahren einer jüngeren Kollegin, der Organisation des Lehrangebots, dem Umgang mit Studierendenprotesten, dem Kampf um die angemessene Raumausstattung oder der Suche nach passenden Kandidaten für administrative Ämter. Die Arbeit des Geistes erschöpfte sich aus der Perspektive von The Chair weitgehend in der akademischen Selbstverwaltung.
Wo aber blieb die Forschung? Hier scheiterte mal eine Person am Kopierer, dort saß eine am antiquiert anmutenden Microfichelesegerät. Das zeugt durchaus von Realitätssinn. In keiner Szene aber sah man, was die Mitglieder des Departments in der Bibliothek oder ihrem Büro am Schreibtisch tun (nicht auf der Couch oder am Fußboden!). Gerade die Tätigkeiten also, die gemeinhin im Zentrum des geisteswissenschaftlichen Selbstbilds stehen, wirkten offenbar zu langweilig und unspektakulär, um auch nur Gegenstand eines satirischen Augenzwinkerns zu werden. Von außen gesehen passiert ja auch wirklich nicht sehr viel: Der angestrengte Blick richtet sich starr auf ein Papier, auf ein Buch oder einen Bildschirm. Manchmal kratzt sich die am Arbeitstisch sitzende Person am Kopf, legt das Kinn in die Hand, rückt den Stuhl, greift nach einem Buch oder einer Kopie. Wenn es gut läuft, bewegen sich die Finger auf der Tastatur. Wenn es schlecht läuft, steht sie kurz auf, geht aus dem Zimmer, kehrt mit einer Tasse Kaffee zurück. Dann wieder Stille. Es handelt sich um eine unscheinbare und einsame Tätigkeit.
10Die Netflix-Serie blickt strikt in Richtung des hektischen akademischen Betriebs. Diese betriebliche Seite der Wissenschaft hat in Deutschland im Rahmen der grundlegenden Reformen der letzten beiden Jahrzehnte das Bild geprägt: eine Welt des »akademischen Kapitalismus«,2 in der immer häufiger »Strategiepapiere und Zukunftskonzepte, quantitative Indikatoren, Leistungsvergleiche und Evaluationen, Pakte, Selbstverpflichtungen und Zielvereinbarungen, strategisches Management, Qualitätssicherung und Monitoring sowie das Wissenschaftsbranding und Wissenschaftsmarketing« den Ton angeben.3 Neue Qualifikationswege (Juniorprofessur, Nachwuchsgruppen u.a.), Projektorientierung und Verbundforschung (nicht zuletzt stimuliert durch die Exzellenzinitiative), die Ersetzung von schwer messbarem, aber mächtigem Renommee durch die Drittmittelquote oder die nachdrückliche Forderung jüngerer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach der Planbarkeit von Karrieren sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben die Imagination des zurückgezogen forschenden Geistesheroen zunehmend irritiert. In The Chair tritt er allenfalls noch als vertüdelter, nicht mehr wirklich zurechnungsfähiger älterer Mann im unförmigen Tweed-Sakko auf, der seine große Zeit offenbar lange hinter sich hat.
The Chair ist eine Serie, die Genrekonventionen gehorcht. Sie folgt aber auch einer anderen Konvention: der merkwürdigen Trennung von Geist und Arbeit. Einerseits findet sich kulturell die Bereitschaft zur Emphatisierung des einsamen Einzelgeistes, dessen wissenschaftliche Aktivität den Blicken – auch der Dramedy – entzogen wird. Andererseits wird die zur Schau gestellte Arbeit als etwas Ungeistiges dargestellt. Die Serie gibt das in chaotischer Betriebsamkeit versinkende Berufsleben des akademischen Departments der Lächerlichkeit preis und isoliert es von der wissenschaftlichen Arbeit im engeren, eigentlichen Sinne. Der quälende administrative Alltagsquatsch negiert also nicht notwendig die Vorstellung einer ehernen Einsamkeit des Forschens, sondern rückt diese geistige Tätigkeit vielmehr in einen separaten Bereich. Diese Aufspaltung des geisteswissenschaftlichen Arbeitslebens findet sich nicht nur in Netflix-Serien, sondern auch in der geisteswissenschaftlichen Selbstbeobachtung, wenn die eigentliche Tätigkeit, die einsam am Schreibtisch stattfinden muss, von dem ganzen Rest geschieden wird, der mit einem gewissen Widerwillen auch erledigt sein will.
11Es verwundert deshalb nicht, dass trotz aller Satiren auf die Wissenschaft, deren Arbeitsbedingungen sich in den vergangenen Jahrzehnten tiefgreifend verändert haben, das Bild der geisteswissenschaftlichen Praxis merkwürdig stabil bleibt, und sei es als schmerzhafter Kontrast, um einer aussterbenden Spezies nachzutrauern.4 Als Sehnsuchtsorte wahrer Gelehrsamkeit dienen in der Gegenwart dann die betrieblichen Ausnahmesituationen der Institutes for Advanced Study, die im turbulenten Wissenschaftsbetrieb Reservate anbieten – nicht weil sie Laborräume, Personal, Gerätschaften sowie andere kostspielige und organisationsaufwendige Ressourcen zur Verfügung stellen, sondern einen ruhigen, abgeschiedenen Arbeitsplatz [→Kap. 27].5
Das auch in den Geisteswissenschaften selbst gepflegte Leitbild der einsamen Schreibtischarbeit wurde also durch die fundamentalen Veränderungen von Wissenschaft und Universität kaum angegriffen.6 Als Gesamtbild hat es aber nie gestimmt und die enorme Fülle an Aktivitäten verdeckt, die den Alltag in der Kombination von Forschung, Lehre, akademischer Selbstverwaltung und öffentlichkeitswirksamer Kommunikation bestimmten. Schon in der Etablierungsphase des modernen Wissenschaftssystems haderten Gelehrte mit den Spannungen, die sich aus dem Berufsbild etwa des Professors und den entsprechenden institutionellen Verpflichtungen einerseits und der Idee des Forscherlebens andererseits ergaben.7 Wer einen Blick in die Briefwechsel des 19. Jahrhunderts wirft, findet dort äußert umtriebige Personen, die kollegiale Netzwerke und Feindschaften pflegen, Dienst- und Studienreisen planen, um die angemessene Ausstattung von Arbeitsräumen ringen, ins Prüfungswesen eingebunden sind, über die Abstimmung von Forschung und Lehre rätseln, in ihren Vorlesungen und Seminaren mit ganz diversen Bildungsvoraussetzungen und Erwartungen der Studierenden zurechtkommen müssen, wissenschaftspolitische Entscheidungen halbwegs vernünftig zu integrieren versuchen, Mitarbeitende einweisen und qualifizieren, Querelen in Projekten schlichten oder Zeitungsartikel für das größere Publikum lancieren. Dazwischen finden sich die kostbaren Minuten des Lesens, Exzerpierens und Annotierens von Quellen und Forschungsbeiträgen, für das Skizzieren, Projektieren und Schreiben von Büchern, Aufsätzen, Miszellen, Gutachten oder Anträgen. Und dann bleibt möglicherweise noch ein wenig Zeit für Familie, Freundinnen und 12Freunde und hier und da für ein paar Urlaubstage – in denen man mit dem Bleistift in der Hand weiterliest.
Uns geht es im Folgenden um das Gemisch von Praktiken, das den Alltag des geisteswissenschaftlichen Arbeitens bestimmt. Wir möchten dabei den Blick insbesondere darauf lenken, dass es sich bei dieser Praxis stets um eine vielfältige, soziale und kollektive Aktivität handelt. Selbst eine so unscheinbare und einsame Praktik wie das individuelle Anstreichen einer interessanten Stelle in einem Buch erweist sich als ein Vorgang, der unverständlich bleibt, solange man nur auf eine einsame Person blickt und nicht auch auf das ganze Drumherum [→Kap. 1, 2 u. 18]. Die Ökonomie der Geistesarbeit, für die wir uns interessieren, besteht im Wesentlichen in der Kunst der Moderation unterschiedlicher Interessen, Absichten und Anliegen, die sich mit dieser Aktivitätsfülle verbinden.
Krisen des Geistes
Die Geisteswissenschaften, so scheint es, sind in der Gegenwart nicht nur dann interessant, wenn sie ihre betriebliche Seite zeigen, sondern auch, wenn sie sich in der Krise befinden oder im Krisenmodus thematisiert werden können – meistens handelt es sich ohnehin um zwei Seiten einer Medaille.8 Was in den Geisteswissenschaften geschieht, erfährt besonders dann eine erhöhte Aufmerksamkeit, wenn diskutiert wird, was ihnen gerade nicht so gut gelingt. Als 1991 aus sozialwissenschaftlicher Perspektive »die erste quantitative und institutionelle Gesamterhebung der Entwicklung der Geisteswissenschaften an bundesdeutschen Universitäten seit Mitte der fünfziger Jahre« vorgelegt wurde, setzte die Einleitung nicht umsonst mit einem Kapitel über »Die Geisteswissenschaften und ihre Krise« ein.9 Schon die Rubrik »Geisteswissenschaften« selbst war und ist eine äußerst krisenanfällige Bündelung, in der sich die entsprechenden Fächer mehr oder weniger gut aufgehoben fühlen und entsprechend mit dieser Einordnung hadern.10 Wir verbinden mit »Geisteswissenschaften« übrigens keine besonders emphatische oder kämpferische Auffassung, sondern nehmen den Begriff als nach wie vor verbreitete Bezeichnung für eine lose Gruppe von Fächern, die sich typischerweise zu Mitgliedern einer philosophischen Fakultät eignen, bestimmte Kooperationsneigun13gen entwickelt haben und sich wechselseitig besonders intensiv beobachten.
An den Geisteswissenschaften werden also mit Vorliebe Fehlstellen thematisiert und nicht das, was dort tagtäglich gemacht wird. So entstehen lange Wunschlisten, die sie erfüllen sollen, ohne dass ein Interesse daran besteht, was tatsächlich geleistet wird. Dieses schiefe Bild der Geisteswissenschaften hat viel damit zu tun, dass sie bislang primär aus der Perspektive der Theorie und nicht aus der Perspektive der Praxis wahrgenommen worden sind: Aus einer nicht selten philosophischen Blickrichtung wurden immer wieder theoretische Überlegungen angestellt, was Geisteswissenschaft eigentlich sein und leisten sollen – sehr häufig ohne sich dafür zu interessieren, was die Geisteswissenschaften in ihren sehr unterschiedlichen Ausprägungen tatsächlich tun und tun müssen. Während sich in der theoretischen Reflexion über die Naturwissenschaften schon lange die Auffassung durchgesetzt hat, dass derartige Überlegungen nur sinnvoll sein können, wenn man den Gegebenheitsweisen und praktischen Vollzugsformen der Forschung viel Aufmerksamkeit widmet und etwa die Einsichten der Laboratory Studies einbezieht, scheint sich diese Auffassung im Rahmen der theoretischen Reflexion der Geisteswissenschaften noch nicht etabliert zu haben. Womöglich weil man ohnehin dazu neigt, diese Gegebenheitsweisen und Vollzugsformen als defizitär zu empfinden – womit wir wieder bei der Krise als grundlegendem Wahrnehmungsmodell der Geisteswissenschaften wären.
Debatten setzen typischerweise mit der dramatischen Beobachtung ein, die Geisteswissenschaften befänden sich »weltweit in einer Krise«11 oder es bestünden »Anzeichen eines sich beschleunigenden Niedergangs hin zu ihrem historischen Ende«.12 Es ist keine sehr neue These, dass sich »die Geisteswissenschaften für die Zukunft schlecht gerüstet« zeigen und sich daher entweder grundlegend »ändern« oder »untergehen« müssen.13 Nicht selten wird dabei über die »Geisteswissenschaften schlechthin« verhandelt, obwohl, wie kritisch dagegen eingewandt wurde, meist spezifische »Problemlage[n] […] von bestimmten Geisteswissenschaften« (und vielleicht auch bestimmten Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern) zu diskutieren wären.14 Selbst wenn nur einzelnen Fächern, etwa aus dem weiten Bereich der Literaturwissenschaft, mit sorgenvoller Miene der Puls gemessen wird,15 bleibt 14es bei einer forsch verallgemeinernden Rhetorik: Das ausgewählte Fach16 befinde sich als solches und insgesamt »in Dauerkrise«.17
Bemerkenswert an den genannten Krisendiagnosen ist, dass sie unausgesprochen meist eine Perspektive privilegieren, etwa die einer bestimmten Statusgruppe. Ist aber eine Krise der Geisteswissenschaften eine Krise der Studierenden, des »Mittelbaus« oder der Professorinnen und Professoren? Und wie steht es mit den Mitarbeitenden im Bereich »Technik, Service und Verwaltung«? Befinden sich Promovierende in derselben Krise wie Postdocs oder bedeutet die Krisenbewältigung auf der einen Seite die Krisenverschärfung auf der anderen? Und wie verhält sich die Personalsituation in unterschiedlichen Fächern? Von der Position mancher fest angestellter Hochschullehrerinnen und -lehrer aus gesehen mag die Forderung nach verlässlichen Berufsbiografien, die unter dem Label »#IchBinHanna« für gewaltige Bewegung gesorgt hat, vornehmlich den legitimen Konkurrenzdruck einer meritokratisch organisierten, vielleicht auch notwendigerweise idealisierten Universität gefährden, also mehr Probleme mit sich bringen als lösen und damit in die Krise führen.18 Aus Perspektive des engagierten ›Mittelbaus‹ verhält es sich genau umgekehrt: Die Rhetorik der Bestenauslese zementiere letztlich Strukturen und führe dazu, dass viele begabte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das System enttäuscht verlassen. Statt für intellektuelle Qualität sorge die meritokratische Idealisierung unter der Hand für eine Auslese, die nichts mit Leistungswillen und -fähigkeit zu tun habe, viel hingegen mit habituellen Dispositionen oder finanziellen Voraussetzungen.19
Eine andere typische Blickverengung betrifft unausgesprochen nationale Perspektiven. Leiden die geisteswissenschaftlichen Fächer in Österreich oder der Schweiz unter denselben Krisen wie die in Deutschland? Wie steht es um die Geschichtswissenschaft in Spanien, die Philosophie in Frankreich, die Germanistik in Großbritannien, die Kunstgeschichte in Polen oder die Musikwissenschaft in Italien? Befinden diese sich in vergleichbaren Krisen? Oder in anderen Krisen? Oder in gar keiner Krise? Von außereuropäischen Universitätssystemen ganz zu schweigen. Zweifellos lassen sich in einigen Ländern in den letzten Jahren abrupte Schließungen von Departments, rabiate Kürzungen von Fördermitteln oder eine Zunahme an politischer Reglementierung konstatieren.20 Diese Maßnahmen werden dann von nationalen Krisendiskursen begleitet, 15ohne dass meist klar würde, wo die Ähnlichkeiten und Unterschiede zu den Krisen in angrenzenden Ländern und deren Wissenschaftssystemen liegen. Betrachtet man etwa die Förderpolitik des National Office for Philosophy and Social Sciences (NOPSS), einer Art chinesischem Pendant zur DFG in den Geistes- und Sozialwissenschaften, wird man in den letzten Jahren eine stetige finanzielle Unterstützung der Geisteswissenschaften finden – mit positiven und negativen Ausnahmen wie etwa der »ausländischen Literatur«, die Einbußen zu verzeichnen hat, der »Weltgeschichte«, die offenbar wichtiger genommen wird, oder der »Chinesischen Geschichte«, die geradezu einen Boom erlebt.21 Dass sich dies nicht einfach auf andere Wissenschaftssysteme übertragen lässt, liegt auf der Hand.
Eine weitere Besonderheit liegt darin, dass im chinesischen Wissenschaftssystem weniger das studierte Fach als die Universität, an der man studiert, bestimmte Karrierewege vorgibt. Daher liegt eine Entwicklung wie etwa in den USA eher fern, wo das Renommee der Universität gemeinsam mit der Entscheidung für einen Studiengang wichtig sind. Wenn sich die Studierenden für bestimmte Fächer zunehmend weniger interessieren, provoziert dies partielle Krisen. Es handelt sich um eine dramatische Entwicklung schon deswegen, weil die geisteswissenschaftlichen Disziplinen dort über die Studiengebühren finanziert werden.22 In den USA vermag auch die Förderung von Seiten des Staates oder der Wirtschaft diesen Schwund nicht auszugleichen, weshalb der klassische Philologe Justin Stover in einem vielgelesenen Essay die Situation der angloamerikanischen Geisteswissenschaften in sehr dunklen Farben gemalt hat: »Die Geisteswissenschaften liegen nicht etwa im Sterben. Sie sind so gut wie tot.«23 Malt man die Krise in derart dunklen Tönen, sieht man möglicherweise bald überall nur noch tiefschwarz: Auch Stover schlägt die Geisteswissenschaften als solche über den angloamerikanischen Leisten. Ist aber die Situation im deutschsprachigen Raum tatsächlich ähnlich schlimm? Oder – um in den USA zu bleiben – in »Harvard«, »Stanford« oder »Yale« genauso wie in einer Bildungseinrichtung, in deren Titel »Southern«, »Northern«, »Eastern« oder »Western« vorkommt?24 Drastische Katastrophenbilder, die auf alle Grautöne verzichten und keine geografisch differenzierte Lagebeschreibung anstreben, müssen wohl in einem wissenschaftspolitischen Quietismus münden, der darauf besteht, 16dass sich die Geisteswissenschaften gar nicht mehr um »Rechtfertigungen für [ihr] Tun« bemühen sollten, weil es letztlich ohnehin »keine guten Gründe zur Verteidigung […] gibt«.25
Meist wird auf die gängigen Krisendiagnosen aber auf andere Weise reagiert: Einerseits erfolgt eine nicht minder stereotype Kritik eines überzogenen »Krisengerede[s]«.26 Es wird also auf das »Elend des Krisengeredes«27 hingewiesen und darauf, dass die Rede über die »Dauerkrise« bestimmter Fächer so alt ist wie diese Fächer selbst,28 dass es sich bei dem Lamento mithin um einen etablierten »Topos« handle – wobei der Einwurf, dass die Krise nur ein Topos sei, selbst topischen Charakter gewinnt.29 Andererseits finden sich vielfach Vorschläge, wie man die Geisteswissenschaften aus ihrer Krise endlich befreien könne. Den krisengeschüttelten Disziplinen werden dann nicht selten große Aufgaben aufgetragen: Sie sollen ihre feste Bestimmung endlich in der Bearbeitung einer als krisenhaft verstandenen Moderne finden, für die Kompensation von Modernisierung verantwortlich sein, als Lieferantinnen großer Erzählungen dienen, nachhaltig Aufklärung fördern, lebenslange Orientierung schaffen oder Sinn stiften.30 Angesichts derart vollmundiger Vorschläge kann man schon den Eindruck gewinnen, dass die eigentliche Krise sich daran ablesen lässt, dass mehr versprochen wird, als man einzulösen vermag.31 Die lange Liste der guten Ratschläge reicht jedenfalls von der Parole »Denker in die Produktion« über »Schreiben lernen« oder »Vergesst die Medien« bis »Mehr Bildzeitung für die Geisteswissenschaften« oder »Aufs Ganze gehen!«.32 Selten sind in den recht vorhersehbaren Debattenverläufen allein Beiträge, die eine Krisenhaftigkeit abstreiten und sich zu der These durchringen, es gebe gar keine Krise.33
Entscheidend ist für uns nun aber ein anderer Aspekt: Die meisten Diskussionen der Geisteswissenschaften konvergieren in einer größeren Öffentlichkeit in Krisendiagnosen, doch die beobachteten Krisenphänomene divergieren radikal. Krisenphänomene sind in den Debatten unter anderem: Probleme durch permanentes Größenwachstum (Expansionskrise) oder durch Stellenstreichungen (Marginalisierungskrise); zu viele Studierende (Massenfächer) oder zu wenige (Orchideenfächer); zu wenig Interdisziplinarität (Versäulung) oder zu viel (Verlust von Disziplinarität); Überspezialisierung oder Entspezialisierung; zu viel Fachsprache (Jargon) oder das Fehlen jeglicher Fachterminologie (Unwissenschaftlichkeit); Me17thodenüberfluss oder Methodenmangel; eklatante Theorieschwäche oder unerträgliche Übertheoretisierung; zu wenig Geschichte (ahistorischer Ästhetizismus) oder zu viel (anästhetischer Historismus); mangelndes Interesse an vertieften Einzelanalysen (keine Detailforschung) oder überzogene Versessenheit auf mikrologische Einzelheiten (keine Syntheseleistung). Und nicht nur das: Die in den Geisteswissenschaften verfassten Bücher seien alle zu dick (niemand kann das mehr lesen) oder es gelinge nicht mehr, umfassende und umfangreiche Monografien zu schreiben (alle verzetteln sich in kleine Formen, denen der lange Atem fehlt); es mangele an medialer Resonanz (Kritik des Rückzugs in den akademischen »Elfenbeinturm«) oder es störe die mediale Dauerpräsenz und damit einhergehende ›modische‹ Anpassung an Gegenwartsdebatten (Kritik der Anmaßung von Allzuständigkeit); es fehle eine Politisierung im Hinblick auf Gegenwartsfragen oder es fehle die wissenschaftliche Distanz zum politischen Tagesgeschäft; die Geisteswissenschaften litten am permanenten Schielen nach Drittmitteln oder am disziplinären Desinteresse an Wettbewerb (im Gegensatz z.B. zu den Naturwissenschaften); es wird der endgültige Verlust der sozialen Trägerschicht des Bildungsbürgertums oder das krampfhafte Festhalten an dieser ›überkommenen‹ Trägerschicht beklagt; schließlich wird das Fortbestehen eines Kanons (Kritik der kulturellen Exklusion) oder der endgültige Verlust des Kanons (Kritik des Traditionsverlusts) als Ursache der Krise festgemacht. Die diversen Beobachtungen von Krisenphänomenen münden dann auch in ganz unterschiedlichen Krisenbeschreibungen (Legitimitätskrise, Finanzierungskrise, Leistungskrise, Überlastungskrise, Marketingkrise). Nur darüber, dass eine Krise bestehe und dass diese Krise die Geisteswissenschaften oder zumindest einzelne Fachgruppen oder Fächer als Ganzes betreffe, besteht meist ein Konsens.
Wie der Literaturwissenschaftler Louis Menand hervorgehoben hat, hat sich in den USA mittlerweile ein eigenes Buchgenre etabliert, das die krisenhaften Geisteswissenschaften publizistisch bewirtschaftet.34 Tatsächlich gibt es schon seit langem mehr Krisendiagnosen und wohlmeinende Rettungsappelle, »als irgendjemand verkraften kann«.35 Auch lässt sich mittlerweile eine gewisse Banalisierung der Krisendiagnose beobachten.36 Diese Tendenz mag damit zu tun haben, dass Krisenzuschreibungen in den Geistes- und Sozialwissenschaften eines der erfolgreichsten Modelle sind, 18sich auf Gegenwart zu beziehen. Die konstatierte Krise ist dann legitimer Ausgangspunkt, um über sich nachzudenken und sich in der Gegenwart zu positionieren. Dies gilt nicht selten auch für die kulturellen Bereiche, die die Geisteswissenschaften berühren und betreffen: Dort befinden sich etwa ›die‹ Literatur oder ›die‹ Literaturkritik in der Krise; ›das‹ gute Buch, ›das‹ aufmerksame Lesen oder ›die‹ humanistische Bildung sind wiederkehrend in krisenhaften Konstellationen. Und über ›den‹ Intellektuellen, gleichsam die öffentliche Verkörperung der Geisteswissenschaften, lässt sich im Grunde schon gar nicht mehr anders als im Modus der Krisendiagnose diskutieren. Nicht nur verschiedene Geisteswissenschaften, sondern auch die an sie angrenzenden kulturellen Felder verhalten sich krisenhaft.
Diese Diagnose lässt sich mit unterschiedlichen polemischen Pointen versehen. So hat etwa der kanadische Literaturwissenschaftler Andrew Piper, der für seine Pionierbeiträge zu den Digital Humanities weltweites Renommee genießt, in seinem Debattenbeitrag Can We Be Wrong? auf die selbst gestellte Frage, was denn in seinem Fach nicht stimme, im Gestus der globalen Krisendiagnose geantwortet: eigentlich alles. Er sieht die Literaturwissenschaft nicht nur in einer Replikations- oder Verifikationskrise, sondern auch in einer Generalisierungskrise. Auf Grundlage ziemlich willkürlich ausgewählter Lektüren, so die kritische Beobachtung, würden ohne Unterlass haltlose Verallgemeinerungen vorgenommen.37 Neu ist diese Krisenanalyse Pipers allerdings nur insofern, als sie das gängige und nicht selten auch berechtigte Argument gegen geisteswissenschaftliche Übergeneralisierung selbst in höchstem Maße generalisiert. Das Argument wird von allen konkreten Kontexten, wie sie für die literaturwissenschaftliche Argumentationspraxis charakteristisch sind, abgelöst und auf die Literaturwissenschaft als Ganze verallgemeinert. Es ist nun nicht mehr diese oder jene Behauptung in dieser oder jener germanistischen Studie, die sich einer Übergeneralisierung schuldig macht, es ist die gesamte Literaturwissenschaft, die von einer überall grassierenden Praxis der Übergeneralisierung in eine tiefgreifende Krise gestürzt wird.38
Für uns ist an dieser Stelle entscheidend, dass selbst die Kritik an schlechten Verallgemeinerungen genau dies tut: schlecht verallgemeinern, und dass dies eine wesentliche Bedingung dafür ist, eine große Krise zu behaupten. Bis in die Gegenwart legitimieren sich 19umfassende Versuche der methodologischen »Grundlegung der Geisteswissenschaften« damit, dass sie die geisteswissenschaftlichen Disziplinen der Gegenwart »bis ins Mark gefährdet« sehen.39 Derart globale und grundsätzliche Krisenzuschreibungen werden jedoch, wie wir in unserem Buch zeigen möchten, nicht einmal der tatsächlichen Krisenhaftigkeit der geisteswissenschaftlichen Praxis gerecht, die bestimmte Orte, bestimmte Teile von Fächern, bestimmte Personen, bestimmte Fragestellungen, Theorien oder Themen betreffen. Statt pauschale Krisendiagnosen zu stellen und dann diskursiv zu bewirtschaften, gilt es genau zu beobachten, wo und wie in den Geisteswissenschaften überhaupt Krisen entstehen: Wie werden sie konkret ausgelöst und beobachtet, wie bearbeitet und aufgeklärt? Wann und warum lohnt es sich, sie zu thematisieren oder vielleicht sogar zu dramatisieren?
Die Perspektive, auf die es uns vor allem ankommt, liegt jedoch noch ein wenig anders. Der Hinweis auf die differenzierten Gegebenheiten lässt sich nämlich wiederum leicht in eine Krisendiagnose wenden: Gerade die Geisteswissenschaften leiden dann unter einem Mangel an Einheit und Übersichtlichkeit beziehungsweise unter dem, was wir im Folgenden immer wieder als strukturelle Überforderung thematisieren werden. Die Themenfelder haben sich entgrenzt, die Methoden und Theorien immer weiter ausdifferenziert, die Arbeitsanforderungen im Quadrat von Forschung, Lehre, Verwaltung und Wissenschaftskommunikation vervielfältigt und die Ansprüche, die an die Fächer der Geisteswissenschaften herangetragen werden, multipliziert, nicht zuletzt von Seiten der Studierenden, denen ihrerseits eine immer größere Heterogenität im Blick auf ihre Eingangsvoraussetzungen zum Studium attestiert wird. Es ist kein Zufall, dass in der Hochzeit der Reformdiskussionen in den 1960er Jahren ein gemeinsamer Befund der unterschiedlichen Debattenbeiträge etwa von Helmut Schelsky, Karl Jaspers, Georg Picht oder Ralf Dahrendorf in der Überforderungs- und Überlastungskrise bestand, aus denen allerdings unterschiedliche Forderungen abgeleitet wurden: mehr Stellen, neue Institutionen (etwa Fachhochschulen), Egalisierung von Entscheidungsverfahren, Abschaffung von strukturellen Barrieren (etwa der Disziplinengliederung) und vieles andere mehr.40 Die Widersprüchlichkeit der Krisendiagnosen, die wir oben aufgelistet haben, resultiert auch aus dieser überbordenden Vielzahl an Erwartungen, von denen je 20nach Innen- oder Außensicht der Geisteswissenschaften mal die eine, mal die andere privilegiert wird.
Wir vermuten, dass jede Homogenisierung und jede einheitliche Lösung, die die Krise zu beseitigen verspricht, bei ihrer Durchführung tatsächlich ›die‹ Krise der Geisteswissenschaften einleiten würde. Hier gilt es, zumal im Blick auf die Leistungsperspektive beziehungsweise die Ansprüche, die von außen gestellt werden, an Niklas Luhmanns trockenen Hinweis auf die soziale Realität zu erinnern: »Jedes Handlungssystem ist einer fluktuierenden, rücksichtslosen, in sich nicht abgestimmten, widerspruchsreichen Umwelt ausgesetzt, der es sich nicht voll anpassen kann, weil gute Anpassung in einer Hinsicht schlechte Anpassung in einer anderen Hinsicht bedeutet, weil eine heute akzeptierte Reaktion morgen als verfehlt behandelt wird, weil den einen Partner kränkt, was dem anderen wohltut.«41 Es sind mithin die vielfältigen Karrierewege mit ihren mehr oder weniger großen Sicherheiten und Unsicherheiten, die vielfältigen Methoden und Theorien, die vielfältigen Typen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die vielfältigen Eingangs-, Bleibe- und Abgangsmöglichkeiten und vor allem die vielfältigen und stetigen Veränderungen, die die geisteswissenschaftliche Praxis (die wir nur aus rhetorischer Verlegenheit im Singular anführen) so bewahrenswert machen. Eine wertvolle und so überaus staunenswerte Institution wie die Universität hat aus unserer Perspektive die Aufgabe, die Vielfalt von Möglichkeiten, wissenschaftlich tätig zu sein, stabil zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass in dieser Pluralität insgesamt ›Wissenschaft‹ erkannt wird. Gewiss muss sich bisweilen die Diversitätsrealität der Einheitsfiktion anpassen. Die Gefahr, dass dabei übersteuert wird, scheint uns jedoch größer als im umgekehrten Fall.
Eine derartige Sichtweise führt weg von generellen Polemiken über den Niedergang der Geisteswissenschaften und allgemeinen Programmatiken zu ihrer Rettung und hin zu einer intensiveren Beschäftigung mit den alltäglichen Aktivitäten des geisteswissenschaftlichen Arbeitens. In dieser ›werktäglichen‹ Arbeitspraxis ereignen sich, wenn man so will, die eigentlich interessanten Krisen, die der weit verbreitete Krisendiskurs aber ignoriert. In den Geisteswissenschaften werden ständig erstaunlich vielfältige Leistungen vollbracht, die extrem unterschiedlichen Interessen gerecht werden müssen und daher nie alle Wünsche erfüllen können. Insgesamt 21jedenfalls, um doch selbst einmal zu pauschalisieren, verhält es sich mit den geisteswissenschaftlichen Fächern wie mit Berlin: Wenn es einem dort nicht gefällt, hat man sich einfach im falschen Stadtteil aufgehalten. In den folgenden Kapiteln möchten wir deshalb zeigen, wie vielfältig die Praxis der akademischen Geistesarbeit bereits auf der Ebene ihrer einfachsten Vollzüge ist. Was auch immer man an den Geisteswissenschaften bewahren oder reformieren möchte: Man sollte grundsätzlich mit einem voraussetzungsvollen, ebenso intrikaten wie empfindlichen Gefüge von Praktiken rechnen. Dies gilt nicht zuletzt dann, wenn die gesellschaftlichen Grundlagen dafür erhalten oder überhaupt erst geschaffen werden sollen, die die Teilhabe an dieser aufwendigen Praxis mehr als einer kleinen Schar von Auserwählten ermöglichen.
Praktiken des Geistes
Wirft man nochmals einen Blick auf die aktuelle Debatte über die Krise der Geisteswissenschaften, so ist auffällig, dass viele Lösungsvorschläge, wie die Krise zu überwinden sei, auf »Theorie« abstellen [→Kap. 11]: So möchte Vittorio Hösle in seiner umfangreichen »Grundlegung« den massiven »Bedeutungsverlust« der Geisteswissenschaften mittels einer Theorie des Verstehens bekämpfen und in seinem beeindruckenden Theoriewerk unter anderem zeigen, wie richtiges Verstehen überhaupt möglich sei.42 Aus einer praxeologischen Perspektive ist die grundlegende Frage jedoch eine andere. Eine derartige Einstellung setzt nämlich nicht beim Verstehen, sondern bei ›eingebetteten‹ Verstehenspraktiken an: bei einer bestimmten Person, die als Teil ihres akademischen Alltags zu einer bestimmten Tageszeit an einem bestimmten Ort ein bestimmtes Buch auf eine bestimmte Weise durcharbeitet. Ein praxeologischer Blick fokussiert mithin die konkreten Vollzüge der akademischen Lektüre. Wir wollen Näheres darüber erfahren, wie ein Lesealltag strukturiert ist, welche Buchformate gebraucht, welche Lesehaltungen bevorzugt, welche Lesemöbel benutzt und welche Lesetechniken eingesetzt werden. Und dabei ist es wichtig zu wissen, wie diese auf vielfältige Weise miteinander verknüpften Aktivitäten die lesende Person mit anderen Personen verbinden: wie die Lektürepraktiken also in einen übergreifenden akademischen Sozial22zusammenhang eingebunden sind. Damit wird eine Blickrichtung auf die Geisteswissenschaften gewählt, die konkrete soziokulturelle Bedingungen nachdrücklich betont.
Um es zu pointieren: Während es für das Verstehen im Allgemeinen grundsätzlich keinen Unterschied macht, ob und wie eine Gesellschaft von der Corona-Pandemie betroffen ist, macht das für die ›eingebetteten‹ Verstehenspraktiken möglicherweise einen großen Unterschied. Arbeiten die Leserinnen und Leser zu Hause oder in der Seminarbibliothek? Können sie auf die physischen Bestände einer Privatbibliothek oder der Universitätsbibliotheken zugreifen oder nicht? Nutzen sie überhaupt physische Bücher oder nur digitale Dateien? Wie verknüpfen sich diverse Praktiken der Lektüre – des Unterstreichens und Annotierens, des Exzerpierens und Kommentierens – mit dem Gebrauch dieser unterschiedlichen Formate? Und welche Effekte haben die Arbeitsräume, die Infrastrukturen und die Lektüremedien darauf, wie sich das Verstehen von bestimmten Texten in einer konkreten Konstellation faktisch vollzieht? Wir möchten zeigen, dass eine derartige Perspektive, die sich für den faktischen Vollzug geisteswissenschaftlichen Arbeitens interessiert, bislang vernachlässigt wurde, sich aber als hilfreich erweisen könnte, auch weil sie erlaubt, dem komplexen Verhältnis von Geistesarbeit und Gesellschaft bereits auf der Ebene einzelner Praxiszusammenhänge nachzugehen.
Das Interesse an der tagtäglich vollzogenen Praxis in den Geisteswissenschaften hat sich – mit bedeutenden Vorläufern43 – seit einigen Jahren merklich intensiviert, wie man unserem Literaturverzeichnis ansieht. Im Vergleich mit der Praxeologie der Naturwissenschaften lässt sich jedoch eine bemerkenswerte Verzögerung feststellen, die unterschiedliche Gründe hat. Einerseits ist sie der bereits geschilderten Konstellation geschuldet, dass die Praxis der Geisteswissenschaften sehr häufig als krisenhaft wahrgenommen wurde, mithin als etwas, das es weniger eingehend zu erkunden als resolut zu reformieren gilt. Andererseits hat die Verzögerung damit zu tun, dass sich parallel zur Theoriebegeisterung in den Geisteswissenschaften ein mächtiger Praxisdiskurs etabliert hat, der die »Praxis« der Geisteswissenschaften außerhalb der Universität und der Wissenschaft situiert. »Praxis« ist hier etwas, das in der außerakademischen Welt stattfindet (im »Berufsleben«), etwas, auf das man sich allenfalls durch zusätzliche universitäre »Praxismodule« 23vorbereiten kann (möglicherweise auch nicht). Dass die Geisteswissenschaften selbst eine äußerst anspruchsvolle Praxis sind und über ein eigenes Arbeitsleben verfügen, dass man die Geisteswissenschaften überhaupt nur erfolgreich betreiben kann, wenn man sich selbst in ihre Praxis einübt, gerät dabei vollkommen aus dem Blick. Dies ist für die Selbstaufklärung der Geisteswissenschaften ein wichtiger Aspekt, ermöglicht aber vor allem auch dem Blick von außen ein besseres Verständnis für geisteswissenschaftliches Arbeiten im akademischen Alltag.
Die praxisorientierte Perspektive, für die wir werben, richtet das Augenmerk auf eine Vielzahl von Phänomenen, die in gegenwärtigen Beschreibungen der Geisteswissenschaften häufig eine untergeordnete Rolle spielen. Wofür genau interessiert sich nun aber eine praxeologische Herangehensweise? Eine grundsätzliche Pointe besteht darin, dass die akademische Welt unentwegt und meist beiläufig durch soziale Arbeitsaktivität hergestellt und wiederhergestellt wird [→Kap. 24 u. 25].44 Die Welt der Geisteswissenschaften ist nichts bereits Feststehendes, sondern das Ergebnis immer wieder erneuerter alltäglicher Anstrengungen. Nur durch eine wiederholte Performanz von gebündelten beziehungsweise miteinander verknüpften einzelnen Praktiken entstehen und stabilisieren sich die akademischen Arbeitszusammenhänge, die wir als ›Geisteswissenschaften‹ wahrnehmen. Die Hinsichten, die für eine praxissensible Perspektive auf das akademische Arbeiten eine wichtige Rolle spielen, lassen sich anhand der Lektürepraxis kurz erläutern [→Kap. 20]: Sie interessiert sich nicht nur für die Ergebnisse der Lektüre, sondern zudem für die Vollzugsordnungen des Lesens (Prozesscharakter); sie berücksichtigt die temporale und lokale Einbettung des Lesens (Situativität); sie fokussiert nicht krisenhafte Ausnahmekonstellationen, sondern das tagtägliche Agieren in den Wissenschaften (Alltäglichkeit); sie spricht den Artefakten und technischen Infrastrukturen (Materialität) eine ebenso wichtige Rolle zu wie der Interaktion unter Anwesenden (Körperlichkeit); sie berücksichtigt die Dimension der Könnerschaft als Konglomerat eingekörperter ›handwerklicher‹ Fähigkeiten (implizites Wissen) und interessiert sich schließlich für die durch Teilhabe an Praxisvollzügen ›gelebte‹ Sinnstiftung (Orientierung).
Einige dieser Punkte verdienen, schon hier etwas ausführlicher vorgestellt zu werden.45 Im Folgenden interessieren wir uns für 24praktische Könnerschaft und dafür, wie sie sich ergibt: Wir fokussieren auf den inkorporierten Charakter von mehr oder weniger artikulierbaren Vollzugskompetenzen. Die Könnerschaft, an einem Praxiszusammenhang kompetent partizipieren zu können, setzt nicht nur den Erwerb von explizitem Wissen, die Anwendung von formalisierten Regeln oder die Ausführung von ausdrücklichen Protokollen voraus, sondern auch die Enkulturation in eine Praxis durch Teilhabe – dabei geht es weniger um klar ausformulierbare, institutionell abgesicherte explizite Normen als vielmehr um die ›stille‹ und ›unsichtbare‹, nicht weiter explizierte Orientierung.
Der partizipatorische Charakter von Praktiken ist aus dieser Perspektive kaum zu überschätzen.46 Um kompetent an einer Praxis teilhaben zu können, reicht es nicht aus, dass eine Person ›neutral‹ oder ›distanziert‹ beobachtet, sie muss auch an der Praxis mitwirken, sich persönlich involvieren und sich für den Fortgang der Praxis gleichsam ›mitverantwortlich‹ fühlen [→Kap. 29]. Diese ›Teilhabe‹ an Praxis erfolgt jedoch graduell: Praktiken verfügen nämlich über unterschiedliche Zonen. Teilhabe kann in unterschiedlicher Intensität, unterschiedlichen Formalitätsgraden und verschiedenen Formen partieller beziehungsweise relativer Teilnahmslosigkeit stattfinden. Periphere Formen der Teilhabe haben gerade bei den ersten Schritten einer sukzessiven Integration in Arbeitszusammenhänge eine hohe Relevanz. Am Anfang werden etwa Personen, die zum ersten Mal einer großen Fachtagung beiwohnen, vielleicht eher hinten im Saal sitzen oder an der Seite Platz nehmen, sich unauffällig verhalten und sich nur vorsichtig an den Diskussionen beteiligen [→Kap. 28]. Erst mit zunehmender Könnerschaft bewegen sie sich bei Konferenzen ins Zentrum und intensivieren ihre Teilhabe. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht bereits von Anfang an mit höchstem intellektuellem und affektivem Engagement in die Praxis des Konferierens involviert gewesen wären (vielleicht sogar mehr als diejenigen auf den vorderen Rängen). Zugleich werden sie im Zuge dieser Könner-Karriere auch dazu befugt, sich auf neue Weise kompetent peripher am Geschehen zu beteiligten, unaufmerksam zu sein, ihre Anteilnahme ungleichmäßig zu verteilen – es gibt, for better or worse, auch eine Könnerschaft des Konferenzschlafs.
Ein Konzept, das diese Zusammenhänge gut zu erfassen vermag, ist dasjenige der Praxiskollektive (»communities of practice«) [→Kap. 2].47 Mit diesem Konzept ist vor allem ein Interesse für die 25Erforschung der Integration von »Novizen« in bereits bestehende Konstellationen verbunden. Hervorgehoben wird in der entsprechenden Forschung, dass das Hineinfinden in eine Praxis immer verknüpft ist mit der schrittweisen Integration in einen bestimmten sozialen Zusammenhang (»community«). Bei der Einbettung in ein Praxiskollektiv wird von den Novizen nicht nur ein bestimmtes Wissen, sondern auch ein bestimmtes Wertgefüge inkorporiert. Wichtig ist auch die Einsicht, dass diese schrittweise Integration keineswegs nur vertikal durch die Interaktion mit dem »Meister« erfolgt, wie es traditionelle Perspektiven wollen, sondern in hohem Maße in der horizontalen Interaktion mit anderen, weniger, gleich oder besser informierten Novizen. Und schließlich: Die Interaktion erfolgt zudem nicht nur mit Menschen, sondern auch mit materiellen Objekten.48
Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft demgemäß die Rolle von Räumen, materiellen Objekten und Dingen für das Verständnis von Praktiken [→Kap. 25]. Aus einer praxisorientierten Perspektive ›sedimentieren‹ sich Praktiken nicht nur als Könnerschaft in menschlichen Körpern, sondern auch in Objekten und Dingen als Teil materieller Infrastrukturen. Eine große Konferenz findet nicht in einem abstrakten Raum statt, sondern in einem Saal, der mit Tischen und Stühlen, vielleicht einem Podium und einem Rednerpult sowie einer Projektionsleinwand ausgestattet ist. Die an einer Konferenz Teilnehmenden treten mit diesen Objekten und Infrastrukturen auf vielfältige Weise in Interaktion, weil sie wissen, wie man sich dazu verhält (und wie man von diesen sozialen Vorbelastungen kompetent abweicht). Objektgruppen wie z.B. eine bestimmte Anordnung von Tischen und Stühlen lassen ein breites Spektrum von Aktivitäten zu – doch haben sie im Kontext einer konkreten Praxis einen bestimmten Aufforderungscharakter (unterbreiten bestimmte Affordanzen), erleichtern oder erschweren also bestimmte praktische Vollzüge, lassen bestimmte Artikulationen für die Teilnehmenden plausibler oder unplausibler erscheinen. So ist etwa in einer Konstellation, in der sich ein innerer Kreis von Teilnehmenden um ein größeres Tischrondell gruppiert, zwischen diesem inneren Kreis wenigstens prinzipiell eine permanente wechselseitige Aufmerksamkeit gegeben; die Personen, die im zweiten oder dritten Stuhlkreis sitzen, sind im Vergleich dazu eher peripher und gehören in einem geringeren Maß ›dazu‹. Was aber ist mit der Koryphäe, die 26in der zweiten Reihe Platz nimmt und auf deren Kommentar alle gespannt sind? Materielle Arrangements von Objekten und Dingen wiederholen sich und werden von den Personen, die mit ihnen interagieren, routiniert gehandhabt. Bereits dieses einfache Beispiel zeigt jedoch, welches Spektrum an Möglichkeiten die Routine ausmacht.
Ein letzter herauszuhebender Punkt betrifft ebendiesen Routinecharakter von Praktiken: Praktiken werden durch wiederholtes Einüben angeeignet und zu Gewohnheit. Gewohnheit heißt hier, dass von der Implizitheit des prozeduralen Wissens auszugehen ist, das im Zuge des Einübens erworben wurde. Die Akteure verfügen über viele praktische Fähigkeiten, die ihnen häufig gar nicht erklärlich sind. Blickt man auf die bereits genannten Einführungsprozesse in Praxiskollektive, so ist auffällig, dass formalisiertes Regelwissen und ausdrückliche Anweisungen häufig nicht ausreichen, um eine routinisierte Könnerschaft herbeizuführen, dass es vielmehr der Einübung bedarf. Häufig ist noch die klarste Regel für Novizen nichtssagend, weil unverständlich bleibt, was damit gemeint beziehungsweise wozu es gut ist.49 Erst indem man die Regelanwendung wiederholt in einem sozialen Zusammenhang vollzieht, etabliert sich ein angemessenes, wenn man so will: regelkonformes Agieren.
Die vorgestellten Gesichtspunkte sollen allerdings keine einheitliche Praxistheorie präsentieren. Vielmehr handelt es sich um ein plurales Gefüge von praxisorientierten beziehungsweise praxissensiblen Perspektivierungen, die in vielen Fällen miteinander verknüpft und gemeinsam ›mobilisiert‹ werden können, ohne zu einer übergreifenden Theorie synthetisiert werden zu müssen.50 Methodisch gesehen ist die praxissensible Perspektive, für die wir mit unserem Buch werben möchten, daran interessiert, die prozessuale Dimension des Sozialen – gerade auch in ihrer Dynamik und Vorläufigkeit – in den Blick zu rücken. In der Regel wird eher die soziale Mikroebene in den Blick genommen, auf der sich einzelne Praktiken beobachten lassen, die dann schrittweise mit weiteren Einzelpraktiken verknüpft werden und sich so zu größeren Praxisformationen verbinden: Wir erkunden zunächst jene fieberhafte Unruhe, die das Formulieren geisteswissenschaftlicher Forschungsbeiträge charakteristiert, um den grundlegend sozialen Charakter der »Geistesarbeit« heuristisch zu profilieren (Kap. 1-2). Von dort wechseln wir zu Praktiken der Kollaboration im Sinn des konkreten 27Zusammenarbeitens von Forscherinnen und Forschern (Kap. 3-6). Die Komplexität der Abstimmungen im Gemeinschaftsunternehmen ›Geisteswissenschaft‹ führt zu der Frage, wie sich die Vielfalt und Vielgestalt von Normen bewältigen lässt (Kap. 7-10). ›Theoretisieren‹ erweist sich dabei als eine besonders wichtige und als wertvoll eingeschätzte Praktik, die nicht nur anspruchsvolle normative Moderationen ermöglicht, sondern auch die Mobilität geisteswissenschaftlicher Forschung in unterschiedlichen Hinsichten fördert (Kap. 11-15). So wie das Theoretisieren nur eine Praktik unter anderen ist, gehen praxeologische Ansätze generell von der Annahme einer ›flachen‹ Ontologie aus, in der die Auffassung von Objekten und der Umgang mit ihnen (insbesondere in Praktiken des Lesens und Schreibens) unauflösbar verflochten sind (Kap. 16-20). Wie diese Aktivitäten strukturiert werden sollen, ist eine laufende geisteswissenschaftliche Diskussion, die nicht zuletzt Sinn und Zweck des ominösen ›Lehrstuhls‹ betrifft (Kap. 21-23). Die Frage, welches Licht die Praxeologie auf solche Arbeitsformen und -strukturen wirft, berührt weitere – insbesondere für die akademische Lehre – zentrale Aspekte: die institutionelle, körperliche und räumliche Verortung und Verdauerung der fluiden Praxis (Kap. 24-26) sowie das Verhältnis von Praxis und Präsenz beziehungsweise die Bezüglichkeit von Praktiken untereinander (Kap. 27-30). Abschließend behandeln wir an einem exemplarischen Fall, welche Konsequenzen sich für das Entstehen, die Etablierung und das Ende einer Praxis ergeben, wenn wir sie als einen Zusamenhang sich wechselseitig bestimmender Praktiken beobachten (Kap. 31-33).
Das Spektrum der Praxis
Wir möchten einen praxeologischen Zugriff auf die Geisteswissenschaften auch vorschlagen, um einen empirisch dichteren und gesättigten Eindruck des wissenschaftlichen Alltags zu vermitteln. Generell legen wir großen Wert darauf, dass wir es stets mit einem Spektrum von Möglichkeiten zu tun haben: Die Besonderheiten und Spitzenleistungen der Geisteswissenschaften sind für uns nicht weniger alltäglich als das viel gescholtene Mittelmaß. Ein derartiger Eindruck lässt sich unserer Auffassung nach nur aus dem Archiv heraus entfalten. Die folgenden Kapitel werden sich des28halb quellennah um die Rekonstruktion der alltäglichen Arbeitskonstellationen von zwei Geisteswissenschaftlern bemühen, die auf ganz unterschiedliche Weise für ihr Fach prägend waren und die Möglichkeiten der Praxis für sich genutzt haben: einerseits der international berühmte, bis in die Gegenwart gefeierte Komparatist Peter Szondi; andererseits der national äußerst einflussreiche, heute allenfalls in kleinen Teilen der Literaturwissenschaft bekannte Germanist Friedrich Sengle. Wir greifen damit auf zwei exemplarische Konstellationen zurück, die sich wegen ihrer Gegensätzlichkeit und vor allem wegen ihrer archivarischen Quellenlage besonders gut dazu eignen, die Komplexität und Vielfältigkeit geisteswissenschaftlicher Arbeit ins Bewusstsein zu rufen.
Die intrikate Verknüpfung von ›kleinen‹ Praktiken zu ›größeren‹ Praxisformationen lässt sich nur rekonstruieren, wenn man auf Archive zurückgreifen kann, in denen sich diese Praxiszusammenhänge umfassend überliefert finden. Anhand der umfangreichen, bisher allenfalls punktuell erkundeten Nachlässe von Friedrich Sengle und Peter Szondi erschließt sich eine große Bandbreite geisteswissenschaftlicher Praktiken. Szondi und Sengle sind für uns nicht nur aufgrund der günstigen Überlieferungslage von großem Interesse, sondern auch aufgrund ihrer Profile. Ohne Übertreibung darf man sagen, dass die beiden Literaturwissenschaftler in vielen Bereichen, die uns in diesem Buch interessieren, geradezu exemplarische Gegensätze sind.
Peter Szondi ist zweifellos einer der berühmtesten Komparatisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Geboren wurde er 1929 in Budapest als Sohn einer Sprachlehrerin und eines Psychiaters (Professor der Psychopathologie und Chefarzt des staatlichen Heilpädagogischen Laboratoriums für Psychopathologie und Psychotherapie). Als Juden von der Ermordung durch die Nazis bedroht, floh die Familie in die Schweiz durch den von Reszö Kasztner organisierten Transport, der über das KZ Bergen-Belsen führte.51 Szondis akademische Laufbahn brachte ihn nach Zürich, Paris, Berlin, Heidelberg und Göttingen, später dann auf Professuren in Berlin, Princeton, Jerusalem und Zürich, wobei sein Suizid 1971 den Antritt der Zürcher Stelle verhinderte. Ein kleiner Kreis von engagierten Schülern und Freunden besorgte postum Ausgaben der Schriften, Vorlesungen und Briefe Szondis, der als zentrale Gründungsfigur einer Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft in der 29Bundesrepublik Deutschland gelten darf. Seine Bücher und Aufsätze erfreuen sich bis heute andauernder Aufmerksamkeit in der Literaturwissenschaft und darüber hinaus.52
Zwanzig Jahre vor Szondi wurde Friedrich Sengle geboren. Er kam 1909 in Indien als Sohn eines im schwäbischen Pietismus verankerten evangelischen Missionars zur Welt. Seine akademische Laufbahn, die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg begonnen hatte, führte ihn im Studium nach Tübingen und Berlin, später auf Professuren in Köln, Marburg, Heidelberg und München.53 Er war ab 1937 Mitglied der NSDAP und von 1939 bis 1945 im Kriegsdienst, wobei er während dieser Zeit weiterhin akademisch aktiv war und einen antisemitischen, völkisch-rassistischen Beitrag über Ludwig Börne schrieb, der erst spät einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde.54 Eine Auseinandersetzung mit seinen ideologischen Verwicklungen im Nationalsozialismus oder denen seines akademischen Fachs hat er unterlassen.55 Er wurde in der Bundesrepublik Deutschland zu einem der institutionell besonders einflussreichen Germanisten und versammelte während seiner Laufbahn einen großen Kreis von Schülerinnen und Schüler um sich – auch weil er ein beliebter Universitätslehrer war, der sich für die akademische Förderung jüngerer Personen engagierte.56 Er gab führende Fachzeitschriften und Reihen heraus, saß in wichtigen förderpolitischen Gremien und betrieb selbst erfolgreich drittmittelgeförderte Projektforschung. Seine Bücher und Aufsätze, an denen er bis zu seinem Tod 1994 weiterarbeitete, werden heute nur noch von wenigen Spezialisten in eng begrenzten Teilfeldern der Germanistik gelesen.57
Diese biografischen Abrisse sollen an dieser Stelle genügen, weil es uns nicht darum geht, die beiden Wissenschaftler hier in eine »Parallelbiographie« einzuspannen, wie sie Wolfgang Schivelbusch jüngst für Szondi angeregt hat.58 Es geht vielmehr darum, dass sich die Gegensätzlichkeit der beiden Geisteswissenschaftler auch an der Ausrichtung ihrer Forschungs-, Lehr- und Verwaltungspraktiken nachvollziehen lässt.59 Hier genügt bereits ein Blick auf die beiden Monografien, die in retrospektiven Darstellungen das geisteswissenschaftliche Œuvre der beiden definieren [Abb. 1].
Abb. 1: Sengles und Szondis Hauptwerke.60
Auf der einen Seite stehen die drei dicken, grünen, in Leinen gebundenen Bände der monumentalen formgeschichtlichen und kulturhistorischen Studie über die Biedermeierzeit, die Sengle über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten verfasst hat und für deren Finalisierung er, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung 1980 zu berichten wusste, ganz »aufs Fernsehen verzichtet« hatte.61 Als Sengle den ersten Band seiner Epochenstudie im Programm des germanistischen Fachverlags Metzler herausbrachte, hatte er seinen 60. Geburtstag bereits hinter sich. Auf der anderen Seite steht die nicht minder ambitionierte Gattungsuntersuchung Szondis: Seine Theorie des modernen Dramas war zunächst ein schmaler, mit einer noblen weißen Broschur versehener Band, der bei Suhrkamp, einem erfolgreichen Publikumsverlag, herausgebracht wurde. Szondi war Ende zwanzig, als das Buch herauskam und Furore machte: Es wurde vom Verlag schon bald als gelbes Taschenbuch vertrieben und verkaufte sich bis 1971 über 50000 Mal.62 Wohl keine literatur31wissenschaftliche Doktorarbeit hat seitdem eine derart erstaunliche Resonanz erfahren.63
Während Sengle in seiner langen Laufbahn etablierte germanistische Großgenres wie die Schriftstellerbiografie, die Gattungsgeschichte oder die Epochensynthese praktizierte, bevorzugte Szondi kompakte Genres, die über fachwissenschaftliche Grenzen hinausweisen, etwa Theorie, Traktat, Versuch und Essay. Während Sengle große Textmengen untersuchte (und sich im Zuge dessen auch für statistische Verfahren interessierte) und ein Verfahren der »Reihenbildung« praktizierte, das nach epochalen Parallelerscheinungen fahndete,64 konzentrierten sich die Arbeiten Szondis primär auf das Singuläre einzelner eminenter Werke, weshalb er eine philologische Praxis, die mit Parallelerscheinungen argumentierte, scharf kritisierte. Sengle hingegen wusste nichts mit Ansätzen anzufangen, die die »Fäden, die vom Werk nach allen Richtungen laufen«, rigoros abschneiden.65
In seinen interdisziplinären Suchbewegungen bemühte sich Sengle deshalb um die Kooperation mit der Geschichtswissenschaft. Er zielte in seinen Arbeiten auf die Einbettung der Literatur in außerliterarische, nämlich geistes-, religions-, sprach-, sozial- und kulturhistorische Kontexte und betrieb eine »pluralistische Methodenkombinatorik«.66 Konsequent votierte er daher für die Erweiterung des Literaturbegriffs und diskutierte immer wieder nicht-kanonische Werke und teilweise sogar Gebrauchstexte. In seiner Gegenstandswahl verfuhr er allerdings auch recht wertungsfreudig und äußerte Vorbehalte gegen politisch oder ästhetisch revolutionäre Strömungen. Szondi war eher an einem interdisziplinären Kontakt mit der Philosophie und an der internationalen Theoriediskussion interessiert. Seine skrupulösen werkzentrierten Deutungen literarischer Texte, die mit dem Repertoire der Werkimmanenz, der Kritischen Theorie, später auch des Strukturalismus und frühen Poststrukturalismus arbeiteten, setzten einen engeren Literaturbegriff voraus. Bevorzugte Arbeitsobjekte waren singuläre Kunstwerke. Selbst als er 1967 im Prozess gegen Fritz Teufel und Rainer Langhans, denen vorgeworfen wurde, mit Flugblättern zur Brandstiftung aufgefordert zu haben, ein Gutachten verfasste, vertrat er ein entsprechendes philologisches Ethos. Im Rückblick bemerkte er 1970 dazu:
32Obwohl ich die Flugblätter bei der ersten Lektüre selbst für kriminell hielt und gegen eine Verurteilung etwa wegen ›groben Unfugs‹ nichts einzuwenden gehabt hätte, war ich von der Anklageschrift des Generalstaatsanwalts entsetzt: sie beruhte durchweg auf Fehlinterpretation. Nachdem ich die (wie sich später herausstellen sollte: falsche) Information erhielt, daß als Strafmaß mindestens mehrere Jahre Zuchthaus vorgeschrieben sind, hielt ich es für meine Philologenpflicht, die Interpretationsfehler in einem Gutachten nachzuweisen.67
Es ging Szondi weder um die »Pläne« der Kommune 1 noch um die »Wirkung« der Flugblätter, sondern allein um die Frage, »was in diesen Flugblättern gesagt […] und inwiefern das in der Anklageschrift falsch ausgelegt« wird.68
Sengle war, auch weil er mit großen Textmassen hantierte, eher ein Kollektivarbeiter, der seine größten Publikationsprojekte arbeitsteilig organisierte und viel auf externe Expertise zurückgriff. In diesem Prozess wurden dann auch die Studierenden und Promovierenden, die Mitarbeitenden und Assistenten involviert, die von Sengle wiederum eine intensive Förderung erfuhren. Das Kollektiv, das durch dieses kollaborative Forschen entstand und sich an dem thematischen und methodischen Rahmen von Sengles Forschungsinteressen orientierte, wurde bereits von Zeitgenossen als weitverzweigte »Sengle-Schule« wahrgenommen – wobei sich mache Beobachter sogar dazu verstiegen, zwischen ›Linkssengleanern‹ und ›Rechtssengleanern‹ zu differenzieren.69 Eine große Schülerschaft hat Szondi dagegen nicht hervorbringen können, wohl auch nicht herausbilden wollen: Er scheint eher einen kleinen Kreis von engen Bezugspersonen bevorzugt zu haben. Auch ist er ein Individualarbeiter gewesen, der sich als Einzelforscher mit dem ebenso individuellen literarischen Einzelwerk konfrontierte und dabei auf weitreichendere arbeitsteilige Forschungspraktiken verzichten konnte. Eberhard Lämmert hat im Hinblick auf Szondi von dem »zwingende[n] Alleinsein des Wissenschaftlers mit seiner Arbeit« gesprochen.70 Auch dieses Alleinsein findet aber, wie wir in den folgenden Kapiteln zeigen werden, in Praxisformationen statt, an denen immer mehr als eine Person teilhat [→Kap. 2].
Szondi war ein international sichtbarer Literaturwissenschaftler und kosmopolitischer Intellektueller, der sehr an Kontakten zu öffentlichen Intellektuellen, zu Personen aus den Bereichen Literatur, Theater und Philosophie interessiert war, sich auch als Überset33zer und Büchermacher betätigte und oft für den Rundfunk und Zeitungen arbeitete. Sengle war dagegen eher ein ›deutscher‹ Literaturprofessor und universitärer ›Beamter‹, der sich weitgehend auf die germanistikinterne Kommunikation beschränkte. Er unterhielt geringeren Kontakt zum Literatur- und Kulturbetrieb, auch publizierte er nur sporadisch in außerwissenschaftlichen Medien. Beide bemühten sich um eine gute Wissenschaftsprosa, aber auch hier mit markanten Unterschieden: Sengle legte Wert auf mühelose Lesbarkeit, richtete sich aber ausdrücklich gegen eine stilistisch ambitionierte Wissenschaftsprosa; Szondi praktizierte dagegen eine gewandte Schreibweise, die sicherlich viel dazu beigetragen hat, dass seine Werke noch heute gelesen werden: sie ist als »konzis und klar, schlank und schlackenlos, nie zu viel, eher zu wenig, gedanklich streng, dabei elegant, fast essayistisch« charakterisiert worden.71
Szondi kultivierte im Gegensatz zu vielen Kollegen nicht das »Professorale«,72 behielt aber – ob er nun als »unerbittliche[r] Zuchtmeister« oder als »schwärmerische[r] Jüngling« wahrgenommen wurde – immer etwas Unnahbares.73 Bei Sengle orientierten sich die Arbeitsbeziehungen dagegen am hierarchischen Modell des »liberalen Patriarchen«.74 Als im Kontext der vielgestaltigen Reformbemühungen an der deutschen Universität der späten 1960er Jahre die etablierten Lehrformen und Lehrveranstaltungstypen als unzulänglich bewertet wurden, konnte Sengle dieser Kritik nicht viel abgewinnen.75 Szondis Verhältnis zu den Reformversuchen war ebenfalls distanziert, er erkannte darin jedoch auch einen positiven Sinn. Das neu gegründete Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin konzipierte er als Gegenwelt einer sich zunehmend bürokratisierenden und vermassenden Universität. Im Gegensatz zu Sengle stand er der Abschaffung etablierter Lehrformen wie der Vorlesung und der Entwicklung neuer Lehrtypen wie etwa von Arbeitsgemeinschaften aufgeschlossen gegenüber – auch weil er im Umgang kolloquial und paritätisch sein wollte und die Lehre eher als Anleitung zum Selberlernen verstand.
Es handelt sich also bei Sengle und Szondi um Geisteswissenschaftler, die sehr verschiedene Lebensschicksale hatten. Nicht minder auffällig ist, wie stark die alltäglichen Praktiken, Geistesarbeit zu betreiben, bei beiden divergieren. Die diametrale Opposition 34kam in dem Moment zum Ausdruck, als die Frankfurter Universität in einem Berufungsverfahren den Münchner Ordinarius Sengle darum bat, die Leistungen des Bewerbers Szondi zu begutachten, und dieser mit Datum vom 13. Oktober 1964 seine despektierliche Einschätzung vorlegte:
Peter Szondi ist […] [w]egen seiner publizistischen Erfolge (Theorie des modernen Dramas, 3. Aufl., Übersetzung ins Italienische) und seiner verfrühten Habilitation in Berlin […] so etwas wie ein verwöhntes Starlet am junggermanistischen Himmel geworden. Der Literaturwissenschaft, so werden wir belehrt, ist ›das Moment des Fragens, mithin der Erkenntnis … abhanden gekommen‹ … Und wie kommen wir zur Erkenntnis? ›Es darf nicht übersehen werden, daß jedem Kunstwerk ein monarchischer Zug eigen ist, daß es nach der Bemerkung Valérys – allein durch sein Dasein alle anderen Kunstwerke zunichte machen möchte … ein Kunstwerk behauptet, daß es unvergleichbar ist … wohl aber verlangt es, daß es nicht verglichen werde. Dieses Verlangen gehört als Absolutheitsanspruch zum Charakter jedes Kunstwerks … und die Literaturwissenschaft darf sich darüber nicht einfach hinwegsetzen, wenn ihr Vorgehen ihrem Gegenstand angemessen, d.h. wissenschaftlich sein soll.‹ (Zur Erkenntnisproblematik in der Literaturwissenschaft, Neue Rundschau 1962 S.149f., 156f.). Entsprechend diesem Programm gebärdet sich Peter Szondi in der Tat höchst monarchisch und absolutistisch. Er hat damit erreicht, daß er aufgefallen ist. Die Alten fühlen sich an alte Zeiten erinnert; mit Grauen, denn sie haben erfahren, daß sich in der Wissenschaft Theorie und Toleranz nicht voneinander trennen lassen. Die Jungen bemerken entsetzt, ›daß man sich in Berlin mit einer Seminararbeit habilitieren kann‹ (Versuch über das Tragische, Insel Verlag, Frankfurt 1961) und sie selbst es so viel schwerer haben. Übrigens hat es wegen dieser Habilitation auch in Berlin selbst Auseinandersetzungen gegeben; sie wurde von manchen Kollegen als germanistisches Verfallssymptom bewertet. Ich selbst dramatisiere den Fall nicht in dieser Weise und meine, daß aus dem vermutlich begabten Kollegen noch etwas werden kann, wenn er seine wissenschaftliche und menschliche Position überprüft. Vorläufig halte ich ihn, auch als Lehrer, noch nicht für lehrstuhlreif.76
Das Frankfurter Berufungsverfahren ist bereits vor einigen Jahren Gegenstand einer Feuilleton-Kontroverse gewesen.77 An den obigen Bemerkungen wäre vieles eingehender zu kommentieren: Die Vorstellung, dass »publizistische[] Erfolge« und die Tatsache, »aufgefallen« zu sein, etwas Anstößiges haben; die Überzeugung, dass es einen ›richtigen‹ Zeitpunkt für das Habilitieren gibt; die Auffas35sung, dass es für einen ›Junggermanisten‹ ungehörig sei, bereits ein »Programm« zu haben; die vollkommen ungedeckte Insinuation, Szondis programmatischer Theorieanspruch habe etwas Antidemokratisches und Intolerantes; die Mitteilung von Gerüchten bezüglich des Berliner Habilitationsverfahrens [→Kap. 1, 9 u. 10] und schließlich die merkliche Ausweitung der Kritik über die fachliche Dimension hinaus auf eine »menschliche«.
Im Rahmen unserer praxeologischen Perspektive kommt noch ein weiterer Punkt hinzu: Wie hat Sengle den massiven Gutachtenaufwand überhaupt bewältigt? Sengle konnte die fast unüberschaubare Anzahl von Publikationen der Bewerber nicht alle Zeile für Zeile lesen, sondern beauftragte Mitarbeitende des eigenen Lehrstuhls, von allen Bewerbern, die in dem Frankfurter Verfahren zu begutachten waren, umfassendere Bibliografien zu erstellen und die zentralen Werke zusammenzufassen. Alle Szondi-Passagen, die er in dem obigen Gutachten zitiert, sind der maschinenschriftlichen Zusammenfassung seiner Mitarbeiterin Marie-Luise Gansberg entnommen.78 [Abb. 279]
Zudem hat sich Sengle das Urteil Gansbergs über die »sogn. Hab.-Schrift« Szondis, die »[e]igentlich bloße Vorarbeiten und Notizen zu einer Unters.[uchung]« enthalte,80 in seinem Gutachten zu eigen gemacht. Aus praxeologischer Perspektive verweist die von ihm vorgenommene Delegation von Lektüre auf eine Vielzahl bis heute relevanter Fragen: Wie werden Begutachtungspraktiken in den Geisteswissenschaften koordiniert? Wie werden gutachterliche Lektüren in diesem Zusammenhang organisiert? Und welche Kriterien sind bei derartigen Evaluationsarbeiten leitend? Welche Praktiken aus einem Praxisgefüge darf man überhaupt an andere Personen delegieren? Derartigen Fragen möchten wir in unserem Buch anhand der Archive von Sengle und Szondi nachgehen.
Ein letzter Aspekt, in dem sich Sengle und Szondi auf charakteristische Weise voneinander unterscheiden, betrifft einen wichtigen Punkt: das Verhältnis zu »Theorie« als einem privilegierten Bearbeitungsmodus aller Probleme der »Praxis« [→Kap. 12-15]. Nicht zufällig ist einer der wenigen publizistischen Orte, an denen Friedrich Sengle und Peter Szondi gemeinsam ›erschienen‹ sind, ein 1973 veröffentlichter Band, der sich der »methodologischen Gärung« in der Germanistik widmet.81 Während darin von Szondi der Aufsatz über die Hölderlin-Philologie und das Problem der Parallelstellenme37