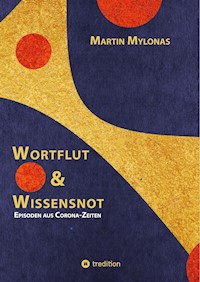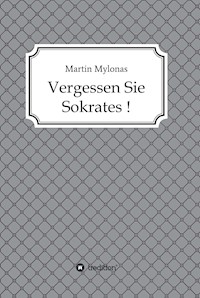6,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Mathematiker Lukas Schönborn ist alarmiert: Sein Cousin Achim Roth, zu dem er zwei Jahrzehnte zuvor jeden Kontakt abgebrochen hatte, hat sich zurückgemeldet. Beide hatten einst ein beträchtliches Erbe angetreten, das der geschäftstüchtige Achim an der Börse vermehren wollte. Der risikoscheue Lukas ließ ihn gewähren, solange das Erfolg versprach, geriet aber in Panik, als es Rückschläge gab. Doch es gab noch mehr, was sie zu Rivalen werden ließ: Achim spannte Lukas dessen Verlobte aus, und Lukas ließ sich mit einer Ex-Geliebten von Achim ein. Es waren das Geld und ihre Beziehung zu den Frauen, welche eine Verständigung immer mehr erschwerten. Als Achim sich dann dramatisch verspekulierte, reagierte Lukas unüberlegt; die öffentliche Reaktion darauf beschleunigte den finanziellen Zusammenbruch des Cousins. Lukas, der dabei ebenfalls viel verlor, kündigte Achim erzürnt die Freundschaft auf, dieser drohte, er werde Lukas eines Tages die Rechnung präsentieren. Ist es nun soweit? Zurückgemeldet hat sich Achim über eine Tochter, von deren Existenz Lukas bisher nichts wusste. Der Cousin, erfährt er, liege ernsthaft erkrankt in einem italienischen Sanatorium. Betroffen erst, dann aber seltsam fasziniert erfährt Lukas, dass es sich bei der jungen Frau um die uneheliche Tochter Achims und seiner einstigen Verlobten handelt. Da ist es für sie ein Leichtes, den Junggesellen mit ihrem Charme zu betören; genau dies war das Kalkül ihres Vaters. So verspricht Lukas am Krankenbett des Cousins, diesem zu besorgen, was er dringend benötigt: Kapital und Sicherheiten für eine neue Spekulation auf Kredit. Es soll Achims ganz großer Wurf und ein endgültiger Befreiungsschlag werden. In seiner Fixierung auf die junge Frau, die seine Tochter sein könnte, blendet Lukas alles Störende aus: Misstrauen und alte Abneigung auf seiner nicht anders als auf Achims Seite. Erst in einigem Abstand findet er zu nüchterner Überlegung zurück: Da bestimmen die Erinnerung an große Verluste und erlittene Schmach bereits das Handeln von Achim und dessen Tochter. Vergessen ist nun auch für Lukas das vorübergehende, scheinbar gemeinsame Interesse. An dessen Stelle treten überstürztes Handeln auf der einen, Verweigerung auf der anderen Seite und schließlich trotziger Alleingang. Alle drei verfolgen ihre eigenen Ziele und steuern damit unweigerlich auf eine Katastrophe zu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
www.tredition.de
Martin Mylonas
Geld und die Triebe
Roman
www.tredition.de
© 2012 Martin Mylonas
Umschlaggestaltung, Illustration: Martin Mylonas
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8491-1701-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1
Heftige Windstöße, Vorboten eines Gewitters, das sich unter noch fernem Grollen und schneller Eintrübung ankündigte, fegten eine Wolke von Dreck die Steingasse hinunter. Vor ihr her lief ein Mann, der kurz vor der Alten Brücke auf einen Hauseingang zu rannte und kräftig den Klingelknopf drückte, als wolle er sich umgehend in Sicherheit bringen. Schnell drückte er, nachdem man ihn eingelassen hatte, die Türe ins Schloss, erklomm schnaufend die steile Holzstiege zum ersten Stock und wurde oben von einer Dame empfangen, deren wie immer sorgfältiges Make-up am frühen Nachmittag vergessen ließ, dass Madame das siebte Lebensjahrzehnt deutlich überschritten hatte.
„Yvonne, stellen Sie sich vor, er kommt …“, keuchte der Mann und wurde von ihr unterbrochen.
„Mein lieber Luc, man könnte glatt meinen, der Weltuntergang persönlich sei Ihnen auf den Fersen. Nun kommen Sie erst einmal herein! So aufgeregt kenne ich Sie gar nicht! Wenn die Umstände nicht so ernst wären, würde ich sagen: eine freudige Überraschung! Lange haben wir Sie nicht mehr bei uns begrüßen dürfen. Ich wünschte, ich könnte Sie hier zusammen mit meinem Phil empfangen.“ Die Dame seufzte.
Lukas Schönborn setzte von neuem an: „Stellen Sie sich vor, er kommt nicht selbst, nein …“. Er schnaufte noch immer heftig.
„Von wem sprechen Sie jetzt eigentlich, Luc?“
„Von wem denn? Von Achim natürlich!“
„Ach so, Achim! Sie wissen Genaueres? Wenn ich mich nicht irre, hatten auch Sie keinen Kontakt mehr zu ihm. Doch nun offenbar…? Was hat er in der Zwischenzeit angestellt? Jetzt aber raus mit der Sprache!“
„Das ist es ja, worauf ich hinauswill“, er korrigierte sich, „verzeihen Sie, Yvonne, weshalb ich auch komme; selbstverständlich wollte ich Sie besuchen und mich nach Phil erkundigen. Doch dann kam das mit Achim dazwischen. Stellen Sie sich vor: Er soll vor einem Monat einen schweren Herzinfarkt erlitten haben. Wurde noch nicht operiert, das stehe wohl noch aus, und jetzt liege er vorläufig in einem italienischen Sanatorium. Er werde so bald nicht reisen können.“
„Und woher wissen Sie das alles und weshalb sind Sie so sicher, dass er überhaupt kommen wollte?“
Lukas sah noch eine Spur ernster drein, fast schon besorgt, zog ein akkurat gefaltetes Blatt aus der Innentasche seines Jacketts und hielt es ihr demonstrativ entgegen. Es entpuppte sich schon bei flüchtigem Hinsehen als Fax.
Madame Lagrande, wie Yvonne offiziell hieß, lief geschwind zu einem kleinen Sideboard, wo sie ihre Lesebrille abgelegt hatte, kehrte ebenso flink zurück und griff nach dem Schreiben.
„Sieh an, unser Achim!“, kommentierte sie und sah fragend zu Lukas auf, ohne das Blatt abzulegen, „Wussten Sie denn von Rom? Und dann, dass er eine Tochter hat? Obwohl, er …“
„Nein, ich hatte keine Ahnung, und das hat mich bis dato auch nicht interessiert!“
„Wie konnte es auch, wenn Sie von ihr nicht wussten“, erwiderte Yvonne und bemühte sich keineswegs, ein spöttelndes Lächeln zu unterdrücken.
Lukas Schönborn war irritiert und versuchte, das Thema zu wechseln: „Verzeihen Sie Yvonne, was ich vor lauter Achim beinahe vergessen hätte: Wie geht es denn Ihrem Phil?“
Phil Krause, das war Yvonnes Lebensgefährte, der lange Jahre eine Bar betrieb, in der sich traf, wer in dem Universitäts- und amerikanischen Garnisonsstädtchen am Neckar zur besseren Gesellschaft gehörte oder gehören wollte. Krause besaß darüber hinaus ein gut besuchtes Speiselokal und eine Reihe von Altbauten im hochwassergefährdeten Bereich der Altstadt, die er, weil das die jährliche Renovierung ersparte, ausschließlich an Studenten vermietete. Eine solche Unterkunft und selbstverständlich Achim waren es, denen Lukas Schönborn seine jahrzehntelange Bekanntschaft mit Krause und Yvonne, der Lebensgefährtin und inoffiziellen Herrscherin über dies ansehnliche Imperium, verdankte.
„Mein Phil“, erläuterte Yvonne, wobei sie geschwind einen Stapel Zeitschriften auf dem Couchtisch beiseiteschob, um Platz für Getränke zu schaffen, „ist inzwischen Dauerpatient in seinem Sanatorium. Und dennoch wird sein Herzasthma immer bedrohlicher, so dass man nicht weiß, ob … Deshalb sähe er es gern, wenn Achim und Sie nochmal bei ihm vorbeischauten. Und das trotz der alten Geschichten und obwohl Achim so lange nichts von sich hat hören lassen. Wir dachten, es wäre an der Zeit, den Graben rechtzeitig zuzuschütten, ehe … Phil hat nicht mehr viele Kontakte, hat die meisten seiner Bekannten überlebt, auch deshalb hatte er den Wunsch, die wenigen verbliebenen nochmals zu sehen. Nur: Bei Achim wussten wir nicht einmal, wohin wir uns wenden sollten. Wir hatten da noch eine alte Adresse in Frankfurt, er selbst war dort nicht mehr zu erreichen, aber jetzt … ebenfalls Sanatorium, seltsam die Duplizität!“ Sie deutete auf das Fax und unterdrückte einen Anflug von Weinen in ihrer Stimme. „Glauben Sie mir, Ich besuche meinen Phil jeden zweiten Tag, könnte dort sogar wohnen, wenn ich das wollte. Doch die Atmosphäre! Sie werden es nicht glauben, Luc: Da kommen Sie sich vor wie noch nicht tot und doch nicht mehr lebendig. Ja, und dann: Irgendwer muss sich schließlich hier um die Geschäfte kümmern.“
„Geschäfte?“, bemühte sich Lukas Schönborn erneut, das Thema zu wechseln. „Ich dachte, Phil hätte sich längst aus allen zurückgezogen.“
„Wo denken Sie hin, Luc. Klar, hat er, was die Lokale betrifft, war ja nicht anders möglich. Aber die Häuser, die gibt es nach wie vor. Und dann die Bank, das Finanzamt, das alles läuft weiter, solange einer lebt und oft auch darüber hinaus. Darum muss ich mich kümmern. Schon damit die uns nicht ganz ausplündern! Aber spannen Sie mich nicht länger auf die Folter, Luc: Was hat es mit dieser Tochter auf sich? Wissen Sie mehr? Wir kennen unseren Achim: vermutlich unehelich … Und ich darf doch?“ Schon brachte sie, noch immer die routinierte Barfrau, auf einem Tablett den Whiskey, zwei Gläser, und Soda herbei.
Lukas wehrte ab: „Wenig, bitte, und vor allem Wasser. An einem so schwülen Tag wie heute …“
In dieser Hinsicht stieß er auf taube Ohren: „Ach, kommen Sie schon, Luc, lassen Sie mich nicht im Stich!“ Sie hob die halbleere Flasche demonstrativ in die Höhe. „So hab‘ ich wenigstens ein Alibi. Auf Dauer nimmt mir das mit dem Angels‘ share keiner ab!“
Diesmal leistete sich Lukas ein Lächeln, das den Eingeweihten verriet, wurde aber sofort wieder sachlich: „Also, weshalb ich komme, wollten Sie wissen. Wie ich schon sagte: um Sie wieder einmal zu besuchen, Yvonne. Und selbstverständlich wegen Phil. Aber es gibt da auch ein Problem …“
„Problem, sagen Sie?“
Lukas war für einen Moment verlegen, fing sich aber schnell: „Ich meine, wie soll ich mich ihr gegenüber verhalten, und dann erst, wie soll ich mit diesem verlorenen Sohn umgehen, wenn er eines Tages tatsächlich …ich meine, nach allem, was war, und nach so langer Zeit? Sie wissen ja selbst …“
„Sie sprechen in Rätseln, Luc. Verlorener Sohn? Worauf wollen Sie hinaus?“
„Hm, Sie kennen vielleicht das biblische Gleichnis.“
Yvonne tat so, als erinnere sie sich.
Lukas erläuterte davon unbeeindruckt: „Da hat einer sein ganzes Hab und Gut durchgebracht, hat unter aller Würde in der Fremde gelebt. Und dann kommt er in aussichtsloser Lage zurück. Der Vater nimmt ihn gnädig auf und weist den älteren Bruder zurecht, weil der empört darüber ist, dass der Vater zur Rückkehr des jüngeren, heruntergekommenen Sohnes ein Fest…“
„Langsam, Luc, damit ich folgen kann. Wer verzeiht hier wem?“
„Auf Einzelheiten kommt es nicht an, eher auf die Moral, die man uns im Konfirmandenunterricht einkerben wollte: Der Gewissenhafte, forderte damals der Pastor, möge doch bitte über die Irrwege und Zumutungen eines leichtfertigen Draufgängers hinwegsehen und sich über dessen Umkehr freuen!“
„Na also, da haben Sie die Antwort auf Ihre Frage.“
„Frage?“
„Na, Sie wollten doch wissen, wie Sie sich verhalten …“
„Ja, klar. Aber genau das hat mich schon damals nicht überzeugt“, widersprach Lukas. „Leichtfertiges Geschwätz, ist mir im Konfirmandenunterricht herausgerutscht. Mein Vater musste deshalb beim Pastor vorsprechen …“
„Verstehe: Und der Gewissenhafte und Ältere sind in diesem Fall Sie, der Leichtfertige unser …“
„Nun sagen Sie nur, Yvonne“, begehrte Lukas auf, „Sie sehen das anders! Klar, der gute Achim besaß ein besonderes Geschick, wenn es darum ging, seine Fehler vergessen zu machen: Hatte er jemanden verletzt, hatte er sich irgendwie verrannt, dann tat er, als sei das nicht der Rede wert. Souveräne Geste, als räume er alles Trennende aus dem Weg, und im nächsten Augenblick forderte er beinahe schon Anerkennung ein für das, was er als großzügiges Nachgeben verstand. Bei einer Gelegenheit hat er mich geradezu aufgefordert: Mach‘s wie ich, Lukas. Man muss vergessen können, nur so wird der Kopf frei für Neues! Klar, aus seiner Sicht war so ein Rezept leicht ausgestellt, aber eingelöst …“
Madame Lagrande machte eine Bewegung, die auf Ungeduld schließen ließ: „Alles schön und gut, Luc. Aber hier steht etwas von einem lebensbedrohlichen Herzinfarkt, Spezialklinik und so. Da werden Sie tatsächlich über manches hinwegsehen müssen. Man könnte geradezu erwarten, dass Sie nach ihm sehen. Und das trotz allem, was zwischen Ihnen war. Übrigens, ich hätte nie vermutet, dass er jetzt in Italien lebt. Auch wir haben seit damals keine Verbindung mehr gehabt.“
„Hm. Aber nach ihm sehen? Wozu das? Ich bin Mathematiker, kein Arzt. Wie sollte ich ihm helfen können?“
„Klar, Luc, Sie sind kein Arzt, aber Sie sind doch Mensch!“
„Eben, Sie sagen es: Ich bin auch nur ein Mensch. Und deshalb ist es in seinem Zustand wohl das Beste: Ich lasse ihm einfach seine Ruhe. Kommt auch meinen Bedürfnissen nicht wenig entgegen! Hat mir eh manch schlaflose Nacht gekostet in den letzten Tagen!“
„Sie haben, wie soll ich sagen, Lukas, so etwas Unbedingtes. Darin gleichen sie fast schon wieder unserem Achim, wenn auch mit anderen Vorzeichen. Dessen Gedanken kreisten auch immer nur um sich und seine Interessen.“
„Na, ich halte mal dagegen: Ich bin immerhin bereit, mich um diese Tochter zu kümmern, sobald sie da ist. Aber deshalb wollte ich Sie eigentlich fragen, Yvonne, ob Sie vielleicht Genaueres … sie stellt sich als Verwandte vor, will mich kennenlernen, baut auf meine Hilfe …Was soll ich davon halten?“
„Was immer Sie wollen! Ich kann Ihnen da nicht helfen, kenne dies Mädchen nicht, bin ihr nie begegnet. Aber wenn sie Achims Tochter ist …“ Sie nahm nochmals das Blatt zur Hand: „Lena? Hm, dann werde ich also in Kürze von Ihnen mehr über diese Lena erfahren.“
„Von mir? Wieso von mir?“
„Luc, dafür hat unsereins ein Gespür: Diese Tochter lässt Ihnen keine Ruhe. Stimmt’s? Sie wüssten nur zu gerne, was für eine Frau Achims Tochter ist.“
„Hm, da mögen Sie recht haben, aber sie schreibt auch“, er deutete auf das Fax, „sie komme nach Deutschland, weil sie sich um die finanziellen Angelegenheiten ihres Vaters kümmern müsse. Finanzielle Angelegenheiten! Läuten da bei Ihnen nicht die Alarmglocken? Es geht wohl nicht um ein Sparschwein. Scheint wieder auf die Beine gekommen zu sein, unser Achim, finanziell, meine ich! Das würde mich schon interessieren! Andererseits: Man weiß bei ihm nicht so recht, Achim ist ein Spieler. Wiegt sich einer in Sicherheit, dann macht er den im Handumdrehen zum Mitspieler … und gleich darauf zum Opfer! Vielleicht hätte ich damals auf meinen Vater hören sollen: Der nannte Achim und seine Mutter einmal Brutschmarotzer!“
„Und was soll das heißen?“
„Na, ich dachte, Sie könnten damit etwas anfangen!“
Madame Lagrande schüttelte sanft tadelnd den Kopf und fuhr beinahe mütterlich fort: „Seien Sie doch nicht so hart, Luc. Klar, vermutlich wusste diese Frau Roth, weshalb sie ihren Sohn bei meinem Phil quasi in ein gemachtes Nest setzte. Aber ich bitte Sie: Phil hat keine Kinder, Achim der einzige Neffe … Hätten Sie an ihrer Stelle anders gehandelt?
Also, mein lieber Luc, lassen wir erst einmal die alten Geschichten! Was spricht dagegen, dass sie sich mit dieser Lena treffen, sobald sie nach Deutschland kommt? Hören Sie sich an, was diese Frau, junge Frau, nehme ich an, von uns, vor allem von Ihnen will. Sie sind schließlich um einige Ecken herum mit ihr verwandt! Und was den Vater betrifft: Der ist vorläufig weit weg. Reiseunfähig und in einem römischen Sanatorium, wie ich hier lese“, sie deutete auf das Fax. „Gut, Sie haben nicht anders als Phil und ich bittere Erfahrungen mit ihm gemacht. Er schreckte seinerzeit vor nichts zurück. Aber: Man kann aus so etwas lernen und vielleicht hat selbst Achim dazugelernt! Vermutlich hätten Sie, hätten wir alle damals skeptischer sein müssen. Ging halt ums Geld, um viel Geld! Da tritt bei den Menschen der Verstand auf der Stelle, oft sogar ganz ab. Das Geld ist verloren, aber wir sind hoffentlich klüger. Deshalb sehe ich keine Gefahr für Sie, wenn Sie sich mit seiner Tochter treffen. Sie müssen sich doch nicht gleich um den Finger wickeln lassen oder erneut auf irgendwelche Anlagetricks ihres Vaters hereinfallen. Wie lange kennen sie Achim schon?“
„Hm, Jahrzehnte!“
„Na ja, wenn wir die beiden letzten abziehen, bleiben immer noch drei, schätze ich mal. So viel Erfahrung sollte nach allem, was war, reichen, um nicht nochmals auf ihn reinzufallen. Deshalb, lassen Sie das mit dieser Lena auf sich zukommen und machen ihr notfalls klar, dass alles, was mit der Kombination Achim und Geld auch nur entfernt zu tun hat, für uns inzwischen tabu ist. Oder? Und hinterher schauen Sie bei mir vorbei und erzählen mir, was es mit dieser Tochter auf sich hat. Neugier gibt es ja nicht nur bei Euch Männern.“ Sie zwinkerte ihm zu.
Lukas nickte erst nachdenklich, dann aber tapfer und zustimmend, als übernehme er gegen allerlei Widerstände ihren Vorschlag, obwohl der trotz mancher Bedenken dem entsprach, worin er insgeheim bestätigt werden wollte. Yvonne Lagrande, welche das durchschaute, lächelte zufrieden und lobte ihren Besucher für sein vernünftiges Einlenken: „Aber versprochen: wenn Sie dann kommt, oder besser, da ist, halten Sie mich auf dem Laufenden. Das geht schließlich auch mich etwas an! Und mein Phil …?“
„Aufgeschoben, Yvonne, aber nur wegen dringender Geschäfte. Sie wissen ja jetzt, weshalb … Aber keinesfalls aufgehoben! Sobald ich kann, lasse ich von mir hören.“
2
Phil besuchen, bevor es zu spät ist! In der Tat war Lukas dazu verpflichtet und er war sich dessen bewusst. Denn er hatte Phil und dessen Lebensgefährtin Yvonne nicht wenig zu verdanken. Freilich galt das auch umgekehrt! Doch was den Besuch bei Phil betraf, war jetzt der ungünstigste Zeitpunkt, den man sich denken konnte. Lukas war zu sehr mit anderem beschäftigt, und das ließ sich nicht einfach beiseiteschieben. Dunkle Wolken, ausgehend von Achim und dessen Tochter, hatten seine bislang wenig getrübten Tage in ein unfreundliches Licht getaucht. Damit musste er erst einmal zurechtkommen.
„Vielleicht hätten wir damals skeptischer sein müssen!“ Soweit Yvonne Lagrande. Leichter gesagt als getan: Wer fiel damals nicht alles auf Achims übersprudelnden Optimismus herein. Das ging nicht nur vielen Freunden und Bekannten, das ging selbst Achims Familie so. Wie konnte man da von ihm, dem Cousin, ganz anderes erwarten!
Insgeheim hatte Lukas erwartet, dass Yvonne ihm deutlicher den Rücken stärkte gegenüber dem von Achim ausgelegten Köder – als solchen verstand er die Botschaft, die Achims Tochter geschickt hatte. Da Yvonne das nicht tat, zumindest nicht in dem Maße, wie er das erwartet hatte, drehten sich seine Gedanken immer wieder um das, was er als Vorwurf verstand: In diese Freundschaft, rechtfertigte er sich, die irgendwann in Rivalität, zuletzt gar in offene Feindschaft umgeschlagen war, war er schließlich ohne eigenes Zutun hineingeraten. Wie man als Kind in ein Gewand gesteckt wird, aus dem man dann im Laufe der Jahre herauswächst. Die zugehörige Ablösung war ihm, was Achim betraf, leider nicht gelungen. Lange, zu lange hatte er, Lukas, immer nur nachgegeben, sich angepasst. Ja, darin hatte Yvonne vielleicht recht: Er hätte den Schlussstrich früher ziehen sollen.
Ein ungestörtes Verhältnis zu dieser Vergangenheit hatte Lukas nur da, wo es um die am weitesten zurückliegende Zeit ging: Vor etlichen Jahrzehnten waren Achim und er tatsächlich nur Cousins, Freunde und Schulkameraden. Das ergab sich, von der Verwandtschaft abgesehen, schon aus der räumlichen Nähe, wie sie in einem kleinen Weinort von wenigen hundert Seelen unvermeidlich ist. Denn dort, weit unten im Südwesten Deutschlands, erblickten sie ein mildes und freundliches Licht der Welt. Lukas‘ Vater, nach dem letzten Weltkrieg aus Thüringen zugewandert, befand zwar nüchtern: Wir leben hier inmitten von grob geschnitztem und unbesorgt hingeworfenem Wort! Von einer herzlich und heiter gestimmten Umgebung sprach hingegen Achims Mutter wie alle Einheimischen. Sie kamen der Wahrheit näher. Denn es gab so viel Verbindendes in dem überschaubaren Nest, in dem die Cousins fast in Rufweite aufwuchsen. Da war einmal der Wechsel von guten und schlechten Weinjahren. Die setzten im Bewusstsein der Erwachsenen die Wegmarken im eigenen Leben nicht anders als zuvor schon in dem ihrer Vorfahren. Das damit verbundene Schwanken zwischen Zuversicht und gelegentlichem Verdruss blieb selbst den Jungen nicht verborgen, wenn es um die Höhe des Taschengeldes ging. Nicht weniger prägte sich den Heranwachsenden der immer gleiche, unverwechselbare Takt im Ablauf der Jahre ein: Der Kreislauf von Rebschnitt im Januar, dann die vielen kleinen, aber unverzichtbaren Arbeiten in Weinberg und Keller bis zum Spätsommer, schließlich der Höhepunkt, die Weinlese im Herbst mit dem süßlichen Maischeduft und den kräftigen Gärgasen danach. Die entströmten den Kellern, Einfahrten und Gassen und kündeten den heraufziehenden Winter an. Auch später, als er schon lange drüben in Heidelberg lebte, waren Spätjahr und Vorweihnachtszeit für Lukas noch immer mit diesen Gerüchen verbunden.
Anderes beschäftigte damals Achim. „Wo bleibt der Höhepunkt am Ende des Sommers?“, hätte der bei solchem Rückblick gefragt. Wurden da nicht reihum von Ort zu Ort ausgelassen Feste gefeiert? „Angeblich“, so Lukas‘ Vater, „um in Fässern und Kellern Platz für die neue Ernte zu machen!“ Achim arbeitete, sobald er die Konfirmation hinter sich hatte, wie alle anderen eifrig bei der Vorbereitung dieser Feste mit und verdiente sich ein zusätzliches Kirmesgeld. Regelmäßig war er dann dabei, wenn es ausgelassen zuging, alles andere als leise, wenn der Dunst von großzügig ausgeschenktem Wein, der Geruch von gebratenem Fleisch, gegrillter Wurst, erhitztem Fett und der Rauch der Holzkohlefeuer sich für ein verlängertes Wochenende über den Ort legten. Selbst Lukas kam nicht umhin, sich bei diesem Treiben dem strengen Elternhaus zu entziehen. Wie auch? Schließlich drehten die Betreiber der Karussells die Musik schon am Freitag so laut auf, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Die einzige Möglichkeit, hätte einer dem entgehen wollen, wäre die Flucht in den kleinen Sommersitz oberhalb des Ortes gewesen, wie Lukas‘ Vater sie der Familie vergeblich verordnete.
Untrennbar gehörte zu diesem Rummel außer den typischen, alles durchdringenden Gerüchen und Geräuschen der Garküchen der Wein: Die Alten tranken in den folgenden Tagen, so dass sie nur mit Mühe nach Hause fanden. Die Jungen – Achim gehörte regelmäßig dazu – tranken manchmal noch mehr, oder sie tanzten lange und verschwanden spät in der Nacht paarweise in den Weinbergen.
Dass die Jugendfreunde nach solcher Prägung, zu der auch eine lange, gemeinsame Schulzeit nicht wenig beitrug, mit Heidelberg schließlich dieselbe Universität wählten, lag nicht alleine an der Nähe oder am Renommee des Städtchens am Neckar. Es lag auch am stillschweigend geteilten Wissen, dass die wichtigen Erfahrungen einer gemeinsamen Kindheit und Jugendzeit sie mehr verbanden, als es Trennendes gab, und notfalls Rückhalt boten. Keineswegs liefen sie immer im Gleichschritt, doch wenn es darauf ankam, verlor keiner die Nöte des anderen ganz aus dem Blick. Sie ergänzten einander trotz mancher Unterschiede.
Von seiner Mutter, die aus einer Metzgerei im Nachbarort stammte, hatte Achim „ein Händchen fürs Geld“ und viel Geschick fürs Praktische mitbekommen. Beizeiten hatte er erfahren, dass die Kasse nur klingeln hört, wer mit dem richtigen Geschirr zu Werke geht. Doch das war nicht die einzige Mitgift: Wie sie war Achim für Überraschungen gut, konnte unberechenbar werden und lehnte sich gegen alle auf, die wohlmeinenden oder auch nur wohlfeilen Rat bereithielten. Ob er andererseits etwas vom Vater Johannes Roth mitbekommen hatte, insbesondere was dessen geduldiges Gehen unterm Joch anging, blieb ein Rätsel. Hätte Achim den Lebenstraum des Vaters, der diesen für vieles entschädigen sollte, wahr werden lassen, hätte er sich für das Ingenieurstudium entschieden: Fachrichtung Tiefbau. Alles andere entzog sich dem Blick von Johannes Roth. Doch der Sohn stieß nicht nur ihn vor den Kopf, als er sich für eine Kombination verschiedener Geisteswissenschaften entschied. Der Vater gab ihm enttäuscht einen Zollstock mit, der ihm die vorgegebene Richtung weisen sollte, die Mutter trug „den Fehltritt“ mit Fassung und vertraute auf die baldige Wende zum Praktischen. Ganz anders Lukas: Der tat, als er sich für die Mathematik entschied, was alle ohnehin von ihm erwarteten.
So wechselten sie im Spätherbst aus ihrer ländlichen Idylle nach Heidelberg. Dass sie dann auch dieselbe Wohnung bezogen, war nicht mehr selbstverständlich und es war nicht ihrem Zutun zuzuschreiben. Hier hatte tatkräftig und ohne Einspruch zu dulden Achims Mutter, Frau Barbara Roth, gründliche Vorarbeit geleistet. Was irgendwie mit Geld zu tun hatte, lag im Hause Roth in ihrer Hand. Schnell hatte sie sich, als der Studienort feststand, eines Cousins im für sie fernen Heidelberg erinnert. Es war ein reicher, kinderloser Junggeselle, der dort in der Altstadt eine Bar betrieb; Einheimische sprachen übertrieben von „Bumslokal“. Johannes Roth hatte denn auch hinter seiner Zeitung unwillig gebrummt: „Was fängste mit so einem wieder an? Was soll denn des jetzt gebe?“ Doch sie wusste, dass der in einem seiner Häuser, in einer parallel zum Neckar verlaufenden Gasse nah der Alten Brücke, Zimmer an Studenten vermietete. Einen Katzensprung zur Universität, hatte er beim Anruf seiner Cousine geschwärmt, ganz nah am Fluss. Letzteres hatte er der lauten Bundesstraße und des regelmäßigen Hochwassers wegen nur nebenbei erwähnt. Die Cousine hätte auf Grund längst verblichener Ortskenntnisse aber damit sowieso nichts anfangen können.
Ihr Schwager, der Apotheker Schönborn, hatte seiner Frau zugeflüstert: „Ich glaube, die will ihren Achim ganz bewusst in dieses Nest setzen. Die weiß schon, warum! Brutschmarotzer! Dein Bruder Johannes – irgendwie tut er mir leid!“ Er beließ es, auch wegen der ängstlich unwilligen Reaktion seiner Frau, bei dieser rätselhaften Andeutung. Doch letztlich bestärkte des Vorteils wegen auch er die Schwägerin bei der Zimmersuche, und so reservierte Frau Barbara Roth die Unterkunft gleich für Lukas mit.
Lukas hatte ganz andere Vorbehalte als die Alten: Ihm schwebte eine Unabhängigkeit vor, wie sie eine gemeinsame Wohnung nicht ermöglichen würde. „Wann, wenn nicht jetzt“, hatte er sich gesagt, „kann ich mich freischwimmen und aus Achims Schatten treten? Er bleibt mein Cousin, und wir werden uns in Heidelberg oft genug über den Weg laufen. Aber dass Achim in allem den Ton angibt, damit muss irgendwann Schluss sein!“ Es blieb vorläufig beim irgendwann. Denn Lukas Mutter wimmelte die zaghaft vorgetragenen Einwände gegen eine gemeinsame Wohnung ab: „Gut, Lukas, wenn du dir zutraust, etwas Günstigeres zu finden ... Dann nimm das aber bitte selbst in die Hand!“ Da sah dieser beängstigend nah die vielen kleinen und größeren Plagen auf sich zukommen, die man verharmlosend mit Alltag umschreibt. Der Kampf auf diesem Feld war seine Stärke nicht. Also siegte auch bei ihm eine Vernunft, welche befand, dass er die Wohnungssuche Frau Barbara Roth überlassen sollte. Denn er schätzte trotz des Wunsches, endlich auf eigenen Füßen zu stehen, auch dies aus Erfahrung: In Achims Gefolge würde ihm manch Lästiges erspart bleiben. Achim sagte einfach: „Komm, lass mich das in einem Aufwasch miterledigen, Lukas!“ Gegen solchen Gegenwind hatte das schwache Flämmchen, das Selbständigkeit hieß, keine Chance. Angesichts einer äußerst günstigen Miete wollte selbst Johannes Roth von dem Vorbehalt gegen den Cousin seiner Frau nichts mehr wissen.
So machten sich eines Morgens mit Koffer, Taschen und einer Art Seesack die beiden Studenten in spe auf den Weg, um sich von zu Hause abzunabeln. Obwohl maulend, musste Roth senior auf Geheiß seiner Frau doch den Dienstwagen samt Fahrer, der ihm für Baustellenbesuche zur Verfügung stand, für einen Transport in die nahe Kreisstadt zweckentfremden: „Wann ich des aufarbeite tu’, des fragt ja keiner von euch!“ Es wurden zwei Fahrten, da der betagte Benz neben den angehenden Studiosi nicht auch noch das gesamte Gepäck fassen konnte.
Von der Kreisstadt ging es nach Mannheim, von dort nach kurzem Aufenthalt direkt nach Heidelberg hinüber. In der riesigen verglasten Bahnhofshalle, die ein warmer Spätsommertag wie zu freundlichem Empfang honigfarben ausleuchtete, sahen sie sich erst einmal ehrfurchtsvoll um und sperrten die Ohren auf für Lautsprecherdurchsagen über ankommende und abfahrende Züge: Achtung, auf Gleis vier fährt ab über Karlsruhe nach Basel ... auf Gleis sieben bitte zurücktreten ... es fährt ein der Fernverkehrszug von Stuttgart über Frankfurt nach Dortmund ... Sie haben Anschluss nach ... Das waren trotz relativer Bescheidenheit Dimensionen, die sie von ihrer Seite der Rheinebene nicht kannten. Achim atmete tief durch, wurde unruhig und bat Lukas, auf das Gepäck aufzupassen. Neugierig steuerte er die Bahnhofskioske an. Stolz präsentierte er bei seiner Rückkehr dem Cousin die Ausbeute: eine Ausgabe von Le Monde, eine Packung französischer Zigaretten und ein Päckchen Kaugummi. Lukas begnügte sich damit, all das Neue mit den Augen zu verschlingen.
Mit einer Straßenbahn, ebenfalls bis dahin unbekannt, fuhren sie bald darauf an modernen Betonbauten vorbei in Richtung Stadtzentrum und verrenkten die Köpfe, als sie das für sie erste und für die Stadt einzige Hochhaus passierten. Am Knotenpunkt Bismarckplatz angekommen meinten sie, endlich mit dem Begriff Großstadt etwas anfangen zu können.
Hier kreuzten sich mehrere Verkehrsströme gleich zweispurig, ein Polizist in der Pose eines Diktators sorgte mit durchdringendem Pfeifen und zackig gestikulierend für ordentlichen Fluss der Autoschlangen. Vor dem Bayrischen Hof stand hochnäsig ein Hoteldiener in grüner Livree mit goldenen Knöpfen, gegenüber prunkte als gewaltiger, weißer Gitterkasten ein Kaufhaus mit futuristisch anmutender Verkleidung. Schrill quietschten und klingelten unablässig die ankommenden und abfahrenden Straßenbahnen, Fahrer ließen ungeduldig die Automotoren aufheulen, sobald ihrer Verkehrsspur freie Fahrt signalisiert wurde. Lukas wartete überwältigt und Achim erregt von all dem Neuen auf die Linie 1. Sie mussten aber mehrere Anläufe nehmen, weil die Waggons so überfüllt waren, dass es aussichtslos schien, ihr vieles Gepäck darin zu verstauen. Als sie dies Problem endlich gelöst, Koffer und Säcke auf der hinteren, gerade nicht benutzten Führerplattform verstaut hatten, setzte sich der Wagen in Bewegung und bremste gleich darauf mit unerwartetem Ruck, der sie weit geschleudert hätte, wenn es denn freien Raum gegeben hätte. Die Fahrgäste hielten einander, sobald der Wagen wieder fuhr, an immer gleicher Stelle, nur die Masse als Ganzes schwankte mit dem Oberkörper bedrohlich mal in die eine, dann wieder in die andere Richtung. Unfassbar war es für die beiden, wie sich der Schaffner durch den überfüllten Wagen zwängen konnte! Er schimpfte, als er sich in Uniform und mit Dienstmütze bedrohlich vor ihnen aufbaute, laut über das viele Gepäck: „Mir sin doch kän Güderzug. Da müsse die Herre Studente halt e Taxi, ach was, besser noch än Kleintransporter nemme!“ Zum Glück zwang ihn eine erneute Vollbremsung, sich der Beruhigung zweier Frauen zuzuwenden, denen er auf den Füßen stand. Derweil nahm der Wagen, nachdem er eine Haltestelle passiert hatte, schnell wieder rasante Fahrt auf, wobei der Fahrer beinahe unablässig eine metallig hämmernde Glocke zur Abschreckung von Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern betätigte, weil die sich alle in beiden Richtungen und selbst auf den Schienen durch die enge Straße drängten. Streckte aus einer der zahlreichen Seitenstraßen ein Auto zu voreilig die Schnauze in die Fahrspur der Straßenbahn, gab es außer wildem und bedrohlichem Gebimmel eine Notbremsung, die wieder nur deshalb für die Insassen ohne Folgen blieb, weil die noch immer keinen Platz hatten, wohin sie fallen konnten. Die beiden sammelten von der hinteren Plattform aus von der als Hauptstraße bezeichneten wichtigsten Verkehrsader der Stadt erste flüchtige Eindrücke: Mal entfernte sich hohe, dann wieder niedrige und aufgelockerte Bebauung aus ihrem Blickfeld nach hinten weg, Barockfassaden wechselten mit schlicht quadratischem Stahl und Glas in den Erdgeschossen, Sandstein, meist schwarzfleckig, mit farbigem Putz oder schmutzigen Klinkern. Achims Augen wanderten erregt zwischen den Geschäften rechts oder links und den Passantinnen mit den kurzen Röckchen hin und her, Lukas konnte die dichte Bebauung und die Eile der Passanten kaum fassen. Nach dem Universitätsplatz, wo sich beinahe alle ungestüm drängelnd durch die schmalen Öffnungen nach draußen zwängten, wurde die Straße noch enger, die Häuser schienen höher, der Verkehr chaotischer, dafür war der Wagen jetzt nur noch mäßig besetzt. Als der Schaffner endlich „Heilischgeistkärsch!“ rief, hatten die angehenden Studenten ihr Ziel beinahe erreicht. Jener schaute mit der Hand am Klingelzug so ungeduldig dem Entladen zu, als mache er Dienst auf einem Fernreisezug. Achim und Lukas schafften hastig ihre Gepäckstücke nach draußen und schleppten sie erst einmal auf den freien Platz vor den Andenken- und Buchläden, die sich wie kleine Nester unten an die gewaltige Kirche duckten. Nachdem sie sich umgeschaut, Auskunft eingeholt und dabei einen schwer zu deutenden Blick eingefangen hatten, als sie Krauses Namen nannten, zogen sie vollgepackt und alle Augenblicke zum Verschnaufen innehaltend um die Kirche herum die Steingasse hinunter direkt auf die Alte Brücke und deren Türme zu. Letztere waren Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung und unübersehbare Wegweiser auf dem Weg zu Achims Onkel.
Das Haus, dessen Adresse sie auf einem Zettel notiert hatten, fanden sie unweit der Brücke; ein Altbau, dessen finsterer Hausflur noch vom letzten Hochwasser modrig roch. Man konnte ihn mit seinen steilen, engen Holzstiegen selbst in jener Zeit nur an Studenten vermieten. Vor dem Eingang erwartete sie bereits Theophil Krause.
Er war klein und untersetzt, sprach viel und vor allem gönnerhaft, eben so, wie man als Onkel aus der Großstadt zu unerfahrenen Jungs vom Land spricht. Trotz dafür weniger geeigneter Proportionen gab er sich, seiner Kleidung nach zu schließen, größte Mühe, städtisch elegant zu wirken: Er trug eine graue, in Bauchhöhe ausbuchtende Flanellhose, weiße, elegant wirkende Lederschuhe mit durchbrochenem, blauem Besatz, einen mittelblauen Blazer mit Einstecktuch, das Hemd zeigte, wo es zur Hose überging, wieder die deutliche Wölbung. Den kurzen Hals zierte ein dunkelrotes Tuch mit Paisleymuster, den markanten Abschluss bildete eine Sonnenbrille, die er erst im Hausflur abnahm. Mit all dem stach er auffällig von der schlichten Umgebung der Gasse und des Hauses ab. Treppauf unablässig etwas erklärend, was sie deshalb nicht verstanden, eilte Phil Krause erstaunlich gewandt ihnen voran die knarrenden Stiegen hinauf und betrat dann im dritten Stock eine Wohnung, auf deren Neckarblick er mit weit ausholender Geste und dem Stolz des Hausbesitzers verwies. Erst jetzt rang er unübersehbar nach Luft. Von der vielbefahrenen und darum lauten Bundesstraße zwischen Haus und Fluss sprach er nicht, schloss aber umgehend die Fenster, so dass sie sich, nachdem er verschnauft hatte, verständigen konnten. Sein Blick ruhte wohlwollend auf Achim und streifte neugierig Lukas. Auch Achim hatte inzwischen die Möglichkeit genutzt, den Onkel, dem er bis dahin nicht begegnet war, zu mustern.
Die „Bude“, wie Phil Krause sie nannte, drei mit Mobiliar höchst unterschiedlicher Provenienz bestückte Zimmer, einen Flur, eine große Wohnküche und einen ebensolchen Waschraum, bewohnte bereits ein älterer Student. Breit lachend stellte der Onkel die „Novizen“ als seine Verwandten vor und schloss dabei Lukas, ohne den gefragt zu haben, großzügig mit ein. Als er die angehenden Studiosi zurückließ, waren die Weichen endgültig in eine Richtung gestellt, von der sie zu diesem Zeitpunkt noch nichts ahnen konnten.
3
Es sollte nicht lange dauern, da durfte Lukas von Achims Tatendrang profitieren: Mussten sie doch den lästigen, aber unausweichlichen Hindernislauf auf dem Feld der Bürokratie bestehen. Dem Cousin war keine Hürde zu hoch und kein Graben zu weit. Dennoch waren sie tagelang unterwegs, bis sie nach erfolgreichem Zieleinlauf mit einer Handvoll bedruckten Papiers feststellen durften, dass sie fortan als ordentliche Mitglieder der städtischen wie auch der universitären Gemeinschaft galten. Die gleich danach als Schreckschuss hingeworfene Behauptung ihres Mitbewohners Klaus: „Ihr wisst vielleicht noch gar nicht, dass die bürgerliche Wissenschaft passé ist. Heute studiert man Marx und Lenin!“, vermochte die Neuankömmlinge wenig zu beeindrucken. Sie wussten weder mit der einen noch mit den anderen beiden etwas anzufangen.
Weil sich für den größten Teil des Tages die Wege dieser ungleichen Wohngemeinschaft trennten, blieb es lange bei verbalen Rempeleien. Denn vorerst praktizierte das neu gebildete Terzett eine halbwegs friedliche Koexistenz auch deshalb, weil die Neuen sich nach Kräften bemühten, über Klaus‘ Selbstbedienung aus ihren Küchenvorräten hinwegzusehen. Lukas zog es schon früh am Morgen zu den abseits über ihren Problemen brütenden Mathematikern, der Geisteswissenschaftler Achim ließ es gemütlicher angehen und steuerte das Bad erst an, wenn der Cousin das Haus verlassen hatte. Im Laufe des Vormittags suchte er dann in alten, etwas heruntergekommenen Häusern, die weit auseinanderlagen und welche die Universität günstig angemietet hatte, die Übungsräume der Literaturwissenschaftler, Historiker oder Philosophen auf, um die Lehr- und Wanderjahre eines Wilhelm Meister zu analysieren, die Quellenlage der Bauernkriege zu diskutieren oder im kleinen Kreis das Philosophieren zu versuchen. Ihr Mitbewohner Klaus inhalierte derweil mit Gleichgesinnten die Lehren seiner Klassiker, das waren Marx, Engels und Lenin, träumte von der nahen Weltrevolution oder verteilte Flugblätter auf zentralen Plätzen der Stadt.
Es war noch kein halbes Jahr vergangen, da kam Achim nach Hause und berichtete stolz, er habe für halbe Tage einen lukrativen Aushilfsjob in einer Getränkehandlung gefunden. Lukas war verdutzt und wollte dies mit dem alles dominierenden Erwerbstrieb der Roths erklären, da meinte Achim: „Ach, was, Lukas! Es geht weniger ums Geld an und für sich, aber ich brauch‘ des, um mei Nachtlebe zu finanziere! Ohne des“, rechtfertigte er sich, „bist du kein Mensch, schon gar net Student! Ich brauch’ des wie die Luft zum Atme. Ist des bei dir denn net so? Weißt du, des Studiere allein, na ja, du wirst des auch noch merke …“ Lukas schüttelte verständnislos den Kopf und stellte bald fest: Je tiefer der Mensch in Achim in Beat-Schuppen und Jazz-Kellern durchatmete, desto mehr ging dem Studenten Achim die Puste aus.
Eine Auszeit von diesem Heidelberger Nachtleben gönnte der Cousin sich nur im Spätsommer: Denn die Weinfeste in der alten Heimat blieben nach wie vor ein Fixpunkt in seinem Kalender. Rechtzeitig am Freitag fuhr er dann in die Pfalz hinüber und kehrte montags ein wenig müde, aber ausgeglichen an den gemeinsamen Studienort zurück.
Was zog ihn zu diesen Festen? Es war nicht zuletzt die pfälzische Sprache, der er dort freien Lauf lassen durfte. Die hatte er schon mit der Muttermilch eingesogen. In Heidelberg musste er sich, wenn es ums Studieren ging, „diesen unnatürliche Zwang antun!“ Wie alle seine Landsleute geriet er ins Schwitzen und Schlingern, sobald er das Hochdeutsche zu simulieren versuchte. Er sprach dann die Silben so exakt, wie der Anfänger am Steuer die Kurven nimmt. Das mündete, wie Lukas spottete, in „eine auffällig abgezirkelte und übertrieben melodische Aussprache: „Achim, wenn du dir das nicht abgewöhnst, wirst du für alle Zeit der Pfälzer Weinschlauch bleiben!“
„Du hast gut rede mit deiner gekünstelte Sprach!“, protestierte Achim. Warum trug Lukas dies Muttermal nicht auf der Zunge? Sein Vater, der Medizinalrat Heinrich Schönborn, nach dem letzten Weltkrieg aus Thüringen zugewandert, tat sich nicht nur mit dem pfälzischen Dialekt sehr schwer, er klagte auch hinter vorgehaltener Hand über die „unzureichend kultivierte Lebensart“ seiner neuen Umgebung und führte sich auf, als habe es ihn auf einen Außenposten der Zivilisation verschlagen. Kopfschüttelnd befand er: „Ich bin halt aus einem anderen Holz geschnitzt als diese Leute hier. In meinem Metier kann eine Unachtsamkeit von wenigen Tausendsteln einem Menschen das Leben kosten!“ Die meisten seiner Kunden maßen ihre Medizin in der Einheit Glas oder Krug. Hinzu kam, dass Heinrich Schönborn sich sein selbstgewähltes Abseits durch ein dialektfreies Hochdeutsch unüberhörbar ertrotzte. Es war wenig förderlich für den Umgang mit der ortsansässigen Bevölkerung, dasselbe galt dann auch für den Gewinn, den die Apotheke abwarf.
Es war zu Beginn des dritten Studienjahres in Heidelberg, da ließ sich Achim mit der Rückkehr von einem dieser Weinfeste ungewöhnlich viel Zeit. „Was ist denn mit dir passiert? Schlüssel verlegt und das große Los gezogen?“, erkundigte sich Lukas kopfschüttelnd, als Achim freudestrahlend und neu eingekleidet erst zur Wochenmitte den Klingelknopf der gemeinsamen Wohnung heftig durchdrückte und nicht mehr losließ. Der Cousin hatte zusammen mit der alten Kleidung den Schlüssel ausgemustert.
Das Malheur konnte ihm die Laune nicht verderben. Er warf sich in die Brust: „Tja, mein lieber Lukas, wie du siehst: des große Los gezogen, Schlüssel verloren, aber Gewinn gleich abgeholt und angelegt. Und stell’ dir vor, ganz gegen alle Wahrscheinlichkeit gibt‘s hier gleich noch en Volltreffer. Und der trifft dich! Ich durchschau‘ des noch net so genau, aber ich krieg‘ des noch raus: Irgendwie hast außer meiner Mutter auch du an der Sach‘ gedreht. Oder?“
Lukas gab sich unwissend und forderte den Cousin auf: „Kannst du mal Klartext …Worum geht es eigentlich?“
Was war passiert? Achims Mutter hatte den Großvater der Cousins – Achims Vater und Lukas’ Mutter waren Geschwister – dazu bewegen können, den beiden Studiosi einen kleinen Teil des für sie vorgesehenen Erbes vorzeitig auszuzahlen. Dieser Großvater, ein Landwirt im badischen Kraichgau, war beinahe über Nacht zum steinreichen Mann geworden, als ein Großteil seiner Äcker zu Bauerwartungsland wurde. Ganz schnell hat dieser Hannes Roth die Landwirtschaft aufgegeben und sich, nachdem er ein stattliches Häuschen erworben hatte, zur Ruhe gesetzt. Einen größeren Teil des Landes, das durch Gemeinderatsbeschluss aufgewertet war, wollte er in seinem Testament den beiden Enkeln vermachen. Es war Achims Mutter, Frau Barbara Roth, die ihm klarmachte, dass die beiden Studenten zur Finanzierung ihres Studiums schon mal eine Anzahlung benötigten. Sie war erfolgreich, denn Hannes Roth überwies den Enkeln jeweils einen fünfstelligen Betrag. Ein Vielfaches davon, das war ausgemacht, sollte nach seinem Tod folgen.
„Drum mach’s wie ich, lass‘ deine Matheaufgaben heut‘ mal ungelöst, Lukas, die laufe dir samt Lösung net davon. Wir machen mal so richtig einen drauf. Lasse ordentlich die Korke knalle. Morgen ist auch noch ein Tag!“ Tatsächlich war Lukas ob des plötzlichen Geldregens derart außer sich, dass er erstmals, soweit er sich erinnern konnte, die Bücher stehen und liegen ließ und sich Achim anschloss, nachdem er sich zuvor bei der Bank vergewissert hatte, dass dieser Geldsegen auch auf sein Konto niedergegangen war.