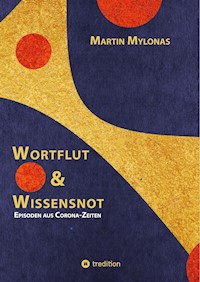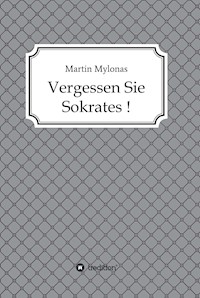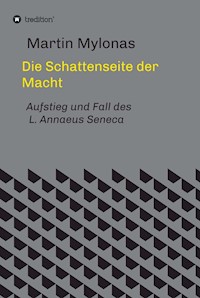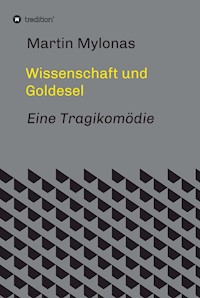
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein ehrgeiziger Klinikchef bekommt von einer Mitarbeiterin ein computergestütztes Behandlungsmodell angeboten, das eine revolutionäre Neuerung darstellt. Schnell erkennt er die Chancen für sich: den nächsten Karrieresprung und ein ausgezeichnetes Geschäftsmodell. Was er nicht ahnt: Die ihm vorgelegten Ergebnisse sind geschönt. Noch weniger rechnet er damit, dass die Mitarbeiterin, die das Programm entwickelt hat, aber davon nicht profitieren soll, sich rächen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 71
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Martin Mylonas
Wissenschaft und Goldesel
Eine Tragikomödie
© 2019 Martin Mylonas
Umschlag, Illustration: Martin Mylonas
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7497-5845-6
Hardcover
978-3-7497-5846-3
e-Book
978-3-7497-6847-0
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Martin Mylonas
Wissenschaft und Goldesel
Eine Tragikomödie
Die Personen:
Professor Burkhard Bruch, Klinikchef
Frau Dr. Grace Springfield, Wissenschaftlerin
Fred Silverstone, Finanzberater
Sofia Pagelakis, Bürgermeisterin
Hans Ziegler, Bauunternehmer
Franz Zeisig, pensionierter Schulleiter
Dr. Berg, Patentanwalt
Frau Ferati, Sekretärin von Professor Bruch
Tanja Dukakis, Servicedame im Golfclub
Daniel Bruch, Sohn von Professor Bruch
Alexander Meyer, Verwaltungschef der Klinik
von der Wiss, Universitätspräsident
Volker Lauthals, Chefredakteur des Allgemeinen Volksblattes
Constantin Vogel, IT-Spezialist
Dr. Brown, Oberarzt in Professor Bruchs Klinik
1. Auftritt
Ein heller, weiter Raum, in dem hinter einem Paravent halb verdeckt eine Untersuchungsliege und medizinisches Gerät zu sehen sind, ferner eine Sitzgruppe für Gespräche in kleinem Kreis sowie ein großer Schreibtisch mit Bildschirm und einer Reihe medizinischer Standardwerke. Es handelt sich um das Sprechzimmer des Klinikleiters Professor Bruch. Seine Sekretärin und rechte Hand, Frau Ferati, führt gerade die wissenschaftliche Mitarbeiterin Frau Dr. Springfield herein.
Ferati:
Nehmen Sie bitte Platz, Frau Dr. Springfield, es kann ein wenig dauern, bis der Chef eintrifft. Er hatte heute Früh seine Vorlesung, in zwischen ist er bei der Visite. Ein Pharmavertreter hat sich auch angekündigt. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Schön, Sie wieder einmal zu sehen. Man sieht sich ja so selten, seit Sie drüben im neuen Labor arbeiten.
Springf.:
So ist es, Frau Ferati. Gegen ein Wasser habe ich nichts einzuwenden.
Die Sekretärin entnimmt einem Barschrank eine Flasche Wasser, holt ein Glas, gießt ein und stellt beides vor Springfield auf den Tisch.
Ferati:
Kann es sein, dass Sie schon ganze drei Jahre bei uns arbeiten?
Springf.:
Seit fast drei Jahren. Weshalb fragen Sie?
Ferati:
Nur so. Sie sind Wissenschaftlerin auf Zeit, wenn ich mich nicht irre?
Springf.:
Wissenschaftlerin auf Dauer, der Arbeitsvertrag ist auf Zeit!
Ferati:
Wusste ich es doch, es geht um den Vertrag. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute.
Springf.:
War das jetzt schon ein Abschied, oder wie soll ich das verstehen?
Ferati:
Nur so. Wissen Sie, ich bekomme jede Woche mindestens eine Bewerbung für eine befristete Stelle auf den Tisch. Zeitlich befristete Stellen scheinen äußerst begehrt.
Springf.:
Klar, weil es keine anderen gibt, es sei denn, man hat Beziehungen.
Ferati:
Da mögen Sie recht haben. Aber ich lasse Sie jetzt doch lieber allein, es wartet Arbeit auf mich.
Die Sekretärin verlässt auffallend schnell den Raum. Springfield vertieft sich in ein Paper, das sie mitgebracht hat. Doch es dauert nicht lange, bis Professor Bruch erscheint, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Dermatologie und Chef der örtlichen Universitätshautklinik.
Bruch:
Ich grüße Sie, Miss Springfield. Was führt Sie zu mir? Wir haben uns längere Zeit nicht gesehen. Ist keine gute Lösung, die sanierungsbedürftige Klinik hier, das neue Zentrallabor eine Straße weiter. Ich arbeite mit Hochdruck an einer baulichen Veränderung. Dauert aber alles seine Zeit. Was macht übrigens Ihr Projekt? Darf ich fragen, wie es persönlich geht? Ich komme leider nicht dazu, mich so um alle Mitarbeiter zu kümmern, wie ich das gerne täte: Vorlesung, Visite, Sprechstunde, Verwaltungsarbeit, Vorträge und und und! Aber das kennen Sie ja. Er lacht. Oder eher nicht. Ich sage gern: Das ist der Vorteil der wissenschaftlichen Projektverträge. Man kann sich ungestört dem widmen, was unsereinem recht eigentlich am Herzen liegt, der Wissenschaft!
Springf.:
Mit dem Zeitdruck als unsichtbarer Peitsche im Nacken.
Bruch:
Zeitdruck? Wie meinen Sie das?
Springf.:
Professor Bruch, ich arbeite seit drei Jahren an meinem Projekt. Die Zeit läuft gerade ab. Was kommt danach?
Bruch:
Und wie weit ist Ihr Projekt gediehen? Leider konnte ich mich zuletzt nur wenig darum kümmern.
Springf.:
gibt sich sichtbar einen Ruck Meine Arbeit, Professor Bruch, steht kurz vor dem Abschluss, ich arbeite bereits an der Dokumentation.
Bruch:
gibt sich erleichtert Dann ist ja alles super! Sie verstehen: Der Druck, solche Stellen, wenn sie im Etat ausgewiesen sind, neu zu besetzen, ist enorm. Ich könnte dutzende solcher Zeitverträge vergeben, so viele Bewerbungen gehen ein. Sofern das mit der Zeit bei Ihnen knapp wird, werden wir sehen, was sich tun lässt. Eine kurzfristige Krankenvertretung findet sich immer. Am besten, ich lasse Frau Ferati gleich eine beantragen! Auch wenn es nur Teilzeit werden sollte, besser als gar nichts. Oder wie sehen Sie das?
Springf.:
Aber …
Bruch:
Aber?
Springf.:
Aber einigen Kolleginnen in der Fakultät hat man nach Ablauf ihres Zeitvertrages prompt einen Anschlussvertrag angeboten! Weshalb habe ich das nicht bekommen?
Bruch:
Meine liebe Miss Springfield, ich sage gern: Kein Fall ist wie der andere. Vergleichen kann man nur, was gleich ist. Als Mediziner sollten wir das wissen! Doch wir sprachen von Ihrem Projekt. Hatte es nicht etwas mit diesem neuen Digitalisierungstrend in der Medizin zu tun? Sehen Sie, so ganz uninformiert bin ich nicht. Sie arbeiten bereits an der Dokumentation, sagten Sie. Können Sie mich mit wenigen Worten auf den aktuellen Stand bringen?
Springf.:
scheint irritiert Aber Professor Bruch, es geht doch um das neue Anti-Aging-Verfahren…
Bruch:
Richtig, Anti-Aging. Er lacht herzhaft, Wenn das meine wohlhabende Privatklientel hört, dann stürmen die mir die Bude. Er lachterneut. Und wer weiß: Vielleicht sollte auch ich mich einer Behandlung unterziehen?
Springf.:
bemüht sich sichtbar, ernst zu bleiben Die Stoffe, die für die Hautverjüngung, Hydratisierung, Unterpolsterung und schließlich Regeneration verantwortlich sind, Professor Bruch, dürfen wir auch dank Ihrer Arbeiten als bekannt voraussetzen. Das eigentliche Problem war immer: Wie dosieren wir diese auf den individuellen Patienten abgestimmt, führen sie ihm zu, wie lassen wir den Prozess der Regeneration gezielt ablaufen? Da ist eine Fülle von Daten zu verarbeiten. Hier kommt mein Diagnosegerät zum Einsatz. Es erstellt dank passender Algorithmen eine Analyse des Ist-Zustandes und gibt einen vierwöchigen Medikations- und Injektionsplan vor. Das Ergebnis: Eine deutlich sichtbare Verjüngung der Bereiche Gesicht und Dekolleté! Wenn Sie einen Blick auf das Paper für die vorläufige Dokumentation werfen wollen?
Bruch:
Er nimmt das Paper, blättert darin, liest flüchtig hier und da ein wenig, wirft schließlich einen Blick auf die beigehefteten Fotografien. Was soll ich sagen? Donnerwetter! Erinnere mich jetzt an die genaue Projektausschreibung! Hatte das gerade nicht mehr auf dem Radar. Aber eines erkenne ich sofort: Das wird ein wichtiger Baustein in unserem Praxis-Alltag als Dermatologen.
Springf.:
Ein bisher unbekannter dazu. Es wird das Anti-Aging revolutionieren!
Bruch:
Er denkt nach, schmunzelt, lacht schließlich zufrieden. Wenn ich das recht verstehe, ist das eigentlich Neue – wie sagten Sie zu Recht? – das Revolutionäre daran, das kombinierte Diagnose- und Indikationsmodul, das über die neu entwickelte Software gesteuert wird. Hm! Zum Glück verfügen wir mit Ihnen über eine Fachkraft, die auf solche Geräte und Programme spezialisiert ist.
Springf.
Sprechen Sie jetzt von der kurzfristigen Springerin für eventuelle Krankheitsfälle, Teilzeit und so?
Bruch:
Ach was, vergessen Sie das! Das kommt für Sie nicht in Frage, meine liebe Miss Springfield. Da kommt doch ein Berg von Aufgaben auf uns zu: Das Gerät muss eingeführt, Ärzte und andere Kräfte müssen geschult werden, vermutlich braucht es mehr als das eine Gerät, Kollegen andernorts werden es ebenfalls haben wollen. Wissen Sie was? Ich vermute, nein, bin sicher, wir müssen das schnellstens für unser Haus patentieren lassen. Und was die wirtschaftliche Verwertung des Patents angeht, wie finden Sie meinen Vorschlag: Wir zwei machen daraus gemeinsam etwas!
Springf.:
Wer? Wir gemeinsam?
Bruch:
Na klar! Ich werde unter diesen Umständen versuchen, na, eine Daueranstellung für Sie herauszuschlagen. Sehe Sie schon als Privatdozentin in unserem Haus! Und wir …
Springf.:
Wir? Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf: Entwickelt habe das Gerät samt Verfahren ganz alleine ich!
Bruch:
Na, Miss Springfield, bleiben wir doch bitte auf dem Boden und lassen die Vernunft nicht außen vor: Wer hat Ihnen diese Stelle als Wissenschaftlerin bewilligt? Wer hat Ihnen Institutsräume, Mitarbeiter, die finanziellen Mittel für die Entwicklung zur Verfügung gestellt? Wer also hat das Ganze angestoßen? Ich schlage vor, wir lassen dies Verfahren auf unser Haus patentieren und überlegen gemeinsam, in welcher Form ein Teil der Erträge aus der Verwertung auch Ihnen zugutekommen könnte. Das wird doch unserem jeweiligen Anteil eher gerecht! Und was die Einführung solcher Geräte am Markt betrifft: Glauben Sie wirklich, Sie könnten da als kleine wissenschaftliche Maus, entschuldigen Sie, ich wollte sagen, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, etwas ausrichten? Das