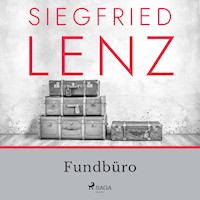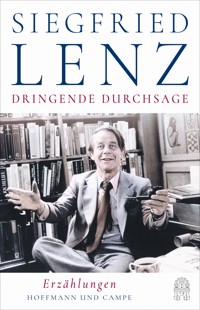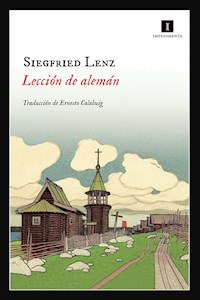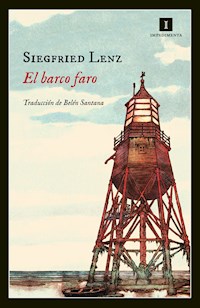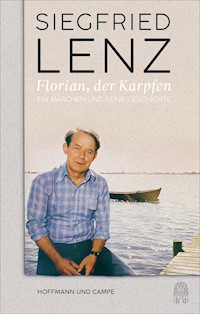19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die wichtigsten Essays von Siegfried Lenz zu Literatur, Gesellschaft und Politik. Ausgewählt und mit einem Vorwort von Heinrich Detering. Der Modus des Staunens ist eine Grundhaltung, die das essayistische Werk von Siegfried Lenz durchzieht. Von jeher begegnet er der Welt und der Weltliteratur mit großer Offenheit und Empathie. Deshalb sind seine Texte zu literarischen und politischen Themen wie auch seine autobiographischen Ausführungen stets Gelegenheitswerke im besten Wortsinn. »Und vielleicht ist dies das überzeugende Geschenk des Müßiggangs: die Gelegenheit zum Staunen, die uns gewährt wird. Wer aber staunt, wer sich selbst aus bescheidenem Anlaß wundert, der beginnt unweigerlich zu fragen, und wer Fragen stellt, wird zu Schlussfolgerungen gelangen: Der Müßiggang wird zu einem aufregenden Zustand.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Siegfried Lenz
Gelegenheit zum Staunen
Ausgewählte Essays
Herausgegeben von Heinrich Detering
Hoffmann und Campe
Der demokratische Stil – Siegfried Lenz als Essayist
Aus dem Jahr 1961 stammt der früheste Essay dieser Auswahl. Ein Jahr später, im Herbst 1962, bricht der Schriftsteller Siegfried Lenz auf Einladung des amerikanischen Botschafters in der Bundesrepublik auf zu einer großen USA-Reise. Jetzt, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, sollen junge und für die öffentliche Meinung wichtige Intellektuelle für den amerikanischen Weg gewonnen werden, und so stehen dem Sechsunddreißigjährigen, wohin er auch kommt, die Türen weit offen. Neugierig und unternehmungslustig reist Lenz, als Zeitzeuge und als Schriftsteller, voller Sympathie für das Land und bemerkenswert frei von Ressentiments wie von Verklärung. Und er führt während der Reise – der unter anderem auch der große Essay über die Schauplätze von Faulkners Romanen zu verdanken ist – das einzige Tagebuch seines Lebens. Genau fünfzig Jahre später hat er es erstmals veröffentlicht, mit einem Vorwort, das nun die vorliegende Sammlung beschließt und das noch einmal das damalige »Gefühl großer Dankbarkeit« wachruft. Es ist der Rückblick aus der Spätzeit eines Lebenswerks auf eine Art Urszene. Denn in der Amerikareise kulminiert jene persönliche Variante dessen, was dann »Westbindung« heißen sollte. Begonnen hatte sie schon mit dem Kriegsende, in der Kriegsgefangenschaft. Dort habe er, erinnert sich Lenz, eine englische Zeitung in die Hand bekommen; es war »die erste Zeitung, die frei war von Lüge«.
Früher und leidenschaftlicher als viele seiner Generationsgenossen hat Siegfried Lenz sich Literatur und Kultur der USA erschlossen: lesend, schreibend und dank des Stipendiums auch aus eigener Anschauung. Und die richtet sich eben nicht allein auf sprachliche Kunstwerke, sondern erfährt eine wunderbare Öffnung der Welt durch eine Literatur, die Platz für viele Stimmen und Ansichten hat. Eine Literatur, die Vielstimmigkeit, Offenheit für Widersprüche, Verstehen lehrt, indem sie dies alles selbst praktiziert.
Der Kern des literarischen Kanons, auf den der Essayist Siegfried Lenz sich lebenslang beziehen wird, hat sich in dieser befreienden Nachkriegszeit herausgebildet, zwischen dem Kriegsende 1945 und der Amerikareise 1962. Er bleibt trotz aller neuen Entdeckungen und Fundstücke bemerkenswert stabil bis in die spätesten Arbeiten hinein. Es sind die Dichtungen des französischen Existenzialismus und seiner amerikanischen Verwandten, die sein eigenes Schreiben künstlerisch und moralisch gleichermaßen imprägnieren: die Dramen und Romane Sartres, Becketts und vor allem Camus’, es sind die Storys von Ernest Hemingway und die Romane William Faulkners und ihrer Vorgänger von Melville bis Mark Twain. Norddeutsche und skandinavische Autoren kommen hinzu, von Storm über Thomas Mann bis zu dem in aller Größe nie unproblematischen Hamsun und dem uneingeschränkt bewunderten Laxness, die russische Erzählkunst des 19. Jahrhunderts und die Romane von Freunden und Weggefährten der deutschen Nachkriegsmoderne wie Wolfgang Koeppen, Heinrich Böll und Günter Grass. Nie steht Lenz dem Werk seiner Lieblingsschriftsteller in bloßer Bewunderung gegenüber, immer erweist er ihnen die Ehre der Kritik und, wo es ihm geboten erscheint, auch des Widerspruchs. Dem Stil seines Lehrers Hemingway hat der junge Siegfried Lenz eine »gewissenhafte Schlichtheit« nachgerühmt. Der Ausdruck bezeichnet, in beiden Wörtern, mindestens ebenso sehr sein eigenes Schreiben. Lenz zieht dem stilistischen Prunk das Understatement vor, und gewissenhaft ist sein Sprachgebrauch, weil für ihn, den norddeutschen Protestanten, die Literatur zuerst eine Gewissenssache ist.
Dabei wird dem neugierigen Amerikareisenden bald, auch hier ähnelt er dem Koeppen der Amerikafahrt, das komplexe Riesenwerk Faulkners wichtiger als die lakonischen Storys von Hemingway. Einige seiner leidenschaftlichsten Essays sind dem monumentalen Epiker der Südstaaten gewidmet; und in der Verfremdung durch die aus bundesdeutscher Perspektive so exotische Welt von Yoknapatawpha County findet er die eigenen, existenziellen Lebensthemen wieder (mit seinen eigenen, früheren Worten: »von Fall, Flucht und Verfolgung, von Gleichgültigkeit, Auflehnung und verfehlter Lebensgründung« (so in Ich zum Beispiel), die Wiederkehr der Vergangenheit, auch die Verschränkung von Rassismus und Gewalt, Schuld und Schande, Sühne und Gnade), nur ohne Vokabular und stilistischen Gestus der existenzialistischen Generation, im stilistischen Reichtum unendlicher perspektivischer Facettierungen. Zugleich entdeckt er in Faulkner die in die äußerste künstlerische Subtilität gesteigerten Sujets seiner abenteuerlichen Jugendlektüren neu. Und wenn die eigene Reise ihm in Faulkners Own Country nur einen »von jeder Mythologie befreiten Mississippi« zeigt und die fortdauernde Wirklichkeit des »Rassenwahns«, dann beweist ihm dies gerade die Überlegenheit der literarischen Modellierung gegenüber der Empirie des Augenscheins, die Gestaltung eines Mythos als Ausdruck einer menschlichen Wahrheit. Denn Faulkner »wiederholte das Land und die Menschen am Mississippi so endgültig, dass sie nie aufhören werden, zu bestehen«.
Für den einstigen blutjungen Seekadetten und »Heldenlehrling«, der nach eigenem Bekunden Hitler erst nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 aus der Distanz gesehen und als besiegbar erkannt habe, bedeutete die literarische Welt-Öffnung der Nachkriegszeit auch einen neuen Blick auf die eigene Herkunft und Geschichte. Der 1966 erschienene Essay Ich zum Beispiel, eine explizite Entfaltung der Selbstbefragung, die er in Der unspaltbare Nachtkern zwei Jahre zuvor implizit begonnen hatte, erzählt die Geschichte der eigenen Jugend im Dritten Reich als Beispiel »eines Jahrgangs«. Dass man »die Bedeutung von Vergangenheit« erkennen müsse, gehört da zu den Lektionen, die er von Hemingway lernt. »Ich wollte«, schreibt Lenz, »gleichzeitig verstehen und zugeben: so begann ich zu schreiben.« In späteren Essays wird das damit Umschriebene noch schärfer, offensiver benannt, bis hin zur ausdrücklichen Bewunderung für die Forderung des deutschen Bundespräsidenten Gustav Heinemann nach einer »Solidarität der Schuld«. Nach dem Ineinander von »Irrtum und Schuld« fragt er noch bei der Lektüre von Thorkild Hansens Der Hamsun-Prozeß (1979); wenig später (1982) liest er dann Halldor Laxness’ Sein eigener Herr als eine bewusste Antwort auf Hamsuns in der Nazizeit missbrauchtes Epos des Bauerntums.
Schon der früheste hier aufgenommene Essay, ein Artikel über das – oder sollte man sagen: gegen das? – allseits gefeierte Jubiläum des Turnvaters Jahn, gerät ihm zum Musterstück einer kulturgeschichtlichen Reflexion, in der die deutsche Vergangenheitsbewältigung über die NS-Zeit hinaus zurückverfolgt wird. Lenz, der Sportler, der selbst einen der großen deutschen Sportromane geschrieben hat, Brot und Spiele – dieser Lenz beschreibt nun aus Anlass des Jahn-Jubiläums »die Geburt der Turnkunst aus dem Geiste nationalen Ressentiments«. Mit Heine beäugt er Jahns germanisierenden Hass auf alles Nicht- und Undeutsche, und Heines würdig sind manche seiner eigenen Bemerkungen über Jahns »bizepsgeschwelltes Demagogentum« – im selben Jahr 1961, in dem das Werk des Turnvaters noch deutschlandweit als pädagogische Großtat gepriesen wird. Die Geschichte, so eröffnet er diesen Essay, werde von uns nicht aufgesucht, »sie sucht uns heim«. Der diesen Satz schreibt, weiß, wovon er spricht. In seinem Essay Der unspaltbare Nachtkern, geschrieben im Jahr 1964, schildert der Überlebende der NS-Zeit und Deserteur der letzten Kriegstage die »äußerste Lage, in der wir überprüft werden«, in dezidiert autobiographischer Perspektive als eine Konstellation, in der »die Alternative lautet: leben und schuldig werden oder sterben und schuldlos bleiben«.
So ist es denn wohl auch dem Eindruck der amerikanischen Begegnungen zu verdanken, wenn Lenz’ Essays der sechziger Jahre so etwas wie einen privaten Funktionswandel der Literatur protokollieren. Für den masurischen Jungen hatte einst die Lektüre der reißerischen Abenteuerhefte, die er in Erste Lese-Erlebnisse so eindringlich in Erinnerung ruft, Fluchtwege der Phantasie aus der Enge des Alltags eröffnet. Von Jörn Farrows packenden U-Boot-Abenteuern aber war es dann nur ein unheimlich kleiner Schritt gewesen zur Verklärung eines fatalen Heldentums in der Hitlerjugendliteratur; da hatten auch die vom Lehrer nahegelegten Gegenlektüren Kästners, Lessings, der Brüder Mann wenig ausrichten können. Wenn Lenz rückblickend ausgerechnet bei seiner Kriegsgefangenschaft an eine »schöne Kulturanstrengung« denkt, dann deshalb, weil von hier an eben Schriftsteller wie Hemingway und Faulkner dem jungen Mann, der kurz vor dem Kriegsende desertiert war, eine neue, weltoffene Literatur zeigten und durch die Literatur eine neue, offene Welt. Hemingway, so erinnert sich Lenz in dem ihm gewidmeten Essay, habe ihm zuerst die Möglichkeit gezeigt, zu »schreiben mit dem einzigen Wunsch, verstehen zu lernen«.
Schreiben wird für den Erzähler wie für den Essayisten schon früh und wegweisend zur Bearbeitung einer deutschen Schuld, die er – Siegfried Lenz, Jahrgang 1926 – auch als die seine empfindet. Und eben weil Zugeben und Verstehen für ihn verschwistert sind, darum wird dieses Schreiben schon so bemerkenswert früh und entschieden zum Beginn eines Austausches, der auch vor unüberwindlich erscheinenden Grenzen nicht zurückscheut.
Wie lebhaft und unverklemmt dieser Austausch werden kann, das zeigt beispielhaft die ruhige Präzision seines Plädoyers für die Aufnahme von Beziehungen mit Polen, geschrieben 1965. Selbst einer von denen, die ihre Kindheitsheimat in Masuren verloren haben, spricht Lenz darin nicht vom eigenen Schmerz, sondern erinnert an verdrängte Schuldzusammenhänge: an den einfachen Sachverhalt etwa, dass Polen »unter der Diktatur Hitlers am meisten gelitten hat«. Auch anderes spricht er aus, was damals viele Deutsche, vor allem seine eigenen ostdeutschen Landsleute, nicht hören wollten, »was von unserer Seite verschwiegen wird«, beispielsweise dass auf Polens »Territorium einst die größten Konzentrationslager errichtet wurden«. Eindringlich gibt er zu bedenken, dass in Anbetracht des kollektiven Verschweigens und Verdrängens, in einer Lage politischer Beziehungs- und Sprachlosigkeit doch zuerst die Literatur gefordert sei – dass es also wohl die Schriftsteller beider Länder sein sollten, die »auf die Herausforderungen einer Unterlassungspolitik« antworten.
Lenz schreibt das vier Jahre bevor mit der Wahl Willy Brandts zum Bundeskanzler die Möglichkeit einer neuen Politik überhaupt in Sichtweite rückte. Und er zeigt mit diesem Text exemplarisch, worin für ihn die moralische und damit auch die politische Verantwortung einer Literatur liegt, wie er sie verstehen gelernt hat: einer Literatur, deren Aufgabe (und deren Wesen) die Öffnung des Blicks und des Denkens ist, die Einübung in ein Verstehen, das Gegensätze nicht aufheben muss, sie aber in Beziehung zueinander bringt. Medium der Vielfalt und der Widersprüche soll die Literatur sein; das, nicht bestimmte Verhaltensanweisungen und Deutungsvorgaben, ist für ihn die eigentliche Botschaft.
Ebendarum findet sich im selben Essay über die Schriftsteller und die deutsch-polnische Stummheit der Satz: »Wir werden immer skeptisch sein, sobald eine Literatur uns zu gewissen idealen Meinungen rät, uns bestimmte Handlungen empfiehlt, uns zu überreden sucht, für die Errichtung dieser oder jener Paradiese zu sorgen.« Wie eine bessere Gesellschaft aussehen könnte, das sollte nach seiner Überzeugung zuerst deren Mitgliedern überlassen bleiben; festgelegt sehen will dieser Schreiber allein die Grundsätze der Offenheit und der Gleichberechtigung des Meinungsaustausches. Weil sie sich aus dieser Grundforderung nach gleichberechtigter Teilhabe zwingend ergibt, darum kann Lenz hier wie an vielen anderen Orten nicht davon absehen, »für eine Solidarität der Gedemütigten einzutreten«.
Lenz’ Vertrauen in die Möglichkeiten der Literatur ergibt sich aus diesem Eintreten für eine offene, in ihrem Pluralismus versöhnte Gesellschaft (und umgekehrt): »Es ist Unvorstellbares geschehen. Damit aber das Geschehene anerkannt wird und zu wünschenswerten Konsequenzen führt, braucht die polnische Literatur hierzuland mehr Leser, und zwar Leser, die bereit sind, sich, wenn es sein muß, entsetzen zu lassen. Im Entsetzen liegt durchaus eine Möglichkeit oder doch ein Anfang zu klaren Beziehungen: wir erkennen uns in den Leiden der andern.« Der Polen-Essay beglaubigt und konkretisiert mit jeder Zeile, wovon diese Grundsätze sprechen.
Gegen alle ideologischen Festlegungen einer Gesellschaft – und in diesem keineswegs feindlichen, nur zurückhaltenden Gegenüber sieht Lenz ihren eigentlichen Ort – »plädiert Literatur dafür, eine Wirklichkeit nicht als endgültig hinzunehmen. Auch auf Schleichwege angewiesen, besteht sie noch auf einer offenen Welt«; so schreibt er in seinen 1981 veröffentlichten Mutmaßungen über die Wirkung von Literatur. Grundsätzliche Bemerkungen wie diese finden sich oft fast nebenbei, jedes Mal aber sind sie unmissverständlich. Beispielhaft etwa für das Sprachempfinden des politischen Essayisten Siegfried Lenz ist seine Lektüre von Gustav Heinemanns Reden. Weil ihm darin der leitmotivische Appell zu einem demokratischen Umgang mit der nicht nur politischen Sprache auffällt, darum überprüft er ihren eigenen Sprachgebrauch. Darum rühmt er »den Stil dieser Rede, ihre Kargheit, ihre Eingängigkeit, ihre konsequente Schmucklosigkeit, die dennoch Humor zuläßt« und damit selbst praktiziert, was sie fordert – so wie eben der Essay, in dem dieser Satz steht. Und darum kann er im selben Atemzug Heinemanns undifferenzierter Ablehnung von Fremdwörtern, namentlich von Amerikanismen, freundlich und bestimmt »die Bereicherung« entgegenhalten, »die unsere Sprache durch sie erfährt«.
Dem Existenzialismus verpflichtet bleibt Siegfried Lenz auch dort, wo die literarischen Vorbilder verblasst sind und die Sprechweisen sich geändert haben. Seine Liebe gilt der offenen Gesellschaft, in der jedem Einzelnen die Freiheit der Entscheidungen gelassen ist; sein Misstrauen gilt allen Forderungen, den Einzelnen diese Entscheidungsfreiheit wohlmeinend wieder abzunehmen. Von ihm waren Plädoyers für die vermeintlich idealen Gesellschaften in Nordkorea oder in Maos China so wenig zu bekommen wie eine Relativierung der Nazivergangenheit. Umso entschiedener aber bezieht er Stellung, wo er die Prinzipien der offenen Gesellschaft und der Brüderlichkeit verletzt sieht.
Es ist wunderbar zu sehen, wie offen und neugierig, wie bereit zum Staunen er die Lebenserinnerungen Pablo Nerudas liest, in denen doch für »die Errichtung dieser oder jener Paradiese« durchaus handfeste Empfehlungen gegeben werden – derselbe Lenz, der den Verkündern auch eines sozialistischen Heils misstraut, und durchaus ohne Aufgabe seines Vorbehalts. Lenz liest diesen Text, mitsamt den Porträts von Mitkämpfern wie Fidel Castro und Che Guevara, nicht nur bewundernd, sondern liebevoll, weil er begreifen kann – und nun seinen Lesern begreiflich macht –, wie sich die politischen Entscheidungen aus den Forderungen des Tages ergeben haben: »die Poesie schlägt gewissermaßen die Augen auf und findet sich unvermeidlich der Politik gegenüber.« Wenn aber Lenz doch den Wegen Castros und Ches keineswegs folgen will, warum empfiehlt er dann so eindringlich die Lektüre ihres Weggefährten Neruda? Weil er in dessen Haltung einen »archaischen Liebeskommunismus« erkennt, der »als äußerste Bestätigung des Menschen den Begriff der Brüderlichkeit« proklamiert, und weil mit der erst anderthalb Jahre zurückliegenden Ermordung Salvador Allendes auch dieser Begriff geschändet worden ist.
In dem so präzisierten Sinne war und blieb auch der Sozialdemokrat Lenz ein politisch engagierter Autor, eben weil er seine demokratischen Maximen nicht als dekorative Kalendersprüche, sondern als moralischen Auftrag verstand: »Ich persönlich«, so bemerkt er am Ende des Neruda-Essays, »halte die Besorgnis erstaunlich vieler Leute, das schriftstellerische Talent könne durch politisches Engagement Schaden nehmen, entweder für arglos oder für heuchlerisch. Der Schriftsteller – meinetwegen auch: der Dichter – ist kein Zierfisch.« Es ist bezeichnend, dass Lenz dasselbe Bild in seiner Friedenspreisrede in der Frankfurter Paulskirche noch einmal verwendet, dreizehn Jahre später: Wer den Schriftsteller als »Zierfisch« betrachte, als »Sachwalter des Scheins«, habe das genuine Ethos der Literatur missverstanden.
Metaphern wie diese sind witzig, und sie vermögen sehr zielsicher die kollektiven Schmerzpunkte seiner Hörerschaft zu berühren. Weil Lenz auch als Essayist und Redner die Diskretion liebt, hat man die Provokationskraft seiner Argumente zuweilen unterschätzt. Doch so leise die Zimmerlautstärke seiner demokratischen Reden klingt und so leicht ihr um Verständnis und um Verstandenwerden bemühter Ton ist, so scharf sind seine Argumente, so präzise die Analysen, die ihnen vorangehen. Nein, die Unbarmherzigkeit, die manchen Literaturkritikern als Ausweis der Unbestechlichkeit galt, ist seine Sache nicht. Stattdessen aber zeigen seine literarischen Essays, zu welchen differenzierten Einsichten eine Kritik imstande ist, die barmherzig sein will, gewissenhaft und nach Möglichkeit wahrheitsgemäß. Exemplarisch zeigen das die aufmerksamen und kritischen Würdigungen Ernst Jüngers und Heinrich Bölls. Beiden denkbar gegensätzlichen Schriftstellern widmet er eine Lektüre, die ihre Absichten zu verstehen sucht, ihre Vorzüge benennt und ihre Schwächen nicht verschweigt.
Bölls verletzliche, unglückliche, klagende Helden etwa: Sie zeigen sich Lenz’ fragendem Blick als »Leibeigene ihrer Erfahrung« und eben in dieser freiwilligen Fixierung als im Grunde unfähig zu ebenjener Freiheit, nach der es sie doch so inständig verlangt. Sie tragen »ihre Leiden nicht schön zu Markte« – aber »ein abgründiges Einverständnis mit ihrer Lage« hält sie im Leiden gefangen. Weil Böll sie aber vor allem aus dieser »Leidenswilligkeit« bestehen lasse, darum erscheinen sie Lenz als letztlich »unwirkliche Leute«. Genauer und kürzer hat niemand die tiefe Verwurzelung Bölls in der radikalen Armutstheologie eines Léon Bloy erkannt, ohne diese Quelle benennen zu müssen. Und genauer, kürzer und diskreter hat niemand die ästhetisch heiklen Konsequenzen dieser Leidens- und Armutsverklärung beim Namen genannt, als Lenz es mit der Beobachtung tut, die Gegenfiguren der Böll’schen Helden dienten »mehr der Belichtung als der Modellierung«. Weil er ihn aber so skeptisch und solidarisch, so verständnisvoll und distanzwahrend zugleich gelesen hat, darum kann Lenz dem Kollegen und politischen Mitstreiter, diesem Anwalt der »berufsmäßig Trauernden«, dann auch so entschieden die eigene Überzeugung entgegenhalten, »daß es heute keine praktizierbare Alternative zur Massengesellschaft gibt, zumindest nicht diese Alternative: Ursprünglichkeit«. Und erst nachdem das alles geklärt ist, kann er schließlich sich selbst mitsamt solcher Gewissheiten wieder dem Böll’schen Gegen-Zweifel aussetzen: Wird man nicht doch, Böll lesend, »zum Leser seiner eigenen Not«? Und wenn dem so wäre, »warum sollte ein Autor nicht das Recht haben, sein Interesse begrenzten, gewissermaßen verfügbaren Charakteren zu widmen?«
Nicht dass in diesen schwebenden Fragen die eigenen Bedenken verschwunden wären, sie werden nur mit der stark gemachten Gegenposition konfrontiert. Hermeneutik, hat Hans-Georg Gadamer geschrieben, sei die fortgesetzte Kunst des Gesprächs. Nimmt man das beim Wort, dann ist der Essayist und Kritiker Siegfried Lenz ein geborener Hermeneutiker. Für ihn heißt alles verstehen auch: vielem widersprechen, aus dem Widerspruch erst ergibt sich ein tieferes Verständnis.
In ganz ähnlicher Weise gelingt auch Lenz’ Beitrag zu Ernst Jünger, wahrhaftig einem Antipoden Bölls, eben deshalb so glänzend, weil er gar nicht glänzen will, sondern nur genau sein. Geschrieben ist der Text aus Anlass des siebzigsten Geburtstags und des abermals von Jünger eingreifend redigierten Schlussbandes der ersten Werkausgabe. Und pointiert sind die Formulierungen auch diesmal, indem sie sich auf Augenhöhe mit ihrem Gegenstand bewegen. Wo Anspielungen auf Werktitel oder Stichworte der Jünger’schen Selbststilisierungen ins Auge fallen, dienen sie nicht dem Nachweis der eigenen Belesenheit, sondern der prägnant abkürzenden Charakterisierung: In »funkelnder Dunkelheit« habe Jünger seine durch die Selbstredaktion »schon veredelte Beute« gemacht, »in sehr subtilen Grabenkämpfen der Erkenntnis«. Dass der Meister der subtilen Jagden sich in seinen Tagebüchern auch als Hauptmann zeigt, gibt dem Kritiker die Gelegenheit festzustellen: »Man fühlt sich zur Lagebesprechung angehalten.« In der Tat, eine Lagebesprechung ist dieser Essay im vollen, Jüngers eigene Maximen ernst und beim Wort nehmenden Sinne. Ob »der große Zauberer auf dem Grunde seines Huts einen Tausch vorgenommen und den nationalen Knallfrosch durch das weiße Kaninchen des Humanismus ersetzt hat« – diese Frage resümiert den verbreiteten Argwohn gegenüber dem Rückzug des Hauptmanns in den einsamen Waldgang, und sie lässt dem Zauberer doch auch dort seine Größe, wo er womöglich nur Taschenspielertricks vorführt.
Wer hätte schärfer, als Siegfried Lenz es hier tut, Jüngers einstigen »dünkelhaften Nationalismus und das feudale Frostblumen-Ideal seiner Ästhetik« benannt, und wer hätte unter dieser Prämisse glaubwürdiger als er dem »hochempfindlichen Einzelgängertum« des Gewandelten seinen Respekt gezollt? Wer könnte einfühlsamer den »in der Gesamtausgabe gefangenen Schriftsteller« betrachten, wie er, »gebeugt über sein rissiges Selbstbildnis«, mit den Geistern der eigenen Vergangenheit kämpft? Noch wo er Jüngers ursprüngliche Textfassungen gegen seine teils beherzten, teils verschämten Revisionen verteidigt, tut er das »nicht frei von Staunen«.
Das ist der Grundzug, der all diese unterschiedlichen Lebens- und Leseäußerungen des Schriftstellers Siegfried Lenz verbindet und zusammenhält: ihre Bereitschaft zum und ihre Freude am Staunen. Der hier titelgebende Essay über den Müßiggang als »Gelegenheit zum Staunen« und das benachbarte Bekenntnis zur »Lieblingslandschaft« der Flensburger Förde als einer Landschaft »der schönen und ergiebigen Langeweile«: Nicht nur als Ausdruck einer allgemeinen Lebenseinstellung haben diese frühen Essays programmatische Bedeutung, sondern auch als Einspruch gegen eine ökonomische Geschäftigkeit, die mit den Wirtschaftswunderjahren keineswegs verebbt ist. Weil der Bewunderer Hemingways und Faulkners von der Literatur ein aufmerksames Gehör für die Stimmen der Toten verlangte, für die Gegenwärtigkeit des Vergangenen, deshalb wurde er zum Anwalt, zur Stimme einer Gelassenheit, der man nicht mehr anmerkt, wie mühsam sie errungen ist.
Weil er seinen Gegenständen mit der Bereitschaft zum Staunen begegnet, darum sieht er sie so genau, so einfühlungs- und lernbereit an, als sähe er sie zum ersten Mal; und weil er sie so betrachtet, als könne sich infolge dieser Betrachtungen jederzeit sein Leben ändern, wahrt er auch im Staunen die aufmerksame Distanz. Dieser Schriftsteller ist ein aufgeklärter Romantiker und ein romantischer Aufklärer, eine seltene deutsche Doppelbegabung.
»Ja, ich weiß«, schreibt Lenz am Ende seines Böll-Essays, mitten im Rebellionsjahr 1967, »die Literatur liegt weit hinter unseren Einsichten zurück.« Anthropologie, Biologie, Soziologie hätten ihr die alten Kompetenzen streitig gemacht. Es sind Einwände, die heute nicht weniger aktuell klingen als ein halbes Jahrhundert zuvor: Wo aus Poesie endlich Wissenschaft geworden sei, da werde der Literatur ihre Daseinsberechtigung streitig gemacht. Warum verteidigt dieser Schriftsteller sie trotzdem so beharrlich? »Ich glaube«, so lautet seine Antwort, die hier zum so unfeierlichen wie entschiedenen Bekenntnis wird, »ich glaube, die Literatur hat nichts von ihrer Funktion eingebüßt, zur Erkenntnis des Menschen in der Zeit beizutragen; zumindest die Möglichkeiten der Erkenntnis festzustellen. Es kommt ihr weniger darauf an, Fragen des Daseins zu lösen, als Fragen an das Dasein zu stellen.«
Fragen an das Dasein: In solchen Wendungen wird noch einmal der Ursprung von Lenz’ Schreiben im Existenzialismus spürbar, nun aber bezogen auf die im Augenblick der Veröffentlichung vorherrschende und im Rückblick als so voreilig erschienene Rede vom Tod der Literatur. Keine der in den Nachkriegs-Jahrzehnten kursierenden kulturkritischen Thesen könnte seinem Credo ferner und fremder sein, seiner inständigen Hoffnung auf die Fähigkeit der Literatur zur Befragung der Gewissheiten, zum Beharren auf dem unveräußerlichen Recht des Einzelnen gegenüber dem Allgemeinen, zur Schulung von Solidarität und Empathie. »Josef K. und Julien Sorel«, so erklärt er fast beschwörend beim Wiederlesen der Romane von Max Frisch 1981, »Fürst Myschkin und Kapitän Ahab haben mehr zur Erkennbarkeit der Welt und des menschlichen Herzens beigetragen als ganze Archive dokumentarischer Erlebnisberichte.« In seinem 1993 erschienenen Versuch Über den Schmerz greift er diesen Grundgedanken auf und verknüpft ihn mit dem alten, wieder erneuerten existenzialistischen Blick auf Leiden und Hoffnungen aller Menschen, die in der Literatur immer als einzelne Menschen sichtbar werden: »Die überlieferten archetypischen Konflikte der Literatur heben die Zeit auf. Seine Wange an den Stein geschmiegt, wird Sisyphos ihn immer zum Gipfel hinaufstemmen und, wie Camus meint, ein kurzes Glück empfinden, wenn er dem hinabgerollten Brocken folgt. Hamlet wird niemals aufhören, das Zaudern vor weitreichenden Entschlüssen zu legitimieren.« (Wohlgemerkt: nicht lediglich zu verkörpern, sondern zu rechtfertigen!) »Rücksichtslos gegen seine Mannschaft, wird Kapitän Ahab uns für alle Zeiten vor Augen führen, welche Opfer gebracht werden müssen, um den weißen Wal der Träume zu erlegen. Und auch sie, die gehorsame Tony Buddenbrook, die uns das Erbarmungslose in den Konventionen der bürgerlichen Welt vorführt, wird für immer den klassischen Konflikt zwischen Pflicht und Neigung personifizieren.«
Das Geschichtenerzählen wird in solchen Passagen – denen sich leicht weitere an die Seite stellen ließen – zum Mittel nicht einer Verkündigung bestimmter Botschaften, sondern zur Einübung in die Einfühlung, zur Einübung in eine Gesellschaft, in der aus den Einzelnen ohne Aufgabe ihrer Einzelheiten offene, freie und solidarische Wesen werden können. Als das »unkontrollierte Zwiegespräch mit dem Einzelnen« beschreibt er einmal das Lesen, in einer denkwürdigen Formulierung. Nicht dass Lenz grundsätzlich etwas gegen Botschaften hätte; manche von ihnen, diejenigen einer sozialen Demokratie und einer christlichen Nächstenliebe etwa, sind seinem Herzen und seinem Verstand offenkundig nahe, und er teilt sie mit Gefährten wie Grass oder Böll. Nur sieht sie der Schriftsteller Siegfried Lenz, so scheint es, eher als einen der Begleitumstände der Literatur an, nicht als ihren eigentlichen Gegenstand. Was allein die Kunst des Geschichtenerzählens vermag, das ist die Möglichkeit, Sisyphos und Hamlet, Ahab und Tony Buddenbrook neben- und miteinander zu sehen und, wer weiß, in sich selbst oder in seinen Nächsten etwas von ihrem Zaudern und Glück, ihren Leiden und Träumen wiederzuerkennen. Vielleicht sind ihm gerade darum die zögernden und zweifelnden unter seinen literarischen Zeitgenossen, Autoren wie Wolfgang Koeppen, Manès Sperber oder Paul Celan, so besonders nahe und lieb.
Dabei liegt ihm, dem Liebhaber der Distanz, eine Überschätzung auch dieses Potenzials der Literatur durchaus fern. Im selben Essay, in dem er die Wirkung von Literatur in der Einübung einer offenen Gesellschaft sieht, bemerkt er selbstironisch: »Man tut gut, sich als Schriftsteller daran zu erinnern, daß mehr als achtzig Prozent aller Menschen in der Welt ohne unsere Produkte auskommen; und es ist nicht auszuschließen, daß diesen Menschen die Bedingungen ihres Glücks ebenso bekannt sind wie die Ursachen ihres Unglücks – ohne Aufklärung durch Geschriebenes, ohne Erkenntnishilfe durch Literatur.« So viel dieser leidenschaftliche Leser den Schriftstellern zutraut, der Gedanke, sie sollten zu Lehrmeistern werden und zu Führern in eine bessere Zukunft, ist ihm auch dann verdächtig, wenn er ihn bei Freunden wie eben Böll oder Grass zu bemerken meint (man lese nach auf Seite 206).
Wieder zeigt er sich hier als, im Wortsinne, gebranntes Kind jener Zeit, die der Literatur von Staats wegen vorschrieb, wie sie auf Glück und Unglück ihrer Leser einzuwirken habe. Sollte sie also, wenn es nach ihm geht, unpolitisch werden? Aber keineswegs, fügt er sogleich hinzu; nur dürfte, ja sollte es doch auch zwischen Literatur und Politik lieber beim »alten Gegenüber« bleiben als beim einträchtigen Miteinander: »Zögern ist angebracht, Skepsis bekommt uns.« Ein kleiner Satz wie dieser resümiert auf engstem Raum die politischen wie die literarischen Überzeugungen des Essayisten Siegfried Lenz. Und wieder geschieht das nicht nur in dem, was er schreibt, sondern auch in der Weise, in der er sie ausdrückt: in der unpathetischen Lakonie und Leichtigkeit, in dieser wunderbar höflichen Diskretion seines demokratischen Stils.
Heinrich Detering
Vorturner der Nation
Friedrich Ludwig Jahn: ein Jubiläum in moll
Geschichte gibt uns keinen Anlaß zur Nachsicht, denn sie sucht uns heim. Geschichte ist auch keineswegs der objektive Stoff, der in den Verliesen der Zeit ruht, schweigend und entrückt, sozusagen die verdaute Speise des Weltgeistes. Von der Geschichte geht vielmehr eine permanente Herausforderung aus, die jeden in seiner Gegenwart betrifft, die jeden zwingt, seine Fragen an vergangene Begebenheiten zu stellen. Insofern ist Geschichte eine Möglichkeit zum Selbstverständnis.
Das wird immer deutlich, sobald wir irgendwelche Jubiläen begehen und dabei versuchen, diesen Jubiläen eine Rechtfertigung zu geben; und wer selbst einmal Jubiläums-Redner war, wird sich seiner verzweifelten Bemühungen erinnern, gleichsam die goldenen Kettenglieder freizulegen, mit denen Vergangenheit und Gegenwart verbunden sind. Wer sich an diesen Kettengliedern entlangtastet, wird sehr bald spüren, daß Geschichte etwas ist, an dem man gegenwärtigen Verdruß oder gegenwärtiges Leid finden kann, beziehungsweise daß die historische Ferne eine beunruhigende Nähe haben kann.
Mir jedenfalls ging es so bei einem wenig beachteten Jubiläum, das gleichwohl ein bemerkenswertes Jubiläum ist: vor 150 Jahren, im Frühjahr 1811, zog Friedrich Ludwig Jahn, der sogenannte Turnvater, mit einer Schar von Knaben hinaus auf die Hasenheide bei Berlin und weihte dort den ersten Turnplatz ein. Die Entdeckung des Körpers schien hier vorzeitig erfolgt zu sein. Unsere deutsche Turnkunst, die sich heute zu Recht auf so viele Anhänger beruft, die der reinen Freude absichtslosen Spiels huldigen, nahm hier ihren entscheidenden Anfang. Turnvater Jahn aus dem Dorfe Lanz bei Lenzen, der 1778 geborene Sohn eines Predigers, gilt als ihr Erwecker und Mentor, als ihr besessener Förderer. Er wurde von Brodwolf in Stein gehauen, neben Scharnhorst und Gneisenau, neben Fichte und Schleiermacher; man hat ihm Bücher gewidmet und Denkmäler errichtet: der bärtige Erzieher zu »Vollkraft und Biederkeit« wurde für seine Verdienste mit Unsterblichkeit belohnt. Friedrich Ludwig Jahn ist längst ein Monument der Geschichte.
Doch dies Monument drückt und bedrückt und wirft kühle Schatten. In der Geschichte zählen auch die Beweggründe, die Ziele; wenn man das Monument daraufhin befragt, stellt sich alsbald eine Unsicherheit ein, ein gewisses Frösteln. Und wenn man unverdrossen weiterfragt, den Begründer der deutschen Turnkunst von allen Seiten betrachtet, dann stellt sich auch Melancholie ein und ein Maß von Unruhe, das wir nicht für möglich gehalten hätten. Es beginnt sich zu zeigen, daß Geschichte in der Gegenwart anwesend ist. Der Vorturner der Nation ist unter uns.
Friedrich Ludwig Jahn, dieser »Nationalromantiker mit einem Überfluß an vaterländischen Gefühlen«, ist nicht unschuldig daran, wenn aus dem heiteren Anlaß des Gedenkens unwillkürlich ein Jubiläum in moll wird.
Als er sich als Vorturner der Nation einführte, tat er dies aus dem obligaten Patriotismus, der damals, beim Zusammenbruch des preußischen Staates, eine selbstverständliche Erscheinung war. Er ließ keinen Zweifel daran, welchen Beweggrund die deutsche Turnkunst hatte, welch ein Ziel. Er selbst sagt es in einem Brief an seinen Lehrer Zernial: »Es lag in der Natur der Sache, daß man schon damals, als das Turnen begann, den Knaben und Jünglingen nicht verschwieg, daß ihre Übungen vorzüglich den Zweck hätten, sich körperlich zum Kampf gegen den Feind des Vaterlandes zu erkräftigen, daß man sie mit glühendem Enthusiasmus für das Vaterland zu beseelen, mit Haß gegen den Feind zu erfüllen suchte. Ersteres, daß nämlich die Turnübungen dazu dienen sollten, in den Turnern Kräftiger des Vaterlandes zu erschaffen, wurde auch fortwährend den Turnern mitgeteilt.«
Die deutsche Turnkunst war für ihn schlicht »die Schutz- und Schirmlehre einer Wehrhaftmachung«, und es versteht sich, daß jeder Klimmzug am Ast einer Eiche, jeder Handstand am Barren als Dienst am Vaterland angesehen wurde.
Gewiß, auch der erste Anlaß des griechischen Sports, der frühen hellenischen Gymnastik, lag ausschließlich in dem Wunsch nach Wehrertüchtigung, aber die Griechen gingen nicht so weit, in der Stärkung des Bizeps das allerbeste Mittel zur Volkserziehung zu sehen. Jahn tat dies. Nachdem sich die Geburt der Turnkunst aus dem Geiste nationalen Ressentiments vollzogen hatte, erläuterte er nach und nach, wozu er den turnenden Menschen erziehen wollte. Für Jahn war Turnen eine nationale Andachtsübung; es war »geschichtemächtiges Tun«. Der Turner wird in Rede, Feier und Lied »erfaßt«, kleidet sich »deutsch« (das heißt: in graues Leinen), ißt Salz und Brot, und falls er Durst bekommt, labt er sich vorzugsweise mit einem Trunk aus deutschem Quellwasser; überhaupt läßt Jahn nur gelten, »was aus altdeutscher Wurzel gezogen ist«. Darum erzieht er seine Turner methodisch zu einem Haß auf jede weltfreie Geistigkeit. Er sprach vom »öden Elend wahngeschaffener Weltbürgerlichkeit« und plädierte für ein grobes, wie er meinte: herzerfrischendes, deutsches Mannestum. Schließlich setzte er sich dafür ein, daß jeder, der beharrlich wider das Deutschtum handelte, vom Turnplatz gewiesen würde. Dieser Tatbestand war für den unsterblichen Provinzler bereits erfüllt, wenn jemand die französische Sprache lernte; das war sogar ein Doppelvergehen, da es außerdem »zur Hurerei« anleitete.
Offenbar gehörte auch das zu des Turnvaters pädagogischem Programm, die Jugend auf dem Turnplatz zu »humanisieren«. Schon damals also verstand man sich auf terminologische Rabulistik; denn wie Diesterweg folgert, war die »Humanisierung« auf dem Turnplatz gleichbedeutend mit einer Injektion Haß gegen das Franzosentum. Heinrich Heine zog in seiner »Romantischen Schule« eine besorgte Bilanz:
»Der Patriotismus des Deutschen bestand darin, daß sein Herz enger wird, daß es sich zusammenzieht wie Leder in der Kälte, daß er das Fremdländische haßt, daß er nicht mehr Weltbürger, nicht mehr Europäer, sondern nur ein enger Deutscher sein will. Da sahen wir nun das idealistische Flegeltum, das Herr Jahn in System gebracht; es begann die schäbige, plumpe, ungewaschene Opposition gegen eine Gesinnung, die eben das Herrlichste und Heiligste ist, was Deutschland hervorgebracht hat, nämlich gegen jene Humanität, gegen jene allgemeine Menschenverbrüderung, gegen jenen Kosmopolitismus, dem unsere großen Geister, Lessing, Herder, Schiller, Goethe, Jean Paul, dem alle Gebildeten in Deutschland immer gehuldigt haben.«
Sicher, Jahn hat gegen den Anspruch der Schule ein gewisses Recht auf Leibesübungen gefordert. Er hat den Turner auf die Einhaltung von Regeln verpflichtet und sich bemüht, ihn zu »Geradheit und ernstem Gutmeinen« zu erziehen; aber dieses »ernste Gutmeinen« war halt mit der Turneruniform drapiert, aus der später die Uniform der Lützowschen Jäger wurde.
Doch gerechterweise sollte man nicht nur danach fragen, wozu Jahn den Turner erziehen wollte, sondern auch wie und mit Hilfe welcher Mittel er es vorhatte.
Diese Mittel sind sehr aufschlußreich, sie sagen auch denen etwas, die immer noch der Meinung sind, daß sich die Auffassungen des begrenzten Spiels bei Jahn und Huizinga annähernd decken.
Was also tut und wie verhält sich des Turnvaters Zögling, sobald er den Platz betreten hat?
Zunächst bekennt er sich zu der Gemeinschaft der Turner, wird einer Riege zugeteilt, die der »Anmann« (der Vorturner) befehligt, der in der sogenannten Turnrast (der Pause) durch vaterländische Ansprachen für die rechte Einstimmung sorgt. Die Erweckung und Ausbildung des Bizeps »zerfällt« in bestimmte Vor- und Hauptübungen und stellt sich so dar:
»Erstens: das Gehen. Hierbei wird in den Vorübungen Anstand, Dauer, Schnelligkeit und Gewandtheit geübt. Als Turnübung betrachtet man 1. den Kriegsschritt, wobei Haltung des Körpers, das Blickwerfen oder die Kopfbewegung, halbe und ganze Wendung, gewöhnlicher und Geschwindschritt, die Richtung in Gliedern, das Schließen, Marsch geradeaus, der Schräg- und Reihenmarsch, die Richtungsveränderung, Auslaufen der Rotten, Schwenkung von der Stelle und im Marschieren berücksichtigt wird.
Das Laufen: Vorübungen sind langsames Traben und Ablaufen eines Weges von 10 Minuten, die endlich kaum zum dritten Teil gebraucht werden. Dabei darf keiner am Ziel außer Atem seyn.
Turnübungen sind: der Schlängellauf, der Schnellauf und schließlich der Springlauf, welcher zur Absicht hat, die beim Laufen sich entgegenstellenden Hindernisse des Bodens durch Sprung zu überwinden, was man durch aufgeworfene Gräben bewirken kann.
Das Springen: der Sprung, welcher mit Beihülfe der Arme und Beine geschieht, ist ein gemischter, der hingegen, welcher nur durch Schnellkraft der unteren Glieder erfolgt, ein reiner Sprung. Zu Sprüngen gehören Hochsprung, Tiefsprung, Weitsprung, bei dem als Turnübung gilt: der Sprung über den langen, ein Fuß tiefen Graben, zuerst ungebunden, dann mit Gewehr, endlich im Trab.«
So lauteten einige Anweisungen zu turnerischer Erziehung. Natürlich gibt es noch mehr davon. Immerhin, in der Bilanz heißt es, »daß alle Turnkunst den jungen Menschen so bilden soll, daß er von den Beschwerden des Lebens soviel als möglich zu seinem Vorteil kehre und insbesondere den Krieg sich erleichtere.«
Die Anlässe, die Methoden und Ziele der Jahnschen Turnkunst sprachen für sich. Die Absichten sind klar: sie denunzieren den Turnvater als »Anmann« einer grob-nationalen Gesinnung, der die guten Ideale des Turnens vielleicht nicht verriet, aber doch den Militärs opferte. Der wehrhafte Vorturner selbst wurde bei der ersten Gelegenheit Werber für die Lützowsche Freischar, später Kommandeur des III. Bataillons.
Selbst wenn man bereit ist, historische Bedingungen als mildernde Umstände anzuerkennen, macht Jahn es einem schwer, sich für ihn zu entscheiden. Durch sein bizepsgeschwelltes Demagogentum, durch das »Rohe und Renommistische« seines Wesens verlor er nicht nur viele Freunde, sondern belastete auch die Ideale des Turnens selbst. Wie bei allen Sektierern ihr Metier, war Turnen für ihn die Mitte der Welt, der Ansatzpunkt zur Veränderung der Welt – und das kennen wir doch: sobald eine Gruppe von Menschen sich darauf geeinigt hat, einer gemeinsamen Leidenschaft anzuhängen, wird aus dieser Leidenschaft ein weltbewegendes Prinzip. Ob es sich darum handelt, gemeinsame Götter zu verehren, eine Gesundheitsmarmelade zu essen oder gemeinsam auf den Insektenstaat zu warten: eines Tages wird man besessen von der Idee, daß die Welt nur unter dem Gesichtspunkt der Gruppenleidenschaft zu verstehen ist.
Für Jahn war das bewegende Prinzip der Welt das Turnen, und zwar in so vollkommener Weise, daß er, figürlich gesprochen, glaubte, durch die Kniebeuge alles ändern und durchsetzen zu können: die patriotische Gesinnung, die Enthaltsamkeit, eine Kleiderreform, eine neue Völkerpsychologie, und wahrscheinlich hätte er Kniebeugen auch gegen abstehende Ohren verordnet.
Nun läßt sich mit einiger Berechtigung darauf hinweisen, daß auch die Einflüsse des modernen Sports nicht eben gering sind: er beeinflußt unsere Kleidung, unseren Haarschnitt und unsere Ernährung gleichermaßen. Das trifft durchaus zu; allerdings – und darin liegt der Unterschied zu Jahn – würde es heute keinem zu proklamieren einfallen: Turnen heißt deutsch sein. Welche Folgen diese Proklamation damals hatte, erwähnt Fritz Simon, ein guter Kenner Jahns, in seinem Buch: »Die deutsche Welt zerfiel nur noch in Turner und Nichtturner. Unter der turnenden Jugend machte sich eine Schwärmerei und Besserwisserei breit, die oft bis zur Geschmacklosigkeit führte. Jahns Grobheit – der Gouverneur von Berlin meinte dazu, man brauche statt Grobian jetzt nur noch Jahn zu sagen – seine Grobheit also wuchs sich bei seinen Anhängern zur Radaulust aus …«
Und das war bezeichnend: das Turnen gab eine Gelegenheit zum Haß auf die Nichtturner, die man »Kuchenbäcker« nannte oder auch »Eckner mit dem Bahgesicht«. Man hatte einen konkreten Gegner, was ja bei solchen Leidenschaften wichtig ist – einen Gegner, den man für eigene und allgemeine Miseren verantwortlich machen konnte. Nun hatte man es in der Hand: sobald Napoleon eine Schlacht gewann, die Preise anzogen oder Wolkenbrüche den Turnplatz aufweichten – die Nichtturner, so konnte man jetzt sagen, waren an allem schuld.
Unter Kennern Jahns gilt es als ausgemacht, daß man den Turnvater nicht ohne den Schriftsteller, den Amateur-Germanisten Jahn verstehen kann. Die Bücher und Schriften, die dieser Mann veröffentlichte – »Über die Beförderung des Patriotismus im Preußischen Reiche«, »Runenblätter«, »Denknisse«, »Bereicherung des hochdeutschen Sprachschatzes« und sein Hauptwerk »Deutsches Volkstum« – Jahns Bücher zeigen uns einen Autor, der nur die Entsprechung des Turnvaters war.
Bereits die Titel lassen auf einen pädagogischen Schriftsteller schließen, der von einigen Leuten nicht zu Unrecht als »Seher« bezeichnet wurde. (Wie Gottfried Benn sagte, gelten hierzulande Männer als Seher, die ihrem Weltbild sprachlich nicht gewachsen sind.) Der Seher Jahn erhob denn auch in seinem »Volkstum« sehr früh schon die Forderung nach rassischer Reinerhaltung des deutschen Volkes – worauf später seine nationalsozialistischen Lobredner feststellen konnten, daß Jahn »mit diesen Erkenntnissen seiner Zeit um ein Jahrhundert voraus war«. Er spricht sich im »Volkstum« dagegen aus, nackte Statuen öffentlich aufzustellen, da Nacktheit undeutsch sei: »… unser Himmelsstrich will für alle ein Kleid.« Und schließlich empfiehlt Jahn in seinem »Deutschen Volkstum«: »… unreife Bücher sind weit gefährlicher als unreife Kartoffeln; schlechte Bücher verderblicher als ungesundes Fleisch. Es gibt Bücher genug, die von Henkershand samt ihren Verfassern verbrannt zu werden verdienten.«
Diese Empfehlung wurde nicht nur auf der Wartburg befolgt. Die Bücher, die er allein gelten ließ, mußten folgendes enthalten: »… alten kindlichen Sinn, einfältige Lehre, herzliche Biedersprache.«
Selbst Jahns eifrigste Freunde waren sich darin einig, daß dies Werk zumindest absonderlich sei; jedenfalls spürten sie wohl, daß zum Verständnis des Jahnschen »Volkstums« eine bestimmte seelische Disposition notwendig war. Der Turnvater sah sein Volkstum so:
»Wogen rollen um Felsen, Orkane stürmen gegen Alpenhörner, die Erde erbebt und besteht. Den Charakter beugt die Not nicht zum Brechen nieder, neukräftig entsteht er aus Leiden, wie die hinschmachtende Blume von Himmelsthau gebadet. Was im gewöhnlichen Menschengewühl der edle Charakter vollendeter Menschen, das im Völkergebiete das Volkstum. Volkstum ist eines Schutzgeistes Weihungsgabe, ein unerschütterliches Bollwerk, die einzige, natürliche Gränze.«
Selbst wenn nichts gegen Jahn spräche – die Sprache spricht gegen ihn, und zwar sein eigentümlicher Gebrauch der Sprache ebenso wie die spezifisch altdeutsche Sprachwelt, für die er sich unermüdlich einsetzt. Er schreibt:
»Rabennachsprechen, Staarmätzigkeit und Papageienkunst entstellen kein Volk so sehr als das Deutsche. Infolge unserer Affenliebe für fremde Sprachen haben wir in den fremden Sprachlehrern gefährliche Kundschafter ins Land gezogen, durch die Immerzüngler und Näseler unser biederherziges Volk verdorben, unsere sinnigen Weiber verpuppt. Klar wie des Deutschen Himmel, fest wie sein Land, ursprünglich wie seine Alpen, und stark wie seine Ströme bleibe seine Sprache. Sie lerne der Schriftsteller und Redner stimmen, wie der Tonkünstler das Werkzeug, auf dem er Wohllaut hervorzaubert …«
Wenn das erreicht ist, besteht für Jahn die Hoffnung, daß deutsche Dichter zu ihrer notwendigen Aufgabe finden: »… den vaterländischen Heerbaum begeistern und Siege ersingen.«
Das Ideal des Turners deckt sich durchaus mit seinem Ideal des Dichters. Die Dichter sollten Siege ersingen, eine deutsche Bücherhalle sollte ein deutscher Bardenhain sein (nach Möglichkeit in der neuen Hauptstadt Teutonia, von der Jahn träumte), und aus der Walhalla unserer Geschichte sollte eine Geisterversammlung von Helden hervorgehen, die täglich kämpfen, fallen und wieder aufleben. Darin liegt für Friedrich Ludwig Jahn schönstes deutsches Volkstum.
Allerdings muß erwähnt werden, daß Jahn auch verdienstvolle Arbeit leistete; derselbe Mann rügte das Regelunwesen der deutschen Rechtschreibung, plädierte für ein neues deutsches Wörterbuch und setzte sich für einen frühen Leseunterricht in den Schulen ein.
Insgesamt jedoch muß man feststellen, daß Jahn durchaus mit sich übereinstimmt: was der Turnvater anstrebte, setzte der Germanist mit anderen Mitteln fort, und woran es dem Germanisten offenkundig mangelte, das gleicht der Turner wieder aus.
Vor hundertfünfzig Jahren, bei der Einweihung des ersten Turnplatzes, nahm der handgreifliche Ruhm des Turnvaters seinen Anfang. Sein Werk wurde exportiert, wurde besonders von Völkern aufgenommen, die im Turnen eine Möglichkeit fanden, der nationalen Unterdrückung zu begegnen. (»Sokol« der Tschechen, »Strzeliec« der Polen, »Luh« der Ukrainer.) Er hat Nachahmer und Lobredner gefunden und ist auch heute noch für manchen ein seelisches Standbild. An seiner Unsterblichkeit ist schwerlich zu zweifeln.
Es wäre falsch, ihm die Verantwortung für das zu geben, was lange nach seinem Tode unter ausdrücklicher Berufung auf seine Lehre geschah. Aber er zwingt uns, zu sagen, daß von seiner Haltung, von seinem Denken und seiner Gesinnung etwas ausging, was verhängnisvoll wirkte bis in die jüngste Zeit. Er hat seinen Teil dazu beigetragen, die Helligkeit des Geistes zugunsten einer dräuenden Welt dunkler Volkskräfte abzuwerten. Er wird der engherzige Mann bleiben, der alles Weltläufige, Urbane zurückwies und uns zu einem Deutschtum erziehen wollte, das sich darin gefiel, die Welt als Turnplatz anzusehen und die Probleme der Welt als deutscher Turner zu lösen.
(1961)
Gelegenheit zum Staunen
Das hätte ein Grieche zur Zeit Platos hören müssen, ein Mann im antiken Rom oder ein florentinischer Zeitgenosse der Medici: man hätte ihnen einmal sagen sollen, daß unser Leben durch Arbeit geadelt, versüßt oder sogar geheiligt wird; man hätte ihnen gegenüber behaupten sollen, daß der Inbegriff des menschlichen Lebens in der Leistungssteigerung liege – ich fürchte, all die kulturbegabten und kulturstolzen Leute von einst hätte es geschaudert. Sie wären in Versuchung gekommen, diese Ansicht für eine krankhafte Besessenheit zu halten, sie als eine Form undiskutabler Verrücktheit anzusehen. Generationen aufgeklärter und produktiver Müßiggänger hätten durch nichts tiefer erschreckt werden können als durch die heute sprichwörtliche Behauptung, daß Arbeit unser Leben versüßt. Denn sie maßen das Niveau einer Kultur unter anderem auch daran, wie hoch die Muße, das aktive Nichtstun eingeschätzt wurde.
Galt es einst als Zeichen von Urbanität, von Lebensmeisterschaft, wenn man seine Muße hervorkehren und sie gleichsam als Gewinn »ausstellen« konnte, so gilt es heute als zeitgemäß, wenn man sich auf seine Arbeitslast beruft, seine Arbeitswut hervorkehrt: niemand wird übersehen, wie genüßlich überbeanspruchte Leute von ihrer Erschöpfung reden. Die Leute haben nicht mehr ihre Arbeit, sondern die Arbeit hat sie, und je härter und heftiger man schuftet, desto größer sind oftmals die Genugtuungen. In gewissen Kreisen wird denn auch über den Herzinfarkt gesprochen, als handele es sich um einen Ritterschlag, um die Aufnahmegebühr in einen Orden der Rastlosen, der entschlossen ist, sich der Arbeit zu opfern. Wir haben wirklich keinen Grund, über Stachanow zu lächeln – Stachanow ist bereits in uns, er ist eine Schlüsselfigur dieser Epoche; sein Name läßt sich auch amerikanisieren.
Weil die Arbeitswut eine weitgehend internationale Erscheinung ist und ohne Rücksicht auf politische Systeme besteht, darum ist eine Verteidigung des Müßiggangs heutzutage bereits ein müßiges Vorhaben; es ist verschwendet, es muß wirkungslos bleiben – eine Feststellung übrigens, die nur von einem Menschen getroffen werden kann, der seinerseits von der Arbeit besessen ist. Denn natürlich wird ein leidenschaftlicher Müßiggänger nicht nach Wirkung und Zweck fragen, nach kalkuliertem Nutzen, vielmehr wird er sich gerade für das erklären, was ihm verschwendet erscheint, er wird das Müßige als das einzig Schätzenswerte ansehen. Und das bezeichnet auch die Qualität seines »Tuns«: es ist nicht blinde Geschäftigkeit, die nur die Zeit füllt oder an einem Zweck gemessen wird, sondern schöpferische Nichtarbeit, produktives Träumen, eben: Müßiggang.
Das hat keineswegs etwas mit Faulheit zu tun. Faulheit im einfachsten Sinne ist zunächst nichts anderes als die tatenlose, ermattete Freiheit von der Arbeit; man lebt ohne Kraft zur Entscheidung wie Oblomow, bis man vom sanften Schlagfluß heimgesucht wird. Dem Müßiggang hingegen liegt eine definitive Entscheidung zugrunde: man ist bereit, das Nichtstun auszukosten, auszubeuten, auf absichtslose Weise aktiv zu sein. Somit ist Müßiggang alles andere als eine Ermattung des Geistes. Der verständige Müßiggänger lehnt es ab, sich mit Betriebsamkeit zu betäuben, da er es durchaus bei sich selbst aushält. Pascals Bemerkung, daß »alle Leiden des Menschen daher kommen, daß er nicht ruhig in seinem Zimmer sitzen kann«, trifft auf ihn nicht zu. Er kann lange ruhig sitzen, er kann wahrnehmen, er kann staunen. Und vielleicht ist dies das überzeugende Geschenk des Müßiggangs: die Gelegenheit zum Staunen, die uns gewährt wird. Wer aber staunt, wer sich selbst aus bescheidenem Anlaß wundert, der beginnt unweigerlich zu fragen, und wer Fragen stellt, wird zu Schlußfolgerungen gelangen: der Müßiggang wird zu einem aufregenden Zustand.
Wenn Oblomow seufzt: »Man schläft, man schläft und hat nicht mal Zeit, sich zu erholen« – dann ist damit doch gesagt, daß der wahre Müßiggang nicht in den Daunen bestätigt werden kann. Der Kenner wird immer darauf aus sein, sozusagen in der Welt müßig zu gehen: an Flüssen und in Kneipen, auf Behörden und belebten Straßen, überall dort, wo anscheinend etwas geschieht; er wird es in seiner Art befragen und durchschauen, vor allen Dingen aber dem geschäftigen Leerlauf ein Beispiel geben: ein Beispiel nämlich für den Rückfall in die Weile. Der Überfluß an Zeit, an Weile ist der sichtbarste Reichtum des Müßiggängers, und indem er ihn zeigt, macht er auch schon unser Verlangen nach Kurzweil fragwürdig. Aber dieser ganz bestimmte Überfluß ist es auch, der eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Kultur gespielt hat.
Der zerstreuungssüchtige Konsument, der Abnehmer von Kurzweil wird bei allem verbissenen Fleiß nie in der Lage sein, Kultur hervorzubringen, da ihm das sublime Nichtstun unbekannt ist. Kultur entsteht immer nur im produktiven Müßiggang, in großen Augenblicken schöpferischer Faulheit. Das ist eine landläufige Ansicht, und wenn wir sie gleichwohl in Erinnerung bringen, so nur deshalb, weil es müßig ist, auf die Vorzüge des Müßiggangs hinzuweisen.
(1962)
In Faulkners Welt
Augenschein am Mississippi
Die Fremde war mir bekannt. Ich kannte viele der Chevaliers und Schufte, die dieses Land berührt hatten, kannte die Namen von Familien, deren Glück und Unglück in der ganzen Welt zur Kenntnis genommen wurden: die Compsons, die Snopes und die Sartories, die McCaslins und die Sutpens – all die Leute, denen William Faulkner ein Schicksal in Mississippi zugewiesen hatte, waren mir vertraut. Sie gehörten so selbstverständlich zum Süden, daß ich darauf vorbereitet war, ihnen zu begegnen, sie wiederzuerkennen.
Sie lebten nicht nur hier im Süden der Vereinigten Staaten, sie waren der Süden selbst mit seiner Vergangenheit, seiner Gier und seinen Träumen. Faulkners Riesenwerk, diese tragische Gewissenslegende, hatte sie zum zweitenmal erschaffen und mit ihnen den amerikanischen Süden. Ja, es hatte für mich den Anschein, daß Faulkners Süden der alleinige, der tiefe, der wahre Süden sein müßte: sein legendäres Yoknapatawpha – das ungefähr mit den Grenzen von Lafayette County übereinstimmt – und sein Jefferson, unter dem seine Heimatstadt Oxford, Mississippi, erscheint, waren schärfer und achtsamer durchforscht als jeder andere Bezirk, hier war alles von einer unbarmherzigen Erinnerung und Einbildungskraft entblößt, der Süden William Faulkners war durch eine Topographie des menschlichen Herzens beglaubigt. Er existierte ohne Zweifel. Er übte Wirkungen aus und ließ Schlußfolgerungen zu. Er ließ uns Anteil nehmen, ließ uns erschrecken, lächeln, nachsichtig und resigniert sein.
Dieser Süden Faulkners bot uns mit seinen Auflehnungen, mit seinen Gewalttaten, Versuchen und Irrtümern ein Abbild der Welt. Er wurde sogar zu einem bestimmenden Modell der Welt; Jefferson wurde zur Hauptstadt menschlichen Scheiterns, und Yoknapatawpha zur auserwählten Provinz exemplarischer Verhängnisse.
Aber diese wirkungsvolle Stadt, diese mächtige Provinz – stimmen sie auch mit der Landkarte überein? Lassen sie sich betreten? Kann man sie wiederfinden und in Augenschein nehmen? Und wieviel ist wiederzuentdecken? Und wie fällt ein Vergleich aus zwischen dem Land, das Faulkners Phantasie entwarf, und dem Süden, der sichtbar ist?
Ich wollte versuchen, Faulkners legendäres Yoknapatawpha wiederzuerkennen, ich hatte mir vorgenommen, die Heimat von Old Ben zu sehen, dem unbesiegbaren Bären und lebenden Anachronismus, die Baumwollfelder der Compsons wollte ich wiederfinden, den Franzosenwinkel, in dem der sanfte Froschaug mit der Pistole herrschte, den hellen, fluchbeladenen Distrikt in Mississippi, wo Thomas Sutpen dem Wahnsinn verfällt und der weiße Neger Lucas Beauchamp gelyncht werden soll.
Das Boot, mit dem ich den Mississippi hinabfuhr, hieß »Nachbarschaft«. Es war ein sauberes, nicht mehr neues Motorschiffchen mit festem Sonnendeck und einer geräumigen Kajüte von altmodischer Eleganz. Die Messingteile blitzten. Ein feiner Öldunst zog vom Maschinenraum herauf. Ich fuhr hinab nach New Orleans, und mit mir reiste natürlich nicht nur Faulkner, sondern auch Cooper und Gerstäcker und Mark Twain. Pünktlich stellten sich Jugendträume ein; die Abenteuer, die die Knabenlektüre gewährt, sie waren auf selbstverständliche Weise da, als ein einarmiger Neger die Leinen loswarf und das Boot hinausdrehte in das trübe, lehmtrübe Wasser des Mississippi. Der Himmel war klar, eine glühende Lichtglocke. Es war windstill. An den unterwaschenen Ufern standen reglos schöne, langbeinige Vögel, wie aus gebleichtem Holz geschnitzt. Das Gras war verbrannt.
Meine Mitreisenden begannen, sich endgültige Plätze zu suchen, nun, da wir in die Mitte des Stroms drehten: für welche Seite, für welches Ufer sollte man sich entscheiden? War der laue Schatten in der Kajüte erträglicher als die klare Sonnengrelle des Decks? Was mußte man gesehen haben? Wie zu einer Theateraufführung nahm man die Plätze ein, denn der Autor hieß William Faulkner, und sein Hauptdarsteller war der Mississippi. Oder täuschte ich mich? Wer waren meine Mitreisenden? Woher kamen sie, wohin fuhren sie? Trug ein einziger von ihnen die Stigmata Faulknerscher Figuren? Wer von ihnen hatte das tragische Vorrecht, aus Yoknapatawpha zu stammen?
Der Mann an der Heckreling, selbstbewußt und wohlgewachsen, erinnerte mich an jemanden: sein überlegenes Lächeln, die schnöde Siegesgewißheit, die reizvolle Selbstgefälligkeit – das konnte Rhett Butler sein, den der Wind hierhergeweht hatte. Vielleicht war er unterwegs, um seiner Scarlett O’Hara schöne Dinge von der Küste mitzubringen. Er stand mit gekreuzten Beinen da, zwei Finger in der Westentasche, und blickte in das wirbelnde Heckwasser. Nein, eine Faulknergestalt war er nicht.
Und auch das Paar, das sich zwei Liegestühle aufgeschlagen hatte, konnte nicht aus Jefferson stammen: der junge Mann, der mit freimütigem Behagen sein Bier trank, der seine athletischen Glieder ausstellte und laut sprach und sich heftig bewegte – er wiederholte den Stan Kowalski aus der »Endstation Sehnsucht«. Und mit ihm reiste, vogelleicht und neurotisch, seine Vivien Leigh.
Aber es waren noch mehr Passagiere an Bord, eine Familie mit drei Töchtern, bei der es mir nicht gelang, die Mutter zu identifizieren; ein kleiner Junge in einer Sheriffuniform, der alle Reisenden als Gangster bezeichnete und sie mit seinem Spielzeuggewehr nacheinander umlegte; ein sehr schönes, sehr träges, sehr künstliches Mädchen, das in ein kostbares Buch blickte, ohne eine Seite umzublättern; ein hübsches, sorgfältig gepflegtes älteres Ehepaar, das sich mit jedem Blick seine ungeduldige Liebe eingestand; eine Gruppe langbeiniges College-Volk, das die Bänke auf dem Bug besetzt hielt; zwei Inspektoren mit randlosen Brillen und ein schweigsamer Kahlkopf mit einer sehr teuren Angelausrüstung.
Diese Reisenden jedoch wurden überlärmt und durchwirkt von einer gemischten Gesellschaft, deren Mitglieder einander unentwegt auf die Schulter hieben, die einander unentwegt zum Trinken einluden und die hier offenbar etwas feierten, mit kühlen Getränken und ihren sonntäglich angezogenen Frauen. Sie waren sehr nett zueinander, und ich glaubte zu verstehen, daß sie ausnahmslos mit der Ausbeutung und Verwertung von Erdgas zu tun hatten. Erdgas kommt bei Faulkner nicht vor.
Das Motorboot trug uns alle gemächlich den Mississippi hinab, über seine trübe, wellenlose Oberfläche, und ich hatte das Gefühl, daß dieser Strom, der im Volksmund des Südens Old Man genannt wird, nur noch in seiner Tiefe lebte und wirksam war, tief über dem schlammigen Grund, wo keine Sonne hintraf. Obwohl die Oberfläche wellenlos war, verriet sich auf ihr etwas von der schweren wallenden Bewegung, mit der die Wasser über den Grund drängten, New Orleans zu, dann in den kochenden Dschungel des Mississippideltas und durch die Bayous in die See. In seichten Stellen hatten sich Barrieren aus angetriebenem Astwerk gebildet, an dem die Strömung zerrte. Pappkartons trieben auf dem Wasser und Flaschen und leere Bierbüchsen. Zwei Motoryachten kamen uns in schneller Fahrt entgegen, und ich sah schlanke, sonnverbrannte Männer, die zu uns herüberwinkten, sah schöne weiße Mädchen in bequemen Leinwandstühlen, die trotz der Hitze kühl wirkten – Erbinnen von Plantagen vielleicht, deren Haut weder von der Hitze noch von der Arbeit versehrt war. Ich sah, wie Fische aus dem Wasser schnellten, ihre gekrümmten Leiber schwebten einen Augenblick in der Luft, bevor sie eintauchten und auf der Oberfläche einen schwankenden Ring zurückließen. Auch ein Wasserflugzeug sah ich, es flog stromaufwärts, trug vielleicht einen Besitzer von Baumwollfeldern nach Hause, der in New Orleans über die nächste Ernte verhandelt hatte.
Ich stand an der Reling und blickte auf den Mississippi und wartete auf etwas, wartete darauf, daß der Strom sich verwandelte und zu erkennen gab, daß er so erschien, wie Faulkner ihn beschrieben hatte. Ich dachte an seine Erzählung »Der Strom« und wartete auf das geheimnisvolle, unverkennbare Geräusch, mit dem der Fluß sich da anzeigte:
»Da hörte der größere Sträfling ein großmächtiges Geräusch. Er hörte es nicht in einem bestimmten Augenblick, er merkte nur auf einmal, daß er es schon die ganze Zeit gehört haben mußte, ein Geräusch, das jenseits all seiner Erfahrung und Aufnahmefähigkeit lag, und für das er bis zur Stunde ebenso taub gewesen war wie die mit einer Lawine reitenden Ameisen oder Flöhe für deren Tosen; nun war er schon seit dem frühen Nachmittag durchs Wasser gefahren und hatte bereits sieben Jahre Pflug und Egge und Pflanzmaschine im Schatten eben jenes Deiches geführt, auf dem er jetzt stand, aber dieses abgründige, dunkle Raunen, das von der andern Seite herüberdrang, konnte er nicht sogleich deuten. Er blieb stehen. Die Schlange der ihm folgenden Sträflinge stieß ruckartig gegen ihn wie ein anhaltender Güterzug, und ihre Fesseln klirrten wie dessen Wagen. ›Weiter‹, rief ein Wärter. ›Was is’n das‹, sagte der Sträfling. Ein Neger, der an einem nahen Feuer saß, antwortete ihm: ›Das is er. Is Old Man.‹ Schließlich verstummten sie, und nun hörten es alle und lagen und horchten auf das tiefe, starke und mächtige Baßraunen. ›Old Man?‹ sagte der Zugräubersträfling. ›Ja‹, sagte ein anderer. ›Der hat’s nicht nötig, sich aufzuspielen.‹«
Ich fuhr einen anderen, fuhr einen gemäßigten, von jeder Mythologie befreiten Mississippi hinunter. In verstopften, schillernden Bayous sammelte sich die Hitze. Das Laub der Bäume wirkte schlaff, verfilzt, von der Glut bezwungen. Kein Geräusch, kein Baßraunen, das uns hätte verstummen lassen, war zu vernehmen. Erschöpfung, eine Art von blendender Erschöpfung lag über dem Gebiet. Lehmrote Bänke schimmerten ölig. Im brühwarmen Wasser einer Bucht meinte ich Schlangen zu sehen, doch es waren wohl nur langsam kreisende Äste. Wir fuhren durch ein sonnenflimmerndes Traumreich. Keiner der Passagiere machte den Eindruck, als ob er zum unvermeidlichen Inventar unseres Bootes gehörte – so wie einst Spieler und Händler und Sklaven zum Inventar der mehrstöckigen, aber flachen Flußdampfer gehört hatten, deren Schaufelräder die schwere Brühe walkten. Es schien eine zufällige Gesellschaft zu sein, die den Strom hinabfuhr.
Der Steward, ein Neger in weißer, gestärkter Jacke, kam mit einem Tablett aufs Achterdeck und reichte uns Erfrischungen. Er tat es wortlos, drehte wortlos das Tablett in den Händen, bis das gewünschte Glas mühelos zu erreichen war. Ich trank ein kühles, nach Rum schmeckendes Getränk, das ich mehr in den Beinen als im Körper spürte. Der kleine Junge mit seinem Spielzeuggewehr kam zum zweiten Mal zu mir und erschoß mich zum zweiten Mal. Die schöne, träge Lesende konnte sich nicht entschließen, eine Seite ihres Buches umzuschlagen. Das rosige alte Ehepaar blickte verlangend zu einem am Ufer verankerten, grau und schwarz getünchten Hausboot, wünschte sich womöglich dorthin, errichtete sich eine von der Strömung gewiegte Liebesinsel. Ich sah über das fahlgrüne, anscheinend menschenleere Land, das unter der Sonne zu gilben schien.
Nur wenige Häuser waren zu erkennen, leicht und wie vorläufig, wie auf Probe ins Land gesetzt – ein Eindruck, der sich später oft wiederholte. Man schien das Land nur auf Widerruf genommen, nur auf Widerruf bebaut zu haben. Für eine einzige, kleine, aber schnelle Stute – so erzählt Faulkner in »Schall und Wahn« – hatte einst ein Compson eine ganze Quadratmeile dieses Landes von dem vertriebenen amerikanischen König Ikkemotubbe eingetauscht; er hatte sie natürlich mit der Zeit verloren und verspielt. Angestrengt spähte ich hinüber, erwartete, das weiße Haus zu sehen unter schattenspendenden Ulmen, das berühmte Compson-Haus, in dem ein glückloser Gouverneur geboren wurde und ein verbitterter und ebenso glückloser General. Ich hielt Ausschau nach dem legendären Herrenhaus, in dem privilegierte Müßiggänger nach einem Ritt über ihre Plantagen Catull oder Livius lasen. Faulkner hatte doch erzählt:
»… und Compson gehörte die ganze Quadratmeile Land, bereits damals beforstet und auch zwanzig Jahre später noch beforstet, wenngleich mehr Park als Forst, mit den Sklavenhütten und Ställen und Küchengärten und den abgezirkelten Rasen und Promenaden und Pavillons, angelegt vom selben Architekten, der das Haus mit der Säulenvorhalle erbaut hatte, das Haus, dessen Einrichtung als Schiffsladung aus Frankreich und New Orleans gebracht worden war.«
Ein verfallener Schuppen, eine Bruchbude, von Unkraut überwuchert – dies konnte nicht das Compson-Haus sein. Außerdem sollte sich ja mit der Zeit Jefferson auf der berühmten Quadratmeile ausgebreitet haben, und von einer Stadt war nichts zu sehen. Plötzlich kam Rhett Butler auf mich zu, schlenderte heran mit seinem überlegenen Lächeln, und ich dachte, er würde mich zu einer Pokerpartie einladen, er, der berühmte Spieler; doch nach einer Weile sagte er: »Fremd hier, nicht?«, und ich sagte: »Aus Hamburg.« – »Oh«, sagte er freundlich, »Ripabähn«, und ich antwortete: »Von dorther.« Er spendierte mir ein eiskaltes Getränk und fragte mich dann, ob ich Verwendung hätte für militärische Geheimnisse. Er lächelte überlegen und vielsagend und deutete auf ein Kanisterfloß, auf dem Negerjungen durch seichtes Wasser paddelten. Ich sagte ihm, daß mein Gepäck das Höchstgewicht erreicht habe und daß ich jedes zusätzliche Pfund sehr teuer bezahlen müßte, worauf er sagte: »Meine Geheimnisse sind’s wert.« Ich wollte wissen, welche Art von Geheimnissen er anzubieten hatte, und er stellte sich als Verpackungsspezialist vor. »Schaun Sie, Fred«, erläuterte er, »alle Waffen, von der Patrone bis zur Titan-Rakete, müssen kunstgerecht verpackt werden. Damit das geschehen kann, müssen uns die Militärs gewisse Eigentümlichkeiten der Waffen anvertrauen. Wäre das nichts für Sie?« – »Ein andermal«, sagte ich, »wenn ich mehr Platz im Koffer habe.« Und er war einverstanden damit und fragte mich lächelnd, was ich auf dem Mississippi suchte. »Faulkner«, sagte ich, »ich will herausbekommen, ob man das Land und die Leute, die er in seinen Büchern entworfen hat, wiederfinden kann. Ich will einfach mal vergleichen: den Süden, den er schuf, und den Süden, der sichtbar ist.« – »Und?« fragte Rhett Butler. »Ich glaube«, sagte ich, »der wahre Süden steckt in seinen Büchern.« Der freigebige Geheimnisträger schüttelte den Kopf, hörte nicht auf zu lächeln. »Ich werde Ihnen etwas sagen, Fred«, meinte er, »um etwas zu finden, empfiehlt es sich, die Verpackung zu öffnen. Auch der Süden hier ist verpackt, wie alles in der Welt. Von allein zeigt sich nichts. Sie müssen etwas dazu tun, Ihren Teil dazu beitragen. Suchen Sie den Süden in Ihrem Gesichtskreis, ganz in der Nähe, und Sie werden ihn finden.«
Rasch schließt man auf dem Mississippi Bekanntschaften. Leicht kommt man in ein Gespräch, besonders, wenn man als Fremder erkennbar ist. Die Höflichkeit, die Fürsorge und Gastfreundschaft des Amerikaners erinnert sehr an die russische Gastfreundschaft und Fürsorge. Rhett Butler, das spürte ich, hatte große Lust, mich mit den anderen Passagieren bekannt zu machen, mich ihrer Fürsorge zu empfehlen. »We have a man from the Ripabähn among us«, hätte er vielleicht gesagt, »let’s take care of him.« Diese Bereitwilligkeit zu einer Gunst gegenüber dem Fremden widersprach ebenfalls dem Verhalten einiger Faulknerscher Figuren, die weder Auskünfte verlangten noch Auskünfte gaben, da sie der Meinung waren, man dürfe sich von Fremden nichts erbitten. Meine Mitreisenden waren Gentlemen von der aufmerksamsten Art. Sie halfen mir, die uneinsehbaren Schönheiten des Stroms zu entdecken, den lehmtrüben Sumpfgewässern einen Reiz abzugewinnen. Sie versicherten, daß die Schwüle und das erbarmungslose Licht erträglich seien, und sie wurden wirklich erträglich.
Von einer alten, baufälligen Pier, einer Privatpier vielleicht, legte ein flacher Flußdampfer mit dünnem Schornstein ab. Ich sah, daß er beladen war mit Menschen, Fahrzeugen und Tieren. Rückwärts manövrierte er in den Strom, gab ein langgezogenes Signal mit der Dampfpfeife, das auf dieser flirrenden Einöde des Wassers so bescheiden wirkte; und auf einmal kam mir dies Bild bekannt vor, so hatte ich ein Ablegemanöver in Erinnerung, wie Faulkner es beschrieben hatte:
»… Sie verfolgten, wie der Dampfer absetzte und drehte und wieder auf der tellergleichen Fläche des kahlen Wassers dahinkrabbelte, das sich mehr und mehr kupfern färbte, und wie sein Rauchfaden in langsamen, kupfergeränderten Püffen aufstieg und sich dünner werdend über den Fluß schlängelte, wie er verblaßte und sich dann in der weiten friedevollen Einsamkeit auflöste, wie das Schiff kleiner und kleiner wurde, bis es nicht mehr zu krabbeln, sondern nur noch auf einem Fleck im zarten, ungreifbaren Sonnenuntergang zu hängen schien und dann zu nichts wurde wie ein winziger Klumpen dahintreibenden Schmutzes.«