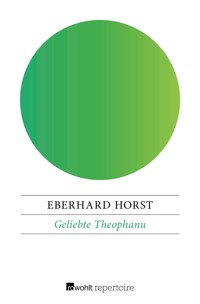
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die deutsche Kaiserin, die aus dem Osten kam Im Jahre 972 reiste die zwölfjährige byzantinische Prinzessin Theophanu mit großem Gefolge nach Rom, um dort mit dem Kaisersohn Otto II. vermählt zu werden. Wenngleich aus politischen Gründen gestiftet, sollte sich die Ehe doch als glücklich erweisen. Doch Otto starb vor der Zeit, und Theophanu übernahm für ihren erst dreijährigen Sohn die Regentschaft. So war aus dem Mädchen aus Byzanz um die Jahrtausendwende der mächtigste Mensch im Deutschen Reich und die einflussreichste Frau ihrer Zeit geworden. Eine der großen weiblichen Herrschergestalten der Geschichte in einer lebendig erzählten Romanbiographie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Eberhard Horst
Geliebte Theophanu
Der Lebensroman einer deutschen Kaiserin aus Byzanz
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Die deutsche Kaiserin, die aus dem Osten kam
Im Jahre 972 reiste die zwölfjährige byzantinische Prinzessin Theophanu mit großem Gefolge nach Rom, um dort mit dem Kaisersohn Otto I.. vermählt zu werden. Wenngleich aus politischen Gründen gestiftet, sollte sich die Ehe doch als glücklich erweisen. Doch Otto starb vor der Zeit, und Theophanu übernahm für ihren erst dreijährigen Sohn die Regentschaft. So war aus dem Mädchen aus Byzanz um die Jahrtausendwende der mächtigste Mensch im Deutschen Reich und die einflussreichste Frau ihrer Zeit geworden.
Eine der großen weiblichen Herrschergestalten der Geschichte in einer lebendig erzählten Romanbiographie
Über Eberhard Horst
Eberhard Horst, geboren 1924 in Düsseldorf, studierte Philosophie, Theologie, Germanistik und Theaterwissenschaft und promovierte über Elisabeth Langgässer. Zu seinen bekanntesten Veröffentlichungen zählen «Friedrich der Staufer», «Julius Caesar», «Konstantin der Große», «Die spanische Trilogie» und «Die Haut des Stiers».
Inhaltsübersicht
Meinen verstorbenen Kölner Freunden Heinrich Maria Deckstein und Wilhelm Nyssen gewidmet
Vorwort
Eine Zwölfjährige, noch mädchenhaft unbekümmert, wird aus ihrer vertrauten Umgebung in eine ihr ganz und gar fremde Welt befohlen. Sie ist auffallend schön und klug, wird von den einen geliebt, von anderen als Fremde, zudem nicht Standesgemäße, mit Mißtrauen empfangen. Diese Ambivalenz durchzieht ihr kurzes Leben. Aber sie lernt politisch denken und handeln und bewährt sich unvergleichlich, indem sie im Aufgenötigten ihre Bestimmung erkennt und bis zu ihrem Tode als Einunddreißigjährige unermüdlich verteidigt und vollendet.
Dies ist die Geschichte der byzantinischen Prinzessin Theophanu, vor einem Jahrtausend Handelsobjekt zwischen den Kaisern Ost- und Westroms. Jeder der beiden Herrscher erhoffte sich einen Vorteil, als Theophanu zur Ehe mit dem siebzehnjährigen Otto II., Sohn und Mitkaiser Ottos des Großen, von Konstantinopel nach Rom gebracht wurde.
Durch Theophanu kam griechisch-byzantinische Lebensart in das karge Land zwischen Rhein und Elbe – in der Kunst, in der Bildung, ebenso in der Mode. Die junge Kaiserin herrschte nach dem frühen Malariatod Ottos II. sieben Jahre mit außerordentlichem politischen Geschick und zäher Durchsetzungskraft. Ihrem elfjährigen Sohn Otto III. hinterließ sie ein im Innern wie im Verhältnis zu Rom gefestigtes Kaiserreich, gestärkt in der westlichen Selbstbehauptung gegenüber Byzanz. »Die deutscheste aller deutschen Kaiserinnen« nannte man die Fremde, die »Ausländerin«.
Ihr Grab fand die Byzantinerin, wie sie gewünscht hatte, in Köln, in der Abteikirche des griechischen Heiligen Pantaleon. Als ich zum ersten Mal vor dem Sarkophag Theophanus stand, wurde meine Neugier geweckt, wie meine Beschäftigung mit Friedrich dem Staufer vor dessen Sarkophag im Dom von Palermo begann. Es war merkwürdig, in einer Kölner Kirche das Grab einer offensichtlich hochverehrten Byzantinerin zu finden, noch merkwürdiger, als es das Grab des Staufers Friedrich im sizilischen Palermo war. Nur bedurfte es, anders als bei meiner Biographie über den Stauferkaiser, eines zweiten Anstoßes, vermittelt durch den tausendsten Todestag der im Jahre 991 gestorbenen Kaiserin Theophanu, um ihrer Lebensgeschichte forschend und schreibend näherzukommen.
Die Auskünfte der Quellen, vor allem der Chronisten Thietmar von Merseburg und Liudprand von Cremona, sind eher dürftig, doch stark genug, unsere Phantasie in Bewegung zu setzen. Es geht mir nicht um historische Rekonstruktion. Vielmehr soll eine Geschichte erzählt werden, die Geschichte einer Entwicklung unter bestimmten, nachvollziehbaren Voraussetzungen. Immer anhand des Möglichen soll die romanhafte biographische Erzählung das wenige historisch Abgesicherte mit Leben füllen, soll die emotionale Entfaltung das Erzählte plausibel machen.
Nicht nachweisbar, doch möglich wäre, daß der Chronist Liudprand (der vermutlich um 973 starb) zur Gesandtschaft gehörte, die Theophanu aus Konstantinopel nach Rom führte. Er galt als bester Kenner der Verhältnisse am Bosporus. Liudprands fiktive »letzte Aufzeichnung« erinnert an das ihm bei seiner ersten – vergeblichen – Brautwerbung am oströmischen Kaiserhof Widerfahrene. Ebensowenig nachweisbar, doch naheliegend wäre eine Begegnung Theophanus im Reichsstift Gandersheim mit der Dichterin Roswitha von Gandersheim, deren Todestag ungewiß ist, deren letzte Dichtung jedoch nach dem Tod Ottos I. entstand, zur Zeit von Theophanus Aufenthalt im deutschen Kernland des Reichs.
Solche Begegnungen wie auch die Gestalt der Hofdame Anastasia, die sich in ihren Berichten als Sprachrohr oder »zweites Ich« Theophanus begreift, entsprechen der inneren Logik des biographischen Romans. Andererseits mußte die Fülle der Namen im Umkreis Theophanus, mußten die zahlreichen Ortswechsel (allein 973 sind dreißig verschiedene Aufenthaltsorte dokumentiert) reduziert werden, damit eine einleuchtende, lesbare Erzählhandlung zustande kommen konnte.
Die Erzählung kann deutlich machen, daß Theophanu nicht nur abstrakte Ideenträgerin war, sondern Mädchen, junge Frau mit Wünschen, Gefühlen, Lebenserwartungen, mit Schwächen und Stärken, mit allem, was Leben ausmacht. Die Byzantinerin überwand ihr Fremdsein, wurde zur »geliebten« Frau und Kaiserin, zur dilectissima, die mit bewundernswertem politischen Verstand die deutsch-lateinischen Interessen vorantrieb.
Politisch wie für das Christentum ist die Bedeutung Theophanus, trotz der Bemühungen anläßlich des Jahrtausendgedenkens, noch kaum zureichend bekannt. Die junge Theophanu, die ihren byzantinisch geprägten Glauben, auch die Verehrung des heiligen Nikolaus, in den Westen mitbrachte, wurde zur Mittlerin zwischen den Kulturen des Westens und des Ostens, zu einer Symbolfigur der Ökumene, der Besinnung auf einen gemeinsamen Glauben.
Eberhard Horst
Erster Teil
Es gab einige, die diese Verbindung Ottos II. mit Theophanu zu hintertreiben suchten und rieten, die unerwünschte Braut zurückzuschicken. Aber der Kaiser hörte nicht auf sie und gab Theophanu mit Zustimmung aller Fürsten seinem Sohn zur Gattin.
Thietmar von Merseburg
Sie hatte einen klaren Verstand, war sehr beredt und von ungewöhnlicher Schönheit.
Annalista Saxo
1. Die Überfahrt
Sie stand regungslos am Heck, nahe der handgeschnitzten Balustrade, einen Schritt vor ihrem Gefolge, als die Prunkgaleere den Hafen der Kaiserpaläste verließ. Sie dachte schon weiter, erwartungsvoll, während ihre Augen in der Frühsonne mit dem Perlengehänge ihres Kopfschmucks um die Wette glänzten, als sie zurückblickte und die am Ufer Versammelten, die weißen und goldbestickten Fahnen kleiner und kleiner wurden und schließlich entschwanden. Ein Nichts hinter den perlmuttfarbenen Wassern wie die verblassenden grünen Hügel, die Paläste, die vergoldeten Kuppeln und spitzen Türme von Konstantinopel. Bis zum letzten Augenblick wollte sie aufnehmen, sich einprägen, was sie nie wieder sehen würde. Niemand hatte es ihr gesagt, sie wußte selbst oder ahnte, daß es von dieser Fahrt keine Rückkehr gab.
Die Abschiedszeremonien waren ihr lästig. Natürlich war sie erregt, schoß ihr das Blut durch die Adern. So viel Feierlichkeit mit Musikaufzügen und Fahnenschwenken, so viel ihr gewidmete tränenreiche Anteilnahme läßt eine Zwölfjährige, eine puella, nicht ungerührt. Sie ließ ihre Kindheit in der Magnaura zurück. Nein, sie weinte nicht. Theophanu weint nicht. Die Nichte des Basileus Johannes Tzimiskes war, wie dessen erste Frau, eine Skleraina, zu beherrscht, zu stolz, ihre Gefühle zu verraten.
Die byzantinische Prinzessin, die am Morgen eines der ersten sonnenklaren Januartage des Jahres 972 auf dem mit Teppichen ausgelegten Achterdeck der Staatsgaleere stand, war nicht unvorbereitet. Seit fast einem Jahr war sie ausersehen, die Gemahlin des siebzehnjährigen Otto, des Sohnes und Mitkaisers Ottos des Großen, zu werden. Sie hatte die deutsche Sprache gelernt, was ihr leichtfiel. Doch unterhielt sie sich lieber in ihrer Sprache mit Erzbischof Gero von Köln und Liudprand von Cremona, den Gesandten des westlichen Kaisers, die beide Griechisch verstanden. Nach monatelangen, von Bischof Liudprand jahrelang wiederholten, oft beschämenden Verhandlungen war das Ehebündnis zustande gekommen, und die beiden Kirchenmänner begleiteten die Braut mit ihrem Gefolge auf dem langen Weg nach Rom.
Sollten die klugen Bischöfe geglaubt haben, auf dem Schiff, in weniger zeremoniösen Gesprächen, der zwölfjährigen Byzantinerin mit der Nachsicht des Alters begegnen zu müssen, so lernten sie das Staunen. Aufgewachsen im Kaiserpalast, hatte Theophanu eine Ausbildung genossen, von der Fürstenkinder anderer Länder nur träumen konnten.
Ihr Wissen, ihre Intelligenz hinderten sie nicht, widerspruchslos einzuwilligen in ihre aus politischen Gründen beschlossene Heirat. Das war üblich, entzog sich jeder Frage. Sie gehorchte, wie man einem gottgegebenen Gesetz gehorcht. Oder gab es in ihrem Gehorsam verschwiegene Bruchstellen, an denen sich ihr Eigensinn behauptete? Blieb ihre Ergebenheit ungeschmälert, nachdem die Türme von Konstantinopel am Horizont versunken waren und ihre Augen nichts mehr fanden, was Macht über sie hatte? Niemand merkte ihr an, wohin ihr Denken trieb, ob sie das ihr Befohlene jetzt noch als Ehre oder als bloße Pflichtübung empfand.
Theophanu wandte sich zurück, nickte hinüber zu den Gesandten des Westkaisers, die beide ihr Vater hätten sein können. Wie wird das sein, wenn ich eine der euren bin, im fremden Land? Ihr Gefolge, von ihr selbst ausgewählt, wich zur Seite, als sie nach einer knappen Bemerkung mit ihrer Hofdame Anastasia die Holztreppe hinunterstieg in ihre mit Seidentüchern ausstaffierte Kammer. Sie wollte den Kopfschmuck, den ihrer grazilen Mädchenfigur zu schweren, lästigen Prunkmantel ablegen, wollte, leichter gekleidet, mit dem Schiff vertraut werden, ehe Gero und Liudprand mit der Unterrichtung über das Land im Westen und den ihr fremden Kaiserhof fortfuhren.
Einiges hatte man ihr schon gesagt, doch nicht, daß sie Gegenstand eines politischen Handels war. Der Westkaiser Otto der Erste suchte durch die byzantinische Heirat seines Sohnes und Mitkaisers die Anerkennung seines römischen Kaisertums, eines Titels, den allein der in Konstantinopel residierende oströmische Kaiser beanspruchte. Einzig er, der Basileus, verstand sich seit Konstantin und Justinian als der von Gott auserwählte Kaiser der Römer. Für Byzanz gab es nur einen imperator Romanorum. Der aber erwartete nichts Geringeres als den Verzicht des Westkaisers auf territoriale Ansprüche in Süditalien, auf die dortigen byzantinischen Themen Apulien und Kalabrien. Otto schien zum Verzicht bereit zu sein, weil ihm und seiner Dynastie durch die eheliche Verbindung ein dauerhaftes Unterpfand zufiel.
Zwei Füchse bedienten sich der Zwölfjährigen als Köder. Eilig hatten es beide, mehr noch als Otto der Erste der Basileus Johannes Tzimiskes. Zwei Jahre zuvor war er durch seine Palastrevolution und die Ermordung seines Vorgängers Nikephoros Phokas zur Macht gelangt. Jetzt drohten ihm selbst innere wie äußere Gefahren. Er brauchte den Waffenstillstand in Süditalien, Versöhnung mit dem Westkaiser, um Aufstände in Kappadokien niederzuschlagen und um mit ungeteilter Kraft die über die Donau drängenden Russen zu bekämpfen. Der Fürst Svjatoslav von Kiew hatte die Bulgaren unterworfen und mußte vertrieben werden, ehe er mit seinen barbarischen Reiterscharen gegen Konstantinopel vorrücken konnte.
Zum Westen hin wollte der Basileus Tzimiskes den Rücken freibekommen. Die ideologischen Vorbehalte seines Vorgängers Nikephoros Phokas schob er beiseite. Tzimiskes nahm in Kauf, daß mit der Zuführung der byzantinischen Braut die Anerkennung des Westkaisers einherging. Der ehemalige General kalkulierte nüchtern. Die militärischen und politischen Verhältnisse zwangen ihn zum raschen Handeln. Hätte er sonst eine so kostbare Fracht im Januar der tage-, ja wochenlangen Meeresfahrt ausgesetzt? Jeder Seefahrer konnte davon berichten, wie in den ersten Wochen des Jahres der von den thrakischen Bergen herabstürmende kalte Nordostwind das Marmarameer und die Ägäis unsicher macht. Kein Naukleros, der sein Schiff nicht irgendwann einmal mit zerfetzten Segeln oder gebrochenem Mast in die nächste Hafenbucht steuerte, falls er sie erreichte.
Tzimiskes berief sich auf die Wetterpropheten, die sturmfreie Tage vorausgesagt hatten, und zunächst trübte kein Wölkchen die Fahrt. Im offenen Meer hatten die Ruderer auf den langen Bänken im Schiffsbauch die Riemen beigelegt. Der vom Festland herabkommende Wind füllte die purpurnen Lateinersegel, trieb die Galeere gefahrlos über das Marmarameer nach Westen.
Manchmal, wenn sie sich unbeobachtet glaubte – eine allzu naive Vorstellung –, ging Theophanu über den Laufsteg zum Vorderschiff und konnte sich nicht sattsehen an den Delphinen, die vor dem Bug die Fahrrinne kreuzten und im Bogen hochschnellten. Sie schlug die Hände zusammen, schrie gegen den Fahrtwind: Thálatta, Thálatta. Thálatta, das Meer, rief Theophanu, nachdem die letzten Möwen mit heiserem Kreischen das Schiff verlassen hatten und sich ringsum nur noch die unendliche, leicht gewellte Wasserwüste ausdehnte. Es war ihre erste Meeresfahrt.
Tzimiskes hatte befohlen, auf der Fahrt durch das griechische Meer bis hinüber nach Tarent, dem letzten byzantinischen Hafen, bei den größeren Inseln zu ankern und die Prinzessin zu kurzen Aufenthalten an Land zu führen. Abschiednehmend sollte sie die Größe des byzantinischen Reichs erkennen, um mit gestärktem Selbstbewußtsein in ihre neue Welt zu ziehen.
Ein Geschwader der schnellen flachen Dromonen war vorausgefahren, um an jeder der vorgesehenen Stationen den Besuch anzukündigen. Und wie empfänglich waren die Inselbewohner in der stilleren Jahreszeit für einen Besuch, der sie zudem teilhaben ließ an den glanzvollen Ereignissen des Reichs.
Inseln, deren Namen Theophanu durch Erzählung und Mythen vertraut waren, stiegen aus dem Meer, nahmen Gestalt an. Theophanu wollte alles genau wissen, jeden Inselnamen. Mit der Entfernung von Konstantinopel wuchs ihre Neugier, ihre Ungeduld. Von ihren Begleitern schickte sie Akritas zum Schiffsführer, Auskünfte über die Windverhältnisse, die Geschwindigkeit, das Messen der Geschwindigkeit einzuholen. Unbekümmert unterbrach sie in der Dämmerung des zweiten Tages Liudprands Ausführungen über den Hof des Kaisers Otto. Wann werden wir in Mytilene sein? Morgen, bei günstigem Wind und wenn kein Sturm aufkommt. Liudprand war die Strecke einige Male gefahren. Er kannte die tückischen Wetterumbrüche. Er wußte, was der Prinzessin verborgen blieb, daß die wiederholten Unterbrechungen der Meeresfahrt auch vorsorglich befohlen waren. Man konnte nicht wissen, ob die Prinzessin die Schiffsreise vertrug, das Schwanken bei bewegter See. Wie würde sie sich verhalten, wenn unvorhergesehen der scharfe Nordoststurm über das Meer heranrollte, mit seinen Brechern zuschlüge und das Schiff, das Prunkschiff des Basileus, zu zerschlagen drohte? So war es doppelt vorteilhaft, in Reichweite schützender Hafenbuchten zu fahren oder dort zu ankern, um der Prinzessin eine Rast an Land zu gönnen.
Unbehelligt passierten sie das Marmarameer und den schmalen Hellespont. Erst mit dem Erreichen der offenen Ägäis trieb der Wind auf und drückte gegen Steuerbord, daß die Galeere unter dem plötzlichen Zugriff ächzte. Aber das quittierte der Naukleros mit einem Lächeln. Der Nordwind pfiff in den Rahen und Gaffeln und spannte die roten Segel zum Zerreißen, doch er jagte das Schiff pfeilgerade in die vorgesehene Richtung nach Süden, immer in Sichtweite des asiatischen Festlandes. Ehe das Schiff in einen der tödlichen Wirbel geraten konnte, erreichten sie die Buchtöffnung zwischen dem Festland und der Insel Lesbos, und in rasender Fahrt steuerte der Naukleros in die Bucht im Schutz der phrygischen Berge.
Keinen Aufenthalt erwartete Theophanu sehnsüchtiger als die Insel Lesbos. Sie war froh, nach ihrer ersten Sturmerfahrung auf dem freien Meer Land unter die Füße zu bekommen. Aber das war ein äußerlicher, trivialer Grund. Im Innersten bewegte sie der Gedanke, den Ort kennenzulernen, von dem ihre Begleiterin, die ein Jahrzehnt ältere Anastasia, so viel erzählt hatte. Noch einmal, schon in der Dämmerung, während die Galeere im beruhigten Wasser an der Inselküste entlangfuhr, wollte sie von Anastasia hören, was der Grieche Longos in seiner Erzählung von Daphnis und Chloe geschrieben hatte: »Mytilene auf Lesbos ist eine große und prächtige Stadt, von Kanälen durchzogen, durch die das Meer hereinströmt, und geschmückt mit Brücken aus glattem, weißem Gestein.« Am liebsten zitierte Anastasia die Dichterin Sappho, die in einem Landhaus bei Mytilene oder Eressos, wie man auch sagte, gelebt und dort junge Mädchen unterrichtet hatte. Als die Galeere, von fast geräuschlosen Ruderschlägen vorwärtsgetrieben, Mytilene näher kam, erinnerte sie Theophanu an einen Vers der Sappho: »Espere, pánta phéreis … Abendstern, alles bringst du uns wieder, was die schimmernde Morgenröte zerstreute.«
Weiß der Himmel, woher Anastasia, seit frühester Kindheit der Prinzessin deren Vertraute und Lehrerin, die Dichtungen kannte. Wer am Hof von Byzanz wußte noch, daß Lesbos einmal die Insel der Dichter war? Nahezu vergessen waren ihre Namen, vergessen wie die Tempel der antiken Götter, die in den Boden sanken oder Steine zum Bau der christlichen Kirchen lieferten.
Theophanu war erschrocken, als sie hörte, daß die Gedichte der Sappho aus der noch unerlösten vorchristlichen Zeit stammten. Wie vertrug sich das Anhören solcher Verse, das Gefallen an ihnen, mit ihrer Orthodoxie? Was würden die Bischöfe dazu sagen? Aber sie war klug genug, um zu begreifen, daß sich die Menschen in ihrem Menschsein um kein Jota verändert hatten, so daß ein Vers der Sappho über ein Jahrtausend und mehr Bestand haben konnte, weil er in sich stimmig und schön war.
Ja, es schmeichelte ihr sogar, von Anastasia zu hören, sie gleiche der Dichterin, die nach der Überlieferung von kleiner, schlanker Statur war, im dunkelhäutigen Gesicht mandelgroße klar- und weitblickende Augen. Anastasia verschwieg, daß jemand die Lyrikerin mit der Nachtigall verglichen hatte, dem kleinen Vogel im grauen Federkleid, doch mit »mißgestalteten Flügeln am winzigen Körper«.
Auf Lesbos fuhr Theophanu im Wagen des kaiserlichen Statthalters ein Wegstück landeinwärts, und ihr Entzücken fand kein Ende, als sie die von Longos geschilderte Natur entdeckte: Kornfelder, Weiden mit grasenden Herden, grünes, zu den Bergen ansteigendes Hügelland, mannshohe Rebstöcke, immergrüne Myrten, Gärten mit Granatäpfeln, Feigen, Apfel- und Birnbäumen, endlose Reihen von Olivenbäumen, aus deren Früchten das begehrte Öl der Insel gepreßt wurde. Theophanus Verhältnis zur Natur war unbefangen, unbelastet. Anastasia sagte ihr, sie verhalte sich nicht anders als die Mädchen von Lesbos, die zu Lebzeiten der Sappho in deren Schule auf ihre Hochzeit und ihre Aufgaben in der Gesellschaft vorbereitet wurden.
Theophanu hörte diese Schilderungen gerne, obgleich ihre Neugier ziemlich unbefriedigt blieb. Eindringlich wurde ihr statt dessen – mitunter bis zum Überdruß – vor Augen gehalten, daß sie auf dem Weg zu ihrer eigenen Hochzeit war. Ach, Anastasia, was erwartet uns in diesem fremden Land, unter fremden Menschen?
Liudprand und noch emsiger Gero von Köln nutzten jede ruhigere Stunde auf See oder an Land, die Byzantinerin mit ihren künftigen Aufgaben als Gattin des jungen Kaisers Otto vertraut zu machen. Liudprand von Cremona, erfahren in griechischer Literatur, in byzantinischer Lebensart, auch in byzantinischer Eitelkeit, nahm die geschickt geplanten Aufenthalte gelassen hin. Theophanus Ausflüge in die griechische Vergangenheit würden ihr vergehen, sobald sie dem lateinischen Kaiserhaus angehörte. Um so mißtrauischer reagierte Gero. Die Prinzessin, sagte er zu Liudprand, beschäftigt sich zu sehr mit dem, was sie zurücklassen sollte.
Gero war zwei Jahre zuvor gegen den Willen des Kaisers Otto zum Erzbischof von Köln gewählt worden. Seine Mission als Brautwerber empfand er als Zeichen von Versöhnung und neuerworbener Ehre, das den aufrechten, aber auch starrköpfigen Westfalen um so pflichteifriger machte. Er wollte dem Sohn und Mitkaiser seines Auftraggebers eine Braut ohne Tadel zuführen, ohne die ihn störende Rückbindung an deren Herkunft. Byzanz blieb ihm fremd, unzugänglich, auch nach der Beendigung seiner Gesandtschaft. Im Grund lief ihm das doch ehrende Unternehmen zuwider. Erst recht ahnte er, wie schwierig es nach seiner Rückkehr in Rom sein würde.
Es blieb dabei: der byzantinischen Prinzessin haftete ein untilgbarer Makel an. Sie war keine dem kaiserlichen Bräutigam ebenbürtige Braut. Sie war nicht als Tochter eines regierenden Basileus im kaiserlichen Purpurzimmer geboren, keine Porphyrogenneta. Ja gewiß, Theophanu stammte aus hochadeligem Haus, war durchaus eine Clarissima als Tochter des Konstantinos Skieros, dessen Schwester Maria der Basileus Johannes Tzimiskes zur Frau genommen hatte, da er das Heer befehligte und noch nicht auf dem Purpurthron saß. Eine Clarissima auch mütterlicherseits; ihre Mutter Sophia Phokaina war eine Nichte des vor drei Jahren ermordeten Basileus Nikephoros Phokas. Komplizierte Verhältnisse, wenn man bedenkt, daß die Mitglieder von Theophanus Mutterfamilie gegen Tzimiskes revoltieren. Aber der Basileus Tzimiskes traute der jungen, klugen Theophanu zu, daß sie als künftige Herrin des lateinischen Westens auch byzantinische Interessen wahren würde.
Das Nachdenken über die verwickelten Verhältnisse treibt dem Erzbischof Gero den Schweiß auf die Stirn. Er will nichts wissen von Byzanz, verdrängt das ihm am Hof von Konstantinopel Widerfahrene oder überläßt das Aufschlüsseln Liudprand. Doch er sinnt Tag und Nacht darüber nach, was er in Rom der nicht erfüllten Erwartung des kaiserlichen Hofes entgegenhalten könnte. Wird man ihm das Scheitern seiner Mission anlasten? Wird man die nicht purpurgeborene Prinzessin zurückschicken? Das Schlimmste, unausdenkbar die Folgen, auch für ihn, der ja eben erst die Gunst des Kaisers zurückgewonnen hat.
Ihm mißfällt der Einfluß der Hofdame Anastasia Dalassena, die ihrer Schutzbefohlenen auf der Insel das griechische Erbe schmackhaft macht. Erregt, mit groben Worten tadelt er die Fürstin, nicht Theophanu, das würde er nicht wagen. Er findet es der zur Kaiserin des Westens erkorenen Prinzessin unwürdig, daß sie dem bukolischen Inselleben, dem griechischen Theater und dem nahegelegenen Haus des Menandros mit den Mosaiken seiner dreisten Komödien mehr Aufmerksamkeit widmet als den Kirchen des wahren Glaubens.
Aber Gero irrt. Der Kirchenmann ahnt nicht im geringsten, was die zwölfjährige Byzantinerin im Innersten bewegt. Es ist alles andere als ein Rückfall, ein Verharren in der alten Welt, eher ein Abschiednehmen, gemischt mit einem Anflug von mädchenhafter Unbekümmertheit, bisweilen von Übermut. So streng, wie sie pflichtgemäß bei ihren öffentlichen Auftritten erscheinen mußte, so beherrscht, eingeschnürt in ihren bodenlangen steifen Schmuckmantel, war Theophanu nicht. Und natürlich betete sie in den Kirchen. Vor den heiligen Ikonen steckte sie ihre Kerzen auf, und vor dem Bild der Theotokos, der Gottesgebärerin, flehte sie um Hilfe, damit sich die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen mochten. So hatte sie es gelernt.
Das Abschiednehmen wiederholte sich von Insel zu Insel, von Küste zu Küste. Schrittweise, von Tag zu Tag mehr, entfernte sich Theophanu von ihrer Herkunft. Sie wuchs in die ihr bestimmte Rolle hinein, lernte unangestrengt, gewann im Umgang mit den Menschen aus der anderen Lebenswelt innere und äußere Sicherheit.
Zunächst fuhren sie südwärts zur Insel Chios, der felsigen Insel des blinden alten Homer. Bei der Zufahrt in der Morgenfrühe schlug ihnen der Duft der Zitrushaine entgegen. Wie bei jeder Landung verlief das anfangs immer sehr förmliche Zeremoniell. Der Empfang durch den Präfekten, die Nobilitäten und Beamten, durch die hohe Geistlichkeit, die Mönche und viele Schaulustige. Nur die Kinder, ungewohnt festlich in ihren hellen Tuniken, ungelenk ihre Blumenkränze schwenkend und schrill singend, verlockten Theophanu und die Versammelten zu einem Lächeln. Hymnische Gesänge und Flötenspiel begleiteten die Prinzessin auf dem Weg zu ihrem Quartier im von hohen Zypressen umgebenen Palast des Präfekten.
Wie gut waren die Aufenthalte gewählt. Mit jeder Insel prägte sich ihrem Gedächtnis ein Stück Byzanz ein. Am Ende trug Theophanu die Inselnamen mit sich wie Perlen, aufgereiht an einer goldenen Schnur: Lesbos, Chios und jenseits der wilden Ägäis Euboia, am kalkweißen Tempelfelsen von Sunion vorbei im Saronischen Golf die friedliche Insel Salamis, die so viel Kriegsschrecken gesehen hatte. Ein Ruderschlag hinüber nach Piräus Athen, aber ja, ein Pflichtgang der byzantinischen Prinzessin hinauf zur Akropolis und die üblichen Prozessionen zu den orthodoxen Heiligtümern.
Der Naukleros, nicht weniger als seine hohen Gäste, atmete auf, als sie, weiterfahrend bei halbwegs günstigem Wetter, die den Stürmen ausgesetzte Insel Kythera passiert und die südlichen bergigen Landzungen der Peloponnes umschifft hatten. Und noch einmal Byzanz, noch einmal die im Frühjahrssonnenlicht schimmernde byzantinische Perlenkette, ungetrübt der Glanz jeder Perle, geschützt vor den rauhen Winden des Ionischen Meeres: die Inseln Zakynthos, Kephallonia, Ithaka, Korfu.
Der Februar ging dem Ende zu. Das Meer um die Inseln war beruhigt. Bis in die Schiffskammern am Heck drang die Stimme des Paukators, der die Ruderer antrieb. Im hellen, schon frühjahrswarmen Sonnenschein steuerte die Prunkgaleere von Hafen zu Hafen, immer empfangen oder geleitet von Fischerbooten, manche mit Blumengirlanden.
Die kurzbemessenen Aufenthalte auf den letzten Inseln vor der Überfahrt nach Tarent weckten in Theophanu ein Gefühl nie zuvor so intensiv gekannter Heiterkeit. Sie fühlte sich wohl, und zwischen Empfängen und Pflichtübungen verblieb genug Zeit, aufzunehmen, was ihr gefiel: die weißblühenden Mandelbäume und die wildwachsenden Hyazinthen, den Duft der Pinien, der Orangen- und Zitronenhaine, das um die Felsbrocken rankende duftige Gesträuch von Myrte und Lorbeer. Zakynthos vor allem erinnerte sie an ihre Kindheit, an die Sommeraufenthalte in den väterlichen Gärten am Ostufer des Bosporus.
Sie erlaubte sich die Erinnerung, sprach davon zu Anastasia, als sie in der Dämmerung des ersten Abends auf Zakynthos zur Kirche Aghios Athanasios gingen. Aber sie erinnerte sich ohne Wehmut. Sie suchte auch nicht Zuflucht in ihrer Erinnerung aus Angst vor der Zukunft, vor allem Ungewissen und dem von den Bischöfen nicht Gesagten. So viele Fragen blieben offen.
Nur ein einziges Mal während der wochenlangen Reise von Insel zu Insel verfiel sie einer unstillbaren Mutlosigkeit, Verzweiflung. Das war bei der Überquerung der Ägäis, als sie Chios zurückgelassen hatten und lange Stunden orientierungslos in der Nachtschwärze umhertrieben, ausgesetzt der sturmgepeitschten See, gejagt von unsichtbaren Kräften.
Das Schiff hob und senkte sich, die Brecher schlugen hart auf die Deckplanken. Den Schiffsgästen war geraten worden, ihre Kammern nicht zu verlassen. Theophanu lag hilflos auf ihren Seidenkissen, ihr war sterbenselend vom Schwanken des Schiffs, vom schauerlichen Sturmgeheul, und in einem Anfall von verzweifeltem Trotz beklagte sie ihr Schicksal: Ich will nicht mehr, ich will zurück, oder tötet mich. Weder ihre Dienerin Eudokia noch der zur Wache befohlene Akritas wußten zu helfen. Die in der Nebenkammer schlaflos liegende hellhörige Anastasia kam, wischte ihr mit einem feuchten Tuch den Schweiß aus dem Gesicht. Als Theophanu versuchte aufzustehen, Luft zu holen, erbrach sie sich und spie Verdauungsreste auf den Boden, würgte gelbgrüne bittere Galle heraus, ehe ihr Anastasia einen Napf vor den Mund halten konnte. Um nicht auszugleiten bei der unablässigen Schlingerbewegung des Schiffs, hielt sie sich krampfhaft an einem der Bettpfosten fest. Anastasia legte die Zitternde wieder auf ihr Lager und blieb bei ihr in der Nacht, in der nicht einer auf der Galeere Ruhe fand.
Das Unwetter war plötzlich aufgekommen, mit sanften, dann rasch härter gegen die Segel klatschenden und aufheulenden Sturmböen, die von Norden, von den thrakischen Bergen herabfegend, über die Schiffe in der Ägäis herfielen wie ein Rudel Wölfe über eine Herde Schafe. Der Himmel verfinsterte sich schlagartig, und schon beim hastigen Kappen der Segel stürzte ein Mann in die brodelnde See. Von den Begleitschiffen, ihnen sonst in der Nacht durch Lichter und Lichtsignale verbunden, fehlte jede Spur.
Der Bischof Liudprand, mit der Literatur der Alten vertraut, hätte der Prinzessin sagen können, daß Boreas, der in den thrakischen Bergen hausende Windgott, mit wilder Kraft herabstürmte, die von ihm begehrte athenische Königstochter Oreithyia zu rauben. Liudprand kannte seinen Ovid. In den Metamorphosen des Römers hatte er gelesen, wie Boreas, als sein Werben und Schmeicheln nichts halfen, wutschnaubend und dröhnend über die Ägäis hereinbrach, seinen Mädchenraub mit Sturmgewalt zu vollenden. Aber Liudprand wagte nicht, auch später nicht, als sie das Kap Matapán passiert hatten und der Windgott besänftigt die Segel streichelte, Theophanu die Legende von Boreas und Oreithyia zu erzählen.
Das Schiff war gerettet. Die Sturmschäden konnten im nächsten windgeschützten Hafen behoben werden. Alle auf dem Schiff fühlten sich wie von einem quälenden Druck befreit, als sie die Ägäis und nach weiteren Tagen, nach der Umschiffung der Peloponnes, das Ionische Meer hinter sich ließen. Keine Gefahr mehr, keine Sturmgewalt, kein Boreas. Die Seeleute sangen, als hätte es niemals einen mörderischen Sturm gegeben, keinen Toten beim Segelkappen. Theophanu, die hörte, wie der Schiffsführer die Männer anbrüllte, weil ihr rauher Gesang die hohen Gäste stören würde, befahl ausdrücklich das Weitersingen.
Theophanu hatte die furchtbaren Schrecken der Nacht in der Ägäis überwunden. Sie war mit sich und dem ihr aufgenötigten Schicksal versöhnt. Auf Korfu, der letzten byzantinischen Insel, deren blumenreiche Vegetation und deren mildes Licht eher zum Bleiben verlockten, drängte Theophanu Skleraina zur Einhaltung der vorgeschriebenen Termine. Sie selbst verlangte die zeitige Überfahrt nach Tarent, denn ihr und ihrem Gefolge stand noch der Landweg durch Kalabrien bevor, bis zum Empfang in Benevent, wo die Beauftragten des Kaisers sie erwarteten, um sie nach Rom zu führen. Auf Korfu dachte sie an den Basileus Tzimiskes, an ihren Vater Konstantinos Skieros und an Byzanz ohne Vorbehalt, ohne den Beigeschmack einer über ihren Kopf hinweg ausgehandelten, ihr auferlegten Pflichtübung. In merkwürdiger Umkehrung sehnte sie sich nach Rom, dem Ort ihrer Trauung mit dem fremden Kaiser.
2. Liudprands letzte Aufzeichnung
Nicht Pflichtvergessenheit, sondern eine meinen Körper schwächende Krankheit hält mich im Kloster der Fratres Benedikti von Montecassino zurück. Gero sagte beim Abschied, ich solle zufrieden sein, die Prinzessin sei in guten Händen, im Schutz des kaiserlichen Gefolges werde sie in der ersten Aprilwoche über die Via Appia in Rom einziehen. Der Erzbischof von Köln hat gut reden. Wie kann ich zufrieden sein, wenn mir auf halbem Weg von Benevent nach Rom diese Recreatio befohlen wird? Die Ärzte duldeten nicht länger, daß mir ein erbärmliches Seiten- und Bruststechen das Sitzen im Sattel, jede Bewegung unerträglich macht. Ließen nur die Schmerzen nach.
War es Genugtuung, die ich in Geros blauen Augen zu entdecken glaubte, weil er in Rom allein den Triumph des Brautwerbers auskosten darf? Ich irre mich. Er ist redlich, offen, viel zu bieder für Hintergedanken. Dankbar war er in Tarent, als der byzantinische Gubernator seinem Ärger über die versöhnliche Geste seines Basileus Luft machte und ich Geros wütende Replik durch eine geschickte Wendung milderte. Sah doch der Gubernator in der Heirat ein Versagen der byzantinischen Politik, ein sträfliches Nachgeben. Er haßt den Kaiser Otto. Man wird mir nicht übelnehmen, wie ich im stillen die Wut des Byzantiners genoß.
Gero wird den Gubernator bald vergessen. Doch in Rom wird er verantworten müssen, daß er dem jungen Kaiser Otto nicht die purpurgeborene Prinzessin Anna, sondern die Nichte des Tzimiskes zuführt. Mit meiner Unterstützung würde er sich wohler fühlen. Das weiß ich.
In Konstantinopel profitierte er von meinen Erfahrungen am byzantinischen Kaiserhof, auch wenn es ihm in seiner naiven Selbstgewißheit schwerfiel, sich dies einzugestehen. Die Unbeholfenheit Geros beobachtete ich, der zwei Jahrzehnte Ältere, nicht ohne Schadenfreude. Äußerten sich so versteckte Rachegefühle? Schließlich hat man nicht mir, sondern ihm, dem Kölner, die Einholung der Braut überantwortet. Wollte man mich übergehen, zum Gehilfen herabsetzen, weil meine Brautwerbung vor vier Jahren mißlang? Aber, mein Gott, der hochgepriesene Kölner Erzbischofsstuhl steht dem Kaiser näher als mein Bischofssitz in Cremona.
Was ich erhofft, aber nicht erwartet hatte, war der Abschiedsbesuch der Prinzessin. Sie kam selbst herauf, schon im grünen Reisekleid, das lange schwarze Haar gebunden, von einer Lederkappe gehalten, und sie fragte nach meinem Befinden. Undenkbar der Vorgang in Konstantinopel. Wäre mir ähnliches am byzantinischen Hof nur ein einziges Mal widerfahren, würde ich anders denken über den Basileus und seine Kreaturen.
Mir lag auf der Zunge, Theophanu an das ganz und gar andere Verhalten ihres Großvaters Leon Phokas zu erinnern. Ich unterließ die Bemerkung, denn Leon Phokas, der Bruder und Hofmarschall des ermordeten Basileus, war nach dem Umsturz verhaftet und auf die Insel Kalonymos deportiert worden. Ungewiß sein Schicksal; man sagt, er sei geblendet worden.
Ich weiß auch nicht, ob Theophanu an der Verwandtschaft ihrer Mutterseite hängt. Mich irritiert, daß die Zwölfjährige so willig dem Heiratsbefehl des Tzimiskes folgte, des Mannes, der den Nikephoros Phokas ermordete und der die nun ihrerseits revoltierende Sippe der Phokades einkerkern ließ. Nicht das geringste Anzeichen von Bedenken, Widerstand oder gar Trauer bei der Prinzessin. War es kindlicher Gehorsam, mädchenhafte Unbekümmertheit, daß sie den Wechsel so schnell vollzog? Manchmal, wenn ich sie in den letzten Tagen beobachtete, dachte ich: Sie hat etwas von einer bindungslosen Abenteurerin, die ihr Gesicht mit Lust gegen den Wind hält. Man kann nicht in sie hineinschauen wie der Anatom in einen toten Körper, den er mit dem Messer öffnet. Wie auch? Sie ist lebendig, jung, anmutig und liebenswert wie niemand unter den Byzantinern, die ich kennenlernte. Vor ihr versagt mein Sarkasmus.
Auf dem Schiff, sooft sie mich rufen ließ zur Unterrichtung über alles Wissenswerte ihrer zukünftigen Lebenswelt, war ihr keine Gemütserregung anzumerken, eher eine Mischung aus Neugier und Einverständnis. Wie auch immer, ich wagte nicht zu fragen, wollte nicht ihr vergelten, wie ihr Großvater mich vor vier Jahren mit Unehren empfing und schmachvoll behandelte.
Er war es doch, der mich und meine zweimal zwölf Begleiter, erschöpft wie wir waren nach wochenlangem mühsamen Ritt, vor den Toren Konstantinopels im strömenden Regen warten ließ, der uns dann eine Herberge zuwies, wo es kein Wasser gab, keine menschenwürdigen Schlaflager, ein offenes Gebäude, das Hitze wie Kälte und Regen hereinließ. Ich erkrankte schwer, litt unter einem Dauerdurchfall, mußte aber jederzeit auf den Beinen sein, wenn die Herren Gastgeber riefen. Schon beim ersten Disput stritten wir zornig um den Titel meines Kaisers Otto, den der Hofmarschall Leon Phokas geringschätzig bloß König der Franken nannte.
Der Hofmarschall war das Sprachrohr seines Bruders, sein Kuropalates und Logothet, wie die Byzantiner sagen. Was für ein komisches Brüderpaar, dem ich nach stundenlangem Warten im Palast zugeführt wurde: neben dem hochgewachsenen Leon der zwergenhafte Nikephoros, kurzbeinig, darüber ein aufgeschwemmter Bauch; auf den schmächtigen Schultern ein dicker Kopf und ein von langen, ungepflegten Haaren umrahmtes Schweinsgesicht. Der Zwerg soll in seinen sechs Regierungsjahren ein tüchtiger Herrscher Ostroms gewesen sein? Die wahren Herrscher saßen, niedriger als er, zu seiner Linken, zwei kleine Kaiser sozusagen, wie er in prunkvollen, doch alten, schon übelriechenden Gewändern. Es waren die Kinder des verstorbenen Basileus Romanos, Stiefsöhne des Nikephoros, der zu seiner Legitimierung die Witwe des Romanos geheiratet hatte.
Nach Anna, der gerade fünfjährigen Tochter des Basileus Romanos, um derentwillen ich als Brautwerber gekommen war, hielt ich vergeblich Ausschau.
In Nikephoros Phokas lernte ich einen eitlen Prahler und Heuchler kennen. Er protzte mit seiner militärischen Stärke, und er ließ keine Gelegenheit aus, mich zu demütigen. Ich habe alles, Wort für Wort, in meinem Bericht an den erhabenen Kaiser Otto aufgeschrieben: wie der Byzantiner mich als Spion beschimpfte, wie er mir, dem Boten des Kaisers, an seiner Tafel nur den fünfzehnten Platz gönnte, einen Platz ohne Tischtuch, wie er mir ein anderes Mal befahl, in einem Gasthaus mit seinen Dienern zu speisen, mir dann wiederum von seiner Tafel Leckerbissen schickte, einen fetten Bock, köstlich gewürzt mit Knoblauch, Zwiebeln, Porree und mit Fischlake übergossen.
Wechselbäder von Gunst und Schmach, wobei die schändliche Behandlung überwog. Man sperrte mich ein, stellte Wachen auf, ließ mich hungern und dürsten, und ich schrieb an die Wand des verhaßten Hauses:
Aus Ausonien kam ich Liudprand von Cremona
Nach Konstantinopel aus Liebe zum Frieden,
Gefangener war ich hier vier Sommermonate lang.
Ja, ja, ja, dazu allein war ich nach Konstantinopel gekommen, gesandt von meinem Kaiser Otto, nicht weniger erwünscht von Nikephoros Phokas, um durch die byzantinische Ehe den Frieden zwischen Ost- und Westrom zu sichern. Nicht von Theophanu war die Rede, sondern von Anna, der fünfjährigen Tochter des Basileus Romanos, denn natürlich drängte mein Kaiser auf die Ehe mit einer ebenbürtigen Kaisertochter. Ich sagte es Nikephoros Phokas ins Gesicht: Wenn es deine Absicht ist, die Prinzessin Anna dem Mitkaiser und Sohn meines Herrn zur Gemahlin zu geben, so sollst du mir dies eidlich bezeugen, und ich werde durch Eid die Gegengabe meines Kaisers bestätigen, wie er ja schon, von mir beraten, ganz Apulien dir überlassen hat.
Er lachte, bis ihm das Wasser aus den Schweinsaugen rann. Mir überlassen? Wir haben deinen Kaiser Otto mit seinen Sachsen, Franken, Bayern, Schwaben und Italern verjagt, als er Bari in Süditalien erobern wollte. Wie schamlos von deinem Herrn, mit Feuer und Schwert in mein byzantinisches Reichsgebiet Apulien einzufallen.
Ich blieb nicht stumm, erwiderte ohne Zögern: Was du byzantinisches Reichsgebiet nennst, gehört in Wirklichkeit zum Königreich Italien, erst recht, nachdem die sizilischen Sarazenen aus Apulien und Kalabrien vertrieben sind.
Eines Tages ließ er mich in den kaiserlichen Tierpark führen, auf seine kindische Art prahlend, dort würde ich ganze Rudel der seltenen, in unseren Ländern unbekannten Waldesel sehen. Beim Anblick der grasenden Tiere kam mir ein Sibyllenspruch in den Sinn, wonach der alte und der junge Löwe gemeinsam den Waldesel besiegen. Die Griechen deuten das als Sieg des griechischen und des lateinischen Kaisers über den König der Sarazenen. Aber ich dachte an eine andere, viel zutreffendere Auslegung. Demnach würden der alte Löwe und sein Junges, nämlich meine Kaiser Otto, Vater und Sohn, durch nichts als durch ihr Alter verschieden, den störrischen Waldesel Nikephoros Phokas verjagen.
So zogen sich die Wochen, Monate hin, mit erhitzten Disputen, Verunglimpfungen, launischen Torturen, flüchtigen Gnadenbeweisen. Ich notierte schon, wie meine Gesundheit schweren Schaden litt. Wo anders als in Konstantinopel finde ich die Ursache meiner Krankheit, die mich zum Aufenthalt im Kloster der benediktinischen Brüder zwingt? Bettlägerig nahe dem Fenster mußte ich sehen, wie die Prinzessin mit ihrem Gefolge ohne mich weiterzog, talwärts reitend zwischen den blühenden Mandelbäumen.
Ich muß nicht wiederholen, was ich vor vier Jahren meinem Schreiber diktierte. Aber es soll mir vor Augen bleiben, zu meiner Rechtfertigung, weshalb nicht die Prinzessin Anna, sondern Theophanu, die Nichte des Tzimiskes, auf dem Weg nach Rom ist.
Es ist alles anders gekommen, als von meinem Kaiser und mir erwartet. Bis zuletzt hielt mich der Basileus Nikephoros hin, spielte er Katz und Maus mit mir. Sollte ich nicht erfreut sein über die Beseitigung des Mannes, der mich zum Narren machte und mich quälte?
Seine Forderungen schraubte er höher und höher, verlangte schließlich die Freigabe von Ravenna und Rom und aller Länder von dort bis nach Konstantinopel, eingeschlossen die schon byzantinischen Themen Apulien, Kalabrien, Lukanien. Das nenne ich Größenwahn.
Was die Prinzessin Anna betrifft, so ließen die Byzantiner, nachdem ich den Ärger wie die Hitze und den Durst nicht länger ertragen konnte und mehr tot als lebendig um Entlassung bat, die Katze aus dem Sack. In Gegenwart des Nikephoros und seines Bruders Leon erklärte mir der Oberkämmerer Basilius mit hochgezogenen Augenbrauen in seinem feisten Gesicht, wir sollten doch wissen, daß es gegen den Brauch des Kaiserhauses verstoße, die im Purpurzimmer geborene Tochter eines purpurgeborenen Kaisers dem Herrscher eines fremden Volkes zur Gattin zu geben.
Lächerlich, dieser Kult mit dem Purpur. Wenn ich Purpur höre, werde ich selbst rot bis hinter die Ohren, nicht aus Scham, sondern aus Zorn. Als ich endlich die Erlaubnis zur Abreise erhielt, erdreistete sich ein simpler Zöllner, mir fünf Mäntel aus kostbarem Purpur wegzunehmen. Die Mäntel hatte ich gekauft, um sie als Geschenke mitzunehmen. Unwürdig, so hieß es, sei der Kaiser Otto, seien die Italer, Sachsen, Franken, Bayern, Schwaben, ja alle fremden Völker, sich mit Purpurmänteln zu schmücken.
War denn der Basileus Nikephoros allein würdig, den Purpur zu tragen? Oder machte ihn gar der Purpur würdig? Ich antworte mit einem Vers des Boethius, dessen Schrift vom »Trost der Philosophie« ich mit mir trage:
Ob mit tyrischem Purpur stolz sich schmückte
Nero, allen verhaßt blieb er dennoch
mit seinem Schwelgen in Grausamkeiten.
Kein Purpur vermag die Schurkereien eines Schurken zu überdecken. Man verlange von mir nicht, den Nikephoros würdig oder gar ehrwürdig zu nennen. Und hat er nicht, um nach byzantinischem Recht als Basileus anerkannt zu werden, die Witwe seines Vorgängers Romanos geheiratet, dieselbe Frau niederer Herkunft, der man neben anderen Bosheiten nachsagt, sie habe ihren Mann, den Basileus, vergiftet? Soll Nikephoros als einziger nicht gewußt haben, was man in Konstantinopel an jeder Ecke erzählte?
Ich weiß, man mag mir jetzt entgegenhalten, dieser häßlichste Mann, der je die oströmische Kaiserkrone trug, habe für Byzanz mehr geleistet als Romanos, er habe genug gebüßt durch seine eigene Ermordung in jener Dezembernacht 969, bei der seine Basilessa wiederum ihre Hand im Spiel hatte. Sie war die Geliebte des Thronräubers Tzimiskes, der sie nur darum nicht zur Frau nahm, weil der Patriarch von Konstantinopel seine Zustimmung verweigerte und verlangte, daß er die Basilessa vom Hof verbannte.
Ich schäme mich, ihren Namen auszusprechen. Sie nannte sich Theophano, Gottes Schein, Gottes Abglanz. Mit ihr jedoch hat unsere Theophanu, wie wir sie lateinisch nennen, so wenig gemein wie Feuer mit Wasser. Die Prinzessin Theophanu ist anderer Art. Wenn ich jetzt, während ich dies diktiere, die unter dem Purpur ausgeheckten Verbrechen bedenke, so bedauere ich nicht mehr, daß unsere Theophanu keine Purpurgeborene ist.
Natürlich ist der Basileus Tzimiskes klüger als der starrköpfige Nikephoros. Er handelt sich den Frieden im Westen ein, Versöhnung mit dem Kaiser Otto, indem er dessen Heiratswunsch erfüllt, und das, ohne eine byzantinische Sitte zu verletzen. Es ist nicht statthaft, die Tochter eines Basileus einem ausländischen Herrscher zur Frau zu geben. Aber Tzimiskes erliegt seinem Wunschdenken, wenn er glaubt, die Prinzessin Theophanu, weil sie gehorsam und seine Nichte ist, werde am Kaiserhof der Ottonen nichts anderes im Kopf haben als seine byzantinischen Interessen. Soviel konnte ich auf dem Schiff, auf der langen Reise hierher, von ihrem Wesen erfahren. Die junge Theophanu ist nicht nur die untadelige Clarissima, sondern die beste Braut des Kaisers Otto, obwohl sie ihn noch nicht kennt, noch nicht einmal gesehen hat.
Sagte ich, daß man nicht in sie hineinschauen kann? Manchmal dachte ich, daß sie wie der absolute Neubeginn ist, eben aus dem Mutterleib entlassen, die Nabelschnur durchschnitten. Eine kindliche Losgelöstheit entdeckte ich in ihr. Ich sah, wie sie nach unserer Lektion zum Vorderschiff lief, nur noch die Meeresfahrt zu genießen, wie sie, als uns in der Ägäis der Sturm überraschte, rückhaltlos klagte, wie sie auf den Inseln, die wir zur Rast besuchten, ausgelassene Freude empfand beim Anblick der Naturschönheiten und der Verteilung von Geschenken an die Kinder, die mit Blumenkränzen zu ihr kamen.
Es war freilich nicht die naive Kindlichkeit, die sie bewegte, denn sie hat ihre Kindheit zurückgelassen, eine zwölfjährige frühreife junge Frau mit ihrer schönen mittelgroßen Gestalt, gebildet, willensstark und durchaus selbstbewußt. Aber sie richtet sich ganz und gar, mit allen Sinnen, auch mit ihrem Verstand, auf das Neue, in das sie hineinbefohlen wurde. Ich sage: hineingeboren wie durch eine zweite Geburt. Sie ist nicht mehr das Geschöpf des Tzimiskes.
Könnte ich doch den Reitern, der Kolonne mit Wagen und Tragtieren auf dem Weg nach Rom, beladen mit der überreichen byzantinischen Mitgift, nachschreien: Unternehmt alles, damit die Prinzessin Theophanu in Ehren aufgenommen wird.
Leicht hält man sich nach einiger Erfahrung auf seinem Gebiet für unersetzlich. Nackenschläge, unvermeidbar, wenn man nicht zum Kriecher werden will, scheinen die Selbsteinschätzung nicht zu mindern, eher zu bestätigen. Bin ich so? Bin ich der einzige, der den byzantinischen Kaiserhof gut genug kennt, um die Prinzessin gegen alle Einwände zu verteidigen? Aber Gero, der anfangs so unbeholfen, steif und förmlich auftrat, gewann Theophanus Vertrauen, gewann es von Tag zu Tag mehr. Er wird in Rom ihr bester Anwalt sein.
Was ist mit den kaiserlichen Abgesandten, die uns in Benevent empfingen, auf nicht mehr byzantinischem, sondern langobardischem Boden? Ob Bischof Dietrich von Metz, der Vetter des Kaisers und sein Beauftragter, Theophanu so verbunden bleibt, wie er sie mit schmeichelnden griechischen Worten begrüßte? Ich kenne mich aus mit übertriebenen Elogen und will für den breitschultrigen Dietrich keine Hand ins Feuer legen.
Mir gefiel übrigens dieser Schachzug des Kaisers, die Wahl Benevents im langobardischen Besitztum in Süditalien zum Ort der offiziellen Übergabe der Braut und der Entlassung des größeren byzantinischen Gefolges. Jedermann kennt die traditionelle Verknüpfung der langobardischen Königskrone mit dem römischen Kaisertum. Deutlicher hätte der Kaiser Otto nicht zeigen können, wie selbstverständlich er als König der Langobarden süditalisches Territorium beansprucht, wie er nicht weniger rechtmäßig die römische Kaiserkrone trägt. Mancher aus dem byzantinischen Gefolge wird Benevent zähneknirschend verlassen haben.
Ich vermerke das wegen der mir in Konstantinopel zugefügten Widerwärtigkeiten nicht ohne Genugtuung. Alles Zähneknirschen kann die durch die Eheverbindung geschaffenen Tatsachen nicht mehr umstoßen. Auch der empörte Gubernator in Tarent mußte sich schließlich der Entscheidung seines Basileus beugen und uns mit der Prinzessin beherbergen. Und als erster bekam der Gubernator zu spüren, wie die Prinzessin Theophanu ihren Willen durchzusetzen und zu befehlen verstand.
Wem bringt die byzantinische Ehe mehr Gewinn, dem Basileus Tzimiskes oder meinem Kaiser Otto? Mir, der ich ungewollt zum Zuschauer der Ereignisse wurde, fällt es nicht schwer zu sagen: dem Kaiser Otto und mehr noch seinem siebzehnjährigen Sohn. Das sollte in Rom und am Kaiserhof von den Angehörigen der kaiserlichen Familie, von den Klerikern und Fürsten niemand vergessen.
3. In Rom. Erster Bericht der Anastasia D.
Endlich in Rom, wohin ja, wie man hier sagt, alle Wege führen. Endpunkt der aus den fernen Provinzen kommenden Heeres- und Pilgerstraßen. Wie schnell lernten wir, was in diesem den Römern gefälligen Spruch an tieferer Bedeutung steckt. Römischer Stolz macht Rom zum Mittelpunkt der Welt, noch immer, obwohl es längst woanders das glanzvolle imperiale Neue Rom gibt. Stupide Überheblichkeit will nicht wahrhaben, daß mit Konstantin die Kaiserstadt, die Hauptstadt des Imperiums, vom Tiber an den Bosporus wechselte. Wie könnte ich das, aus Byzanz kommend, als geborene Dalassena, als Begleiterin Theophanus und – wie ich ohne Scheu sage – deren engste Vertraute auch nur einen Tag vergessen? Seit wir in Rom eingezogen sind, vergeht kein Tag, an dem ich nicht Lust verspürte, den Römern eine Lektion zur Geschichte des Imperiums zu erteilen.
In Wahrheit kann ich nur Theophanu von den römischen und griechischen Kaisern erzählen, sofern das nicht gründlicher der Erzbischof Gero besorgte oder Liudprand von Cremona, der krank in Montecassino zurückblieb. Die Bischöfe sind keine Römer, aber doch dem Westkaiser verpflichtet. Unterwegs beschuldigte mich Gero, die Prinzessin zu oft an Byzanz zu erinnern und zu wenig vom Reich des Kaisers Otto zu sprechen. Was weiß ich schon davon? Und ist es nicht wichtiger, unter dem Ansturm des Neuen ein Stück Byzanz festzuhalten? Wir sind keine Barbaren, die auf Befehl verleugnen, was gestern war.
Es lag auch nicht nur an mir. Ich folgte der Aufforderung meiner Herrin Theophanu. Ihre Stimme summt mir noch in den Ohren. Anastasia, erzähl mir von den Griechen, von Byzanz, wie Kaiser Konstantin seine Stadt gründete, die Landgrenze mit den Auguren abschritt, wie Justinian seine Gesetze sammelte, wie er die Hagia Sophia errichten ließ.
Wißbegierig, gelehrig war schon das Mädchen, das ich in der Magnaura kennenlernte, als man mich, die Dalassena, der ein Jahrzehnt jüngeren Skleraina mit dem vielbewunderten Namen Theophanu zur Seite gab. Unsere Väter achteten auf den Adelsrang unserer Familien, obwohl Theophanu als Nichte des Basileus eine Vorzugsstellung einnahm. Zuerst fielen mir ihre großen, fiebrig glänzenden Augen auf und wie sie ihre Lehrer in der Palastschule oder mich mit den unmöglichsten Fragen traktierte. Aber jetzt, wo sie wußte, was sie am Ziel unserer Reise erwartete, schien sie nach Wissen zu verlangen wie nach einem Schutzpanzer, den sie anlegte, um Sicherheit zu gewinnen, um sich nicht wehrlos auszuliefern.
Als unser Wagen kurz vor Rom über das Basaltpflaster der Via Appia rumpelte und die übermüdete Theophanu aus ihrem Halbschlaf aufschreckte, fragte sie mich: Ist es wahr, Anastasia, daß der Kaiser Justinian die Tochter eines Bärenführers geheiratet hat, die Schauspielerin Theodora? Eine dumme Frage. Natürlich wußte sie selbst die Antwort, wußte sie auch, wie sich die nicht standesgemäße Theodora in ihrer Rolle als Basilessa bewährt hat. Aber was ging in ihrem Kopf vor? Das hätte ich gerne gewußt.
Wir sind in Rom, nicht mehr in Byzanz, sagte ich, als wir die antiken Grabmonumente seitlich der Via Appia passiert hatten und uns dem Stadttor näherten. Kuriere waren vorausgeritten, unsere Ankunft zu melden, und der Stadtpräfekt hatte den Römern Beine gemacht. Da standen sie nun an beiden Straßenseiten, Scharen von Zivilisten, Abordnungen der Stände, der Schulen, Kleriker, Ordensleute, Soldaten in Reih und Glied, von Offizieren in farbigen Umhängen zu Willkommensrufen angefeuert, daß es uns dröhnend in die Ohren ging.
Wir waren solchen Empfang gewöhnt, doch stärker als anderswo schlug uns hier blanke Neugier entgegen. Was dachten sie wohl? Was erwarteten sie aus Byzanz? Ich hatte immer gehört, die Römer seien Besucher aus entlegenen Provinzen und fernsten Ländern gewöhnt, solche Besuche würden sie nicht unbefohlen aus ihren Häusern locken. Aber wir wußten es ja, der Erzbischof Gero hatte es oft genug gesagt, die byzantinische Prinzessin als auserwählte künftige Kaiserin des Westreichs war eine Besonderheit, eine Attraktion selbst für die verwöhnten Römer.
Wir wußten, was uns erwartete, und doch ärgerte ich mich, weil sich die Neugier der Römer so aufdringlich und grobschlächtig zeigte, weil ihnen jegliche Heiterkeit zu fehlen schien. Wie heiter waren doch die Empfänge auf den Inseln gewesen. Die Römer stierten uns an wie eines der sieben Weltwunder. Ich ärgerte mich für Theophanu, die den Leuten freundlich zunickte, selbstsicher, gar nicht mehr mädchenhaft. Erst jetzt begreife ich, was wir dem Verhandlungsgeschick des Basileus Tzimiskes verdanken: zugesichert das byzantinische Hofgefolge, groß genug, daß man nicht den deutschen und römischen Dienstleuten ausgeliefert war; unangetastet die in der Wagenkolonne mitgeführte Fülle an Gefäßen, Geräten, an Alltags- und Prunkgewändern, an kostbaren Seidenstoffen, die Theophanu so sehr liebt, an Gold und Schmucksachen jeder Art.
Byzanz entließ uns überreich und einer künftigen Kaiserin würdig. Niemand sollte Grund haben, dem oströmischen Kaiserhof Geiz oder Schlimmeres vorzuwerfen.
Angenehmer waren die offiziellen Begrüßungen, nur schrecklich ermüdend. So viele Empfänge, so viele Zeremonien, an denen wir teilnehmen mußten. So viele neue Gesichter, mit denen sich hohe Titel und unaussprechliche Namen verbanden, weit mehr, als wir von Gero und Liudprand gehört und uns eingeprägt hatten.
Eines muß ich nun doch meinen Notizen, wer immer sie lesen mag, anvertrauen, denn ich will nicht dem Verdacht der Ungerechtigkeit ausgesetzt sein. Die deutschen Fürsten, die Mitglieder der Kaiserfamilie – ich rätsele immer noch, wer mit wem verschwägert oder sonstwie verwandt ist –, nahezu alle besitzen mehr Anstand, Höflichkeit, bessere Lebensart, als man uns von ihnen erzählt hat.
Wir gewannen Freunde, noch ehe wir dem kaiserlichen Vater Otto mit seiner Gemahlin Adelheid und dem nun schon mit Theophanu vermählten jungen Kaiser Otto vorgestellt wurden. Den uns vertrauten Bischof Liudprand vermißten wir. Aber Erzbischof Gero, trotz seiner früheren Vorhaltungen, erwies sich im entscheidenden Augenblick als bester, verläßlicher Helfer.
Der Sachse Willigis, der Berater des jungen Kaisers, als Erzkaplan und Kanzler der wichtigste Mann am Hof, versicherte uns seiner Freundschaft. Er gehört zu den Männern, auf deren Wort man bauen kann. Und ohne Scheu zeigte uns der auch Otto genannte Sohn Liudolfs von Schwaben, der Enkel des Kaisers und seiner ersten Gemahlin Edgitha von England, seine Zuneigung. Er ist der Stiefneffe und gleichaltrige Freund des jungen Kaisers, lebhaft, großherzig, einfach liebenswert. Vielleicht liegt es an seiner Jugend, seinem unverstellten Wesen, daß er, wo immer er auftritt, Sympathie auslöst.
Wir brauchten Freunde, denn wir wußten längst, daß bis zur kaiserlichen Krönung und Hochzeit nicht alles zu unseren Gunsten stand. Über gutwillige, vielleicht auch böswillige Zuträger, von denen genug an den Türen lauschen, hatten wir Beunruhigendes erfahren. Demnach gab es unter den hochadeligen Männern einige, die dem Kaiser einzureden versuchten, Theophanu sei eine unerwünschte Braut seines Sohnes. Der Basileus Tzimiskes habe dem Westkaiser die purpurgeborene Kaisertochter Anna vorenthalten und an deren Stelle seine Nichte gesandt. Theophanu müsse zurückgeschickt werden. Jetzt verstand ich den Erzbischof Gero, seine Besorgnis, die in Rom einem hartnäckigen Einstehen für die Braut Theophanu wich.
Man schämte sich nicht, den Kaiser allen Ernstes zu bedrängen, er solle die Prinzessin wie ein unwillkommenes Geschenk zurückweisen, ihre Rückreise samt Begleitung veranlassen. Wir waren empört, wir zitterten der ersten Begegnung mit der kaiserlichen Familie entgegen.
Ich ertappe mich dabei, immerfort wir zu sagen, weil ich gewohnt bin, für Theophanu mitzudenken, mitzufühlen. Aber hat sie das noch nötig? Seit unserem Einzug in Rom verhält sie sich wie ausgewechselt, selbstsicher (ich notierte das schon), ihrer Erwählung voll bewußt, ohne dabei etwas von ihrer mädchenhaften Anmut einzubüßen. Sie strahlte, als sie den genannten Männern vorgestellt wurde, dem jungen Kanzler Willigis, dem achtzehnjährigen Otto, der sie als Freund ihres künftigen Gemahls begrüßte. Nur gegenüber dem älteren Bischof Dietrich von Metz, dem Vetter des Kaisers, der uns seit dem Empfang in Benevent zur Seite steht, bleibt eine gewisse Distanz, was nicht allein an ihr liegt. Aber Dietrich von Metz verteidigt uneingeschränkt die byzantinische Heirat, wie man sie hier am Hof nennt.





























