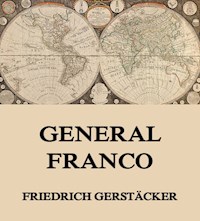
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Lebensbild aus Ekuador. Friedrich Gerstäcker war ein deutscher Schriftsteller, der vor allem durch seine Bücher über Nordamerika und aus aller Welt bekannt wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
General Franco
Friedrich Gerstäcker
Inhalt:
1. Die Familie Buscada.
2. Die Execution.
3. In Bodegas.
4. Der quitenische Officier.
5. Ein Familienabend.
6. In Quito.
7. Auf dem Lande.
8. Doctor Ruibarbo.
9. Der Bote.
10. In Guajaquil.
11. Juan Ibarra.
12. Verschiedenes Schicksal.
13. Der Marsch gegen Quito.
14. In der Branntweinbrennerei.
15. Das Souper.
16. Der Ausmarsch der Quitener.
17. Die Begegnung.
18. Nach Camino real.
19. Señor Malveca.
20. Flores' Brief.
21. Am Chimborazo.
22. Die Schlacht von Tucumbo.
23. Die Verfolgung.
24. Franco in Guajaquil.
25. Im Hotel de France.
26. Castilla's Botschaft.
27. Doctor Ruibarbo's Hochzeit.
28. Die Einnahme von Guajaquil.
29. Franco's Flucht.
30. Der erste Morgen.
31. Das Verhör.
32. Fortunato in Quito.
33. Nachwort.
General Franco, F. Gerstäcker
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849615475
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich Gerstäcker – Biografie und Bibliografie
Roman- und Reiseschriftsteller, geb. 10. Mai 1816 in Hamburg, gest. 31. Mai 1872 in Braunschweig, Sohn eines seinerzeit beliebten Opernsängers, kam nach dessen frühzeitigem Tode (1825) zu Verwandten nach Braunschweig, besuchte später die Nikolaischule in Leipzig, widmete sich dann auf Döben bei Grimma der Landwirtschaft und wanderte 1837 nach Nordamerika aus, wo er mit Büchse und Jagdtasche das ganze Gebiet der Union durchstreifte. 1843 nach Deutschland zurückgekehrt, widmete er sich mit Erfolg literarischen Arbeiten. Er gab zunächst sein Tagebuch: »Streif- und Jagdzüge durch die Vereinigten Staaten von Nordamerika« (Dresd. 1844, 2 Bde.; 5. Aufl., Jena 1891) heraus, schrieb kleine Sagen und Abenteuer aus Amerika nieder und wagte sich endlich an ein größeres Werk: »Die Regulatoren in Arkansas« (Leipz. 1845, 3 Bde.; 10. Aufl., Jena 1897), worauf in rascher Reihenfolge »Der deutschen Auswanderer Fahrten und Schicksale« (Leipz. 1847; 3. Aufl., Jena 1899), »Mississippibilder« (Leipz. 1847–48, 3 Bde.), »Reisen um die Welt« (das. 1847–48, 6 Bde.; 3. Aufl. 1870), »Die Flußpiraten des Mississippi« (das. 1848, 3 Bde.; 10. Aufl. 1890) und »Amerikanische Wald- und Strombilder« (das. 1849, 2 Bde.) neben verschiedenen Übersetzungen aus dem Englischen erschienen. 1849–52 führte G. eine Reise um die Welt, 1860–61 eine neue große Reise nach Südamerika aus; 1862 begleitete er den Herzog Ernst von Koburg-Gotha nach Ägypten und Abessinien. 1867 trat er eine neue Reise nach Nordamerika, Mexiko und Venezuela an, von der er im Juni 1868 zurückkehrte. Seine letzten Jahre verlebte er in Braunschweig. Seine spätern Reisen beschrieb er in den Werken: »Reisen« (Stuttg. 1853–1854, 5 Bde.); »Achtzehn Monate in Südamerika« (Jena 1862, 3. Aufl. 1895) und »Neue Reisen« (Leipz. 1868, 3 Bde.; 4. Aufl.). Gerstäckers Reisen galten nicht wissenschaftlichen oder sonstigen allgemeinen Zwecken, sondern der Befriedigung eines persönlichen Dranges ins Weite; seine Schilderungen sind daher vorwiegend um ihrer frischen Beobachtung willen schätzbar. Ebenso verfolgte der fruchtbare Autor bei seinen zahlreichen Romanen und Erzählungen schlechthin Unterhaltungszwecke. Wir nennen davon: »Der Wahnsinnige« (Berl. 1853); »Wie ist es denn nun eigentlich in Amerika?« (2. Aufl., Leipz. 1853); »Tahiti«, Roman aus der Südsee (5. Aufl., das. 1877); »Nach Amerika« (das. 1855, 6 Bde.); »Kalifornische Skizzen« (das. 1856); »Unter dem Äquator«, javanisches Sittenbild (7. Aufl., Jena 1902); »Gold« (4 Aufl., Leipz. 1878); »Inselwelt« (3. Aufl., das. 1878); »Die beiden Sträflinge« (5. Aufl., das. 1881); »Unter den Penchuenchen« (das. 1867, 3 Bde.; 4. Aufl. 1890); »Die Blauen und Gelben«, venezuelisches Charakterbild (das. 1870, 3 Bde.); »Der Floatbootsmann« (2. Aufl., Schwerin 1870); »In Mexiko« (Jena 1871, 4 Bde.) etc. Seine kleinern Erzählungen und Skizzen wurden unter den verschiedensten Titeln gesammelt: »Aus zwei Weltteilen« (Leipz. 1851, 2 Bde.; 6. Aufl. 1890); »Hell und Dunkel« (das. 1859, 2 Bde.; 6. Aufl. 1890); »Heimliche und unheimliche Geschichten« (das. 1862, 3. Aufl. 1884); »Unter Palmen und Buchen« (das. 1865–67, 3 Bde.; 3. Aufl. 1896); »Wilde Welt« (das. 1865–67, 3 Bde.); »Kreuz und Quer« (das. 1869, 3 Bde.); »Kleine Erzählungen und nachgelassene Schriften« (Jena 1879, 3 Bde.); »Humoristische Erzählungen« (Berl. 1898) u. a. Unter seinen Jugendschriften verdienen »Die Welt im Kleinen für die kleine Welt« (Leipz. 1857–61, 7 Bde.; 4. Aufl. 1893), unter seinen Humoresken besonders »Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer« (das. 1857, 11. Aufl. 1896) Auszeichnung. Gerstäckers »Gesammelte Schriften« erschienen in 44 Bänden (Jena 1872–79), eine Auswahl in 24 Bänden, hrsg. von Dietrich Theden (das. 1889–90); »Ausgewählte Erzählungen und Humoresken«, hrsg. von Holm in 8 Bänden (Leipz. 1903).
General Franco
1. Die Familie Buscada.
Bodegas, das sonst so friedliche, sonngebrannte Städtchen, das, am Bodegasstrom unweit Guajaquil belegen, den eigentlichen Centralpunkt für den ganzen Binnenhandel der Republik bildet, befand sich heute in einer fast fieberhaften Aufregung, und während überall kleine Trupps wild genug aussehender Soldaten mit klingendem Spiel einherzogen, sammelten sich die Bürger und zahlreiche Arrieros und Maulthiertreiber in Gruppen und betrachteten mißtrauisch das geräuschvolle Leben um sich her. Grund dazu hatten sie auch wahrlich genug.
Heute war nämlich zu noch ganz früher Stunde der ecuadorianische Usurpator, General Franco, der sich am liebsten Excellenz, als künftiger Präsident, tituliren ließ, eingerückt, um Bodegas zu seinem Hauptquartier zu machen und von hier aus seine Operationen gegen die Hauptstadt des Reiches, gegen Quito, zu beginnen, und heute schon sollte ein junger quitenischer Officier, den man noch in Bodegas angetroffen und jetzt beschuldigte, ein Spion des Generals Flores zu sein, standrechtlich erschossen werden.
Ganz Bodegas war dazu auf den Füßen, aber wahrlich nicht allein aus Neugier, um das blutige Schauspiel mit anzusehen, sondern mehr aus einem Gefühl eigener Beunruhigung, denn was hier einem vollkommen unschuldigen Manne geschah, konnte unter der Willkür dieses Menschen jedem Andern von ihnen auch geschehen. Und wer hätte sich ihm widersetzen wollen?
Mit einer Horde gedungenen Gesindels behauptete er seine Macht in diesem südlichen Theile der Republik. Die uniformirten und bewaffneten Banden waren aber, wenngleich schlecht bezahlt und lediglich auf die Plünderung der reichen Stadt Quito vertröstet, doch dem Usurpator so ergeben, daß er mit ihnen machen konnte, was er wollte – und das wußte er. Nur durch den Schrecken, durch die Furcht, die er um sich her verbreitete, regierte er, und weil er vielleicht ahnte, daß das eigentliche Volk doch im Herzen der quitenischen Regierung ergeben sei und seine Herrschaft nur gezwungen duldete, nutzte er die so gewonnene, unbeschränkte Gewalt in boshafter Schadenfreude auch jetzt gründlich aus.
Umsonst hatte man deshalb auch schon Alles an diesem Morgen versucht, um das Herz des Generals zur Milde gegen den Unglücklichen zu stimmen. Umsonst erbot sich eine Deputation der Einwohner, Bürgschaft für ihn zu leisten. Es lag kein anderer Beweis gegen ihn vor, als daß man ihn, nachdem ein kleiner Trupp quitenischer Soldaten, der Uebermacht weichend, abgezogen, allein noch in Bodegas – Morgens um sieben Uhr – aufgefunden. Franco selber glaubte vielleicht nicht einmal an seine Schuld, aber auf alle Bitten erwiderte er nur: man müsse ein Exempel statuiren, um diesen vermaledeiten Quitenern zu zeigen, was sie zu erwarten hätten, wenn sie sich nicht gutwillig seinem milden Scepter unterwürfen – und dabei blieb es.
Die Execution war geschlossen, selbst ohne eine nicht für nöthig erachtete Untersuchung, und um elf Uhr sollte der Unglückliche draußen vor der Stadt erschossen werden.
In Bodegas hatte sich indessen ein so wunderliches wie romantisches Gerücht verbreitet, daß jener junge quitenische Officier Benito Espinoza nicht etwa der Politik sondern der Eifersucht des Generals zum Opfer falle. Franco hatte nämlich in demselben Haus, in dem er sich jetzt auch wieder einquartirt, bei der Señora Buscada, schon vor einigen Monaten einmal ein paar Tage gewohnt, und man vermuthete, daß ihn die Señora mit ihrer Familie sogar vor einiger Zeit besucht habe, denn sie hielt sich acht Tage in Guajaquil auf. Als aber die Quitener danach Bodegas besetzten, war Espinoza ein täglicher Gast in dem Hause der Señora Buscada und – wie man behaupten wollte, von der jüngsten Señorita gar nicht ungern gesehen. Selbst die alte Señorita begünstigte seine Besuche, denn er spielte Morgens, während die jungen Damen Toilette machten, oder auch nach Tisch Monte mit ihr, wobei er regelmäßig sein Geld verlor, klimperte reizend auf der Guitarre und hatte eine allerliebste Tenorstimme, mit der er quitenische Lieder und Romanzen sang. Dazu war seine Partei gerade die herrschende, weshalb also nicht einen so liebenswürdigen Vertreter derselben in ihrem Hause dulden.
Jetzt, da Franco's Truppen so plötzlich in Bodegas einrückten, schien es mehr als wahrscheinlich, daß sich der junge Espinoza nicht so rasch hatte von seiner angebeteten Celita trennen können – lag doch auch eine gewisse Romantik darin, der herannahenden Gefahr muthig die Stirn zu bieten, nur General Franco selber besaß außerordentlich wenig Sinn für Romantik, und da er von seinen zahlreichen Spionen gerade genug erfahren, um seinen Doppelhaß gegen den Quitener und Nebenbuhler zu lenken, so war von ihm wahrlich keine Gnade zu hoffen.
Espinoza mußte sterben. Es schien das ja auch zu einer so allgewöhnlichen Sache geworden zu sein, irgend einen der eingefangenen Feinde auf irgend einen Verdacht hin erschießen zu lassen, daß es nicht einmal der Mühe lohnte, darüber nur ein Wort zu verlieren. Er war im Weg und wurde beseitigt, und damit charakterisiren sich überhaupt fast alle südamerikanischen Revolutionen dieser sogenannten Republiken, daß die verschiedenen Aspiranten zur Präsidentschaft den Gegner nicht etwa durch die Wahl und Stimmen des Volkes zu besiegen suchen, sondern ihn einfach vernichten, wo sie ihn eben fassen können. So lange sie deshalb die Militärgewalt in den Händen haben, so lange regieren sie – aber nicht einen Tag darüber.
Es mochte elf Uhr sein, und Franco's Generalstab – ein paar Officiere mit entsetzlich überladenen Uniformen, die ordentlich bedeckt mit Goldschnüren und Quasten und Troddeln schienen – hielt vor dem Eckhaus, das der Señora Buscada gehörte und wo der General Quartier genommen hatte. Dieser aber, als unabhängig Regierender, schien sich nicht so genau an die von ihm selbst festgestellte Zeit zu binden. Der Generalstab mochte warten und ebenso der zum Tode Verurtheilte, bis seine Zeit kam. Franco, mit seiner Toilette beschäftigt, stand am Fenster vor einem kleinen Spiegel und mühte sich eben ab, die Cravattenschnalle hinten zuzubringen.
Und das war der Mann, der ein ganzes Land in Aufruhr gebracht, der die Macht hatte über Leben und Tod von Tausenden und in dem südlichen Theil der Republik schaltete und waltete wie er eben wollte, während Männer von Geist und Bildung ihm dienten und sich seinen Befehlen fügten?
Es war eine kleine gedrungene, breitschultrige Gestalt, nicht einmal volle fünf Fuß hoch, mit einem runden gemeinen Gesicht, kleinen halb zugekniffenen Augen, und Zügen, in denen rohe Sinnlichkeit so deutlich ausgeprägt war, wie es in einem Menschenantlitz nur möglich ist. Seine Feinde behaupteten dabei, er sei ein Sambo – d. h. ein Abkömmling von Mulatte und Neger, und wenn das auch vielleicht übertrieben sein mochte, so trug er doch die vollständig ausgeprägte Mulatten-Physiognomie, und die gelbbraune Haut machte seine überdies widerliche Erscheinung nicht freundlicher.
Draußen auf dem Executionsplatze stand, von Soldaten umgeben, der Verurtheilte mit auf den Rücken gebundenen Händen und harrte des Augenblicks, der ihm in der Blüthe der Jahre den Tod geben sollte. Vor dem Thore des Hauses hielten die Officiere, die schon dreimal Meldung hinauf geschickt hatten, daß Alles bereit sei, das begonnene Drama zu beenden, und oben in dem Zimmer stand der kleine Mulatte, der alle diese blutigen Fäden in der Hand hielt, vor seinem Spiegel und ordnete seine Cravatte so sorgsam und in so voller Ruhe, als ob er zu einem Balle geladen wäre und nicht wisse, was mit der müßigen Zeit vorher anzugeben.
Da öffnete sich die Thür und ein junges Mädchen in einem etwas sehr leichten Morgenanzuge stand auf der Schwelle. Sie mochte etwa zwanzig oder einundzwanzig Jahre zählen und ihre Züge waren regelmäßig, ja selbst schön zu nennen, während die vollen, hinten zu einem Knoten gebundenen dunkelkastanienbraunen Haare ihrem Kopf etwas Edelantikes verliehen. – Und doch lag – vielleicht auch nur in diesem Augenblick, ein recht häßlicher Zug von Spott und Verachtung um ihre Lippen, als ihr Blick über die Gestalt des Mannes streifte und dann – wie suchend durch das Zimmer glitt. Ja selbst in dem späteren Gespräch verlor er sich nicht ganz, sondern milderte sich nur in etwas.
»Excellenz,« sagte sie mit leiser, aber nichts weniger als schüchterner Stimme, und ihr Blick haftete dabei fest auf der kleinen gedrungenen Gestalt des Mulatten.
»Ah, meine schöne Celita,« erwiderte der General, ohne sich nach ihr umzudrehen, denn er hatte im Spiegel vor sich ihr Gesicht erkannt. »So früh schon munter, Señorita? Treten Sie doch näher.«
»Excellenz,« fuhr aber die Schöne fort, ohne der Einladung Folge zu leisten, »ich komme mit einer Bitte.«
»Sie wissen doch, daß ich Ihnen nichts abschlagen kann,« erwiderte galant der General.
»Gut,« sagte das junge Mädchen, »dann bitte ich um das Leben des Verurteilten, der, wie ich fest überzeugt bin, unschuldig an dem ihm zur Last gelegten Verbrechen ist.«
»Puh, Señorita,« rief Se. Excellenz und suchte sich dabei in die etwas enge Uniform hineinzuzwängen, denn er hatte bis jetzt in Hemdärmeln vor dem Spiegel gestanden, »mischen Sie sich nicht in Politik. Das ist ein äußerst gefährliches Spielzeug für junge Damen, und es wirft außerdem auch in diesem Fall ein sehr schlechtes Licht auf Ihre Loyalität, wenn Sie das Leben eines Rebellen von mir verlangen.«
»Eines Rebellen, Excellenz?«
»Ja wohl, eines Rebellen,« wiederholte der General und suchte dabei im Zimmer umher nach seinem Säbel und Federhut – »oder rechnen Sie die Quitener, die sich meiner rechtmäßigen Oberhoheit noch mit den Waffen in der Hand widersetzen, etwa nicht dazu?«
»Also selbst diese kleine Gefälligkeit wollen Sie mir weigern?«
»Kleine Gefälligkeit!« sagte Franco, sich den gefundenen Säbel umschnallend. »Die ganze Stadt freut sich auf das Schauspiel, einen dieser verdammten Quitenen todtschießen zu sehen.«
»Die ganze Stadt hat schon Deputationen zu Ihnen geschickt, die um Gnade baten,« sagte das Mädchen finster.
»Die ganze Stadt? Ein paar mißvergnügte Halunken waren es,« rief der kleine Mulatte erbost – »Verrätherische Subjecte, die es im Geheimen mit Flores halten, denen ich aber schon auf die Finger sehen und sie bei nächster Gelegenheit dafür züchtigen werde – verlassen Sie sich darauf. Außerdem sind meine braven Soldaten heute Morgen expreß zu der Execution hinausmarschirt, braten schon seit einer vollen Stunde auf der offenen Ebene draußen – nennen Sie das etwa auch eine Kleinigkeit? – Uebrigens,« setzte er hinzu, nachdem er seine Toilette vollendet hatte und dicht zu der Dame trat, »möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, Señorita, daß man hier in Bodegas ganz eigenthümliche Sachen munkelt – bitte, vertheidigen Sie sich nicht – ich will nichts davon wissen und nichts gehört haben, denn die Gesinnungen Ihrer Tante bürgen mir dafür, daß Sie keine verrätherischen Absichten in Ihrer Familie hegen. Señora Entonza würde sonst dieses Haus nicht zu ihrem Aufenthaltsort gewählt haben, da sie durchaus loyal und mir und meiner Sache treu ergeben ist – hat sie doch auch Grund genug dafür. – Aber – es wäre gut, wenn ich auch nichts hören müßte, was mich mißtrauisch machen könnte, Señorita, denn« – fügte er leise hinzu und hob ihr mit dem Finger das Kinn etwas in die Höhe, »ich meine es gut mit Ihnen und – möchte nicht, daß Sie Ihrem eigenen Glück im Wege ständen.«
Damit schritt er an der ihm Raum gebenden Dame vorbei und die Treppe hinab, daß sein Säbel polternd auf den hölzernen Stufen hinter ihm drein klirrte. In der Seitenstraße unten, vor einer schmalen Flucht dort angebrachter hölzernen Schwellen, standen die Pferde; ein Neger hielt den Zügel seines muntern Thieres, das er bis dicht an die Treppe gedrängt hatte. Franco brachte sich mit einiger Mühe in den Sattel und sprengte wenige Minuten später, von seinem Generalstab und den Blicken – und vielleicht auch leise gemurmelten Verwünschungen der Nachschauenden gefolgt, die Straße hinab, die in das Innere führte und gleich vor der Stadt in eine weite, nur mit niederem Gebüsch überstreute Ebene ausmündete.
Celita stand noch eine Weile ganz so, wie sie der General verlassen, auf der Schwelle von dessen Stube, und hatte ihr Antlitz vorher Spott und Verachtung gezeigt, so zog jetzt ein noch viel drohenderes Gewölk über ihre Stirn und gab dem sonst so hübschen Gesicht einen düstern, fast wilden Ausdruck. Wie unwillkürlich ballte sich ihre Hand, und als sie den Platz verließ und dem gemeinschaftlichen Wohnzimmer zuschritt, murmelte sie leise bös klingende Worte vor sich hin.
Im Wohnzimmer fand sie nur ihre Mutter, die in einem weiten weißen, nicht übermäßig glänzenden Morgen- oder Negligérock, mit einer Tasse Kaffee neben sich, auf dem aus Rohr geflochtenen Sopha lag, ihre Cigarre rauchte und kaum den Kopf wandte, als die Tochter das Zimmer betrat.
»Nun?« fragte sie, als sie den finstern Ausdruck in deren Zügen erblickte – »Hab' ich es Dir nicht gleich gesagt? – Das war umsonst und Du hättest Dir die Mühe sparen können.«
»Er ist blutgierig wie immer,« sagte Celita, »und das Land bekommt keine Ruhe, bis er einmal – seinen Meister gefunden.« »Laß Du das, um der heiligen Jungfrau willen, nicht die Tante hören,« rief die Mutter rasch und warf den scheuen Blick im Zimmer umher, als ob sie selbst jetzt ihre Nähe fürchtete. »Außerdem,« setzte sie aber ruhiger hinzu und qualmte stärker, »geschieht es dem albernen Espinoza vollkommen recht. Er wußte, was ihm bevorstand – es ward ihm von verschiedenen Seiten deutlich genug zu verstehen gegeben. Aber nein, Gott bewahre, er mußte da hocken bleiben, bis sie ihn beim Kragen hatten, nur um sein langweiliges und nutzloses Schmachten noch ein Paar Stunden länger fortzusetzen. Ich hätte doch nie meine Einwilligung zu Eurer Verheirathung gegeben.«
»Benito stammt aus einer guten Familie,« zürnte die Tochter.
»Was hilft mir die gute Familie, wenn sie kein Geld hat,« sagte die Mutter und schüttelte gleichgültig den Kopf. »Der Proceß mit Malvecas hat ihnen Alles gekostet, was sie besaßen, ein kleines erbärmliches Haus in Quito ausgenommen, und der Vater malt jetzt Bilder für Geld und die Tochter näht für andere Leute – da hast Du Deine »gute Familie.« Dieser Señor Espinoza wäre nicht zur Armee getreten, wenn er gewußt hätte, sich auf andere Weise durchzubringen, und von seinem Lieutenantssold soll er doch wohl keine Frau – und ihre Familie ernähren! Nein, das war eine von den unglücklichsten Ideen, die Du je gehabt, und General Franco konnte uns wirklich gar keinen größeren Gefallen thun, als daß er den unbequemen Menschen aus dem Weg schafft. Wir, vor allen Anderen, sollten ihm dankbar dafür sein.«
»Mutter!« warf Celita grollend dazwischen.
»Ach was – leben kostet Geld,« sagte die alte Dame trotzig, und ihre ohnedies nicht hübschen Züge nahmen einen recht fatalen Ausdruck an. »Ihr beiden Mädchen braucht alle Jahre mehr für Putz Eurer Kleider und Gott weiß, wozu sonst – wo soll's endlich herkommen? Eure hübschen Gesichter sind das Einzige, was uns noch Kostgänger in's Haus und Leute hierher bringt, die ihr Geld mit Anstand verzehren. Seid Ihr Beiden aber toll genug, Euch dem ersten Besten an den Hals zu werfen, der den Arm nach Euch ausstreckt, was wird nachher aus Euch, aus mir? Sei vernünftig, Celita,« fuhr sie endlich nach einer Pause fort, in der das junge Mädchen schweigend vor sich nieder gestarrt hatte, »sieh, von Eurer Tante – so reich sie sein mag – habt Ihr nicht das Mindeste zu erwarten, als vielleicht einmal ein Kleid oder einen Hut, oder sonst ein Stück Flitterkram, denn die alte Gans wird nächstens ihren dümmsten Streich machen und den Doctor heirathen. Ja, sie wird's« – setzte die Mutter rechthaberisch hinzu, als Celita ungläubig mit dem Kopf schüttelte, »den Doctor reizen die Häuser in Guajaquil und Quito, ihn lockt das baare Geld, das sie im Kasten liegen hat, und er ist gerade der rechte Mann, hartnäckig und unermüdlich dahinter her zu sein – kenn' ich ihn doch von früher gut genug.«
»Aber so weit ich ihn kenne,« sagte Celita, »hängt er an der quitenischen Regierung, und die Tante, der Flores einmal verhaßte Einquartierung in's Haus gelegt hat, ist eine fanatische Schwärmerin für Franco –«
»Caramba,« sagte die alte Dame, indem sie mit den Fingern ein Schnippchen schlug, »so viel geb' ich für Doctor Ruibarbo's politische Meinung. Sein Katechismus ist der: es mit der Regierung zu halten, die gerade am Ruder ist oder in deren Bereich er sich befindet. Alles Andere kümmert ihn verwünscht wenig, und er wäre der Letzte, seine Politik ein Hinderniß sein zu lassen, wo er mit da- oder dorthin Neigen sein Glück machen könnte.«
»Die Tante ist vier Jahre älter als er.«
»Desto schlimmer für die Tante,« sagte Señora Buscada trocken. »Das darfst Du aber – wenn es die Tante auch noch bis auf den letzten Moment ableugnet – für eine abgemachte Sache halten. Von der Seite haben wir nicht das Geringste zu erwarten und sind und bleiben auf uns selber angewiesen. Wenn Du es jetzt aber nur ein klein wenig klug anfängst, so kannst Du den Franco um den kleinen Finger wickeln und gelingt Dir das, dann ist unser Glück gemacht.«
»Und glaubst Du wirklich, daß er sich so lange halten kann? sagte die Tochter verächtlich.
»Bah, das bleibt sich ganz gleich,« erwiderte die alte vor sich hinlachend, indem sie sich eine frische Cigarre drehte; »jedenfalls bleibt er lange genug am Ruder, um für sich und – Andere – ein hübsches Vermögen zusammen zu scharren, und wer die Zeit zu benutzen versteht, gewinnt. – Doch was brauch' ich Dir mehr darüber zu sagen,« brach sie kurz ab, »Du bist ja sonst immer ein so gescheidtes Mädchen, und – ich höre auch Jemand draußen – sieh doch einmal nach.«
Ehe Celita dem Befehl nachkommen konnte, öffnete sich die Thür und Doctor Ruibarbo – oder Don Manuel, wie er kurzweg im Hause genannt wurde, erschien auf der Schwelle und grüßte mit seinem runden, verschmitzten Gesicht die Damen auf das Freundlichste.
»Ach, Señoritas,« sagte er, indem er zuerst auf Señora Buscada zuging und ihr die Hand küßte und dann der jüngeren Dame ein Gleiches that – »wie befinden Sie sich bei der Hitze? – Caramba! ich schmelze beinahe. Es geht auch nicht ein Luftzug heute,«
»Setzen Sie sich, Doctor,« sagte die alte Dame, während es die junge nicht der Mühe werth hielt, ihm zu antworten, »und Celita, bringe uns die Caraffe mit Wasser und den Cognac – wie der Doctor nur von der Hitze sprach, habe ich Durst bekommen. Es ist wirklich ein fatales Klima – wenn ich Quito dagegen annehme.«
»Aber doch augenblicklich in Quito ebenfalls eine etwas drückende politische Atmosphäre,« sagte der Doctor mit einer leichten Spötterei. »Die Actien stehen in der Balance, und wenn unser gemeinschaftlicher Freund Franco seinen kühnen Siegeszug wirklich bis dahin ausdehnen sollte –«
»Glauben Sie, daß er es durchführt, Doctor?« unterbrach ihn die alte Dame, indem sie ihn scharf ansah.
»Wer weiß,« erwiderte der Doctor mit einem, den Südländern ganz eigenthümlichen Achselzucken. »Er hat einen unternehmenden Geist und großen Anhang – sehr großen Anhang.«
»Und dann?«
»Ja und dann, Señora – das ist wohl leicht gefragt, aber schwer beantwortet, und wir können nur hoffen, daß unser armes, schwer bedrängtes Vaterland nachher den Frieden findet, den es so nöthig braucht.«
»Lassen wir die Politik,« brach aber Señora Buscada ab, die wohl wußte, daß sie aus dem schlauen Doctor vergebens irgend eine bestimmte Meinung herauszulocken suchte. »Machen wir ein Spielchen, Don Manuel?«
»Mit dem größten Vergnügen, wenn Sie mir Ihre kostbare Zeit so weit opfern wollen.« Damit half sich der Doctor zu einem Schluck Cognac und Wasser und nahm, während die Señora die stets neben ihr auf dem Sopha bereit liegenden Karten mischte, ihr gegenüber an dem Tische Platz.
So mochten sie etwa eine halbe Stunde gespielt haben und Celita lehnte indessen an dem offenen Fenster und schaute in düsteren Gedanken hinab auf den vorbeiströmenden Bodegasfluß, als plötzlich klar und deutlich eine kurze Salve knatternden Kleingewehrfeuers an ihr Ohr schlug. Das junge Mädchen zuckte erschreckt empor und selbst der Doctor hielt die Karte fest in der Hand, die er eben umlegen wollte – ein flüchtiger Blick hatte ihn belehrt, daß er mit derselben seinen Satz verlor.
»Nun, was ist?« sagte die Señora, deren ganze Aufmerksamkeit auf die Karten gerichtet blieben.
»Armer Benito,« seufzte Celita leise vor sich hin.
»Aeußerst schnelle Justiz hier im Lande,« bemerkte der Doctor, der aber fand, daß er das Blatt den Augen gegenüber nie im Leben unterschlagen konnte, »Señor Espinoza hat ausgelitten. – Die Familie wird sehr betrübt sein.«
»Das ist der Krieg,« erwiderte aber gleichgültig die Dame. »Wenn die Quitener einen der Unsrigen erwischen, machen sie es gerade so mit ihm – nun, Doctor, was haben Sie da – aha, den Reiter« – und sie strich sich mit Behagen das ihr zugeschobene Silber ein.
Von dem Erschossenen wurde nicht mehr gesprochen.
2. Die Execution.
Die Umgebung von Bodegas bildet eine ausgedehnte, sandige, mit Weideland und Weidenbüschen bedeckte Ebene, die aber in der Regenzeit von dem austretenden Bodegasfluß vollständig unter Wasser gesetzt wird. Selbst in der trockenen Jahreszeit sind die Spuren dieser Ueberfluthung noch deutlich an den Büschen bis zu zehn und zwölf Fuß Höhe zu erkennen, wo sich die Reste von angewaschenem Schlamm und eingeschwemmten Reisern und Blättern zeigen. In jener Zeit steht Bodegas mit dem höher liegenden Land auch nur durch Canoes in Verbindung, und die Bewohner der Stadt selber müssen ihre sämmtlichen unteren Geschosse räumen und in die oberen flüchten.
Jetzt freilich war von solcher Ueberschwemmung keine Spur. Der ziemlich breite Fluß, der aber seine Strömung je nach Ebbe oder Fluth des Meeres regelt, füllte noch nicht einmal seine Ufer, und überall fiel der Blick auf freundlich grüne Flächen, auf denen zahlreiche Heerden weideten, oder auf kleine, malerisch gruppirte Büsche, die oft wie von einer geschmackvollen Hand künstlich gestellt erschienen und dem ganzen anmuthigen Bilde einen eigenthümlichen Zauber verliehen. Und wie malerisch lagerten dazu die wilden, kriegerischen Gestalten, über den offenen Grund zerstreut und jeden Schatten benutzend, denen ihnen hier und da eine alte Weide, oder ein einzeln liegendes Gebüsch bieten konnte. Allerdings wäre ein Europäer wohl kaum auf den Gedanken gekommen, daß er es hier mit regulären Soldaten zu thun habe – denn etwas Irreguläreres ließ sich kaum denken; aber pittoresk genug sahen die Burschen aus, und ein Salvator Rosa würde wundervolle Gruppen für seine Leinwand darunter gefunden haben. Sie glichen in der That nur einem Haufen zusammengelaufenen Gesindels, das hier versteckt lagerte, um mit Einbruch der Nacht vielleicht die Stadt zu überfallen und zu morden und zu plündern, und – will man die Wahrheit gestehen, so waren sie auch nicht viel besser, und nur Franco's Versprechungen, nicht etwa seine Macht, hielten sie noch in Rand und Banden und machten sie seinen Befehlen gehorchen.
Kaum die Hälfte von ihnen stak dabei in Uniformen und nicht zehn von Allen trugen Schuhe, während der Schwarm eine solche Mischung von Lanzen, Musketen, Säbeln und Bajonetflinten führte, daß es ordentlich aussah, als ob sie ein altes ethnographisches Naturaliencabinet überfallen und geplündert und sich in den Inhalt getheilt hätten.
Ja selbst in ihrer Hautfarbe waren sie sich nicht gleich, und die »Schattentracht des heißen Sonnenstrahls« zeigte sämmtliche Nüancen vom ungesunden Gelb des Guajaquilenen bis zu dem tiefen, entschiedenen Schwarz des Congonegers, wobei allerdings Neger und Mulatten am allerzahlreichsten vertreten schienen. Die polizeiwidrigsten Physiognomien fanden sich dabei, die sich auf der Welt nur denken lassen. In keinem Bagno hätten bestimmtere und abstoßendere Verbrechergesichter gefunden werden können.
Daß diese Schaar hier herausberufen war, um die Todesstrafe an einem – möglicher Weise ganz unschuldigen Menschen zu vollstrecken, konnte ihre Gemüthlichkeit natürlich nicht im Geringsten stören. Der Mann war einer von ihren »Feinden« und »verurtheilt«, was kümmerte sie das Uebrige, und Blut – Du großer Gott, was für Blut hatte diese Bande schon vergossen – was konnte sie ein einzig Leben mehr bekümmern!
Von den verschiedenen Gruppen der Soldaten umgeben, aber nur von zwei mit geladenen Gewehren bewaffneten Vagabonden wirklich bewacht, lag das unglückliche Opfer dieses Morgens fest gebunden im Schatten eines alten knorrigen Weidenbaumes, dessen Wurzeln sein Blut in wenigen Stunden, vielleicht Minuten, düngen sollte, und die übrige Bande schien auch außerordentlich wenig Notiz von ihm zu nehmen. Um Flaschen voll Agua ardiente und Tschitscha geschaart, hier und da Einige sogar mit Kartenspiel beschäftigt, lagerten sie zu kleinen gesellschaftlichen Cirkeln und schrieen und lachten und sangen nach Herzenslust.
Aber auch von den Bewohnern Bodegas hatte sich eine Anzahl von Zuschauern gesammelt, die sich freilich nicht unter die Soldaten mischen durften und wahrscheinlich auch wenig Lust dazu verspürten. Aber doch Zeugen des Dramas wollten sie sein, denn neugierige Müßiggänger giebt es ja überall, und wunderbarer Weise sind es ganz besonders die Frauen, die bei solchen Gelegenheiten die Mehrzahl derselben bilden. Man sollte glauben, daß gerade ihre Nerven zu schwach wären, die Spannung einer solchen blutigen Katastrophe zu ertragen, daß ihr weicheres Herz so viel tiefere und dadurch peinlichere Eindrücke empfangen müsse. – Wie dem auch sei, die Thatsache steht fest, daß sie vor allen Anderen sich zu Hinrichtungen drängen, und auch hier schimmerten die bunten Kleider aus verschiedenen Gruppen vor, und zeigten sich liebe angsterfüllte Gesichter – die aber etwas darum gegeben hätten, wenn die halb ersehnte – halb gefürchtete Execution ihren Anfang genommen.
Nur ein Wesen von Allen schien nicht aus Neugier hier herausgekommen – nur ein Herz von all' den Hunderten, die hier draußen versammelt waren, schien in Angst und Schmerz zu schlagen und vor dem nahenden Augenblick zu zittern. Das war ein junges Mädchen von kaum sechzehn Jahren, mit gar so lieben unschuldigen, wenn auch jetzt todtenbleichen Zügen, das unfern der Gruppe, wo der Gefangene lag, mit ihren zarten Händen den Sand tief aufgewühlt hatte, um eine irdene Flasche mit Wasser frisch und kühl zu halten. Aber sie sprach dabei kein Wort. Still und ineinander gebrochen kauerte sie auf der Stelle, und nur manchmal flog der angsterfüllte Blick der Stadt zu, denn sie wußte nur zu gut, daß von dort her das Zeichen für den nahenden furchtbaren Augenblick auftauchen mußte. Der Gefangene selber wurde, wie schon bemerkt, nur von zwei Soldaten bewacht, und selbst diese wären nicht nöthig gewesen, denn man hatte ihm die Arme so zusammengeschnürt und selbst ein Seil um seine Füße und den nächsten Busch geschlungen, daß er ohne fremde Hülfe nie im Stande gewesen wäre, sich auch nur aufzurichten. Unfern von ihm aber standen drei Officiere der Franco'schen Armee in ernstem und lebendigem Gespräch, und der Blick, der manchmal von dem einen oder andern derselben zu dem Gefangenen hinüber flog, verrieth deutlich genug, daß er selber den Inhalt der Unterhaltung bilde.
Sie waren, weit besser und anständiger als die Soldaten, in eine der französischen ähnelnde Uniform gekleidet, und besonders der eine von ihnen – ein noch junger Mann von vielleicht fünfundzwanzig Jahren, hatte ein intelligentes, offenes Gesicht und scharf ausgeprägte Gutmüthigkeit in seinen Zügen – und doch betraf ihr Gespräch hier nichts weniger als Hochverrath und Meuterei. – Es galt das Leben des Verurtheilten.
So sicher sich auch Franco nämlich auf seine Soldaten verlassen konnte, die jedenfalls so lange bei ihm aushielten, als sie Aussicht auf Plünderung der eroberten Städte oder regelmäßigen Sold bekamen, so unsicher stand er mit seinen ecuadorianischen Officieren, meist jungen Leuten, die in Quito selber erzogen und anfänglich vielleicht nur durch das Abenteuerliche des Krieges angelockt worden waren, dem Usurpator ihre Kräfte zu leihen. Franco war außerordentlich reich an Versprechungen gewesen, und als der Krieg begann und er sich zum Dictator aufwarf, verkündeten seine Worte das Aufblühen der Republik zu einer nie geahnten Höhe. Kunst und Wissenschaft wollte er dabei gern begünstigen, aber der Soldatenstand sollte und mußte der geehrteste von allen sein. Er gedachte eine reine Militärrepublik zu gründen, und das verlockte manchen jungen Officier, sich ihm, in Aussicht einer brillanten Carrière, anzuschließen.
Franco war aber keineswegs der Mann, der seine wahren Absichten und Neigungen hätte lange geheim halten, oder den intelligenten Theil seiner »Unterthanen« hätte täuschen können. Nur zu bald trat der freche, sinnliche Mulatte in den Vordergrund, und da er selber recht gut fühlte, daß er bei den wirklichen Ecuadorianern von spanischer Abkunft keinen richtigen und festen Boden unter den Füßen habe, fing er an, sich mehr und mehr mit seinen eigenen Leuten, mit Mulatten und Negern zu umgeben und diese auch, auf die er sicher rechnen konnte, zu Officieren zu machen.
Das natürlich entfremdete ihm den Sinn der »Weißen« mehr und mehr, aber nicht einmal eine Klage darüber durften sie laut werden lassen, denn überall hatte der kleine, mißtrauische General seine vortrefflich bezahlten Spione, und wehe dem Unglücklichen, der ihm gegründete Ursache zu Verdacht gab – er war rettungslos verloren und einem Kriegsgericht verfallen, das nur aus der unmittelbaren Umgebung des Generals selber bestand und eigentlich nichts als den Willen und Befehl des Dictators repräsentirte.
Viele Officiere bereuten deshalb jetzt den Schritt, der sie der Franco'schen Armee einverleibt hatte und sogar zwang, gegen ihre eigenen Quitener Freunde feindlich aufzutreten, aber – er war einmal geschehen und für jetzt wenigstens kein Rücktritt für sie möglich. Nur ein Ansuchen um Entlassung würde die schwersten und unberechenbarsten Folgen für sie gehabt haben, denn eine Anklage auf Hochverrath gegen sie wäre keinesfalls ausgeblieben.
In Furcht und Gehorsam hielt sie Franco damit – das ist wahr, aber ihre Zuneigung konnte er damit nicht gewinnen. Doch die verlangte er auch nicht. Sobald sie nur seinen Befehlen gehorchten, kümmerte ihn das Andere wenig genug, und in seinen aufgebauten Luftschlössern sah er sich schon, von seinen treuen Schaaren umgeben, im Palast von Quito, der ganzen reichen Republik Gesetze dictirend und indessen in den dort aufgehäuften und confiscirten Schätzen schwelgend. Er glaubte schon nicht einmal mehr an eine Schlacht, sondern da er Bodegas so leicht und ohne Blutvergießen genommen hatte, nur an einen Siegeszug durch das ganze Reich, der ihn mit leichter Mühe zum gefürchteten und mächtigen Präsidenten der Republik machte.
Bis dahin schien auch wirklich Alles zusammengetroffen zu sein, um seine kühnsten Pläne zu begünstigen und ihnen den Stempel des unbedingten Erfolgs aufzudrücken. Mit der Hülfe des peruanischen Präsidenten Castilla im Rücken, dessen Kriegsdampfer sogar vor Guajaquil lagen, von einer zahllosen Schaar von Stellenjägern, die bei solchen Revolutionen nie fehlen, sondern sie meist hervorrufen, umlagert und unterstützt – das meist aus Mulatten und Negern, aber durchschnittlich aus Gesindel bestehende Heer durch Aussicht auf Plünderung begeistert, schien in der That nichts seinen Siegeszug zu hemmen oder seiner rohen Willkür Einhalt thun zu können – nicht einmal seine Officiere.
Desto empörter waren aber deshalb gerade die besseren unter ihnen durch den nutzlosen Blutdurst des kleinen Ungeheuers, das sich jetzt wieder ein neues Opfer ausersehen hatte, um das gehaßte Quito seine Macht fühlen zu lassen, und wäre ihnen Zeit genug geblieben, wer weiß, ob nicht schon jetzt ein verzweifelter Widerstand sie vereinigt hätte. So aber drängte sich das ganze Ereigniß in wenige Stunden zusammen, eine Besprechung wurde zur Unmöglichkeit, und nur der Officier, dem die specielle Überwachung des Verurtheilten übertragen worden, sann einen kecken Plan aus, dem Gefangenen zu helfen und dem Usurpator das schon sicher geglaubte Opfer zu entziehen, ohne sich selber der Rache desselben preis zu gehen. – Natürlich konnte dabei nichts mit Gewalt geschehen, nur allein die List mußte ihnen helfen.
José Fortunato war aber nicht der Mann, einen einmal gefaßten Plan wieder so rasch aufzugeben, und da ihn der Zufall noch so weit begünstigte, einen ihm gleichgesinnten Freund zugetheilt zu bekommen, lag ihm nur die Schwierigkeit ob, den dritten Kameraden sich ebenfalls geneigt zu machen, denn Villegas, der junge Officier und ebenfalls ein Quitener, oder doch aus der Nachbarstadt Ibarra stammend, haßte den Mulattengeneral wohl eben so viel wie sie, aber kannte auch dessen Macht und Grausamkeit und zeigte anfangs nicht die geringste Lust, die Rache und den Zorn desselben auf sein eigenes, bisher noch ungefährdetes Haupt zu ziehen. Es liegt überhaupt nicht in dem Charakter der Ecuadorianer, irgend etwas für einen Andern zu thun, wo nicht der eigene Nutzen mit im Spiele ist und das Wagniß wenigstens einigermaßen lohnen könnte.
Die Drei standen etwas abgesondert von den beiden wachthabenden Soldaten, einem Cholo oder Eingeborenen und einem Mulatten, und Fortunato hatte eben seine ganze Ueberredungskunst aufgeboten, um den jungen Freund ihrer Sache zu gewinnen. Die Zeit drängte, und Franco konnte jeden Augenblick mit seinem Stabe erscheinen, ja hätte eigentlich schon lange auf dem Platze sein müssen, und dann war der Gefangen rettungslos verloren.
»Companeros,« sagte da Villegas, indem er sehr bedenklich mit dem Kopf schüttelte – »das ist ein ganz verzweifeltes Unternehmen. Sehen Sie die Banden da drüben? – ein einziger Wink Francos', und sie fallen mit derselben Wonne über uns her wie über jedes andere Schlachtopfer, das dieses kleine Ungeheuer ihnen bezeichnet. Wenn man uns entdeckt!« –
»Aber es wird nicht entdeckt, Villegas,« drängte Fortunato, »ich gebe Ihnen mein Wort, Alles, wobei ich betheiligt bin, sobald es nur nicht mich selber betrifft – glückt; artet aber in das schmählichste Pech aus, sobald ich persönlich das geringste Interesse dabei habe. Das ist aber hier gerade nicht der Fall; ich kenne diesen jungen Espinoza gar nicht – habe ihn in meinem Leben nicht gesehen und weiß nur, daß er aus einer guten und achtbaren Familie stammt und des ihm zur Last gelegten Verbrechens so wenig schuldig ist wie Sie und ich oder de Castro da.«
»Aber es soll wirklich ein verkappter Spion gewesen sein,« wandte Villegas noch einmal ein, vielleicht um sich selber glauben zu machen, daß er es mit einem Verbrecher zu thun habe, dessen Rettung er kein Opfer zu bringen brauche.
»Spion!« rief de Castro, »Espinoza ist so wenig Spion wie ich. Daß diese Erzkokette, diese Celita, ihr Netz nach ihm ausgeworfen und ihn gefangen hat, das ist sein Verbrechen. Das erbärmliche Geschöpf aber wendet den Tod des Unglücklichen, den sie selber dem Verderben geweiht, nicht einmal ab, sondern beginnt schon wieder ihr Spiel mit dem Mörder.«
»Ist überhaupt eine liebe Familie, die Sippschaft Buscada, Mutter wie Töchter,« sagte finster der Hauptmann Fortunato, »gnade Gott dem, der in ihre Schlingen fällt.«
»Aber wie, im Namen aller Heiligen, können wir dem armen Teufel helfen?« frug Villegas wieder. »Das Todesurtheil ist gefällt, dort lagern die Vollzieher, hier liegt das Opfer gebunden, und sobald Franco eintrifft, was jeden Augenblick geschehen kann, dauert es keine fünf Minuten mehr, und die Hinrichtung ist vollzogen. Sollen wir ihn etwa um Gnade bitten?«
»Nein, Kamerad,« erwiderte Fortunato, indem er den Blick vorsichtig umherschweifen ließ, »das wäre allerdings der verkehrte Weg und würde, wenn irgend etwas, gerade das Gegentheil von dem bezwecken, was wir zu erreichen wünschen. Aber wir haben einen andern Plan und verlangen von Ihnen nicht einmal, daß Sie uns beistehen, sondern nur, daß Sie sich für kurze Zeit um nichts kümmern, was um Sie her vorgeht. Weniger kann man doch eigentlich kaum von seinem Verbündeten fordern!«
»Und darf ich nicht wissen, was Ihr vorhabt?«
»Sicher,« lachte Fortunato, »denn daß Sie uns nicht verrathen, davon sind wir überzeugt. Sie werden dann aber auch selber einsehen, daß unser Plan so einfach wie gefahrlos ist. Von den neun Mann, die beordert wurden, den Verurtheilten zu erschießen, sind glücklicher Weise acht aus meiner Compagnie und unterrichtet und gewonnen. Sie laden blind und werden Espinoza keinen Schaden thun. Nur der neunte ist ein von Franco selber angeworbener, frisch eingetretener Rekrut, den wir nicht wagen durften in das Geheimniß zu ziehen. Er war früher Bedienter bei dem General und Helfershelfer bei allen seinen liederlichen Streichen. Er würde uns augenblicklich an Franco verrathen.«
»Und der wird ihn todtschießen,« rief Villegas.
»Wir haben allen Grund zu vermuthen, daß sein Gewehr versagen könnte,« meinte Fortunato mit einem Seitenblick auf de Castro. »Sollte das aber doch nicht der Fall sein, nun so muß Espinoza der Gefahr dieser einen Kugel trotzen, die indeß nicht übermäßig groß ist, denn der Bursche hat vor wenigen Tagen das erste Gewehr in die Hand bekommen und weiß noch nicht damit umzugehen.«
»Und welcher Zweck wird so erreicht?« sagte Villegas achselzuckend. »Wenn er auf die erste Salve nicht fällt, beordert Franco – wie das schon oft geschehen ist – neue Schützen vor, und eine oder die andere Kugel trifft ihn endlich sicher.«
»Dafür ist gesorgt,« versetzte Fortunato. »Dem Gefangenen werde ich schon einen Wink geben: sowie die Schüsse fallen, bricht er zusammen. Mein Cholo, der jetzt dort bei ihm Wache steht, ist treu wie Gold und mir ergeben. Auf ihn können wir uns fest verlassen – nur des pockennarbigen Mulatten sind wir nicht sicher, aber der wird durch irgend einen gleichgültigen Auftrag entfernt. Des Gefangenen Sarg steht schon im Gebüsch bereit, und haben wir ihn erst einmal da drin, ist er auch gerettet. Wer bekümmert sich denn noch nach einer Execution um einen Erschossenen und Gerichteten!«
»Aber deshalb gerade wird der Sarg auffallen,« zweifelte Villegas, dem der Plan noch immer zu gewagt erschien, wenn er auch die Möglichkeit des Gelingen für sich hatte.
»Vielleicht ja,« sagte de Castro ruhig. »Doch eine Entschuldigung dafür ist leicht gefunden. Sollte Franco, was ich kaum glaube, dennoch fragen, so sagt man ihm einfach, man habe den Sarg nur als Bahre hierher geschafft, um den Leichnam in den Fluß zu tragen und zu verhindern, daß die quitenisch Gesinnten ihm ein ehrlich Begräbniß geben, und das wird ihn sogar freuen.«
»Stehen Sie uns bei, Kamerad,« drängte nun auch Fortunato. »Die Wirthschaft mit den Mulattengeneral kann ja nicht lange mehr dauern, und wer weiß, ob uns in späterer Zeit ein also gerettetes Leben nicht vielleicht das eigene erhalten mag. Der Krieg bringt wunderliche Wechsel.« »Gott weiß es,« sagte Villegas mit dem Kopfe nickend. »Wenn's aber fehlschlägt, sind wir sofort um unsere Hälse.«
»Doch nicht ganz,« entgegnete Fortunato. »Dort drüben stehen unsere Pferde fertig gesattelt und mit festgezogenen Gurten. Müssen wir daher fliehen, so bringt uns die nächste Legua schon in Feindes Land, wohin uns Franco's Burschen nicht folgen dürfen. Es ist ja ein Kamerad, den wir retten wollen.«
»Aber ich erfahre noch immer nicht,« schalt Villegas, »was ich dabei zu thun habe und, beim Himmel! dort wirbelt der Staub schon auf – dort kommt Franco, und es bleiben uns keine zehn Minuten Zeit mehr. – Weiß denn der Gefangene von dem Plan zu seiner Rettung?«
»Noch nicht,« sprach Fortunato, »aber zwei Worte genügen zur Verständigung für Jemanden, dessen Leben an einem Faden hängt. Gehen Sie dem General entgegen, de Castro, und überlassen Sie das Andere uns Beiden. Sie, Villegas, haben weiter nichts zu thun, als – eben nichts zu sehen und unberufene Neugierige, die uns gefährlich werden könnten, abzuhalten. Wollen Sie das?«
»Meinetwegen,« sagte der junge Mann, »ein toller Plan bleibt's immer, daß wir unsere Köpfe riskiren keines einzigen vernünftigen Grundes wegen, als einem wildfremden Menschen das Leben zu retten! Aber es sei. Liegt doch auch ein eigener Reiz darin, dem kleinen Mulatten eine Nase zu drehen. Also frisch an's Werk, – da drüben kommt er eben angesprengt.«
Es war in der That keine Zeit zu verlieren, und Fortunato – nur noch einmal Villegas' Hand schüttelnd – schritt auf den Gefangenen zu. – Dieser hatte indessen, eben so gut wie die Offiziere, die nahende Staubwolke bemerkt, womit der Augenblick seines Todes heranrückte, aber kein Zeichen von Schwäche prägte sich auf seinem Antlitz aus, das in der Erregung des Augenblicks nur um einen Schatten bleicher wurde. Fest biß er die Zähne, in tiefem Grimm zog er die Brauen zusammen, aber er regte sich nicht und schien entschlossen zu sein, seinen letzten Gang unerschüttert anzutreten. »Companero,« flüsterte da eine leise Stimme an seiner Seite, und rasch drehte er das Antlitz danach, denn der Ton klang wie der eines Freundes. Aber sein Blick begegnete einem vollkommen fremden Gesicht und traf auf die verhaßte Uniform des Usurpators. Was anders hatte er von dessen Creaturen zu hoffen, als den Tod, und finster brütend starrte er wieder vor sich nieder.
Da berührte eine leichte Hand seine Achsel und die Stimme flüsterte wieder: »Guten Muth, Companero, so lange Athem da ist, so lange ist Hoffnung. Wollt Ihr leben?«
»Eine freundliche Frage an den, für den schon die Gewehre geladen sind,« lautete die trotzige Antwort. »Seid Ihr gekommen, Euren Spott mit mir zu treiben?«
»Mir bleibt keine Zeit zu einer Erklärung,« drängte aber Fortunato. »Glaubt also meinem Worte. Ihr habt Freunde in der Nähe. Hört schweigend, was ich Euch sage. Keine Silbe – und liegt still, daß man keinen Verdacht schöpft. Hunderte von Augen hängen an uns. Sowie die auf Euch abgefeuerten Schüsse fallen, von denen Euch keiner Schaden thun wird, werft Ihr Euch nach vorn über und zuckt nicht weiter. Das Andere überlaßt uns – Ihr habt mich verstanden?«
Der Gefesselte bejahte leise.
»Gut, und was auch kommen mag, Ihr brecht zusammen und rührt und regt Euch darauf nicht.«
Ohne eine abermalige Antwort abzuwarten, winkte der Offizier die beiden Wachen heran, daß sie die Bande des Gefangenen lösten, und hielt sich von da an von ihm entfernt.
Die in der Nachbarschaft gelagerten Mannschaften hatten allerdings den General heransprengen sehen, es aber nicht der Mühe werth gehalten, sich zu erheben und in Reih' und Glied zu treten. Die Sonne brannte heute furchtbar heiß von dem wolkenleeren Himmel nieder. Weshalb sich also ihren Strahlen früher als unumgänglich nöthig aussetzen! Franco selber verlangte einen solchen Zwang gar nicht. Er wußte, wozu er seine Banden treiben konnte, so lange er ihre Freiheit nicht zu sehr beschränkte, und war vollkommen mit ihnen zufrieden, wenn sie nur den gegebenen Befehlen gehorchten.
Sobald sich übrigens der Staub des heransprengenden Trupps, der wie eine Wolke auf der Ebene lagerte, etwas verzogen hatte, rief ein Trompetensignal die Mannschaft auf die Füße, und nicht ohne Schwierigkeit wurde ein weites Viereck gebildet und nur von der Seite offen gelassen, wo der Verurtheilte jetzt zwischen seinen Wachen unter der alten Weide stand. Diesem Baume gegenüber, und etwa achtzehn Schritt davon entfernt, hielt der General mit seinem Stabe und beschäftigte sich, während die Vorbereitungen zum Tode des Unglücklichen getroffen wurden, damit, eine Orange zu schälen und zu verzehren. Einer seiner Begleiter, ein riesiger Mulatte, schien dazu eine sehr pikante Anekdote erzählt zu haben – General und Gefolge lachten herzlich. Was kümmerte sie das Menschenherz da drüben, das in wenigen Minuten aufhören sollte zu schlagen.
Fortunato sah indessen, wie die neun Mann, die de Castro zu befehligen hatte, aufmarschirten, und wollte eben den Gefangenen niederknieen lassen – man durfte den General doch nicht zu lange den heißen Sonnenstrahlen aussetzen – als ein junges Mädchen, eine Flasche mit klarem Wasser in der Hand haltend, scheu und doch entschlossen zugleich auf den Gefangenen zuschritt, ohne die rohen Scherzreden, die ihr die Soldaten zuriefen, zu beachten – vielleicht sie nicht einmal zu hören.
»Zurück, mein Kind,« sagte Fortunato laut, aber nicht unfreundlich zu der Nahenden, »das ist kein Platz für Sie.« Aber die Jungfrau achtete nicht auf die Warnung. Wie von einer innern, unwiderstehlichen Gewalt getrieben, schritt sie auf den Gefangenen zu und reichte ihm lautlos, aber mit zitternden Händen die Flasche.
»Jacinta,« sagte Espinoza mit weicher, tiefbewegter Stimme, »Du also bist es, die noch an den unglücklichen Benito denkt?«
»Trinkt,« sagte das junge Mädchen, und das Wort rang sich ihr mühsam zwischen den Lippen vor, ihre ganze Gestalt zitterte – ihr Antlitz war todtenbleich, und sie wäre zu Boden gesunken, wenn nicht Fortunato sie gehalten und ihr mit ein paar freundlichen Worten Trost zugesprochen hätte.
Ein heiseres Gelächter der Soldaten, die in der Entfernung Zeugen der Zwischenscene waren, erscholl, und vom General Franco mußte die Unterbrechung unliebsam bemerkt worden sein, denn ein gellendes Trompetensignal mahnte an die Bedeutung des Augenblicks.
»Gehen Sie fort, Señorita,« sagte Fortunao, »meine Pflicht verbietet mir, Sie länger hier zu dulden. Kniet nieder, Señor.«
»Ich will mit ihm sterben, laßt mich!« flehte das Mädchen in Todesangst und suchte ihre zitternde Schwäche gewaltsam zu bekämpfen. De Castro war mit seinem kleinen Trupp Executoren vormarschirt und die Gewehre rasselten, als die Soldaten ihre Patronen hinunterstießen. »Bahn frei, Fortunato!« rief er dem Freunde neben dem Gefangenen zu. Fortunato war in der peinlichsten Verlegenheit. Das Mädchen hatte sich, als sie den dröhnenden Klang der Waffen vernahm, in verzweifelnder Selbstvergessenheit an den Hals Espinoza's geworfen und hielt ihn fest umklammert. Dauerte das Hinderniß noch eine Minute länger, so wußte Fortunato, daß der ungeduldige General Leute abschicken würde, die er dann nicht wieder beseitigen konnte, und sein Plan mußte scheitern, ja die Entdeckung der beabsichtigten Täuschung konnte nicht ausbleiben. In seiner Bestürzung faßte er den Arm der Unglücklichen und suchte sie loszumachen.
»Oh, um der Wunden Christi willen, Señor, laßt mich mit ihm sterben – gönnt mir doch die Kugel, die meinem elenden Leben ein Ende macht.«
»Fort von ihm, wenn Sie ihn nicht verderben wollen,« raunte ihr aber der junge Offizier zu. »Er soll leben – wir retten ihn – aber eben darum hinweg von ihm, oder Sie selbst werden seine Mörderin.«
»Ich?« rief die Unglückliche entsetzt und ließ los. Im nächsten Augenblick zog sie Fortunato am Handgelenk auf die Seite, und wieder erscholl das Signal, diesmal als Commando. für den vorbeorderten Trupp, um sich fertig zu machen und zu feuern.
»Excellenz,« wandte sich in diesem Augenblick einer der den General begleitenden berittenen Officiere an diesen, »wie ich zu meinem Bedauern sehe, hat man versäumt, dem Gefangenen einen Geistlichen beizugeben, und ihm dadurch den letzten Trost der Kirche entzogen. Wollen Sie nicht Befehl geben, daß die Execution –«
»Lieber Fereira,« unterbrach ihn barschen Tones der General, »thun Sie mir den einzigen Gefallen und bekümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Glauben Sie etwa, daß ich hier eine Stunde lang in der Sonne halten will, um zu warten, bis der Rebell unter geistlichem Beistand Gelegenheit gehabt hat, den lieben Gott um mein Verderben zu bitten? – Bah – die Sache hat schon viel zu lange gedauert, und wenn wir um jeden einzelnen Quitener so viel Umstände machen wollen, werden wir in zehn Jahren nicht mit ihnen fertig! Adelante!« und erhob dabei die Hand zum Zeichen, daß das letzte Commando gegeben würde. – »Was zum Teufel hatte die Mamsell bei dem Rebellen zu thun?«
Noch während er sprach, erschallten die Commandoworte: »Fertig zum Feuern! Legt an! Feuer!«
Die Schüsse knatterten nicht auf einen Schlag, sondern unregelmäßig hintereinander drein, und der Knieende fiel, ohne eine weitere Bewegung, ohne einen Schrei auszustoßen, nach vorn auf den Boden.
»So sollen alle Verräther sterben!« schrie der riesige Mulatte, der in Majors-Uniform auf einem Maulthier neben Franco hielt. »Es lebe Seine Excellenz unser verehrter General und Präsident! El viva!«
»El viva!« brüllten die nächststehenden Soldaten, während sich der Ruf in den Reihen fortpflanzte. Franco nahm gravitätisch seinen schweren, dreieckigen Hut ab, wandte sein Pferd dann und sprengte, ohne auch nur einen Blick auf sein Opfer zu werfen, von den Officieren gefolgt, in die Stadt zurück. Die Soldaten dagegen wollten, wie sie das gewöhnlich thaten in aufgelösten Gliedern zu dem Erschossenen hinüber laufen, um zu sehen, wie die Kugeln getroffen hätten. Hier aber sprang ihnen Villegas in den Weg und de Castro's Stimme commandirte in lautem, donnerndem Ton: »Halt! Richt' Euch! Schultert's Gewehr. – Bataillon formirt – erster Zug rechts abgeschwenkt! Marsch!«
Es dauerte ein paar Augenblicke, ehe sich die Soldaten in den unerwarteten Befehl finden konnten und in Ordnung kamen. De Castro aber, der ihnen schon bei verschiedenen Gelegenheiten gezeigt hatte, daß er nicht mit sich spaßen lasse, gönnte ihnen keine Zeit, sich auch nur umzusehen, und wohl oder übel mußten sie seinem Befehl gehorchen. Ganz fort brachte er sie aber doch nicht gleich, denn unter den Büschen, wo der Schwarm vorher gelagert hatte, war noch eine Anzahl erst halbgeleerter Agua ardiente- und Tschitscha-Flaschen zurückgeblieben, und die Leute murrten, daß sie diese im Stiche lassen sollten. Es lag übrigens gar nicht in de Castro's Plan, sie verdrossen zu machen, nur ihre Aufmerksamkeit wollte er von dem Gefallenen ablenken, und während er die Leute jetzt vor den Büschen aufmarschiren ließ, beorderte er die vorzutreten, die noch irgend etwas dort liegen hätten. Dann aber mußten sie wieder in Reih' und Glied treten, und unter klingendem Spiel des Musikcorps, unter Trällern und Schwatzen der Soldaten, die das blutige Schauspiel lange vergessen hatten, oder doch so an derartige Scenen gewöhnt waren, um sie gar nicht mehr zu beachten, zog die Truppe in die Stadt zurück.
Nur Fortunato blieb mit vier Soldaten und ein paar Peons, die er jedenfalls dahin bestellt haben mußte, bei dem Leichnam, und während die Soldaten den Auftrag hatten, die neugierig herbeidrängenden Bewohner von Bodegas abzuhalten, brachten die Peons den bis dahin versteckt gehaltenen Sarg oder Kasten herbei, in welchem der Gefallene zum Fluß befördert und diesem so wie den darin hausenden Alligatoren übergeben werden sollte. Wer hätte sich in der Hitze damit quälen wollen, ein Grab für ihn zu graben!
3. In Bodegas.
Wenn es unter den Städten Amphibien geben könnte, so müßte Bodegas eine von diesen sein, denn kein weiterer Platz der Welt theilt wohl seine Existenz so entschieden zwischen Wasser und festem Boden, wie dieser kleine betriebsame Ort, den aber jedenfalls nur die Noth an diesen wunderlichen Platz zwingen konnte. Nimmt man eine Specialkarte von Ecuador in die Hand – denn auf den gewöhnlichen Karten ist es nicht einmal angegeben, obgleich es den Schlüssel des ganzen ecuadorianischen Binnenhandels bildet –, so findet man es auf der Straße oder wenigstens in der Richtung zwischen Guajaquil und Quito, etwa einen halben Grad nordnordöstlich von Guajaquil an einem Strom oder Fluß, der das Wasser zahlreicher, noch nördlicher liegender Lagunen bei Guajaquil in den Strom gleiches Namens führt und durch vollkommen niederes, außerordentlich fruchtbares Land seine Bahn schlängelt.
Bis zu dieser kleinen Stadt aber und noch weit darüber hinaus ist die Strömung des Bodegasflusses nur von Ebbe und Fluth des Meeres abhängig und dadurch außerordentlich geeignet, eine Handelsstraße zu bilden, da er die schwerfälligsten Fahrzeuge mit der nämlichen Schnelle und Leichtigkeit, sowohl von dem Hafenplatz Guajaquil nach Bodegas hinauf, wie von diesem Ort hinab trägt. In der Regenzeit aber können die Lagunen das von den Cordilleren rasch herabstürzende Wasser nicht alles fassen; die niederen Ufer füllen sich schnell, und nun tritt die Fluth über die ihr bis dahin gesteckten Grenzen und überschwemmt das flache Land auf riesige Strecken.
In dieser Zeit ist denn auch die Handelsverbindung zwischen Guajaquil und Quito – da überdies die Maulthierpfade über die Gebirge grundlos und unpassirbar werden, vollständig unterbrochen, und wer noch von Bodegas aus in die näher gelegenen Ortschaften des höheren Landes will, muß zu einem Canoe seine Zuflucht nehmen, mit dem er gezwungen ist, zwischen den vorstehenden Wipfeln der Weidenbüsche und Bäume hin seine ungewisse Bahn zu suchen. Dann steht aber auch Bodegas vollkommen im Wasser, und die Bewohner verkehren unter einander aus der ersten Etage heraus durch Canoes oder andere kleine Fahrzeuge.
Die Gebäude selber sind darauf eingerichtet und stehen entweder auf starken Pfählen und Balken, die der eindringenden und durchquillenden Fluth nicht zu vielen Widerstand leisten und ihr freien Spielraum lassen, oder auch auf festen Mauern, denen nur der obere Stock aus Holz aufgesetzt und das ganze Jahr über von den Familien bewohnt wird, während man die unteren Räume nur in der trockenen Jahreszeit zu Waarenlagern benutzt. In diesem heißen Klima verdunstet ja auch jede Feuchtigkeit rasch, und sobald das Wasser nur erst einmal wieder gefallen ist, werden die Gebäude bald wieder trocken.
Aber nicht alle Bewohner von Bodegas haben feste Wohnungen, denn es gehört immer eine große Umsicht dazu, den rechten Moment zum Ausräumen zu erfassen, da die Wasser manchmal außerordentlich rasch steigen und oft den Waaren verderblich werden. Viele beziehen vielmehr für das ganze Jahr sogenannte Balsas, in denen sie mit großer Ruhe jede beliebige Veränderung der Fluth erwarten können, denn sie steigen und fallen mit ihr.
Diese Balsas sind, ihrer Bauart nach, außerordentlich tragfähig, denn sie bestehen aus nichts als einer Anzahl mit einander fest verbundener Balsastämme, die ein so vollkommen korkartiges und fabelhaft leichtes Holz haben, daß ein Mann ohne Anstrengung einen ausgetrockneten Balsastamm von zwanzig Fuß Länge und zwei Fuß Dicke auf seiner Schulter trägt. Diese Balsaflöße, gehörig überbaut und bedacht, bilden nicht allein einen Theil der Wohnungen von Bodegas, indem sie am Ufer befestigt werden und zu Kaufläden und Hotels dienen, sondern man benutzt sie auch als geräumige Fahrzeuge für den Waarenverkehr zwischen Quito und Guajaquil.
Außerdem wohnen in Bodegas sehr viele Arrieros (Maulthiertreiber), die mit ihren Thieren den Binnenhandel vermitteln. Sobald die Regenzeit aufgehört und die Sonne die bis dahin bodenlosen Wege ausgetrocknet hat, füllen ihre Karawanen die ganze Straße nach Quito. In Bodegas ist und bleibt aber der Knotenpunkt, wo sich die Waaren und Producte auf dem Wege nach dem Meere kreuzen. Wie eine Art von Binnenhafen empfängt es und liefert es aus, und fast jeder dort wohnende Kaufmann ist ein Spediteur.
Daß diesen Leuten der Kriegszug des Usurpators eben keine große Freude machte, läßt sich denken. Ihr Geschäft blüht nur im Frieden, bei ungestörtem, ununterbrochenem Handel. So lange Franco in Guajaquil und die von dort nach Quito führende Straße frei blieb, war der Verkehr wenigstens nicht ganz unterbrochen, denn ober- oder unterhalb Guajaquil hatte man immer noch Gelegenheit gehabt, kleine Ladungen verstohlen auszuschiffen. Jetzt aber, da er selber nach Bodegas gekommen, hörte das Alles auf. Kein bepacktes Maulthier durfte seitdem mehr nach dem Innern aufbrechen, daher denn auch Eilboten nach der nächsten bedeutenden Speditionsstadt Guaranda, am Fuß des Chimborazo, abgeschickt worden waren, um die dortigen Kaufleute zu warnen und ihnen den baldigen Besuch von Franco's Armee anzukündigen.
Was Franco's Plan sei, wußte freilich Niemand, denn die Wenigsten glaubten, daß er in der That beabsichtige, gegen Quito vorzurücken und das ganze Land sich zu unterwerfen. Die Idee klang zu abenteuerlich, um irgend eine Wahrscheinlichkeit zu haben, und doch bewies der kleine Mulatte bald darauf, daß er in der That nichts Geringeres beabsichtige, als den Hauptschlag gegen die Republik in deren eigenem Herzen und gegen ihren wundesten Fleck zu führen.
Franco selbst – wie er sich auch anders darüber gegen die Seinen aussprechen mochte – war keineswegs so fest von dem Sieg seiner beutegierigen Banden über die »quitenischen Rebellen« überzeugt, daß er es sofort gewagt hätte, die letzte Brücke – wozu er Bodegas rechnen mußte – hinter sich abzubrechen. Außerdem brauchte er den Ort und dessen Spedition für seine Truppenbewegung gegen das Innere, um den nöthigen Kriegsbedarf ungesäumt und mit allen zu Gebote stehenden Packthieren einzuholen und die Communication mit Guajaquil zu unterhalten. Daher hatten seine Leute strengen Befehl bekommen, sich ordentlich in Bodegas zu betragen und nichts zu nehmen, ohne dafür zu zahlen. Wie sehr er ihre Enthaltsamkeit damit auf die Probe stellte, das wußte jedoch Franco so wohl zu würdigen, daß er auch gleich an eine kleine Entschädigung seiner Soldaten gedacht hatte.
Drüben nämlich, über dem etwa sechzig bis achtzig Schritt breiten Strom, wo sich eine Menge Sand angeschwemmt und das Ufer dadurch mehr erhöht hatte, lag ein ziemlich großes und geräumiges Gebäude, eine Art Villa, die dem quitenischen General Flores, Franco's Erzfeind, gehörte. Dieselbe stand mit der Stadt in gar keiner Verbindung, es war nur ein Privatbesitz, und ihn beschloß Franco aus verschiedenen Gründen in Beschlag zu nehmen. Erstlich konnte er das große Gebäude vortrefflich gebrauchen, um es als Kaserne für seine Soldaten zu benutzen, und dann gab es diesen auch eine angenehme Beschäftigung, den Platz zu besetzen und nach Gutdünken darin zu wirthschaften. Als daher Franco von der Execution nach Bodegas zurückkehrte, nahm er sich kaum Zeit, eine Flasche Champagner – sein Lieblingsgetränk – zu leeren, dann ließ er sich, ohne zuvor in seinem Quartier zu erscheinen, an das andere Ufer übersetzen. Natürlich wollte er den Platz erst besichtigen, ob er nicht Eins oder das Andere selber brauchen könnte, ehe er den Soldaten freies Spiel ließ.
Flores schien aber eine starke Ahnung gehabt zu haben, daß sein Eigenthum bei einer Ueberrumpelung von dem Usurpator zu allererst würde in Beschlag genommen werden. Er hatte in Zeiten Alles, was nur irgend von Werth war, ausräumen und nach irgend einem Versteck hin in Sicherheit bringen lassen. Der kleine Mulatte sah darum seine Bemühungen keineswegs so belohnt, wie er gehofft hatte, denn die Ansiedelung zeigte ihm nichts, was seine persönliche Habgier hätte reizen können. Aber eine kleine Unterhaltung für seine Soldaten bot sie immerhin noch. Franco erklärte deshalb die Besitzung als sein – oder wie er sich ausdrückte: als Staatseigenthum und schickte augenblicklich eine Ordonnanz zurück, um »die Armee« herüber zu beordern und ihr die Gebäude erst zur Plünderung und dann zur Wohnung zu übergeben.
Plötzlich erwachte nun ein wunderliches und wildes Leben in Bodegas und vorzugsweise dort vor einem der größeren Gebäude, das früher der Regierung gehört hatte und jetzt zur Kaserne umgeschaffen war. Die Trompeter, von denen Franco eine außerordentliche Menge mit sich führte, riefen das Volk zusammen, alle nur irgend verfügbaren Boote und Flöße wurden herbeigebracht, um die Leute über den Fluß zu setzen, und kaum eine halbe Stunde später kreuzten die »Tapferen« den Strom, um sich jenseits wie die Heuschrecken über die freundlich gelegene Ansiedelung des Rebellengenerals hinzustürzen.





























