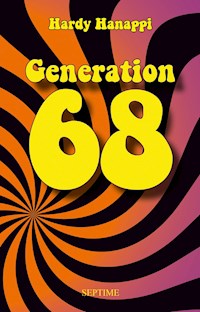
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hardy Hanappi erinnert sich an die Musik, die gehört, und an die Bücher, die gelesen wurden, an Emanzipationskämpfe, an Sex and Drugs und den Summer of Love, an Karl Marx und was er mit der Revolution zu tun hatte. Während die ersten Menschen am Mond landeten, während eine halbe Million junge Soldaten nach Vietnam geschickt wurden, während schwarze Bürgerrechtskämpfer und antistalinistische Emanzipationsbewegungen in Osteuropa das jeweilige Establishment herausforderten, entwickelte die Jugend der 68er ein eigenes weltweites Lebensgefühl, eine Vision. Die meisten von ihnen leben noch heute und werden sich in diesem Buch wiederfinden, vielleicht sogar etwas klarer sehen, was damals vor sich ging. Das Buch leitet aber auch in die Gegenwart, ja in die Zukunft. Denn auch heute braucht eine Jugend nichts dringender als eine Vision, wie sie leben möchte. Das Vermächtnis der Generation 68 sind nicht nur unzählige kleine praktische Emanzipationsschritte, das wichtigste Vermächtnis für die heutige Jugend ist ebendiese Vision. Die Generation 68 ist kein lokales Phänomen, das nur im nationalen Kontext eines bestimmten Landes auftrat, ihre Entstehung war vor allem ein globales kulturelles Ereignis. Es konnte nur entstehen, weil eine genügend große Anzahl von Ländern eine genügend weit entwickelte Kommunikationstechnologie hervorgebracht hatte, die es gestattete, grundlegende kulturelle Verhaltensweisen weltweit zu übertragen und Imitation zu ermöglichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelseite
Impressum
Autor und Klappentext
Titelseite
Buchanfang
I. Generation 68
II. Musik
III. Haare
IV. Sex
V. Kleidung
VI. Leben
VII. Bücher
VIII. Drogen
IX. Sport
X. Staat
XI. Revolution
XII. Marx
XIII. Globales
XIV. Gender
XV. Klassen
XVI. Politik
XVII. Zukunft
Epilog
Gefördert von der Stadt Wien Kultur.
© 2020, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten.
EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer
ISBN: 978-3-903061-81-1
Lektorat: Elvira M. Gross
Cover: Jürgen Schütz
Printversion: Hardcover, Schutzumschlag, Lesebändchen
ISBN: 978-3-902711-16-8
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag
www.twitter.com/septimeverlag
Hardy Hanappi
(geb. 1951) ist Universitätsprofessor im Ruhestand (seit 2017) an der TU Wien am Institut für Wirtschaftsmathematik und hält dort immer noch Vorlesungen und Seminare. Er ist ad personam Jean Monnet Chair für politische Ökonomie der europäischen Integration. Hardy Hanappi leitet seit 2011 sein eigenes Forschungsinstitut »Vienna Institute for Political Economy Research« (VIPER e.V.). Weiters war er Gastprofessor in London und Montreal sowie langjähriger wissenschaftlicher Leiter der European Association for Evolutionary Political Economy.
Im Zuge seiner Tätigkeiten erschienen bis heute nahezu 200 Publikationen (fast ausschließlich in englischer Sprache). Sein letztes deutschsprachiges Buch war Die Entwicklung des Kapitalismus (1989, Peter Lang Verlag). In den letzten Jahren schrieb Hardy Hanappi zahlreiche Kapitel und Gastbeiträge in Büchern, unter anderem über seinen Vater Gerhard Hanappi.
Generation 68 ist seine erste Publikation bei Septime.
Klappentext
1968 - Das Jahr, das die Welt veränderte Hardy Hanappi erinnert sich an die Musik, die gehört, und an die Bücher, die gelesen wurden, an Emanzipationskämpfe, an Sex and Drugs und den Summer of Love, an Karl Marx und was er mit der Revolution zu tun hatte. Während die ersten Menschen am Mond landeten, während eine halbe Million junge Soldaten nach Vietnam geschickt wurden, während schwarze Bürgerrechtskämpfer und antistalinistische Emanzipationsbewegungen in Osteuropa das jeweilige Establishment herausforderten, entwickelte die Jugend der 68er ein eigenes weltweites Lebensgefühl, eine Vision. Die meisten von ihnen leben noch heute und werden sich in diesem Buch wiederfinden, vielleicht sogar etwas klarer sehen, was damals vor sich ging. Das Buch leitet aber auch in die Gegenwart, ja in die Zukunft. Denn auch heute braucht eine Jugend nichts dringender als eine Vision, wie sie leben möchte. Das Vermächtnis der Generation 68 sind nicht nur unzählige kleine praktische Emanzipationsschritte, das wichtigste Vermächtnis für die heutige Jugend ist ebendiese Vision. Die Generation 68 ist kein lokales Phänomen, das nur im nationalen Kontext eines bestimmten Landes auftrat, ihre Entstehung war vor allem ein globales kulturelles Ereignis. Es konnte nur entstehen, weil eine genügend große Anzahl von Ländern eine genügend weit entwickelte Kommunikationstechnologie hervorgebracht hatte, die es gestattete, grundlegende kulturelle Verhaltensweisen weltweit zu übertragen und Imitation zu ermöglichen.
Hardy Hanappi
Generation 68
Eine Freizeitlektüre | Septime Verlag
I. Generation 68
People try to put us down
Just because we get around
Talking about my generation
The Who
Dieser Text richtet sich vor allem an jene, die zwischen 1944 und 1958 geboren wurden. Sie erlebten ihre Sozialisation, also den ihre kulturelle Einstellung prägenden Zeitraum, vom vierzehnten bis zum zwanzigsten Lebensjahr hauptsächlich in den 60er Jahren: Sie sind die Generation 68.
Diese Generation ist kein lokales Phänomen, das nur im nationalen Kontext eines bestimmten Landes auftrat, ihre Entstehung war vor allem ein globales kulturelles Ereignis. Es konnte nur entstehen, weil eine genügend große Anzahl von Ländern eine genügend weit entwickelte Kommunikationstechnologie hervorgebracht hatte, die es gestattete, grundlegende kulturelle Verhaltensweisen weltweit zu übertragen und Imitation zu ermöglichen. Was hier übertragen wurde? Vor allem Widerstand gegen althergebrachte Kultur, gegen Gesellschaften, die gerade zwei Weltkriege produziert hatten und drauf und dran waren, einen dritten Weltkrieg vorzubereiten. In der bipolaren Welt der 60er Jahre ragen da vor allem der Beginn des Vietnamkrieges der USA und der Einmarsch der UdSSR in die Tschechoslowakei heraus, es waren aber auch unzählige andere unerträgliche Zustände, gegen die die Generation 68 in den Widerstand ging. Dieser Widerstand betraf das Schul- und Universitätssystem in Italien und Frankreich, das Wiedererstarken alter Naziklüngel in Deutschland und Österreich, stalinistische Praktiken in Jugoslawien und letztlich auch die verkrusteten Parteistrukturen in China, gegen die die dortige »Kulturrevolution« anzugehen schien. Jede einzelne Tendenz trug viel lokales Kolorit, doch der Widerstand gegen das Überkommene, der weltweite Wille, es zu überwinden, war allem gemeinsam.
Ein entscheidender Beitrag, der all diese Elemente in ein globales Phänomen binden konnte, war das Trägersystem, über das sich die rebellierenden Verhaltensweisen verständigen konnten: (1) die gemeinsame neue Musik, der Beat, dessen Songtexte ungeniert andeuteten, was der Generation 68 wichtig war; (2) die Kleidung, die die über dieses Medium dargestellte Hierarchisierung der Gesellschaften für lächerlich erklärte; (3) die generelle Abkehr von Förmlichkeit und Etikette und die Suche nach entspannten und freundlichen Umgangsformen – insbesondere auch im Sexuellen. Es ist offensichtlich, dass eine Rebellion über derartige Trägersysteme auf den ersten Blick kaum politisch revolutionär erscheint. Das war sie zunächst auch nicht, schon gar nicht in den Köpfen ihrer exponiertesten Proponenten. Der Anfang der Generation 68 war naiv, was sonst kann man von einer so tiefgreifenden Revolte denn auch erwarten. Unaufgeklärte Ablehnung der herrschenden Verhältnisse kann breit sein. Und weil andererseits diese herrschenden Verhältnisse selbst so allgegenwärtig weltweit in Erscheinung traten, war auch ihre Ablehnung ein globales Phänomen.
Die meisten von uns haben das allerdings bis heute nicht verstanden. Für viele ist dieses Gemisch aus Verhaltensweisen und Gefühlen, das sich damals verbreitete, ein immer noch unerklärliches, ein historisches Phänomen, das man wie eine nette Reliquie in ein Puppenhaus stecken und aus der Entfernung betrachten kann. Ja, ja die 68er. Dieser Umgang ist dann ja auch schnell Usus der Feinde dieser Generation geworden. Aus dem scheinbar sympathisierenden Sager »Wer sich daran erinnern kann, der war nicht dabei« wird rasch der Umkehrschluss »Wer darüber schreibt, der kann nicht dabei gewesen sein. Und daher sollten alle darüber schweigen«. Die Feinde stürmten recht rasch auf die gesellschaftliche Bühne, doch davor lohnt es sich, noch einen kurzen Blick auf die Generation davor zu werfen.
Sie waren, schlicht gesagt, die Überlebenden der Katastrophe Zweiter Weltkrieg. Diejenigen, deren Sozialisation noch in den Trümmern des Kriegsgetümmels begonnen hatte und deren Eltern entweder zu einer stolzen Siegernation oder zu einer verbitterten Verlierernation gehörten. Nation aber jedenfalls. Darüber lag eine Weltgesellschaft, in der eines der drei zuvor herrschenden Gesellschaftssysteme, der Faschismus, gerade besiegt worden war, sodass nur mehr Kapitalismus und sowjetischer Sozialismus übrig waren. Die zugehörigen Militärapparate begannen auch rasch zum letzten Gefecht aufzurufen. Das war den meisten der jungen Generation der 50er Jahre nicht besonders sympathisch, viele ihrer Idole waren lässige Verweigerer (James Dean), oft auch zigarettenrauchende Alkoholiker (Humphrey Bogart) oder sich in Intellektualität flüchtende Verstörte (Jean-Paul Sartre). Der letztgenannte Typus wurde im Sowjetimperium meist »Dissident« genannt. Im deutschsprachigen Raum hingegen hatten diese Helden ihrer Zeit jene schwerfällige Komik und Unbeholfenheit, die bereits das kulturelle Nachhinken dieses Sprachraums in der gesamten Nachkriegszeit einläutete. Seemänner (Freddy Quinn, Hans Albers) und charmante Idioten (Theo Lingens, Gunther Phillip, Maxi Böhm) besaßen Kultstatus. Für Frauen hatte Marylin Monroes prüde-lockende Weiblichkeit auf das »deutsche Mädchenwunder« übergeschwappt (Connie Frohböss). Die Message der Idole der 50er Jahre war am ehesten noch Ratlosigkeit, in deutschen Landen überzuckert mit oberflächlicher Fröhlichkeit, um jede Schuld am Kriegsdrama rasch vergessen zu machen. In Europas Mittelmeerländern kam es teilweise zur kulturellen Emigration. Die italienische Mafia wurde eine Außenstelle ihrer früheren amerikanischen Kolonie, die griechischen Reeder Onassis und Niarchos traten als aus den USA herrschende Oligarchen auf. Die lässig im Mundwinkel hängende Zigarette wurde in Frankreich zum Markenzeichen einer ganzen Generation besonders cooler männlicher Rollenmodelle wie dem »atemlosen« Gauner Jean-Paul Belmondo, mit dem Filmemacher Godard eine kulturelle Grundlage für die Wende zum Pariser Mai 68 legte. In Frankreich war der Import amerikanischer Verhaltensweisen von Anfang an stärker von lokalem Kolorit durchdrungen als anderswo in Europa. Die große Orientierungslosigkeit der während des Krieges herangewachsenen Menschen traf auf eine Mischung von Eltern, die ihren Kindern gegenüber entweder als Täter, als tatenlose Mitläufer oder als den Faschisten unterlegene Opfer dastanden; durch die Bank Images, über die man lieber schwieg. So blieben als Helden und Heldinnen nur die amerikanischen GIs und die fernen Sexbomben, von denen man sich Anleihen holen konnte.
Die iberische Halbinsel blieb von dieser Entwicklung eher abgeschottet, da die autoritären Diktaturen der verbliebenen Hitlerfreunde in dieser ersten Zeit den Einfluss der alliierten Siegermächte erfolgreich kleinhalten konnten. Das störte diese auch nicht, der Fokus der US-Politik lag auf dem kalten Krieg gegen die Sowjetunion. Wenn Diktatoren den Einfluss von Gewerkschaften und linken Parteien diesseits des Eisernen Vorhangs ausschalteten, dann nahm man schon in Kauf, dass sie in der Vergangenheit Kriegsgegner wie Generalissimo Franco gewesen waren.
Die Lage in den osteuropäischen Ländern war vielschichtiger. Gewiss hoffte man auf Modernisierung und Verbesserung der Lebensumstände, nachdem die Sowjetarmee das Land von den deutschen Besatzern befreit hatte. Die Bilder der glorreichen amerikanischen Befreier drangen etwas gedämpfter in diese Länder vor und wurden vom Eindruck der lokalen Befreier aus dem Osten konterkariert. Die sozialen Verbesserungen in den Bereichen Bildung, Wohnen und anderer Infrastruktur standen in krassem Gegensatz zur Omnipräsenz von Soldateska und Parteidiktatur. Die hohle stalinistische Phrase vom neuen sozialistischen Menschen holte keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Aus dieser emotionalen Leere der Elterngeneration der 68er entsprang hauptsächlich tatenlose Frustration – die neue Wohnung war ein Plattenbau, das Auto ein Trabant – bestenfalls hatte man einen kaltschnäuzigen Zynismus jedweder Politik gegenüber parat. Es war dieses Vakuum, in das die heute so mächtig gewordenen Kräfte von Religion, Nationalismus und ethnischem Wahnsinn (der sich vor allem in der Vertreibung anderer Ethnien konstituiert) schon früh vorstoßen konnten. Dennoch hat sich auch in diesen Ländern eine 68er-Generation herauskristallisiert. Infiziert von den durchsickernden Merkmalen der anvisierten neuen Lebensweise entstanden in Prag, Budapest, Krakau, Ostberlin, ja in beschränkterem Umfang auch in kleineren und entfernteren Städten Osteuropas, kulturelle Inseln der 68er. Sie lebten den Gegensatz zu ihren Eltern vor allem als eine neue Lebenslust, als einen Sprung in Originalität und Unbekümmertheit, der dann oft auch in eine Flucht in den Westen mündete – soweit ihnen das möglich war.
Was in Europa geschah, war offensichtlich ein auf ein recht unterschiedliches Umfeld treffendes globales kulturelles Phänomen. Seine Träger waren sich ihrer Zusammengehörigkeit nicht dadurch bewusst, dass sie alle die europäische Halbinsel bewohnen. Was wesentlich war, waren die symbolischen Verhaltensweisen und die dabei präsentierten Ikonen. Und dennoch war es keine Religion, sondern vielmehr das genaue Gegenteil davon, nämlich Kritik an allem Festgefügten, dogmatische Bekämpfung jedes Dogmas, wobei man sich der Schlüpfrigkeit solcher Argumentation durchaus bewusst war. »Ja« zu »Ja« zu sagen ist leicht und stringent, »Nein« zu »Nein« zu sagen verweist auf einen offenen Prozess ständig neuer Erkundung. Ein wenig philosophisch inspiriert ist diese rauschhafte Bestimmtheit der 68er von Anfang an. Kein Wunder, dass manche ihrer Protagonisten sich später in den Begriff der Dialektik verliebten. Dürfen sie auch, schließlich steht genau diese Verliebtheit in den kontroversen Dialog am Anfang der griechischen Wurzeln europäischer Kultur. Es wäre aber falsch, die damalige Kulturrevolte als ein europäisches Phänomen zu stilisieren. Eher ist sie eine Art globaler Rückschlag, den die kulturlose Befreiung von europäischen Zwängen (zuerst des 19. Jahrhunderts und später des Faschismus) primär in Nordamerika provoziert hat. Also ist ein rascher Blick auf die Geschehnisse in den USA jedenfalls angebracht.
Die USA waren 1945 kein Kriegsschauplatz gewesen. Die Elterngeneration war aber teilweise in den Krieg involviert gewesen, hatte Europa von Hitler befreit oder im Pazifik die Vorherrschaft gesichert. Wieder daheim verschmolz sie mit den während des Krieges aus Europa Vertriebenen. Diese Generation hatte gesiegt, sie hatte ein grauenhaftes Gesellschaftsmodell, den Faschismus, von der Weltbühne gefegt. Damit wäre die Überlegenheit des amerikanischen Kapitalismus endgültig bewiesen – gäbe es da nicht noch die Sowjetunion und China. Das Weltbild der Sieger schlitterte direkt in die bipolare Sichtweise des Kalten Krieges. Die militärische, ökonomische und ideologische Festigung der europäischen Halbinsel als Teil des Westens war deshalb ein unmittelbar verständliches Anliegen für die amerikanische Elterngeneration. Dem US-Haushalt kostete die Marshall-Plan-Hilfe für Europa etwa zehn Prozent des BIP, ein Opfer, das es zu tragen wert war, wenn dafür das eigene Gesellschaftsmodell als role modelfürdie ganze Welt exportiert werden konnte. So wurde es zumindest der US-Bevölkerung nahegelegt, fürMilitärund Konzerne standen viel banalere Argumenteim Vordergrund. Und dann war da Vietnam. Die Franzosen mussten diesen Teil ihres zerfallenden Kolonialreichs aufgeben, fürdie USA ergab sich dadurch die Möglichkeit, einzuspringen und einenöstlichen Brückenkopf am eurasischen Kontinent seiner neuen Feinde – UdSSR und China – zu befestigen. Die Gelegenheit wurde ergriffen und dieÄltesten der 68er-Generation wurden für den Vietnamkrieg eingezogen. Sehr oft traf es diejenigen, die ohnehin schon als aufmüpfig gegen Rassismus, die rechtskonservative Politik von McCarthy oder schlicht gegen den überzogenen Patriotismus ihrer Eltern waren. Am Höhepunkt des Vietnamkrieges befanden sich etwa eine halbe Million junger US-Soldaten in diesem ihnen meist sinnlos und unverständlich scheinenden Schlachtfeld – unter ihnen auch Jimi Hendrix. Dieses Desaster erzeugte schon vor der endgültigen Niederlage in den USA massiven Widerstand unter der jungen Generation. Die ersten amerikanischen 68er waren in aller Regel Gegner des Krieges in Vietnam. Nicht nur der Vietkong hatte die USA geschlagen, auch der enorm anschwellende Widerstand in den USA selbst hatte dazu beigetragen.
Für viele Junge war der Realitätsschock Vietnam auch ein Wachrütteln aus der Traumwelt der US-Kulturindustrie der 50er Jahre. Die verlogene heile Welt, die in den Liedern des stets betrunkenen Dean Martin und des smarten Mafia-Freundes Frank Sinatra besungen wurde, erschien plötzlich widerwärtig. Die vom Normalbürger gelebte Prüderie mit ihrem verzerrten Spiegelbild in der Affäre des Sex-Idols Marylin Monroe mit dem Sunny-Boy-Präsidenten John F. Kennedy, diese ungesunde Mischung einer falschen Welt im Inneren, einer nur von den Idolen gelebten wahren Freizügigkeit, diese ganze beklemmende Spannung musste abgeschüttelt werden. Und das gelang den ersten 68ern in den USA auch recht rasch und radikal. Schließlich war das Land kulturell jung, man könnte sagen, kulturlos, nicht belastet von kulturellen Traditionen, nicht angekränkelt von der Blässe des althergebrachten, ästhetischen Gedankens. Es war die Stunde der Beatniks und der wilden Poeten der Ostküste, der schwarzen Bürgerrechtler und der frühen Frauenbewegung.
Das alles fand vor dem Hintergrund einer florierenden Wirtschaft statt. Die USA hatten England in der Rolle der globalen Hegemonialmacht endgültig abgelöst. Das hatte sich zwar schon nach dem ersten Weltkrieg angekündigt, wirklich manifest wurde es aber erst, als auch im Zweiten Weltkrieg der Eintritt der USA den Sieg brachte. Der Dollar stand als Weltwährung fest und das System fester Wechselkurse von Bretton Woods versprach eine stabile Zukunft. Die Jungen kümmerten sich wenig um die ökonomischen Details, de facto war das wirtschaftspolitische System von Paul Samuelsons neoklassischer Synthese inspiriert: Staatseingriff und Regulierung sind in maßvollem Umfang sinnvoll, eine theoretische Fundierung wird zwar anvisiert, doch solange alles wächst, regiert der wirtschaftspolitische Pragmatismus. Für Average Joe hieß das, dass Motorisierung und Eigenheim gesichert schienen, die Ansprüche auf politische Partizipation, die die aufgewühlten ersten 68er stellten, erschienen der alten Elite allerdings absurd. Im Übrigen war die amerikanische Bevölkerung – mit Ausnahme der Emigranten aus der alten Welt – recht ignorant, was den Rest des Globus betraf.
Die Geisteslage der jungen Amerikaner war von Europa aus gesehen bewundernswert kontemplativ, lässig, oberflächlich stets freundlich und friedliebend, bildungsmäßig naiv, aber in speziellen Fragen politisch dann auch wieder hochmotiviert. Kurz gesagt: cool. Cool vor allem im Vergleich zu den eigenen Eltern in ihrem verzwickten Verhältnis zur eigenen unmittelbar überstandenen Vergangenheit. Die amerikanische Jugend schien jenes Abschütteln der Last überkommener Traditionen geschafft zu haben, das im von seiner Geschichte geplagten Europa so schwer auf allen Schultern lastete.
Die Befreiung startete dann in England, als die ersten R&B-Bands, die ersten Beatbands, den Blues der Schwarzen der amerikanischen Baumwollfelder zu imitieren begannen. Der Blues war faszinierend, er war das einzige eigenständige Kulturgut, das Nordamerika hervorgebracht zu haben schien. Doch er war umwerfend! Die britische Jugend fügte ihm noch etwas ganz Spezielles hinzu: Glanz und Glorie der »splendid isolation« des britischen Weltreiches des 19. Jahrhunderts waren zwar verschwunden, aber der Hochmut der herrschenden Klasse Englands lebte fort. Schon um die Jahrhundertwende war diese hochnäsige, aristokratische Haltung allerdings kulturell gebrochen worden, etwa durch Zyniker wie Oscar Wilde. Selbst der Ökonom Keynes kann dieser Gattung des geistreichen britischen Intellektuellen zugerechnet werden, der sich in seinen Bonmots über die vorherrschende Ideologie der herrschenden Klasse lustig macht, sich dadurch als ein Mitglied derselben zugleich über diese sich erhebt. Die frechen jungen Arbeitslosen in Liverpool, die später zu den Beatles wurden, haben diese Nonchalance in ein sorglos-mutiges Auftreten transformiert, dem ein Element von britischem Hochmut stets beigemischt war. Jedes Interview des jungen Mick Jagger wird von dieser brisanten Melange aus provozierender Uninteressiertheit, gepaart mit stellenweise direkter verbaler Aggression gegen das Establishment getragen. Diese Attitüde – in beiden Formaten, dem milderen, volksliedhaften Beatles-Stil wie auch dem nach Blues-Originalität strebenden Studenten-Stil der Rolling Stones – bot der britischen Jugend ein Vorbild, an dem sie sich orientieren konnte.
Mit dem Re-Export von Beatles und Stones in die USA und der gleichzeitigen Infektion des Kontinents mit dem 68er-Virus brach die Kulturrevolution aus.
II. Musik
Wie Menschen sich zu Gruppen verbinden, ist immer mit ihren Möglichkeiten zur Kommunikation verbunden. Was sie teilen und gemeinsam als Schablone zur Gruppenidentität annehmen, ist Sprache der Gruppe. Sie tritt in vielen Formen auf, Musik war für die 68er-Generation die wichtigste davon.
Musik kam aus dem Radio, Musik kam von der Schallplatte – und zwar in dieser Reihenfolge. Die unsichtbare Botschaft der kulturrevolutionären Internationale wurde über die Insidern bekannten Radiostationen erforscht, etwa Radio Luxemburg, und »unsere Musik« als neues Idiom in den Sprachschatz der künftigen 68er aufgenommen. Radiowellen kennen keine Grenzen, und der englische Gesang brauchte auch gar nicht so gut verstanden zu werden, Lautmalerei reichte, solange der Beat stimmte. Daher war die Identifikation des »Beat« das Zentrale. Es gab nur einen Beat der 68er, doch er hatte unzählige originelle Variationen. Und offensichtlich war die Sprache des Beat der älteren Generation völlig verschlossen. Sie reagierte mit Kopfschütteln, verlangte das Reduzieren der viel zu hohen Lautstärke und verwies auf das Fremde in dieser »Negermusik«. Es war klar, dass diese Feindschaft in Bezug auf »unsere Musik« die 68er einte, nichts verbindet mehr als ein gemeinsamer Feind. Der Nachteil von Radiosendungen ist die Flüchtigkeit ihrer Existenz, hat man sie gehört, so sind sie verpufft. Das entspricht zwar dem Wesen von Musik, und mit Erinnerungsvermögen begabte Wesen können ja einiges in sich wachhalten, die Vergänglichkeit des Erlebnisses schmerzte aber doch. In genau diese Kerbe unbefriedigten Bedürfnisses rückte denn auch das erste Bataillon der Firmen vor, das die anschwellende Kulturwende erahnte: die Plattenindustrie. Durch den Erwerb der schwarzen Vinylscheiben war man im Besitz der Musik, konnte sie sich nach Belieben vorspielen und darin – allein oder in Gruppen – schwelgen.
Es war ein welthistorisch neues Phänomen, dass sich eine globale Kulturrevolution über das Medium der Musik ausbreitet. Gesprochene und geschriebene Sprache eint diejenigen, die sie teilen, – und trennt sie zugleich von anderen Sprachgemeinschaften. Die über viele Generationen reichende Sprachgemeinschaft ist der Nährboden nationaler Kultur, ja die wesentlichste Komponente der Herausbildung dessen, was als Nation Geltung beansprucht. Bei Musik ist die Sachlage einigermaßen anders: Zwar spielen auch hier die über lange Zeiträume tradierten und geographisch beschränkten musikalischen Hörgewohnheiten eine Rolle, sie über Bord zu werfen ist aber wesentlich leichter, da Musik immer schon ein Element der Muse war. Selbst – und gerade – der Blues, den die Baumwollpflücker während ihrer Arbeit sangen, konterkarierte die Eintönigkeit ihrer beschwerlichen Arbeit, hob deren Rhythmus in sein dialektisches Gegenteil. Musik kann geographische Grenzen stets leichter überqueren als Sprache, weil sie, zumindest in ihrer instrumentalen Form, nicht übersetzt zu werden braucht. Und die Lyrics bleiben Beiwerk, nationales Beiwerk, beim Beat der nichtanglophonen 68er oft auch nicht einmal verstandenes Beiwerk. Im Mittelpunkt der Musik steht nicht wie sonst im Leben der Arbeitsprozess und die Regeneration davon, sondern der Gegensatz zwischen Rhythmus (Struktur) und Melodie (Freiheit von Struktur). Das Paar »Rythm and Blues« fängt das insofern ein, als der auf Repetition, Wiedererkennung und orientalische Mystik derselben setzende Rhythmus ein Gefühl freisetzt, eben den Blues, den man hat, der in einer über den Rhythmus gelegten Melodie seinen Ausdruck findet. Beide Elemente durchdringen einander, der Rhythmus stolpert stellenweise in frei generierte Spannungsfelder, die Melodie gefällt sich in eitlen Wiederholungen. Schon beim Wiener Walzer ging der Zauber seiner Wirkung von diesem Wechselspiel aus; von ihm führt ein direkter Weg zum Swing der frühen 50er Jahre. Doch Beatmusik ist anders als dieses Abheben vom Alltag, das in Walzer und Swing so präsent ist. Es ist keine Verzierung für Mußestunden, es ist Kampfansage an diesen Alltag, Kampfansage an die Trennung zwischen entfremdeten Arbeitsstunden und Freizeit, in der das wahre Leben zugleich Erholung vor dem nächsten Arbeitstag sein soll. Dieses Aufbegehren gegen den gesamten herkömmlichen Lebensstil war daher vor allem den Jungen – Schülern, Studenten und jungen Arbeitslosen – vorbehalten. Der Pariser Mai und die Schülerrevolten in Italien zeigen beides, dass befreiende Radikalität auch ein gewisses Maß an jugendlicher Naivität erfordert und dass diese dann auch wegen dieser erfrischenden Unbedarftheit im kulturellen Bereich versandet.
Die Phrasen vom jugendlichen Mick Jagger und John Lennon, ob musikalisch oder im Interview, sind hingerotzte Kommentare und keine Symphonien, keine Weltentwürfe. Letztere hätten ihren Fans auch sicher nicht gefallen. George Harrison war ein Meister des zum kurzen Gitarrensolo gewordenen, einprägsamen Understatements. Damit schienen sie zwar nahtlos an die cooleren Typen der 50er Jahre anzuschließen, doch das konnte nur jenen so vorkommen, die damals nicht dabei waren: Elvis Presley war kein Beat, Beatles und Rolling Stones waren Beat! Die gefühlte Trennlinie war so scharf, dass sich die Beatles erlauben konnten Besame Mucho zu intonieren.
In den frühen Jahren war es auch selbstverständlich, dass Beatmusik von einer kleinen Gruppe, von vier oder fünf Musikern, gespielt wurde. Das ermöglichte das einfache Heraushören des Beitrags jedes einzelnen Bandmitglieds. Hierarchie, wie die des Dirigenten bei einem Orchester, war nicht nötig. Stattdessen gab es außerhalb der Musik einen Leithammel für die Vermarktung, den Bandleader. Der klassische Nukleus bestand auch in Bezug auf die Instrumente aus einem fixen Set: Rhythmusgitarre, Sologitarre, Bass und Schlagzeug – Ausnahmen bestätigten die Regel. Ganz entscheidend war auch die gesteigerte Lautstärke, Beatmusik musste laut sein, sehr laut. Man musste die Schallwellen körperlich spüren. Gespräche im Publikum gab es nicht, was es gab, war die Identifikation mit der Band, mit deren Musik, mit der Umsetzung des Erlebten in Tanz. Der Tanz zum Beat ist das Gegenteil des hergebrachten, regelgebundenen höfischen Tanzes, er ist spontan und entspricht der Persönlichkeit der Ausführenden im Zusammenspiel mit dem Ausdruck der gehörten Musik. Weil er im Kollektiv geschieht, ist er in aller Regel auch kein Paartanz. Im Beatkeller wogt die Masse, das gesellschaftlich abgesegnete, peinliche Balzritual zwischen Mann und Frau, wie es vom Menuett bis zur Polka tradiert wurde, ist plötzlich meilenweit entfernt. Beat und Tanz sind genauso untrennbar verbunden wie die Band und die Zuhörer, die sie bewegt.
Musik existiert nur in der Zeit, in der sie geschieht. Man kann sie zwar wiederholen, aber sie ist wie der sprichwörtliche Fluss, in den man nicht in gleicher Weise zweimal steigen kann. Ihre Verbundenheit mit den sich fortlaufend ändernden Musikern und ihren Zuhörern zwingt ihr ebenfalls stete Veränderung auf. Weil das besonders beim Beat auftritt – bei klassischer Musik hingegen hat die perfekte Reproduktion des immer gleichen Musikstücks, i. e. Werktreue, höchste Priorität –, entspringen daraus zwei interessante Phänomene. Zum einen wird die Virtuosität der Musiker weniger an ihren technischen Fähigkeiten als vielmehr daran gemessen, wie gut es ihnen gelingt, ihr Publikum in den Bann ihres Beat zu ziehen. Zum anderen bewirkt die Identifikation von Zuhörern und Musikern, dass eine ganze Generation beginnt die zentralen Instrumente des Beat – Gitarre, Bass und Schlagzeug – zumindest ansatzweise zu erlernen. Und so laufen heute noch Scharen von 68ern herum, die mit diesen Instrumenten etwas anfangen können. Auch darin unterscheiden sie sich von jenen, denen von den Eltern Klavier- oder Geigenunterricht aufgezwungen wurde oder die am Land zur Blasmusik vergattert wurden. Wo uns das als Kind drohte, sind wir davor in unsere eigene Musik geflüchtet.
Der frühe Beat der Beatles und der Rolling Stones war aber erst der Anfang. Wo vor allem bei den Beatles zunächst noch recht lieblich vom Händchenhalten und dem Liebesbekenntnis gesungen wurde, da brach sich schon bald der Brunftschrei nach Befriedigung, die Satisfaction Jaggers, seinen Weg. Die Beatles reagierten unverzüglich und überraschend: Sie hoben das Thema Liebe vom traditionellen Niveau des Schmachtens eines Mannes nach der Liebe einer bestimmten Frau auf das Niveau breiter, alle Menschen umfassender Liebe. Der »Summer of Love« in Kalifornien war in ihrer Hymne All You Need Is Love inkludiert.





























