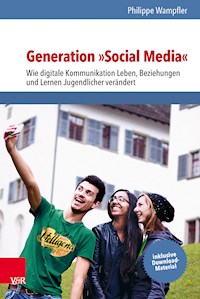
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Über die Auswirkungen digitaler Kommunikation wird viel spekuliert: Dem Versprechen, dass Neue Medien uns dabei helfen, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, unser Leben einfacher und gehaltvoller zu gestalten und unsere Arbeit zielstrebig und effizient zu erledigen, misstrauen viele Menschen zu Recht. Ähnliche Skepsis verdienen die Befürchtungen, der digitale Medienwandel würde uns zu atemlosen, oberflächlichen Maschinenmenschen machen.Wir können die Veränderung, die wir momentan erleben, nur verstehen, wenn wir sie präzise beschreiben und beim Untersuchen ihrer Auswirkungen nicht von Ängsten, Vorurteilen und Extrembeispielen ausgehen, sondern uns von wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten lassen.Wampfler zeigt, wie sich Menschen durch ihre Techniknutzung verändern, wie sich die Bedeutung ihrer Beziehungen durch eine digitale Ebene wandelt und wie Lernen mit Neuen Medien möglich ist. Dabei wird darauf verzichtet, das Virtuelle als eine der Realität gegenüberstehende Sphäre abzugrenzen, weil digitale Kommunikation in ihrer Virtualität gleichzeitig Teil der Realität ist und sich das Leben im Cyberspace und das Leben im direkt wahrnehmbaren Raum gegenseitig beeinflussen.Ein kritischer Blick auf die Generation der »Digital Natives« zeigt auf, dass in ihrer Beschreibung nicht getrennt wird zwischen dem Verhalten, das Jugendliche unabhängig von digitaler Technologie auszeichnet, und spezifisch medienbedingten Veränderungen. Ausgehend von einer sachlichen Beschreibung der Mediennutzung von Jugendlichen wird anschaulich, in welchem Rahmen die Kinder von heute sich entwickeln und morgen ein gehaltvolles, würdiges Leben führen können. So entsteht eine nüchterne Medienpädagogik jenseits von Polemik und übertriebenen Befürchtungen, auf deren Grundlage wirkungsvolle Prävention der gefährlichen Aspekte der Nutzung Neuer Medien denkbar wird. Konkretisiert werden diese Überlegungen mit ganz praktischen Tipps, wie Erwachsene Jugendliche in ihrer Mediennutzung begleiten können und sollen, um sicherzustellen, dass sie mit der Fülle von Material und ihrem Ablenkungspotential selbständig umgehen können.Abschließend entwickelt eine Verbindung von Erzählungen aus Science Fiction mit einer Analyse technischer Möglichkeiten eine Vorstellung davon, wie Menschen Maschinen in Zukunft selbstbestimmt nutzen können, um ihr Leben frei zu gestalten. Eine sachliche, wissenschaftlich fundierte Beschreibung der Veränderungen, die digitale Medien für die Jugendlichen von heute und von morgen bedeuten, ermöglicht zielführende (medien-)pädagogische Arbeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philippe Wampfler
Generation »Social Media«
Wie digitale Kommunikation Leben, Beziehungen und Lernen Jugendlicher verändert
Mit 5 Abbildungen
Vandenhoeck & Ruprecht
I’ve come up with a set of rules that describe our reactions to technologies:
1.Anything that is in the world when you’re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works.
2.Anything that’s invented between when you’re fifteen and thirty-five is new and exciting and revolutionary and you can probably get a career in it.
3.Anything invented after you’re thirty-five is against the natural order of things.
Apply this list to movies, rock music, word processors and mobile phones to work out how old you are.
Douglas Adams, How to Stop Worrying and Learn to Love the Internet (1999)
Der Autor freut sich über Kritik, Fragen, Anregungen oder Kommentare.
Kontakt: Philippe Wampfler, Ahornstr. 27a, CH-8051 Zürich
E-Mail: [email protected]/
Internet: http://philippe-wampfler.ch
Das digitale Zusatzmaterial finden Sie unter:
http://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
2., durchgesehene Auflage
© 2019, 2014, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Fiorella Linder
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-666-70278-5
Inhalt
Statt eines Vorworts: Selfies at Funerals
1.Einleitung
1.1 Medienwandel in der historischen Perspektive
1.2 Digitale Kommunikation und Social Media
1.3 Generation »Social Media«
1.4 Stolpersteine der Medienkritik
1.5 Digitale Kluft
1.6 Die Absicht dieses Buches
Intermezzo I: Eine Liebeserklärung an die Däumlinge
2.Körper und Geist
2.1 Wie Medien auf den Menschen einwirken
2.2 Wohlbefinden und Social Media
2.3 Aufmerksamkeit und Ablenkung
2.4 Das Versprechen der Hirnforschung
2.5 Gedächtnis
2.6 Beeinflussung der Schlafqualität
2.7 Sexualität
2.8 Körperkontakt
2.9 Social-Media-Sucht
2.10 Körperliche Gesundheit
2.11 Essstörungen
2.12 Schulische Leistungsfähigkeit
Intermezzo II: Wie neue Praktiken entstehen
3.Beziehungen
3.1 Digitale Nachbarschaft
3.2 Beziehungen Jugendlicher untersuchen
3.3 Wie Jugendliche Social Media zur Beziehungspflege nutzen
3.4 Social Media medialisieren Beziehungen
3.5 Machen Social Media einsam?
3.6 Liebesbeziehungen
3.7 Freundschaft
3.8 Privatsphäre und Datenschutz
3.9 Oberflächlichkeit und Narzissmus
3.10 Parasoziale Interaktion
3.11 Die Angst, etwas zu verpassen – Fear of Missing Out
3.12 Die Konsensillusion
3.13 Geschlechterrollen und Social Media
Intermezzo III: Japan als Beispiel
4.Wie aus Neuen Medien ein neues Lernen entsteht
4.1 Veränderte Arbeitsplätze und Lebenswelten
4.2 Social Media als professionelles Hilfsmittel in der Schule
4.3 Kompetenzen und Herausforderungen
4.4 Das Ende der Didaktik
4.5 Bedingungen für kollaboratives und individuelles Lernen
Intermezzo IV: Überwachung als Bedrohung und Versuchung
5.Was tun?
6.Materialien
6.1 Smartphone-Etikette für Jugendliche
6.2 Leistungsbeurteilung für Arbeiten mit Social Media
6.3 Aufbau eines Persönlichen Lernnetzwerks
6.4 Sichere Passwörter wählen
6.5 Fake-Profile erkennen auf Social Media
6.6 Fear of Missing Out – Diagnose
7.Literatur
Statt eines Vorworts: Selfies at Funerals
Eine junge Frau hat ihr eigenes Porträt aufgenommen. »Love my hair today. Hate why I’m dressed up #funeral«, schreibt sie dazu; sie möge also ihre Frisur, sei aber unglücklich darüber, weshalb sie sich aufbrezeln musste: Für eine Bestattung nämlich. Auf der Seite selfiesatfunerals.tumblr.com hat der Journalist Jason Feifer im Herbst 2013 eine ganze Serie solcher Selfies gesammelt. Damit sind digitale Selbstporträts gemeint, welche auf bildbasierten sozialen Netzwerken wie Instagram oder Snapchat zum Alltag Jugendlicher gehören, offenbar selbst auf Beerdigungen.
Wie Erwachsene darauf reagieren würden, dass Jugendliche sich auf Trauerfeiern selbst inszenieren, war absehbar: Empört wurde das Verhalten von Kommentierenden als zutiefst narzisstisch und pietätlos eingeschätzt. Die Verfügbarkeit von Smartphones habe dazu geführt, dass nicht einmal mehr Trauer zu einer tröstenden Verbindung von Menschen führe, sondern Jugendliche selbst in diesem Zustand in ihrer Selbstbespiegelung isoliere.
Diese vorschnelle Verurteilung der Mediennutzung Jugendlicher ist symptomatisch für das medienpädagogische Nachdenken unter Erwachsenen. Weil die digitalen Informationsströme eine vertraute Welt der Verarbeitung von Nachrichten in wenigen Jahren auf den Kopf gestellt haben, wird oft vorschnell angenommen, die Auswirkungen müssten verheerend sein. Die Unsicherheit über die Bedeutung der Veränderungen wird bei Jugendlichen besonders deutlich, weil sie einerseits gern provozieren, andererseits aber neue Chancen rascher und radikaler wahrnehmen, als Erwachsene das können und wollen.
Dieses Buch versucht eine gewisse Distanz einzunehmen, aus welcher es leichter fällt, Zusammenhänge zwischen Sachverhalten zu erkennen. Wer sich ein Urteil über Jugendliche anmaßt, sollte etablierte und akzeptierte Verhaltensweisen ebenso prüfen, die Praxis junger Menschen wirklich verstehen und auf solide wissenschaftliche Daten zurückgreifen. Dann ergeben sich aufschlussreiche Erkenntnisse, die wertvoller sind als die Beobachtungen und Urteile des Alltags.
Betrachtet man die Beerdigungsselfies aus dieser Perspektive, kann man zunächst einfach festhalten, dass Menschen einen individuellen Zugang zum Trauern haben. Es gibt zwar gesellschaftliche Normen dafür, die jedoch oft gerade in Trauerphasen wenig Rückhalt bieten. Zudem sind diese Normen ebenso fragwürdig wie das digitale Selbstporträt: Warum ziehen sich viele schön an, wenn es doch um die Toten gehen soll? Warum schlagen sie sich den Bauch voll und trinken mittags Alkohol, wenn in Würde von einem geliebten Menschen Abschied genommen werden soll? Man könnte Webseiten mit Bildern von Trauergästen füllen, die sich bei Bestattungen betrinken oder ihre Krawatten mit Häppchensauce bekleckern. Weil Jugendliche sich nicht wie Erwachsene verhalten, sind sie kritischeren Blicken ausgesetzt.
Abbildung 1: Selfie
Selfies sind, so kann man annehmen, knappe Tagebucheinträge, die sich an ein limitiertes Publikum richten. Die junge Frau könnte sagen: »Schaut mal her, mir ist was Trauriges passiert, ich muss zu einer Trauerfeier. So sehe ich aus.« Damit dokumentiert sie ihren Tag, sie kann später darauf zurückgreifen, sieht sich selbst ins Gesicht und kann Erinnerungen abrufen. Für einen Tagebucheintrag über ein Begräbnis würden wir niemandem einen Vorwurf machen. Wir würden ihn nicht einmal lesen und ihn schon gar nicht auf Blogs zitieren und verbreiten.
Hinzu kommt, dass Selfies nicht ausschließlich einzelne Menschen zeigen. Seit 2014 dokumentieren Prominente Erlebnisse mit Selfies. Darauf sind – wie auf vielen Selfies von Jugendlichen – meist mehrere Personen zu sehen. Aus dem Selbstporträt wird oft ein Gruppenbild und die Praxis rückt weit weg von einer narzisstischen Ich-Bezogenheit.
Jugendlichen werden mit der Aufgabe, eine eigene Identität zu finden und ein Beziehungsnetz zu knüpfen, oft allein gelassen. Wird zu sichtbar, welcher Methoden sie sich bedienen, müssen sie mit Spott und Ablehnung von Erwachsenen rechnen, die oft nicht einmal zu verstehen versuchen, was hier abläuft. Erst später adaptieren auch Erwachsene diese Kommunikationsmittel.
Im Projekt Selfiecity wurden die Selfies mehrerer Metropolen untersucht. Wesentliche Erkenntnisse waren, dass Selfies weniger häufig gemacht werden, als gemeinhin angenommen (nur 4% aller analysierten Bilder waren Selfies), dass sie hauptsächlich von jungen Menschen und vornehmlich von Frauen stammen, die zudem auffälligere Posen einnahmen als Männer. Das Projekt verdeutlichte zudem, dass Menschen in Bangkok auf Selfies deutlich häufiger lächelten als in Moskau (Manovich, 2014).
Geht man von der quantitativen Untersuchung zur Interpretation über, so kann man in Jenna Bragers Essay Selfie Control nachlesen, dass Selfies wohl nicht zufällig in dem Moment populär werden, in dem Überwachung sowohl durch die Smartphones unserer Mitmenschen als auch durch Geheimdienste zu einem globalen und omnipräsenten Phänomen werden. Selfies ermöglichen in einer »lähmenden Landschaft zwischen visueller Übersättigung und Leere fatale Verhandlungen zwischen zu starker Sichtbarkeit und Verschwinden, zwischen Selbstrepräsentation und Vereinnahmung« (Brager, 2014, übersetzt von Ph.W.). In ihnen kommen die Beobachtenden und die Beobachteten zur Deckung.
Betrachten wir Selfies als eine Art Höhepunkt des fotografischen Einverständnisses über den verschlauften Blick (der Fotograf ist das Subjekt und Objekt), können wir rechtliche Überlegungen verabschieden und verschiedene Analysen von Einverständnis und Wahrnehmung befragen – wer darf beispielsweise kein Selfie aufnehmen und was bedeutet das für die Lebensbedingungen dieser Personen. (Brager meint Strafgefangene, denen in den USA Fotografien oft nicht gestattet sind, Anmerkung Ph. W.) (ebd.)
Social Media sind im Moment ein Sammelsurium von medialen Handlungen, für die es kaum einen Kodex oder eine klare Norm gibt. So entwickeln sich Verhaltensweisen, die auf den ersten Blick sonderbar erscheinen, letztlich aber eine bestimmte Funktion haben. Diese kann nur erkannt werden, wenn Prozesse und Daten klar erfasst und beschrieben werden können. Das vorliegende Buch hilft dabei, verfügbare Erkenntnisse zur Verwendung von Social Media und ihrer Einflüsse zu überblicken. Eine vorschnelle Ablehnung und Verurteilung von Modeströmungen unter Jugendlichen steht dabei nicht im Vordergrund, es geht vielmehr darum, Verständnis für die Perspektive der Jugendlichen zu wecken. Wie ihre erwachsenen Mitmenschen leben sie in einer schnellen Welt, die viele Erwartungen und komplexe Möglichkeiten bereithält.
1. Einleitung
Wir haben die Tendenz, die Auswirkungen von Technologie kurzfristig zuüberschätzen, sie aber langfristig zu unterschätzen.Amaras Gesetz nach Roy Amara (1925–2007)
Wer Jugendliche dabei beobachtet, wie sie über ihre Geräte gebeugt Nachrichten eingeben, von ihren Mitmenschen durch die Musik in ihren Kopfhörern abgeschottet, erinnert sich schnell an die Schlagzeilen, die uns in regelmäßigen Abständen in einer breiten Palette von Publikationen verkünden, Neue Medien machten uns dumm, wütend, unglücklich und einsam. Dass dies Jugendliche in besonderem Maße betrifft, fällt nicht schwer zu glauben. Ihr Rückzug in die sozialen Netzwerke, in denen ständiges Geplauder jede vertiefte Beschäftigung mit Kultur oder Wissenschaft zu verhindern scheint, gibt Anlass zu düsteren Zukunftsprognosen.
Gleichzeitig sind Social Media auch Hoffnungsträger: Sie ermöglichen es, eine Ordnung in das unüberschaubare Meer von Informationen zu bringen, in dem die Internet-User schwimmen. Wissen ist aus erster Hand abrufbar und bearbeitbar: Hier sollten gerade Jugendliche Mittel und Wege finden, sich zu bilden; abseits von etablierten Strukturen, die schwerfällig sind und an Traditionen kleben. Und auch solche Geschichten füllen die Zeitungen, die wir immer häufiger selbst mit dem Smartphone abrufen: Wir lesen von sechzehnjährigen Hochbegabten, welche die Informationen im Netz genutzt haben, um die Medizin oder die Physik voranzubringen, und betrachten Youtube-Videos, in denen kreative Jugendliche neue Ideen ohne die Hilfe Erwachsener erproben und umsetzen.
Was stimmt? Schaden digitale Medien der Generation, die damit aufwächst, oder ermöglichen sie ihr Leistungen, die bisher nicht denkbar waren? Wer Erwachsenen zuhört, die über diese Fragen sprechen, wird meist mit bedrohlichen Wahrnehmungen konfrontiert, wie die folgenden Stichworte aus einer kleinen Umfrage zeigen, welche die Konzeption dieses Buches begleitet hat:
Kopplung von Selbstwertgefühlen mit Social-Media-Präsenz; Depression – Kontrollverlust des Gefühlshaushalts durch Dauerpräsenz der Außenwelt – Wann kommt der Punkt, an dem Jugendliche lieber reale Erfahrungen machen statt virtuelle? »Willst du mit mir gehen?«, Küssen, Konflikte austragen etc. – Aufnahmefähigkeit, Fähigkeit, sich im Informationsdschungel zurecht zu finden. Konzentration. Auswirkungen auf die eigene Analysefähigkeit und Meinungsbildung – Auswirkungen im Familienleben, beim gemeinsamen Essen, Einkaufen, Film Schauen. Wie bringen sie ihre Eltern dazu, die geteilte Präsenz und Aufmerksamkeit zu akzeptieren oder so … – Wie gehen sie mit dem dauernden Druck um, nichts Falsches auf FB hochzuladen? Mit der Angst, dass Fotos oder Texte gegen einen verwendet werden könnten? – Das »Nicht-da-Sein«, sondern dort, respektive hier [auf Facebook] – Frag mich schon lange, wie Babys wohl reagieren, wenn ihre Mütter und Väter ständig ins Display gucken statt in ihre Augen. (Facebook, 14. Oktober 2013, Kommentare mit leicht angepasster Rechtschreibung)
Es gibt auch Stimmen, die darauf hinweisen, Social Media führten zu einer »Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten, Verfeinerung von Annäherungsversuchen«, doch die gehen unter in einem Chor, der pessimistische Töne anschlägt.
Dieses Buch will diese Wahrnehmungen prüfen und die Frage nach den Auswirkungen von Social Media in einem nüchternen Licht betrachten. Roy Amara, ein amerikanischer Zukunftswissenschaftler, hat das Gesetz formuliert, das als Motto über diesem Abschnitt steht. Es ist als Ausgangspunkt hilfreich, um zu verdeutlichen, dass der Blick auf Technologie oft getrübt ist und es entscheidend ist, klar zu sehen. Zwei Verzerrungen werden deshalb vermieden: Einerseits die nostalgische Vorstellung, welche die Zeit ohne virtuelle Vernetzung als eine ruhigere, weniger oberflächliche präsentiert, in der Menschen sich in gehaltvollen Gesprächen ausgetauscht haben; andererseits die zweckoptimistische Haltung, deren technologische Versprechen oft im Marketing von Firmen begründet sind, die den Menschen jedes Jahr neue Geräte verkaufen und sie mit neuer Software ausstatten müssen. Im Mittelpunkt steht die Frage, was über Einflüsse des digitalen Wandels auf Jugendliche bekannt ist und wo lediglich reine Befürchtungen oder allenfalls Vermutungen beginnen?
Der Blick auf die Jugend ist dabei von besonderer Bedeutung, wie ein Zitat von Matthew Diamond, einem Fernsehproduzenten, zeigt:
Gewohnheiten werden bis zum Alter von 20 Jahren geprägt. Die gesamte Generation erfährt gerade eine völlig neue Konditionierung in ihrer Mediennutzung. (zitiert nach Fichter, 2013)
Social Media stehen bei dieser Konditionierung im Mittelpunkt. Digitale Empfehlungen von Freundinnen und Freunden ersetzen immer mehr Vermittlungen durch Massenmedien oder Werbung. Welche Konsequenzen hat das?
Dieser Frage sind die Kapitel zwei und drei gewidmet: Zunächst werden wissenschaftliche Ergebnisse und Überlegungen von Expertinnen und Experten zu den Auswirkungen digitaler Kommunikation auf den Körper und den Geist von Jugendlichen zusammengefasst, dann die Frage diskutiert, wie sich das Zusammenleben der Generation »Social Media« im Vergleich mit ihren Eltern verändert.
In einem vierten Teil werden pädagogische Reaktionen auf diese Veränderungen präsentiert: Wie können Lehrpersonen und Eltern in einem neuen medialen Umfeld angemessen mit Jugendlichen zusammenarbeiten?
Ziel dieses Buches ist es, zum Dialog mit Jugendlichen einzuladen und ihre Praktiken in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Wer sich nicht mit vereinfachten Darstellungen zufrieden gibt, wird erkennen, dass auch scheinbar sinnlose mediale Tätigkeiten für Jugendliche eine Funktion haben – und diese Funktion erst in einem zweiten Schritt bewertet werden kann. Selbstverständlich tun Jugendliche nicht nur Dinge, die ihnen guttun: Das gilt für ihren Umgang mit Medien wie für andere Bereiche ihres Lebens. Aber vor der Beurteilung sollte eine genaue Auseinandersetzung mit den Auswirkungen von Kommunikationsverhalten stehen. Dies ermöglicht die Lektüre so, wie das Michèle Binswanger in der Reflexion einer Mutter auf die medialen Gewohnheiten ihrer Töchter im Teenager-Alter entworfen hat:
Das Spiel verändert sich von Generation zu Generation, die Spieler bleiben dieselben. Auch wir waren narzisstische, fiese, wütende, verunsicherte und geile Teenager und hielten uns für den Mittelpunkt der Welt. Auch wir mussten lernen, uns in die vorhandenen Strukturen einzufügen. Und wir taten es genau gleich wie die Kids von heute: zuschauen, ausprobieren, schauen, wohin es führt. (Binswanger, 2013)
1.1 Medienwandel in der historischen Perspektive
Wenn wir lesen, denkt ein Anderer für uns: wir wiederholen bloß seinen mentalen Proceß. Es ist damit, wie wenn beim Schreibenlernen der Schüler die vom Lehrer mit Bleistift geschriebenen Züge mit der Feder nachzieht. Demnach ist beim Lesen die Arbeit des Denkens uns zum größten Theile abgenommen. (Schopenhauer, 1851, § 291)
Schopenhauers Kritik an der Lektüre belustigt im 21. Jahrhundert: Dieselben Argumente, die gegen die Nutzung Neuer Medien angeführt werden, wurden im 19. Jahrhundert gegen das Lesen von Büchern vorgebracht. So wird deutlich, dass der Wandel von analogen Medien zu digitalen nur eine von vielen medialen Umwälzungen in der Kulturgeschichte ist. Diese Übergänge führen zu zusätzlichen und veränderten Zugängen zu Information – und damit zu Wissen. Das hat gesellschaftliche Konsequenzen: Hierarchien ergeben sich über die Teilhabe an Wissen (oder den Ausschluss davon) und über die Möglichkeit, auf bestimmte Arten zu kommunizieren. Ilana Gershon weist darauf hin, dass neue Kommunikationstechnologie stets von Behauptungen begleitet werde, soziale Beziehungen würden sich dadurch fundamental ändern (2010, S. 52 f.).
Einige Beispiele sollen verdeutlichen, wie Medienwandelprozesse, die wir aus der Distanz klarer beurteilen können, in der zeitgenössischen Diskussion wahrgenommen worden sind. Die Debatte über die Lesesucht hat Albrecht Koschorke in einer Mediologie des 18. Jahrhunderts ausführlich dargestellt (2003, S. 397 ff.). Das Problem definiert ein Wörterbuch von 1809 wie folgt:
Lesesucht, die Sucht, d. h. die unmäßige, ungeregelte und auf Kosten anderer nöthiger Beschäftigungen befriedigte Begierde zu lesen, sich durch Bücherlesen zu vergnügen. (zitiert nach König, 1977)
Betroffen von der Kritik sind erstens also Gruppen wie Frauen oder Jugendliche, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erstmals die Möglichkeit erhalten, Bücher zu lesen. Sie befinden sich, so ein Kritiker, an einem sozialen Ort,
[…] wo der Mensch so wenig in sich, sondern stets außer sich zu existieren gewohnt ist, wo er so wenig durch sich selbst ist und alles durch andere, durch den Gebrauch äußerlicher Werkzeuge zu werden suchen muss, wo er folglich nur selten sich selbst genug sein kann, wo er einen großen Teil seiner moralischen, ja man kann dreist behaupten, auch seiner physischen Freiheit, Preis giebt und dennoch hinter seinem, oft ganz chimärischen Ziele, weit zurückbleibt. (Bauer, zitiert nach Koschorke, 2003, S. 400)
Damit bringt die Kritik zweitens einen digitalen Dualismus ins Spiel, also die Vorstellung, es gäbe neben der physischen Welt eine imaginäre virtuelle, die zwar nicht echt ist, aber dennoch negative Auswirkungen auf das Leben in der echten Welt haben kann: Indem sie zum Beispiel moralische Haltungen angreift.
Ein dritter wesentlicher Aspekt der Lesesucht-Debatte ist ein vager und tendenziöser Suchtbegriff, mit dem veränderte mediale Gewohnheiten abgewertet und als schädlich bezeichnet werden können. Seit dem 19. Jahrhundert hat sich der Suchtbegriff stetig ausgeweitet. Er ist zu einem Kampfbegriff geworden, mit dem missliebige Praktiken pathologisiert und als schädlich markiert werden können. Davon sind besonders Randgruppen betroffen, die den Diskurs über ein gesundes Leben nicht zu prägen vermögen: also auch Jugendliche (Boyd, 2014, Pos. 1320 ff.).
Rund hundert Jahre später betrifft eine ähnliche Debatte den Umgang mit dem Kino. Zur Frage, ob Film ein sinnvolles Medium für den Unterricht sei, äußert sich Robert Gaupp wie folgt:
Wir leben ja in einer Zeit nervöser Hast und Vielgeschäftigkeit, in der von allen Seiten die mannigfaltigsten äußeren Reize auf die jungen Seelen einstürmen, in der die Jugend so leicht blasiert wird; sollen wir da eine Belehrungsform gutheißen, bei der nur ein flüchtiges oberflächliches Erfassen, ein passives Hinnehmen und ein halbes Verstehen des Gebotenen stattfindet? Die pädagogische Erfahrung lehrt uns, dass wenig sehen, aber das Gesehene geistig tief verarbeiten, beim Erfassen der Außenwelt aktiv mitwirken, gründliche und willenskräftige Menschen schafft. Aus ruhiger eindringlicher Beobachtung erwächst das selbständige und schöpferische Denken. Zu all dem aber gehört Zeit und immer wieder Zeit. Der Kino hat aber keine Zeit, Bild drängt sich an Bild; die Nummer folgt der Nummer. (Gaupp, 1912, S. 7)
Gaupps Kritik wird von Neil Postman aufgegriffen: In seinem erfolgreichen Buch Wir amüsieren uns zu Tode von 1984 hält er fest, die durchschnittliche Einstellung im Fernsehen sei 3,5 Sekunden lang, »das Auge ruht nie, hat immer etwas Neues zu sehen« (Postman, 1985, S. 86). Generell sei Fernsehen oberflächlich und könne als Medium nur unterhalten, »Bildung, Reflexion oder Katharsis« würden verunmöglicht (ebd., S. 88).
Diese Kritik an der Geschwindigkeit neuer Medien ist ein Topos, den Anaïs Nin in einem Tagebucheintrag vom Mai 1946 in Bezug auf die Möglichkeit, mit Radio und Telefon zwischenmenschliche Verbindungen aufrechtzuerhalten, eindringlich auf den Punkt bringt:
Das Geheimnis eines erfüllten Lebens liegt darin, zu leben und mit anderen so zu leben, als seien sie morgen nicht mehr da, als sei man selbst morgen nicht mehr da. Dann gibt es nicht mehr das Laster, Dinge aufzuschieben, die Sünde, etwas zu verzögern, das verpasste Gespräch, die fehlende Gemeinschaft. Diese Erkenntnis machte mich gegenüber allen Menschen aufgeschlossener; gegenüber allen Begegnungen, die den Keim von Intensität enthalten, der oft leichtfertig übersehen wird. Dieses Gefühl stellt sich immer seltener ein und wird durch unseren gehetzten und oberflächlichen Lebensrhythmus mit jedem Tag seltener, in einer Zeit, in der wir glauben, mit viel mehr Menschen in Verbindung zu sein, mit mehr Völkern, mit mehr Ländern. Diese Illusion kann uns daran hindern, mit dem Menschen, der uns wirklich nahe ist, eine aufrichtige Beziehung einzugehen. Die bedrohliche Zeit, in der mechanische Stimmen, Radio und Telefon, an die Stelle menschlicher Beziehungen treten, und die Absicht, mit Millionen in Verbindung zu sein, schafft eine zunehmende Verarmung von Vertrautheit und Menschlichkeit. (Nin, 1971, S. 205 f.)
Einzugestehen, dass die Medienkritik des 21. Jahrhunderts Argumente wiederholt, die regelmäßig vorgebracht wurden, wenn sich Verschiebungen im Fluss und der Zugänglichkeit von Informationen ergeben, heißt nicht, dass diese Argumente falsch wären. Die von Gaupp, Postman und Nin festgestellte Beschleunigung des Lebens und der Bilder ist messbar und wirkt sich auf das menschliche Leben aus. Aber die Beurteilung dieser Auswirkung kann erst erfolgen, wenn sie präzise beschrieben und in einen größeren Kontext eingeordnet werden kann. Die historische Perspektive zeigt auf, dass Medienwandel zu wenig gehaltvollen Reflexen führt, die von Ängsten und Abwehrhaltungen ausgelöst werden.
Dabei wird ausgeblendet, dass Menschen immer wieder Mittel gefunden haben, um der Überforderung durch die gesteigerte Verfügbarkeit von Informationen Herr zu werden. Spricht Postman von der Oberflächlichkeit der Inhalte am Fernsehen, so wurde er durch die Entwicklung anspruchsvoller Autorenserien, die im 21. Jahrhundert in den USA und in Europa entstehen, Lügen gestraft. Sie verdanken ihren Ursprung einerseits wirtschaftlichen Entwicklungen der privaten Sender in den USA, andererseits neuen technischen Gegebenheiten: Die breite Verfügbarkeit von Aufnahmegeräten erlaubte Regisseuren und Drehbuchautoren Feinheiten in Fernsehproduktionen einzubauen, die nur beim mehrmaligen Sehen erkennbar sind.
Ann M. Blair hat in Too Much to Know einen ähnlichen Mechanismus untersucht. In ihrem Buch befasst sie sich mit der Frage, wie Informationen in wissenschaftlichen Büchern zwischen 1500 und 1700 zugänglich gemacht wurden. Ausgangspunkt sind die Befürchtungen Intellektueller, durch die Bücherflut einen Rückschritt in der Entwicklung zu erleiden. Leibniz schreibt etwa:
[…] diese schreckliche Masse von Büchern, die ständig wächst, wird von der unbestimmten Vielfalt von Autoren dem Risiko des allgemeinen Vergessens ausgesetzt. Es droht eine Rückkehr in die Barbarei. (Leibniz, 1680)
Die Befürchtung sollte sich nicht bewahrheiten, weil eine Reihe von Innovationen wissenschaftliche Bücher verbessert haben: Inhaltsverzeichnisse, Indexe, Abschnitte und Seitenzahlen kamen auf, Menschen begannen, kurze Zusammenfassungen und so genannte Florilegia anzulegen, Anthologien mit wichtigen Auszügen aus anderen Werken.
In ihrem Fazit skizziert Blair mehrere Perspektiven auf den Wandel im Informationsmanagement: Man könnte ihn als eine gesteigerte Abhängigkeit von Ersatzverfahren und Abkürzungen sehen oder als eine Verfeinerung und Demokratisierung neuerer Methoden. Entsprechend kann Blair auf eine Tradition verweisen, die in neuen Formen des Umgangs mit Informationen einen Zerfallsprozess sieht, wie auch auf eine Tradition, die erweiterte Zugangsmöglichkeiten als einen Fortschritt betrachtet (Blair, 2010, S. 267). Neue Werkzeuge verändern die Welt; vor allem, wenn es ihre Aufgabe ist, Kommunikation zu ermöglichen. Diese Veränderung im ersten Moment abzulehnen, scheint menschlich zu sein, wenn man die letzten 300 Jahre Technikgeschichte betrachtet. Die Geschichte zeigt ebenso, dass sich diese Zurückweisung längerfristig oft als unüberlegt erweist.
Kathrin Passig hat in einem Essay Standardsituationen der Technologiekritik festgehalten: »Die Reaktion auf technische Neuerungen folgt in Medien und Privatleben ähnlich vorgezeichneten Bahnen.« Neues werde zuerst als unnütz beschrieben, später als ein Werkzeug für Randgruppen und Bösewichte. Findet es Verbreitung, gilt es als Mode, später dann als wirkungslos, ineffizient oder unzuverlässig.
Das eigentlich Bemerkenswerte am öffentlich geäußerten Missmut über das Neue aber ist, wie stark er vom Lebensalter und wie wenig vom Gegenstand der Kritik abhängt. […] Es ist leicht, Technologien zu schätzen und zu nutzen, die einem mit 25 oder 30 Status- und Wissensvorsprünge verschaffen. Wenn es einige Jahre später die eigenen Pfründen sind, die gegen den Fortschritt verteidigt werden müssen, wird es schwieriger. (Passig, 2009)
Die Autorin schlägt zwei Auswege vor, mit denen die Standardargumente vermieden werden können: sie zur Kenntnis zu nehmen und sie nur dann zu verwenden, wenn sehr gute Gründe dafür sprechen; oder zu verlernen, wie die Welt früher funktioniert hat und zu akzeptieren, dass Gelerntes und Erfahrungen durch technologischen Wandel bedroht werden.
1.2 Digitale Kommunikation und Social Media
Wenn hier die Rede von digitaler Kommunikation oder Social Media ist, dann ist damit eine Phase der Internetkommunikation gemeint, in der Inhalte in Netzwerken geteilt werden, die Gemeinschaften und Beziehungen abbilden. Präziser kann man gestützt auf Boyd und Ellison (2013, S. 158) Social Media als soziale Netzwerke definieren, die drei Bedingungen erfüllen:
1.Auf den Plattformen interagieren identifizierbare Profile, die durch User, Drittuser oder automatisch durch das System bereitgestellte Inhalte gefüllt werden.
2.Sie können Verbindungen und Beziehungen zwischen Usern öffentlich ausdrücken, so dass andere sie einsehen und nachvollziehen können.
3.Sie können Nachrichtenflüsse von Inhalten, die User durch ihre Verbindung mit dem Netzwerk generiert haben, hervorbringen oder zum Konsum beziehungsweise zur Interaktion anbieten.
Die Forscherinnen haben damit ihre einschlägige Definition von 2007 revidiert, um der Evolution von Social Media Rechnung zu tragen, die sich weniger an Profilen orientieren als an Nachrichtenströmen, welche User konsumieren und produzieren.
Die Veränderung sozialer Netzwerke ist für die Forschung ein generelles Problem. Während es gut etablierte Erkenntnisse zu Facebook gibt, einem global verwendeten Netzwerk mit hoher Beteiligung in Industrieländern, das sich zudem gut untersuchen lässt, ist das Sammeln von Daten zu sozial erweiterten Chats wie WhatsApp deutlich schwieriger. Sie genügen den neuen Definitionen von Boyd und Ellison insofern, als dass die Chat-Gruppen, die Jugendliche vielfach erstellen, Nachrichtenflüsse entstehen lassen.
Will man den aktuellen Zustand der Social-Media-Nutzung beschreiben, so ist das aus zwei Gründen äußerst schwierig. Die Erhebung von Daten braucht erstens viel länger, als sich die wechselnden Praktiken unter Jugendlichen halten. So sind beispielsweise große Erhebungen wie die JIM- und JAMES-Studien in der Lage, die Resultate der Befragungen rund ein Jahr nach ihrer Erhebung zu publizieren. Sie sind so also bis zu zwei Jahre alt, bevor die neuen Ergebnisse erscheinen. Zweitens sind die Praktiken äußerst uneinheitlich, verschiedene soziale Gruppierungen migrieren zwischen verschiedenen Netzwerken und verwenden sie teilweise höchst eigensinnig. Sie nutzen Tools oft so, wie das ihre Hersteller und Designer nicht beabsichtigt haben. Ein erstaunliches Beispiel haben Boyd und Marwick in Befragungen von Jugendlichen ermittelt:
Mikalah beschrieb, wie sie ihr Facebook-Konto jeden Tag deaktivierte, nachdem sie es benutzt hatte. Facebook führte die Deaktivierung als Alternative für das Löschen eines Kontos ein. User hatten die Möglichkeit, ihre Inhalte so zu verbergen, dass sie komplett verborgen waren. Bereuen sie ihre Entscheidung, reaktivierten sie ihr Konto und können wieder auf alle Inhalte, Verbindungen und Nachrichten zugreifen. Mikalah tat dies täglich, was darin resultierte, dass alle ihre Freunde ihr nur Nachrichten schicken oder Kommentare hinterlassen konnten. Dadurch verwandelte sie Facebook in ein Netzwerk, das nur in real-time funktionierte. Sie wusste, dass Erwachsene tagsüber ihr Profil anschauen könnten und wollte nicht über die Suche auffindbar sein, sie hatte regelmäßig mit staatlichen Institutionen zu tun und traute Erwachsenen nicht. Aber sie nahm vernünftigerweise an, dass die meisten Erwachsenen in der Nacht, wenn sie online war, weniger oft auf ihr Profil stoßen würden. Sie kreierte so eigentlich eine Tarnkappe – so dass sie für die sichtbar war, mit denen sie interagierte, und für die unsichtbar, die ihre Informationen durchsuchen konnten, während sie abwesend war. (Boyd/Marwick, 2011, S. 20 f., übersetzt von Ph. W.)
Das Design und die Programmierung von Social Media schaffen bestimmte Affordanzen: Sie erleichtern bestimmte kommunikative Handlungen, schaffen Anreize und erschweren oder verunmöglichen andere. Eine dicke Glasscheibe – ein Beispiel von Danah Boyd (2014, Pos. 235) – erlaubt Menschen, sich zu sehen, ohne einander zu hören. Das bedeutet aber nicht, dass sie deswegen nicht miteinander kommunizieren könnten: Vielleicht schreiben sie Nachrichten auf Blätter oder nutzen Pantomime. Das Beispiel von Mikalah zeigt, dass die Affordanzen auch zu nicht vorgesehenen und dementsprechend unerwarteten Nutzungsweisen führen. Enge Vorgaben bei der Erstellung von Profilen (Zwang zum Klarnamen und beschränkte Auswahlmöglichkeiten bei der Wahl des Geschlechts, des Wohnorts und des Alters) führen oft dazu, dass Menschen erfundene Angaben vornehmen; obwohl oder gerade weil es sehr einfach wäre, eine bestimmte Identität abzubilden.
Die Affordanzen von Social Media umfassen vier Aspekte, die von herausragender Bedeutung sind (vgl. Boyd 2014, Pos. 235), weil sie die Kommunikation verändern und verschobene Anreize schaffen:
1.Dauerhaftigkeit und Archivierbarkeit von Inhalten,
2.Sichtbarkeit für ein bestimmtes Publikum oder für die Öffentlichkeit,
3.Möglichkeit, Inhalte zu teilen und zu verbreiten,
4.Auffindbarkeit mittels Suchmechanismen.
Wer beispielsweise mit einer Dienstleistung eines Unternehmens nicht zufrieden ist, hat in Social Media einen Kanal, auf dem Beanstandungen sichtbar werden und verbreitet werden können. Die Position der Kunden wird gestärkt und Unternehmen können über die Suchfunktionen gezielt nach Rückmeldungen suchen und Verbesserungen vornehmen. Die Konzeption der Social-Media-Tools erleichtert diese Aspekte der Kommunikation nicht nur, sie schafft auch massive Anreize, sich darauf einzulassen. Mittels Geschäftsbedingungen, die User kaum lesen, und über automatisierte Voreinstellungen stellen die Anbieter sicher, dass sie die Inhalte ihrer Nutzerinnen und Nutzer maximal nutzen können. So entstehen die Affordanzen letztlich ebenfalls. Sie wandeln sich, wie man vom Übergang der SMS-Kommunikation zu WhatsApp sieht, auch recht schnell: War es in der ersten Generation von Textnachrichten wichtig, sich knapp zu halten, um Kosten zu sparen, ist diese Einschränkung heute irrelevant geworden. WhatsApp ist so designt, dass User viel schreiben, sofort reagieren und Videos, Bilder und Textnachrichten in ihre Chats einbauen.
Das heißt aber nun nicht, dass Jugendliche sich durch die Technologie bestimmen lassen. Während sie in Belangen, die ihnen unwichtig sind oder die sie in ihrem Alltag ohnehin nicht kontrollieren können, oft gleichgültig wirken können, sind sie kreativ und engagiert, wenn es darum geht, ihr soziales Netz gezielt zu pflegen und zu erweitern. Aus diesem Grund hacken sie die Tools oft – nicht in dem Sinne, dass sie sie umprogrammieren, sondern indem sie Vorgaben als spielerische Herausforderung statt als Vorschriften interpretieren.
1.3 Generation »Social Media«
Ist im Titel dieses Buches von einer spezifischen Generation die Rede, so vermag diese Einschränkung der Abhandlung einen Fokus zu geben: Untersucht werden die Auswirkungen von Social Media auf einen Ausschnitt aus der Gesellschaft, eine bestimmte Generation. Gerade dieses Konzept ist aber zunächst höchst diffus. Der Begriff der Generation wird zwar oft verwendet, ist aber notorisch ungenau, wie Charles Berg festhält:
Der Generationsbegriff als eine Art Schnittpunktkategorie stellt die Sozialwissenschaften vor eine Reihe von Dilemmas. Generation kann in einer diachronen, verstanden als Folge in einer historischen Ahnenreihe, oder in einer synchronen Perspektive, verstanden als das Mit- und Gegeneinander simultan existierender gesellschaftlicher Gruppen, gesehen werden. Der Generationsbegriff kann subjektiv oder objektiv ausgelegt werden: einmal als meist nur begrenzt zutreffende kollektive Selbstdeutung (»Wir sind die 68er.«), dann als quasi objektiviertes soziologisches Gruppenmerkmal. Das Generationskonzept kann einen familienbiografischen oder sozialgeschichtlichen Fokus haben, es kann sich auf Erlebtes, auf Wissen, auf Verhalten beziehen.
Eine derart komplexe Kategorie bietet sicher den Königsweg zum Verständnis der gegenwärtigen Gesellschaft und ihres evolutiven Potenzials, aber auch herrliche Sackgassen, die an der Einmündung verlocken, aber dennoch am Ende zu nichts führen. (Berg, 2006, S. 33).
Um die heutige Gesellschaft verstehen zu können, ist ein relationaler Generationenbegriff sinnvoll: Im Blick stehen die Jugendlichen von heute, deren Abnabelung von den sozialen Strukturen ihrer Eltern schon immer mit den Möglichkeiten digitaler Kommunikation erfolgt ist. Als Beispiel dafür kann Philipp Riederle gelten, der sich mit seinem Buch Wer wir sind, und was wir wollen als eine Art Sprachrohr für diese Generation inszeniert. In der Einleitung schreibt der zur Zeit der Niederschrift 19-jährige Autor:
Willkommen bei der Generation Y, der Generation Z oder der Generation C – C wie Connected. Uns sind schon so viele Generationsbezeichnungen übergestülpt worden, da sollte man sich nicht festlegen. Schließlich kann es uns egal sein … Die vom kanadischen Schriftsteller Douglas Co[u]pland aus der Wiege gehobene Generation X definierte sich noch über das gepflegte Slackertum, die gespielte Verzweiflung angesichts der lähmenden Multi-Optionen, die die Gesellschaft zu bieten hat. Wir nutzen sie. Mehr, als Ihr vermutet. Unsere Leitfrage lautet: »Was ist für uns relevant?« (Riederle, 2013, S. 9 f.)
Auch wenn Riederle sich darüber empört, dass ältere Menschen ihm vorhalten, »von sich auf andere zu schließen« (2013, S. 9 f.), so tut er genau das. Während er sich als Vertreter seiner Generation sieht, formt er in seinen Texten und Vorträgen ganz bewusst ein bestimmtes Bild dieser Generation. Durchgängig verwendet er die erste Person Plural, doch das »wir«, für das Riederle eintritt, scheint wenig mehr als die Vorstellung zu sein, dass andere auch so seien wie er. Aber nicht nur sind wenige Jugendliche so privilegiert, dass sie mit 13 ein iPhone erhalten, das aus den USA importiert ist, viele interessieren sich auch nicht dafür, Erwachsenen mit gelehrten Zitaten aus dem bildungsbürgerlichen Kanon zu erklären, wie denn die heutige Jugend so tickt.
Die Generation »Social Media« ist – wie die Generation Y, Z oder C – soziales Konstrukt, eine Projektionsfläche, deren Wahrnehmung oft mehr über die



















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









