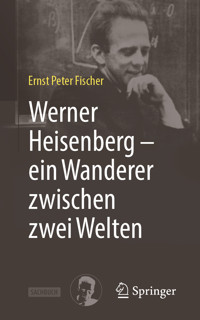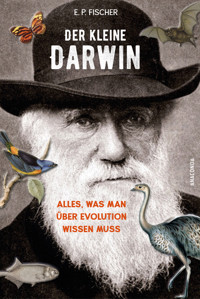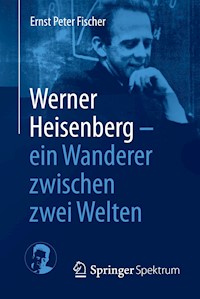8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herbig, F A
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Erst Erbsen, dann Fruchtfliegen, Mäuse, Würmer, Viren, Bakterien und Schafe. Die Genetik arbeitete sich vor, bis sie schließlich das Eigentliche ins Visier nahm: den Menschen. Sein Genom zu entschlüsseln und seine Erbanlagen zu identifizieren, ist zweifellos ein Höhepunkt in der Forschung an uns selbst. Schließlich lässt sich nun das, was jeden von uns zu einem Individuum macht, biochemisch erfassen und damit nutzen. Der renommierte Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer erzählt die rasante Erfolgsgeschichte der Genetik anhand der wichtigsten Erkenntnisstufen, stellt markante Köpfe der Disziplin vor und verrät, dass Durchbrüche in der Forschung auch immer mit glücklichen Zufällen zu tun haben. Wissen für alle - unterhaltsam und spannend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Ernst Peter Fischer
GENial!
Was Klonschaf Dolly den Erbsen verdankt
Ein Streifzug durch die Genetik
Herbig
Bildnachweis: Alle Abbildungen wurden nach Vorlagen des Autors von EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice Pfeifer, Germering, erstellt, außer: Abb. 7: Archiv des Autors; Abb. 20: Medienarchiv Wikimedia Commons
Besuchen Sie uns im Internet unter
Inhalt
Vorwort
Genetisch kommt von Goethe
Der Physiker im Klostergarten
Gregor Mendel und die Gesetze der Vererbung
Der erste Blick auf die Gene
William Bateson, Carl Correns, Archibald Garrod, Wilhelm Johannsen
Die Ankunft einer Fliege
Thomas Hunt Morgan und seine Schule führen die Fliege Drosophila ein
Die Moleküle des Lebens
Die Biochemiker und der Weg zur Ein-Gen-ein-Enzym-Hypothese
Das Atom der Biologie
Max Delbrück & Co. begründen die Molekularbiologie
Ein Gefühl für den Organismus
Barbara McClintock – eine Frau in der Männerwelt
Am Faden des Lebens
J. D. Watson, F. Crick und andere erkennen die Struktur des Erbmaterials
Revolution in der Molekularbiologie
Der genetische Code, die Synthese der Proteine, das Dogma der Molekularbiologie und die Regulation der Gene
Eine neue Technik bringt eine neue Genetik
Werner Arber, Herbert Boyer, Paul Berg und die Faszination des Klonens
Die Auskunft einer Fliege
Seymour Benzer und andere, die Verhalten und Genetik zusammendenken wollen
Hello Dolly – Vom kurzen Leben eines berühmten Schafes
Über einige Grenzen der genetischen Eingriffe
Tausendundein Genom und mehr
Walter Gilbert, Craig Venter, Francis Collins & Co. knöpfen sich die Genome vor
Nachwort
Der genetische Stand der Dinge
Anhang
Zeittafel Ausgewählte Literatur Glossar Register
Vorwort
Genetisch kommt von Goethe
Nach mehr als einem Jahrhundert voller Vorbereitung und Tatendrang ist die Genetik beim Menschen angekommen. Sie erfasst und ergreift ihn persönlich und wird ihn nicht mehr loslassen. Sie wird sein genetisches Profil bestimmen und ihm eine Diskette oder Genchips mit all den Erbinformationen in die Hand geben, die seine Zellen enthalten und zu seinem Leben beitragen. Mithilfe der offengelegten und maschinenlesbaren Auskünfte hoffen Wissenschaftler und Ärzte, in einer nicht mehr ganz fernen Zukunft jeder Person eine individuelle Behandlung anbieten und ihr ein Rezept ausstellen zu können, das ganz allein auf sie zugeschnitten ist. Wer sich seine Gene zeigen lässt, kann vielleicht sogar in Erfahrung bringen, von welchem Lebensjahr an ihm oder ihr mit welcher Wahrscheinlichkeit Alterserscheinungen wie zum Beispiel die Alzheimer-Krankheit persönliche und soziale Probleme bereiten oder Krebszellen ihr Wachstum beginnen werden. Die Genetik legt somit in diesen ersten Jahren des 21. Jahrhunderts den Grundstein für eine neue Medizin mit neuen Diagnosemöglichkeiten und neuen Therapien, die genau auf die genetische Information einer bestimmten Person abgestimmt ist und sogar aktuelle Varianten zu erfassen versucht, die von der Umwelt beeinflusst werden.
Doch so erfreulich die oben angedeutete Entwicklung einer persönlichen Genetik auch klingt, sie wirft zugleich Fragen auf wie die, ob wir mit den zahlreichen Informationen überhaupt umgehen können. Lassen wir uns durch zu viele Vorhersagen nicht vielmehr einengen, sodass wir Gefahr laufen, das Leben selbst, das wir gerade führen, aus den Augen zu verlieren? Wie kann es bei einer Gendiagnose noch zu einem informed consent, einer vom Patienten wirklich verstandenen Einwilligung in die Untersuchung kommen, wenn die Vielzahl der genetischen Varianten, die sich dabei zeigen und zu unterscheiden sind, nicht in wenigen Stunden oder Tagen erläutert werden können – falls es überhaupt noch jemanden unter den Fachleuten gibt, der sich da noch umfassend auskennt? Hier steckt ein Problem, dessen Behandlung die Verfechter einer »Personalgenetik« gerne hinausschieben, ohne dass sie von den Patienten daran gehindert werden.
Historische Fragen
Selbst wenn die Forscher, die heute zur Humangenetik beitragen und der Realisierung der skizzierten Vision näher kommen, es nicht explizit wissen, so erfüllen sie doch nach und nach einen der grundlegenden und lohnenswert erscheinenden Aufträge, die ihre Vorgänger zu Beginn der Genetik vor mehr als 100 Jahren angenommen haben. Sie versuchen nämlich zu verstehen, wie die Einzigartigkeit von Menschen, das Besondere und Unverwechselbare des Gegenübers, wie die biochemische Individualität einer Person zu erfassen und mithilfe von exakten Verfahren zu begreifen ist. Dabei besteht das medizinische Ziel dieses Tuns gestern wie heute darin, den Artgenossen mit diesen Kenntnissen zu helfen, sie vor Gefahren zu schützen und ihr Leben zu erleichtern.
Es lohnt sich nicht nur, dem Ursprung dieses Fragens und Wollens nachzugehen. Es lohnt sich auch, die Geschichte der Genetik kennenzulernen, weil sie, wie in diesem Buch erzählt werden soll, schlichtweg zu uns selbst führt. Im Mittelpunkt wird dabei die Einkreisung des Begriffs des Gens stehen. Dieser ist längst alltäglich geworden. Selbst Fußballspieler haben damit keine Mühe, wenn sie etwa auf ihr Sieger-Gen hinweisen. Doch in diesem Buch geht es auch um die Wissenschaftler, die sich der Erkundung des Gens gewidmet haben, und um die Motive, die sie diesen Weg wählen ließen. Die Geschichte der Genetik demonstriert auf ihre ganz eigene Weise die Unvermeidlichkeit der Einsicht, die Goethe den Lesern seiner Wahlverwandtschaften von 1809 anvertraut: »Das eigentliche Studium des Menschen ist der Mensch.«
Der eigentliche Studiengegenstand der Genetik ist tatsächlich der Mensch, auch wenn man bei oberflächlicher Betrachtung vieler Lehrbücher und anderer Texte den Eindruck gewinnen kann, dass es dieser Wissenschaft mehr um Erbsen, Bohnen, Fliegen, Mäuse, Heuschrecken, Seeigel, Würmer, Bakterien, Viren und andere Viecher als um die menschliche Spezies geht. Aber auch die längste Reise beginnt bekanntlich mit dem ersten Schritt, und der kann nicht sofort den Gipfel erreichen, auf dem wir Menschen uns vermuten. Bis zu uns dauert es eben seine Zeit.
Natürlich ist der Mensch auch das eigentliche Studienobjekt, wenn es darum geht, die Geschichte der Genforschung zu erzählen. Denn er ist bzw. die Menschen (Plural!) sind für das verantwortlich, was die Wissenschaft wissen will und letztlich an Erkenntnissen zutage fördert.
Wer sich einzelne Forscherexemplare in dem hier anvisierten Rahmen genauer anschaut, wird immer wieder auf Überraschungen stoßen. Und zwar von Anfang an. Denn unsere Geschichte der Genetik beginnt den Schulbüchern zufolge mit einem Mönch. Es ist tatsächlich nicht ganz falsch, wenn zu lesen ist, dass die westliche Wissenschaft erste Einsichten in die Abläufe der Vererbung durch das Zählen von Erbsen in einem Klostergarten bekommen hat, für den der österreichische Augustinermönch Gregor Mendel im tschechischen Brünn zuständig war. Aber wissen wir damit schon, was Mendel angetrieben hat und erfahren wollte?
Des Weiteren trifft es zu, wenn uns beigebracht wird, dass die klassische Form der Genetik vor allem durch das Kreuzen von Fliegen in den Laboratorien des amerikanischen Biologen Thomas H. Morgan entstanden ist. Aber wie sind die Insekten dorthin gekommen? Warum hat man sie nicht verscheucht?
Außerdem ist es ganz sicher richtig, wenn zu lesen ist, dass der Weg in die moderne und erfolgreiche Molekularbiologie erst durch Arbeiten mit Viren und Bakterien freigelegt worden ist. Unter anderem haben deutsche und italienische Biophysiker, die noch vorgestellt werden, entscheidend zu diesem Fortschritt beigetragen. Aber welche Umstände haben sie und ihre Kollegen auf diese Winzlinge aufmerksam gemacht, die doch noch weiter vom Menschen weg zu sein scheinen als Fliegen und Erbsen?
Traditionelle Darstellungen, wie sich die Erforschung der Vererbung entwickelt hat und zu der Genetik wurde, die wir heute kennen, lassen diese Entwicklungen unverbunden hintereinander stattfinden und nebeneinander stehen. Dabei übergehen sie die historisch bedeutsame Tatsache, dass bereits ganz zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Frage aufgetaucht ist, um die es bis in unsere Tage und darüber hinaus aus gutem Grund geht. Und zwar um die Frage nach einem wissenschaftlichen Verständnis für die Individualität eines jeden Menschen. Warum ist die eine Person mehr anfällig für Infektionskrankheiten als eine andere? Weshalb trägt dieser ein höheres Einzelrisiko, übergewichtig zu sein oder unter hohem Blutdruck zu leiden, als jener?
Zwar sehen unsere Gesichter – äußerlich betrachtet – alle verschieden aus. Aber was ist »innen« der Fall? Was gilt für die Moleküle in den Zellen eines Körpers? Wie zeigt sich da unsere Einzigartigkeit? Mein Cholesterin wird sich höchstens der Menge nach von dem meines Nachbarn unterscheiden, und das Gleiche gilt für die Zucker, Salze und anderen chemischen Bausteine, die sich in meinen Zellen und Gefäßen tummeln. Wo aber bin ich innen qualitativ anders als er und andere Menschen? Wo stecken meine oder deine oder irgendeine molekulare Besonderheit und biochemische Unverwechselbarkeit? Und wie wirkt sich ihre Manifestation auf das persönliche Leben und seine Möglichkeiten aus?
Die Gene
Die Frage nach der biochemischen Individualität findet seit einigen Jahren ihre Antwort in der Reihenfolge (Sequenz) der Bausteine, aus denen die Gene bestehen. Diese Gensequenzen können heute für einzelne Menschen in Form sogenannter persönlicher Genome angefertigt werden, wie am Ende des Buches zur Sprache kommen wird. Diese geistige Errungenschaft verdanken wir den Molekularbiologen respektive den Genomforschern, deren Bemühungen in den letzten Jahrzehnten immer erfolgreicher und durchschlagsfähiger geworden sind. Die Biologen legen seit den 1990er-Jahren die Bauweise der diskreten »Elemente« offen, deren chemische Identität sie seit den 1950er-Jahren kennen und deren gesetzmäßiger Vererbung bereits Gregor Mendel im 19. Jahrhundert auf der Spur war. Seit dem frühen 20. Jahrhundert – genauer: seit 1909 – sind sie als Gene bekannt.
Das schöne Wort »Gen« stammt dabei von einem Dänen. Er hieß Wilhelm Johannsen. Als er es 1909 vorschlug, legte er aus zwei Gründen Wert auf eine kurze Bezeichnung für die Erbfaktoren. Der neue Ausdruck sollte zum einen leicht kombinierbar sein, und er sollte zum anderen erlauben, etwas in einfacher Weise zu sagen: So sollte man im Fall von Genen für bestimmte Eigenschaften beispielsweise von »Genen für blaue Augen« sprechen können. Während sich die erste Idee bewährt hat, wie die Beispiele »Gentechnik« und »Gentherapie« zeigen, bringt die zweite bis heute vor allem Nachteile mit sich. Sie macht es nämlich viel zu leicht, Genen etwas in die Schuhe zu schieben, mit dem sie direkt eher wenig zu tun haben. Mit der sprachlichen Vorgabe der hübschen Gene hat sich – unabhängig von wissenschaftlichen Kenntnissen und ohne Rücksicht auf entsprechende Einsichten – ein inflationärer Gebrauch des Wortes eingebürgert. Er reicht von »Genen für Krebs« bis zu »Genen für Untreue«, lässt auf keinen Fall die »Gene für Intelligenz« aus und verweigert Mitarbeitern einer Führungskraft die Beförderung mit dem Hinweis, sie verfügten nicht über »Führungsgene«, sondern über »Assistentengene«.
So rasch sich diese Sprechweise auch durchgesetzt hat, so irreführend und abwegig ist sie. Denn wer so spricht, fällt hinter Mendel zurück, der trotz einiger Unklarheiten in der Darstellung seiner Versuche deutlich verstanden hat, dass es nicht die Eigenschaften eines Lebewesens wie etwa seine Augenfarbe sind, die durch die »Erbelemente« oder »Faktoren« bestimmt werden. Was festgelegt wird, sind vielmehr die Unterschiede von Eigenschaften, und zwar durch Unterschiede in den Genen. Im Klartext: Man kann aus den wissenschaftlich verfügbaren Tatsachen nicht den Schluss ziehen, dass ein gegebenes Gen für ein gegebenes Merkmal– Augenfarbe, Körpergröße, Nasenform – sorgt. Man kann nur sagen, dass abweichende Merkmale durch abweichende Gene bedingt werden. Die Gene machen uns also nicht gleich, wie immer wieder befürchtet wird. Im Gegenteil, sie sorgen vielmehr dafür, dass wir verschieden sind. Davon wird im Folgenden noch ausführlich zu erzählen sein.
Doch auch die Auffassung dessen, was ein Gen letztlich ausmacht, war im Laufe der Geschichte nicht immer gleichbleibend. »Was ist ein Gen?« – diese Frage wurde zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich beantwortet, was ein Beispiel für die von außen gesehen oft unverständliche Tatsache liefert, dass die Forschung nicht von Anfang an weiß, womit sie es zu tun hat, sondern dies im Laufe ihrer Arbeiten erst versteht und festlegt. Eine Ahnung von der genetischen Sprachverwirrung vermitteln nebenstehende Zitate großer Forscher von Mendel bis zur Gegenwart.
Die umgekehrte Reihenfolge
Das Kuriose an dem Geburtsjahr 1909 des Gens besteht darin, dass es zu diesem Zeitpunkt den Namen »Genetik« für die inzwischen ins Laufen gekommene Wissenschaft von der Vererbung schon gab. Er war drei Jahre zuvor – 1906 – von dem Briten William Bateson vorgeschlagen worden, der seiner Wissenschaft durch einen griechisch angehauchten Ausdruck Adel verleihen und Genetiker werden wollte. Doch damit hören die historischen Überraschungen nicht auf, denn vor dem Wort »Genetik« kursierte bereits das damit zusammenhängende Attribut »genetisch«, das von Goethe stammt, und zwar aus dem 18. Jahrhundert.
Goethe wollte ab 1796 eine Wissenschaft der Morphologie als »die Lehre von der Gestalt, der Bildung und Umbildung der organischen Körper« etablieren und fördern. Ihre Vertreter sollten sich darum bemühen, mit ihrer Hilfe die Bildung aller Gestalten und Formen der Natur aus einem Grundplan heraus zu verstehen, also das organische Werden »durch die mannigfaltigste Wiederholung des ursprünglichen Bildungstypus« zu begreifen. Mit diesen Worten begründete Goethe »die Notwendigkeit der genetischen Methode für alle Naturwissenschaft« – und seitdem ist der Begriff in der Welt und in unserem Sprachschatz.
Das Genetische drückt gemäß seiner griechischen Wurzel ein Werden aus (es sei auf den Begriff der »Generation« oder der biblischen »Genesis« verwiesen), und exakt dieses Geschehen – das Werden des Lebens und die Bildung seiner Formen und Fähigkeiten – gilt es zu verstehen. Die Vielzahl der Wissenschaften kann heute einiges dazu sagen, ihre dabei eingesetzte »genetische Methode« verdankt sie der Wissenschaft von der Genetik.
Fassen wir also zusammen: Erst dachte man »genetisch« – nämlich schon zu Goethes Zeiten –, dann konzipierte man die »Genetik« zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und erst zuletzt machte das »Gen« selbst sein Debüt. Diese Reihenfolge bringt eine bis in die Gegenwart reichende maßgebliche Konsequenz für das Verständnis der Abläufe im Lebendigen mit sich, die leider wenig Beachtung findet. Wer heute meint, »genetisch« habe eine einfache Bedeutung, die nur darauf hinweist, dass etwas von Genen abgeleitet oder bedingt wird, der verschenkt einen großen Teil der Bedeutungsinhalte, die auf diese Weise ausgedrückt werden können. Ein Beispiel: Wer »sachlich« sagt, meint mehr, als dass es irgendwo eine Sache gibt, von der meist auch nicht so viel bekannt ist. Und wer »genetisch« sagt, sollte deshalb mehr meinen, als dass es irgendwo ein Gen gibt, das er im Zweifelsfall auch nicht kennt.
Das über Gene hinausreichende Genetische des Lebens wird wichtig, wenn sich die biologischen Wissenschaften ihrem grundlegenden Thema zuwenden und verstehen wollen, wie sich Leben bilden kann, wie aus einem mehr oder weniger gestaltlosen Ei ein hochgradig strukturierter und morphologisch differenzierter Organismus hervorgeht. Es lohnt sich, diesem Treiben zuzuschauen – dem Leben und der Wissenschaft. Dabei entsteht unsere Geschichte.
Der Physiker im Klostergarten
Gregor Mendel und die Gesetze der Vererbung
Nur wenigen Naturforschern ist es vergönnt, dass ihre Namen zum Begriff werden und theoretische Prinzipien, physikalische Gesetze oder technisches Gerät bezeichnen – das Newtonsche Uhrwerk, die Röntgenstrahlen, der Faradaysche Käfig, die Planckschen Quantensprünge, das Bohrsche Atommodell, Maxwells Dämon, Schrödingers Katze und der Bunsenbrenner sind berühmte Beispiele, die jedem Wissenschaftler und vielleicht auch vielen anderen Menschen vertraut sind (zu wünschen wäre es jedenfalls). Wer es mit seinem Namen so weit gebracht hat, kann schon als äußerst berühmt gelten. Und doch gibt es noch eine Steigerung, die weit über diese Ehrung hinausgeht. Gemeint ist die Tatsache, dass die Namen von Wissenschaftlern zu Tätigkeitswörtern umgewandelt werden und in den alltäglichen Gebrauch der Sprache eingehen. Das haben nur zwei Forscher geschafft: der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923) und der Mönch Gregor Mendel, der 1822 geboren und 62 Jahre alt wurde. Wer zum Arzt geht, hat bekanntlich große Chancen, geröntgt zu werden, und wenn die Vererbung von Eigenschaften erörtert wird, hört man hin und wieder, dass da »gemendelt« wird oder dass sich durch Züchtung bestimmte Eigenschaften »ausmendeln« lassen. Tatsächlich definiert der Duden: »Mendeln« heißt, »nach den Vererbungsregeln Mendels in Erscheinung treten«, wobei anzumerken ist, dass der Name Mendel es sogar in den angelsächsischen Sprachraum geschafft hat, in dem Erbkrankheiten Mendelian diseases und Experimente mit Kreuzungen Mendelian mating heißen.
Die »Versuche über Pflanzen-Hybriden«
Mendel ist also berühmt. Da nun viele von uns im Biologieunterricht angehalten wurden, seine Kreuzungsversuche mit Erbsen wenigstens gedanklich nachzuvollziehen, und wir auch mindestens eine Fotografie von Mendel vor Augen haben, sind wir ganz sicher, über den Mann und sein Werk im Bilde zu sein. Doch stimmt das, was wir über ihn zu wissen meinen? Stimmt es, dass die Zeitgenossen Mendel weder verstanden noch zur Kenntnis genommen haben? Stimmt es, dass man seine Erbgesetze zunächst ignoriert hat und erst zu Beginn dieses Jahrhunderts begreifen konnte, um sie dann gleich dreifach wiederzuentdecken? Und stimmt es überhaupt, dass Mendel die Gesetze der Vererbung entdeckt hat?
Richtig ist, dass Mendel in einem Klostergarten in Brünn sogenannte »Versuche über Pflanzen-Hybriden« unternommen und seine Ergebnisse unter diesem Titel 1865 der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Nicht richtig ist, dass Mendel mit dieser Arbeit die Absicht hatte, Gesetze der Vererbung aufzustellen. Dieser Schluss ist jedenfalls unvermeidlich, wenn man die etwas mehr als 40 Seiten liest, in denen Mendel über seine Kreuzungen berichtet. Das Wort »vererben« kommt in seinem Text nämlich nur am Rande vor und dann auch noch negativ: Das »Verschwinden der grünen Färbung«, so stellt Mendel nach einem Blick auf die Erbsen fest, mit denen er experimentierte, »vererbt sich nicht auf die Nachkommen.« Punkt. Das ist alles, was ihm zu diesem Ausdruck einfällt und eine Mitteilung wert ist.
Was also hatte Mendel mit seinen Versuchen im Sinn? Ein Bericht, der am 9. Februar 1865 im Brünner Tagblatt erschienen ist, hilft hier weiter. Er enthält die Neuigkeiten von der Versammlung des »Naturforschenden Vereins« in Brünn, die tags zuvor stattgefunden hatte und bei der etwa 40 Teilnehmer gezählt wurden. Wie zu lesen ist, hatte Mendel, der zu den Gründern des Vereins gehörte, bei dieser Gelegenheit berichtet, wie er seine Erbsen über Jahre hin gekreuzt hatte – keineswegs ein einfaches Geschäft, das viel gärtnerische Sorgfalt und saubere Buchhaltung erfordert. Die Zeitung hatte ferner zusammengefasst, was sich dabei beobachten ließ. Der leider anonyme Berichterstatter teilt den Lesern ziemlich klar und unmissverständlich mit, worauf der Mönch Mendel bei seinem »längeren, besonders für Botaniker interessanten Vortrag« besonderen Wert gelegt hatte: auf die experimentelle Beobachtung, dass die »Pflanzenhybriden, welche durch künstliche Befruchtung stammverwandter Arten hervorgebracht werden (…), stets geneigt waren, zur Stammart zurückkehren.«
Wenn die Gerüchte stimmen, dass Mendel selbst den Bericht für die Zeitung verfasst hat, dann lässt sich daraus übrigens eine Art Mendelsche Regel für Forscher ableiten: Was du der Nachwelt sagen willst, musst du als Zeitungsmeldung formulieren.
Was die Sache selbst angeht, so klingt das, was das Tagblatt meldet, auf keinen Fall nach Gesetzen der Vererbung. Dort steht nichts anderes, als dass Mendel mit seinen Versuchen die Absicht hatte, den Nachweis zu führen, dass Pflanzen im Laufe von Generationen in ihrer Erscheinungsform (ihren sichtbaren Merkmalen) zwar nicht konstant bleiben, dafür aber stets dazu neigen, wieder zum elterlichen Ausgangspunkt, zu ihrer »Stammart«, zurückzukehren. Und diese müsse wohl göttlichen Ursprungs sein.
Wenn man nun böse sein wollte, könnte man jetzt den Verdacht äußern, dass hier jemand versucht, die Möglichkeit der Entwicklung oder der Evolution zu widerlegen. Doch selbst wenn Mendel diese Absicht im Hinterkopf gehabt und verfolgt hätte, so steht doch fest: Alle Biologen, die sich heute auf ihn berufen, haben ihn anders verstanden. Wenngleich kaum jemand seine Arbeit gelesen hat, so bewundert man gemeinhin, dass sie die im Inneren der Pflanzen verborgenen Mechanismen, die zur Weitergabe von Merkmalen – also zu ihrer Vererbung – führen, experimentell und quantitativ zugänglich macht. Und diesen Zugriff haben nachfolgende Generationen fleißig weiter verbessert und so die Wissenschaft von der Vererbung aufgebaut, die heute zu den spannendsten Gebieten zählt, auf denen sich Forschung umtun kann.
Mendels Regeln
Mendels Regeln erwecken zwar vielfach den Eindruck, für das Leben zu liefern, was uns Newtons Gleichungen der Bewegung für die Materie geben, nämlich Gesetze der Natur, nach denen alles strikt geregelt und vorhersehbar abläuft. Aber was Mendel gefunden hat, ist von völlig anderer Art als die Newtonschen Gesetze, auch wenn dies selten ausdrücklich gesagt wird. Während Newtons Einsichten mit mathematischer Hilfe genau berechenbare Abläufe der materiellen Natur erfassen, stellen die heute nach Mendel benannten Regeln bestenfalls statistische Zusammenhänge für das Leben her, und sie kommen fast ohne Formelsprache aus. Das heißt, was Mendel gefunden hat, gibt vor allem Auskunft über die Wahrscheinlichkeit, mit der eine zählbare Eigenschaft von einer Generation (Eltern) auf die nächste (Kinder) übertragen, mit der also etwas vererbt wird.
Wenn sich das Leben vermehrt und Nachwuchs hervorbringt, geht es weder völlig zufällig noch völlig vorhersehbar vor. Es agiert in dem Rahmen, den Mendels Regeln aufspannen, und es tut dies unter der Vorgabe, dass dabei Sex nötig ist und getrieben wird und es zu einem Austausch von Merkmalen kommt. Mendels statistische Einsichten kommen also zur Anwendung, wenn zwei Geschlechtspartner – einer männlich, einer weiblich – zusammenfinden, um Nachkommen zu zeugen. Was dabei entsteht, kann mithilfe der Mendelschen Regeln verstanden werden, die für Erbsen wie für Edelweiß und für Mäuse wie für Menschen gelten.
Sie erfassen, wie sich die von ihm entdeckten »Elemente« oder »Faktoren« der Vererbung bemerkbar machen, die wir heute Gene nennen. Als Besonderheit muss dabei hervorgehoben werden, dass dem Mönch eine eigentümliche Dualität aufgefallen war. Jeder der beiden Sexpartner trägt nämlich zwei Formen (Allele) eines Erbelements in seinen Zellen mit sich, wobei diese Varianten entweder gleich oder verschieden sein und sich auch unterschiedlich auswirken können.
In Mendels erster Regel wird anzugeben versucht, welche Form eines väterlichen oder mütterlichen Erbelements im unmittelbaren Nachwuchs ankommt. Das Ergebnis spielt keine Rolle, solange die beiden Gene bei beiden Eltern nicht zu unterscheiden und also gleich sind. Alle Kinder werden dann genetisch gleichartig bestückt sein. Die Filialgeneration ist in Hinblick auf dieses Merkmal uniform, wie es korrekt in der Fachsprache heißt.
Die zweite Mendelsche Regel handelt von dem, was passiert, wenn sich diese uniforme Generation fortpflanzt, wenn also zwei gleichartig bestückte Kinder (1. Filialgeneration) ihrerseits Kinder bekommen (2. Filialgeneration). Das ist vor allem dann interessant, wenn die ursprünglich ins Visier genommenen Erbelemente der Eltern (Parentalgeneration) zwischen Mann und Frau so verschieden sind, dass sie zu deutlich sichtbaren Unterschieden führen – etwa roten oder weißen Blüten bei den Erbsen oder weißen und roten Augen bei Fliegen. Mendels zweite Regel besagt, dass sich die Gene auf dem Weg in die 2. Generation so unabhängig voneinander trennen können, wie sie vorher zusammengefunden haben. Man spricht in den Schulbüchern etwas unglücklich von der Spaltungsregel und nutzt sie aus, um Mendels Regeln mit Zahlen auszustatten und ihnen so den Anschein eines Naturgesetzes zu geben.
Wenn die zwei Erbelemente, über die jemand für ein und dasselbe Merkmal – etwa eine Farbe oder eine Größe – verfügt, verschieden sind, wird gewöhnlich nur eines von den Genen sichtbare Spuren zeigen. Mendel bezeichnete dessen Form als dominant und den unterlegenen Partner als rezessiv. In diesem Fall kommt in der 2. Filialgeneration ein Verhältnis der beiden Eigenschaften von 3:1 zum Vorschein – das dominant vererbte Merkmal wird dreimal so häufig sichtbar wie das rezessive Gegenstück, da es bei vier möglichen Kombinationen nur eine gibt, in der beide rezessiven Gene zusammenkommen.
Bislang haben wir den Erbgang von einem Gen und dem dazugehörigen Merkmal betrachtet. Es gibt noch eine dritte Mendelsche Regel und die erfasst die Vererbung von zwei solchen Elementen. Sie besagt in aller Kürze, dass es dabei erneut unabhängig zugeht. Das bedeutet, dass in den Filialgenerationen alle möglichen Kombinationen auftreten können. Welche Erbelemente der Eltern in einem Kind auftauchen, kann theoretisch ermittelt werden, wenn man jede mögliche Kombination als gleich wahrscheinlich ansieht.
Um Mendels Regeln der Vererbung aufschreiben und verstehen zu können, ist es nötig, seine bemerkenswerte Unterscheidung zwischen dominanten und rezessiven Eigenschaften zu beachten, wie sie im Text erläutert wird. In der traditionellen Darstellung drückt man ein dominantes Gen durch einen großen und ein rezessiv wirkendes Gen durch einen kleinen Buchstaben aus – A und a, wobei das Gen A zum Beispiel zu heller und das Gen a zu dunkler Blütenfarbe führen kann. Mendels erste Regel besagt nun, dass dann, wenn ein Organismus mit zwei Kopien eines dominanten Gens (AA) und ein Organismus mit zwei Kopien einer rezessiven Variante (aa) Nachwuchs produzieren, dort stets die Kombination (Aa) zu finden ist. Es kommt also zu einer Vermischung der Erbelemente namens Gene. Mendels zweite Regel erfasst den Fall, dass zwei Partner mit der Kombination (Aa) Nachwuchs haben. Die Beobachtungen lassen erkennen, dass sich die Gene trennen und im Nachwuchs auf alle möglichen Weisen zusammenfinden können – AA, Aa, aA und aa. Die Gene agieren wie unabhängige Elemente, die sich alleine auf den Weg in die nächste Generation machen und dort wieder verbinden können.
Insgesamt weisen Mendels Regeln auf so etwas wie frei bewegliche Erbelemente hin, die sich in allen Kombinationen erst mischen und dann wieder trennen können, ohne an einem Gängelband zu hängen. Dies stimmt aber nur sehr grob, wie die moderne Molekularbiologie nach und nach aufdecken konnte. So befinden sich viele Gene hintereinander auf zellulären Strukturen, die als Chromosomen bekannt sind. Das belegen Versuche ab 1910, die zuerst von Thomas H. Morgan mit Fliegen durchgeführt wurden und die einen staunen lassen. Irgendwie ist es Mendel gelungen, bei seinem Versuchsobjekt, der Erbse, gerade solche Gene in Augenschein zu nehmen, die auf verschiedenen Chromosomen liegen. Erbsen verfügen über sieben solcher gentragenden Strukturen, und Mendel hat genau sieben Eigenschaften seines Versuchsobjekts analysiert. Da hat der Mönch wohl sehr viel Glück gehabt, wie wir einmal annehmen wollen. Auch was die Qualität seiner mitgeteilten Zahlen angeht, kann man nur staunen. Allerdings lässt die Genauigkeit, mit der Mendels Daten zu den nach ihm benannten Regeln passen, inzwischen viele Statistiker skeptisch dreinblicken und den Verdacht äußern, dass da jemand bereits vor den Kreuzungsversuchen wusste, was am Ende dabei herauskommen sollte. Es ist eben eine uralte Streitfrage bei der Wissenschaft – bestimmt die Theorie das Experiment oder das Experiment die Theorie? Wer kann das schon allgemein wissen?
Der Physiker Mendel
Kurioserweise hat der als Vater der Genetik gefeierte Augustinermönch Mendel keine Ausbildung in Biologie, sondern in Physik erhalten. Der Abt des Klosters, in das Mendel 1843 als Novize eingetreten war, hatte ihn dazu ausersehen, Physiklehrer zu werden. Und so schickte man ihn auf die Universität nach Wien. Vermutlich litt Mendel unter Prüfungsangst, denn die Lehrerprüfung hat er gleich zweimal nicht bestanden. Das Kloster gab ihm daraufhin die Möglichkeit, seiner zweiten Leidenschaft neben der Wissenschaft zu frönen, der Gärtnerei. Mit ihr war Mendel von seinem Elternhaus her vertraut, und hier im Klostergarten vereinte er das praktische Wissen und Können eines Gärtners mit den theoretischen Vorgaben und Konzeptionen der exakten Wissenschaft, die begonnen hatte, die Gegenstände durch ihre atomaren Bestandteile zu verstehen. Dieses Vorgehen hatte der ehemalige Physikstudent verinnerlicht. Er wusste, wie Experimente am besten durchzuführen sind, nämlich so, dass man möglichst viele Bedingungen konstant hält und den Einfluss eines Parameters untersucht, den man variiert. Bei Gasen etwa hält man das Volumen und den Druck konstant und prüft, was passiert, wenn man die Temperatur ändert.
Um Experimente dieser Art an lebenden Objekten wie Erbsen durchführen zu können, benötigte Mendel Pflanzen, die sich treu reproduzieren – »reine Linien« erzeugen, wie man sagt – und die er dann mit anderen kreuzen konnte. Daher bestand Mendels erste Tätigkeit zur Vorbereitung seiner Versuche darin, über viele Jahre hinweg von durchreisenden Händlern die geeigneten Erbsensorten zu erwerben und anzubauen. Dies tat er so lange, bis er ausreichend viele reine Sorten zusammenhatte, die er umfassend kreuzen und damit den Weg einer Variante verfolgen konnte – die Farbe der Hülsen, die Form der Schoten und die Anordnung der Blüten. Mendels Beobachtung bestand dann im Zählen. Und mit den Zahlen wurde aus einer bis dato nur qualitativ betriebenen Biologie eine quantitative Wissenschaft, die es mit der Physik aufnehmen wollte.
Was nun bei Mendels langjährigen botanischen Versuchen herauskam, lässt sich ganz einfach ausdrücken: Mendel hat die Hypothese aufgestellt und einer experimentellen Prüfung zugeführt, dass es im Inneren der Pflanzen konkrete »Elemente« gibt, deren »lebendige Wechselwirkung«, wie er es nennt, die Qualitäten hervorbringt, die wir außen wahrnehmen können. Modern ausgedrückt hat Mendel entdeckt, dass Vererbung mit Partikeln (Elementen) erfolgt, es also Atome der Vererbung gibt. Wir nennen sie heute Gene.
Mehr zu Mendel
Wir wissen und lernen heute viel über Gene und Genetik, aber kennen wir auch den Mann, mit dem dies alles begonnen hat? Man darf sich auf keinen Fall vorstellen, dass Mendel nur gearbeitet und ein völlig von der Außenwelt abgeschnittenes Leben im Kloster geführt hat. Er hat die Mauern, die seinen Garten umgaben, oft verlassen und sich viel im Ausland umgesehen. 1862 zum Beispiel war er in Paris und London, um Industrieausstellungen zu besuchen, und mehrfach nahm er an der »Wanderversammlung Deutscher Bienenwirte« teil – schließlich hatte er neben der Physik und seinen Studien zur Vererbung noch eine weitere Leidenschaft, die der Imkerei.
Eine Gelegenheit, den Menschen hinter der Arbeit kennenzulernen, liefert eine Biografie der Wissenschaftsjournalistin Robin M. Henig. Sie erzählt, warum Mendel ins Kloster ging, welche Reisen er unternehmen durfte, welches Studium er absolvierte, weshalb ihn Steuerforderungen an das Kloster wütend machten, mit wem er korrespondierte, wie sein Leibesumfang zunahm und vieles mehr. Henig beschreibt nicht nur ausführlich Mendels Versuche, mit denen er sogar gefährliches Territorium betrat, weil es dabei um Sex ging und er seinen geistlichen Brüdern und Schülern das Geschlechtsleben der Pflanzen erklären musste. Henig verfolgt auch die langfristige Wirkung von Mendels Versuchen. Sie schildert die Wiederentdeckung seiner Beobachtungen und arbeitet die unterschiedlichen Motive der Wissenschaftler heraus, die daran beteiligt waren. Und sie stellt dar, warum Mendels Ergebnisse sogleich in der englischsprachigen Welt auftauchten und auf diese Weise dafür gesorgt wurde, dass im 20. Jahrhundert gerade dort die neue Genetik aufblühte, die das untersucht, was heute im Internet unter Mendelian Inheritance of Man (MIM) gegoogelt werden kann.
Wir erfahren sehr viel über den Mönch im Garten, allerdings ist die Autorin – wie übrigens alle anderen Mendel-Biografen auch – gezwungen, unentwegt Mutmaßungen anzustellen. »Vielleicht ist Mendel«, »wahrscheinlich hat er«, »wir können uns vorstellen« und »es mag sein« – Formulierungen wie diese sind dauernd zu lesen. Wir wissen vieles einfach nicht und müssen uns ausmalen, wie zum Beispiel seine heute berühmten Vorträge bei den rund 40 Zuhörern angekommen sind. Es ist denkbar, dass die wenigsten verstanden haben, was er wollte, und die Mehrzahl im Saal langsam eingenickt ist, als Mendel die endlos langen Zahlenkolonnen vorlas, mit denen er seine Erbsenkinder und ihre Eigenschaften erfasst hatte. Aber, wie gesagt, wir wissen es einfach nicht, denn die Quellenlage ist äußerst unbefriedigend. Von Mendel ist nur wenig überliefert, was konkret ein paar Schriften und ein paar Briefe meint. Als er starb, hat man im Kloster gründlich aufgeräumt und alles verbrannt, was sich in seinen Unterlagen fand. Im Gegensatz zu seinem Zeitgenossen Charles Darwin (1809–1882), dessen Gesamtwerk fast nur in Regalmetern zu erfassen ist, liegen uns von Mendel nicht viel mehr als die 44 Seiten vor, auf denen er seine Versuche mit Pflanzen-Hybriden beschreibt. Es geht dabei um die Erbse, die Botaniker unter dem lateinischen Namen Pisum sativum kennen. Unglücklicherweise stellt Mendel seine Ergebnisse in einer Weise vor, die alles andere als leicht verständlich ist. Zum Beispiel heißt es dort: »Sind mehrere differirende [sic!] Merkmale durch Befruchtung in einer Hybride vereinigt, so bilden die Nachkommen derselben die Glieder einer Combinationsreihe, in welcher die Entwicklungsreihen für je zwei differirende [sic!] Merkmale vereinigt sind.«
Diese merkwürdig ausgedrückte Einsicht nennen die Lehrbücher heute die freie Kombinierbarkeit der Merkmale. Doch selbst wem nun in Mendels Satz jetzt irgendwie einleuchtet, was »für je zwei differirende Merkmale« bedeutet (etwa für die Farbe und Form der Samen), der wird spätestens im Originaldokument Verständnisprobleme bekommen. Denn dem Text ist zur Illustration eine Art algebraische Formel beigegeben, die in Worte zurückübersetzt nur als »je ein (verschiedenes) Merkmal eines Paares« gelesen werden kann und somit etwas anderes aussagt. In der ersten englischen Übersetzung von 1902 steht dagegen »each pair of differing traits«, was nicht nur die Sache klarstellt, sondern zugleich verständlich macht, warum angelsächsische Autoren seit mehr als 100 Jahren Mendel loben und als Vater der Genetik feiern. Ihnen blieb das Original erspart – ein Umstand, der nach dem Aufschwung der modernen Molekularbiologie sogar dazu geführt hat, dass Briten und Amerikaner in ihrer Bewunderung die Landsleute Mendels weit übertreffen. Wenn Vererbung etwas Biologisches meint, spricht man in England und den USA ganz selbstverständlich von Mendelian inheritance, vererbbare Eigenschaften heißen Mendelian traits, und wer ihre Wanderung durch die Generationen mit den Augen des Mediziners erforscht, kümmert sich vor allem um Mendelian diseases, um Erbkrankheiten.
Mendels angelsächsische Verehrung rührt folglich daher, dass es jemanden gegeben hat, der rund vier Jahrzehnte nach Mendels Präsentation seiner umständlichen Versuche über Pflanzen-Hybriden den Text ins Englische übertragen hat. Das war der Naturforscher William Bateson (1861–1926). Als dieser sich an Mendels Text machte, konnte er die Erfahrungen nutzen, die in den vorhergehenden Jahrzehnten von den Biologen gesammelt worden waren. Auf diese Weise war er in der Lage, Unklarheiten im Deutschen in englische Klarheiten zu verwandeln, wie oben an einem Beispiel gezeigt worden ist. Bateson ist damit gelungen, was sonst kaum zu schaffen ist, nämlich die Verbesserung des Originals durch eine Übersetzung. Diese Arbeit konnte nur ein großer Kenner der damaligen Genetik erledigen, die sich gerade anschickte, eine moderne Wissenschaft zu werden.
Denn dies war sie vorher bei Weitem nicht. Die Wissenschaftler, die vor Mendels Zeit Pflanzen kreuzten, zeigten keineswegs dieselbe rationale Grundhaltung zur Wissenschaft, wie sie heutigen Genetikern zu eigen ist. Der von Mendel ausführlich gelesene und zitierte Joseph Kölreuter (1733–1806), der gerne als Begründer »einer systematischen und experimentellen Erforschung von Pflanzen« gefeiert wird, agierte in Wahrheit als Alchemist. Wenn Kölreuter im 18. Jahrhundert Pflanzen kreuzte und Bastarde erzeugte, hatte er eine mysteriöse Verwandlung des Lebens im Sinn. Er meinte, damit »ebenso viel geleistet zu haben, als wenn ich Bley in Gold, oder Gold in Bley verwandelt hätte«, wie er 1764 schrieb.
Mendels wissenschaftliche Unterweisung muss sich wenigstens zum Teil in solch einem Klima vollzogen haben, in dem erst allmählich der Gedanke auftauchte, dass neues Leben weniger erzeugt und dafür mehr reproduziert wird. Nur von diesem Standpunkt aus kann man den Vorgang der Vermehrung wissenschaftlich ins Auge fassen: als Reproduktion und nicht als Kreation.
Der doppelte Bruch
Wer amerikanische Genetiker fragt, worin Mendels Leistung besteht, bekommt eine klare Antwort. Sie lautet sinngemäß: Mendel hat entdeckt, dass Vererbung partikulär funktioniert, und er hat vor allem Zahlen und mit ihnen die Regeln der Wahrscheinlichkeit in das Botanische gebracht.
Damit hat der wissbegierige Mönch einen doppelten Bruch im traditionellen Denken vollzogen. Fortan bemühte man sich, biologische Phänomene mit mathematischer Genauigkeit zu erfassen, ohne dabei zu erwarten, dass die ermittelten Zusammenhänge jeden Einzelfall festlegen. Vielmehr rechnete man damit, nur statistische Gesetze zu finden.
Die Einsicht, dass unsere Erbanlagen nicht flüssig sind wie etwa Blut, sondern körnig daherkommen wie Sand, mag banal klingen, stellt aber in der Geschichte des Denkens eine Revolution dar. Wie radikal neu diese Einsicht ist, wird mit Blick auf die Medizin schnell klar. Dort wurde lange Zeit angenommen, dass die Gesundheit eines Menschen durch Flüssigkeiten bestimmt wird. Deshalb wurden Kranke ja auch oft mit Einläufen und Aderlässen behandelt. Und was die Vererbung angeht, so sprechen wir heute noch von der Blutsverwandtschaft oder sagen zu unseren Kindern: »Du bist von meinem Fleisch und Blut«.
Natürlich wussten die Menschen vor Mendel, dass es Eigenschaften gibt, die in Familien weitergegeben, also vererbt werden – beispielsweise die Lippenform oder die Farbenblindheit. Aber man hatte keinerlei Vorstellung von den zugrunde liegenden Mechanismen, und völlig rätselhaft war, wie ein Vater seine Eigenschaften weitergeben konnte. Wie kam seine Augenfarbe oder seine Nasenform in die Samenflüssigkeit, mit deren Hilfe er Kinder zeugte?
Mendels Entdeckung von partikulären Erbelementen mit statistischen Eigenschaften beantwortete Fragen dieser Art keineswegs, aber sie gab immerhin schon mal einen wichtigen Hinweis, der für den Fortgang der Wissenschaft entscheidend war. In der Wissenschaft darf man im Übrigen nie erwarten, mit einer Einsicht alles zu erklären. Es reicht, wenn man eine Frage beantworten kann – in Mendels Fall einige Regelmäßigkeiten im Erbgang –, und man muss auch damit rechnen, dass aus verschiedenen Ecken Kritik an der erworbenen Erkenntnis laut wird. Und die gab es reichlich selbst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als gleich mehrfach bestätigt wurde, was Mendel erkannt hatte: nämlich dass es teilchenartige Erbelemente geben muss, die sich mehr oder weniger unabhängig voneinander bewegen und sich auf dem Weg in die nächste Generation so zufällig mischen, wie es die Karten beim Skatspiel tun.
Die Hauptkritik an Mendels biologischen Atomen oder Erbelementen kam von Wissenschaftlern, die sich um die Entwicklung des Lebens kümmerten und dabei verfolgten, wie sich die lebende Form ändert, wenn aus einer Eizelle erst ein Embryo, dann ein Fötus und zuletzt ein neugeborenes Lebewesen wird. Diese Embryologen konnten den Formenreichtum der Natur nur bewundern, und der Gedanke erschien ihnen absurd, eine derartige Pracht und Vielfalt durch irgendwelche einfältigen Partikel erklären zu wollen. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass die kleinen Kügelchen, von denen Mendel gemurmelt hatte, irgendeine Relevanz für die komplexen Gestalten der Organismen haben sollten.
Das war damals ein gutes Argument, und wenn man will, kann man in diesen beiden Positionen ein Gegenüber von zwei Wissenschaftsauffassungen sehen: Mendels statische Elemente auf der einen und die genetische Dynamik des Embryos auf der anderen Seite. Mendel und seine Anhänger erklärten das Leben als Physiker von seinen Teilen her (bottom-up), während die Embryologen ihr Augenmerk auf Ganzheiten und Gestalten richteten und ihnen alles andere unterordneten (top-down). Dabei hatten sie alles Mögliche im Sinn, nur keine Physik.
Die Rolle der Physik
Die Physik stellt ohne Frage die erfolgreichste aller exakten Wissenschaften dar, und zu ihren großen Triumphen im 19. Jahrhundert zählt die Fähigkeit, bis zu diesem Zeitpunkt unverstandene Erscheinungen wie Wärme oder Druck durch die Bewegung und die Wechselwirkung von kleinen Teilchen erklären zu können. Diese kleinen Teilchen nannte man Atome. Heute wissen wir längst, dass Atome teilbar sind, dass sie einen Kern und eine Hülle haben, und noch viel mehr. Zu Mendels Lebzeiten konnte man nur die Hypothese vertreten, dass es Atome gibt, und wenn man sich überhaupt eine Vorstellung von ihrem Aussehen machte, dann dachte man an kleine Kügelchen, die hart aufeinanderprallen.
Wie erwähnt: Nachdem Mendel ins Kloster eingetreten war, schickte man ihn nicht gleich in den Garten, sondern erst auf die Universität, damit er dort Physik studieren und Lehrer für dieses Fach werden konnte. Letzteres hat Mendel zwar nicht geschafft, aber Physik hat er immerhin studiert. Somit musste er sich zwangsläufig mit dem damals aktuellen Denken auseinandersetzen, das alles aus unteilbaren Atomen aufbaute. Als Mendel, der ohne Diplom kein Lehrer werden konnte und deshalb irgendwann eine Tätigkeit im Klostergarten zugewiesen bekam, beim Unkrautzupfen ins Sinnieren fiel, muss ihm der Gedanke gekommen sein, dass nicht nur die tote Materie der Physik, sondern auch der lebendige Stoff des Lebens aus kleinsten Einheiten, aus Atomen der Vererbung, aufgebaut sein könnte. Seiner Meinung nach musste es Erbelemente geben, und von denen konnte er sich vorstellen, dass sie – mit seinen Worten – »in lebendiger Wechselwirkung« zu den Eigenschaften der Organismen führen, die wir beobachten und eventuell zu fördern wünschen.
Eine These zu formulieren ist eine Sache, sie zu beweisen eine andere. Was sollte Mendel tun, um seine Idee zu untersuchen? Er musste auf jeden Fall völlig anders vorgehen als die Biologen seinerzeit. Ein Biologe nahm sich in der Regel eine einzelne Pflanze vor und beschrieb bewundernd möglichst viele ihrer Merkmale. Ein Physiker – und Mendel war nun mal einer – geht genau anders herum vor. Er sucht sich ein Merkmal aus – etwa die Blütenfarbe oder die Samenform – und fragt, wie es sich bei sehr vielen Pflanzen einer bestimmten Art ausbildet und verteilt. Das heißt, er ändert im Experiment nur einen und nicht zwei oder mehrere Parameter, um dann diesen einen Messwert (Blütenfarbe, Samenform etc.) an vielen Exemplaren zu studieren. In diesem Sinne stellen Mendels Versuche über Pflanzen-Hybriden eine typische Experimentalreihe der Physik seiner Zeit dar.
Die Teile und das Ganze
Es mag vielleicht beim ersten Lesen zu einfach klingen, aber ein Verständnis für die Wissenschaften und ihre Entwicklungen wird insgesamt leichter möglich, wenn man sich auf eine saubere Unterscheidung einlässt: Es gilt, zwischen einzelnen Teilchen und dem zusammenhängenden Ganzen sorgfältig zu trennen und beide Aspekte gleichberechtigt gelten zu lassen. Dazu muss man die dazugehörigen Spannungen im Denken aushalten.
Wer etwa die Luft ins Auge fasst, die er einatmet, oder das Wasser betrachtet, das er trinkt, wird selbst im 21. Jahrhundert zunächst in beidem die einheitlichen (durchgängigen, kontinuierlichen) Elemente sehen. Nicht anders die antiken Philosophen seit Platon; sie setzten das Ganze der Welt aus vier Elementen – Feuer, Erde, Wasser, Luft – zusammen, die selbst nicht als zusammengesetzt, also als unzerlegbar, angesehen wurden. Es gehört schon eine ziemliche gedankliche Anstrengung dazu, die durstlöschende Flüssigkeit oder das lebensnotwendige Ganze der atmosphärischen Gasmischung als eine Ansammlung von Teilen zu deuten, die uns als Moleküle vorgestellt werden und H2O, H2 (Wasserstoff), O2 (Sauerstoff) oder anders heißen. Die physikalischen und chemischen Wissenschaften haben also ihre Zeit gebraucht, um einzusehen, dass und wie das anschauliche Ganze aus unanschaulichen Teilen gebildet wird. Die Wissenschaften, die sich mit organischen Dingen beschäftigen, bilden da keine Ausnahme. Ihre Vertreter entdeckten zum Beispiel in den 1830er-Jahren, dass Organismen und ihre Organe aus Zellen gebildet werden, dass also das jeweilige Ganze aus Teilen besteht. Wer diese weitreichende Erkenntnis heute als langweilig abtut und kaum noch beachtet, verschenkt zum einen eine gute Gelegenheit zum Staunen – es ist doch wahrlich verwunderlich, dass etwa mein Auge oder die Schnecke in meinem Ohr aus individuellen Zellen errichtet sein soll, die zudem alle aus einer einzigen solchen Einheit hervorgegangen sind –, und er verpasst zum Zweiten einen allgemeinen Zug der wissenschaftlichen Entwicklung. Wenn Organismen aus Organen und Organe aus Geweben und Gewebe aus Zellen bestehen, dann kann man weiterdenken und das Ganze der zuletzt aufgeführten Lebenseinheit auch aus Teilen zusammengesetzt denken, wobei an dieser Stelle keineswegs das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Auch die Bestandteile von Zellen können wieder aus Teilen bestehen, die erneut aus kleineren Einheiten zusammengesetzt sind. Die Geschichte der genetischen Wissenschaft führt nicht nur Schritt für Schritt zu diesen hin, sie kommt dabei auch an ein Ende der Teilung, wie im Verlauf dieses Buches erzählt wird. Natürlich gelangt sie dabei nicht gleichzeitig an ein Ende der Wissenschaft selbst. Diese orientiert sich jetzt vielmehr neu. Doch dazu später.
Es lohnt sich auf jeden Fall immer, auf das unauflösbare und unaufhebbare Wechselspiel von einem Ganzen und seinen Teilen zu achten. Nur so kann man verstehen, womit sich eine Wissenschaft beschäftigt und wie sie akzeptiert und verstanden wird. Dieser Gedanke gehört zur Biologie, seit entdeckt wurde, dass das (ganze) Leben aus (einzelnen) Zellen besteht. Jede dieser Zellen, so sagten bereits deren Entdecker, führt »ein zweifaches Leben«, nämlich eines als eigenständiges Gebilde und ein zweites als Mitglied eines größeren Verbandes, der als Gewebe oder Organ erscheint. Und mit dieser Vorbemerkung kann man sagen, dass Mendel unterhalb der Zelle ein weiteres Gebilde mit einem zweifachen Leben entdeckt hat. Die Gene stellen sowohl eigenständige Gebilde dar, die heute von einer molekularen Forschung erkundet werden, als auch Bausteine des Lebensganzen, das sie trägt und mit sich führt. Mendels Versuche zeigen uns, dass es Teile in den Zellen von Organismen gibt, die eine Vererbung des Ganzen bewirken, das wir etwa in Form einer Erbsenpflanze vor uns haben. Vererbung funktioniert mit »Erbelementen« oder »Faktoren«, wie Mendel es formuliert hätte, und es ist dieser Gedanke, der seinen Zeitgenossen Probleme bereitete. Sie konnten sich mit ihm erst nach 1900 anfreunden und dann das bewerkstelligen, was die Schulbücher zwar gerne und rasch die Wiederentdeckung der Mendelschen Regeln für die Vererbung nennen, was aber tatsächlich die Akzeptanz des Gedankens darstellt, dass sich partikuläre Erbfaktoren nachweisen und zählen lassen.
Viele Genetiker aber lehnten selbst nach 1900 noch die Ideen einer partikulären Vererbung ab, die sie als Mendelismus verspotteten. Sie konnten sich schlichtweg keine Erbelemente vorstellen. Ihnen erschien es absonderlich und ausgeschlossen, dass man das komplexe und verwobene Ganze einer lebendigen Gestalt mithilfe von winzigen und sicher formlosen Teilen (Teilchen) herbeizaubern könnte. Konkret dachten sie vielmehr an die vielen Mischmöglichkeiten von Flüssigkeiten wie etwa Blut, und so dauerte es lange und benötigte überzeugende Experimente, um Mendels festen Erbelementen im Inneren der Zellen umfassend Anerkennung zu verschaffen.
Die Biologie steht mit ihrer anfänglichen Erkenntnisverweigerung nicht allein. Es dauerte in der Physik ja auch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, bis sich der Gedanke allgemein durchsetzte, dass Gase, Flüssigkeiten und feste Körper aus Atomen und aus ihnen zusammengesetzten Molekülen bestehen. Das heißt: Als die Biologen Mühe mit Mendels Erbteilchen in den Erbsen hatten, weigerten sich gleichzeitig auch viele Physiker, in ihrer Disziplin atomistisch zu denken, wie man heute sagt. Tatsächlich konnte niemand direkt beweisen, dass es die diskreten Teilchen der Materie, die Atome, gab. Der berühmte philosophierende Physiker Ernst Mach wollte daher von ihrer Existenz nichts wissen. »Haben Sie schon ein Atom gesehen?«, pflegte er seine anders denkenden Kollegen zu fragen. Er hätte sich damals ebenso gut unter die Biologen mischen und sich erkundigen können: »Haben Sie schon ein Erbelement gesehen?«
Atome des Lebens
Geschult durch sein Physikstudium, war Mendel das atomistische Denken vertraut und die Vorstellung von Teilen (Elementen) in einem Ganzen selbstverständlich. Letztere hielt er sogar für das einzig probate Mittel, um die Ergebnisse seiner eigenwilligen Gartenarbeit zu deuten. Diese bestand zunächst darin, zahlreiche Variationen (»Varietäten«) von Erbsen zu erwerben, die ihm verschiedene Züchter anboten, um sie untereinander zu kreuzen. Die Resultate betrachtete er nicht mit den Augen von Züchtern, die nach (kontinuierlichen) Mischungen Ausschau hielten. Er betrachtete sie mit den Augen eines Physikers, der sich vorstellte, dass es im Inneren der lebenden Materie Grundbestandteile (»Elemente«) gibt, die den Atomen im Inneren der toten Materie entsprechen. Mendel nahm an, dass die vererbbaren Eigenschaften der blühenden Pflanzen durch »lebendige Wechselwirkung« dieser »Elemente« zustande kommen. Erbsen, die sich in diesen Atomen des Lebens unterschieden, zeigten unterschiedliche Qualitäten, und zwar von Generation zu Generation, wie die nachwachsenden Generationen im Klostergarten zeigten.
Heute können wir diese Einsicht mit den Worten beschreiben, dass Mendel die Gene gefunden hatte, und er stellte sie sich tatsächlich so wie Atome vor, nämlich als unteilbare, unangreifbare und unsichtbare Größen im Inneren der (lebendigen) Körper oder ihrer Zellen. Das Einzige, was man tun konnte, bestand darin, sie zu zählen, und zu diesem Zweck unternahm Mendel seine Versuche. Doch diese fanden noch vor einem anderen Hintergrund statt, der leicht übersehen wird, weil er für uns inzwischen selbstverständlich geworden ist. Gemeint ist die Tatsache, dass es bei dem Zusammenspiel vieler Teile (Teilchen) nicht klar geregelt, sprich deterministisch, zugeht, sondern dass man zur Erfassung des Sachverhalts statistisch vorgehen und mit Wahrscheinlichkeiten rechnen muss. Das musste in den Tagen von Mendel aber erst einmal verstanden und verdaut werden.