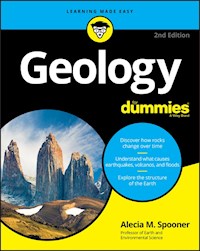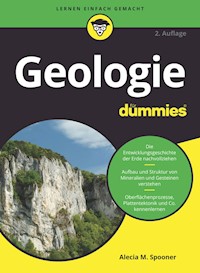
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH GmbH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: ...für Dummies
- Sprache: Deutsch
Eiszeiten, Vulkanismus, Erosion, Meteoriteneinschläge - unser Planet hat in seiner Geschichte schon einiges mitgemacht. Und so vielgestaltig die Erde aussieht, so umfangreich und komplex ist auch das Thema Geologie. Aber keine Sorge, Alecia Spooner erklärt Ihnen leicht verständlich alles Wichtige, was es zum Thema Geologie zu wissen gibt: von den chemischen Grundlagen und der Bedeutung von Wind und Wasser für die Geowissenschaften bis zur Bildung und Bestimmung von Gesteinen. Sie erfahren alles Wissenswerte zu Konvektion, Plattentektonik, Mineralien, Fossilien, Erdbeben, Oberflächenprozessen, den geologischen Zeitaltern und vieles mehr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Geologie für Dummies
Schummelseite
GEOLOGISCHE ZEITSKALA
Alle Altersangaben in Millionen Jahren vor heute
DER GESTEINSKREISLAUF
DER SCHALENBAU DER ERDE
Geologie für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
2. Auflage 2023
© 2023 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Original English language edition Geology for Dummies © 2020 by Wiley Publishing, Inc. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Copyright der englischsprachigen Originalausgabe Geology for Dummies © 2020 by Wiley Publishing, Inc. Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Diese Übersetzung wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: Schlesier – stock.adobe.comKorrektur: Claudia Lötschert
Print ISBN: 978-3-527-72062-0ePub ISBN: 978-3-527-84221-6
Über die Autorin
Alecia M. Spooner unterrichtet seit vielen Jahren verschiedene Geo- und Umweltwissenschaften. Sie hat Universitätsabschlüsse in Anthropologie (University of Mississippi, Bachelor), Archäologie (Washington State University, Master) und Geologie (University of Washington, Master). In ihrer Forschung befasst sie sich mit fachübergreifenden Themen aus Paläoökologie, Paläoklimatologie und Archäologie. Derzeit unterrichtet sie am Everett Community College und widmet sich der Entwicklung wissenschaftlicher Lehrpläne auf Grundlage von aktiven Lernmethoden. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Shoreline im US-Bundesstaat Washington.
Widmung
Dieses Buch ist meinen Lehrern und meinen Schülern gewidmet.
»Es gibt nichts, wovor man sich im Leben fürchten müsste, man muss es nur verstehen. Jetzt ist die Zeit, um mehr zu verstehen, damit wir uns weniger fürchten mögen«
Marie Curie
Danksagung der Autorin
Dieses Buch wäre ohne die Unterstützung von folgenden Menschen nicht zustande gekommen: Igor Tatarinov, mein Ehemann, der einen überproportionalen Teil der Kinderbetreuung übernahm, damit ich meine Abende und Wochenenden mit Schreiben verbringen konnte (ich liebe Dich), meine beiden Jungs, die in mir jeden Tag den Sinn für die Wunder der Welt und die Ehrfurcht vor diesen neu wecken, und die Menschen, die mir dabei halfen, meine eigene Welt nicht aus dem Blick zu verlieren und mich nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Dank an meine Familie für die unendliche Unterstützung, an meine Freunde, die keine Sekunde daran gezweifelt haben, dass ich dieses Buch fertigstellen würde, für – Ihr wisst schon – Eure Freundschaft, an Heather, Jessica, Alison, Julie und Beckie, die meine Kinder genauso lieben wie ich, an Jani und Kysa, die das Chaos unter Kontrolle hielten, an meinen Bruder Kyle, der mit mir unendlich viele Sommer lang »Schule spielte«, sodass ich meine Tätigkeit als Lehrerin bereits in unserer Kindheit üben konnte, an meine wissenschaftlichen und unterrichtenden Kollegen und Mentoren, von denen ich jeden Tag so viel lernen konnte, an meinen Agenten Matt Wagner, mit dem es einfach Spaß machte zu arbeiten, und an Joan Friedman, die wohl beste Lektorin der Welt (die auch versteht, dass kranke Kinder einen kleinen Aufschub des Abgabetermins rechtfertigen). Euch allen herzlichen Dank.
Über die Übersetzerin
Dr. Ilona Hauser promovierte im Fach Geologie-Paläontologie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie arbeitet als Museumspädagogin im Senckenberg Naturmuseum Frankfurt. Daneben ist sie als Übersetzerin naturwissenschaftlicher Fachbücher in den Bereichen Geologie, Paläontologie und Evolutionsbiologie tätig und digitalisiert zur Entspannung alte geologische Bohrdaten.
Über den Fachkorrektor
Dr. Christian J. Nyhuis promovierte an der Universität zu Köln im Fach Geologie-Paläontologie. Derzeit arbeitet er als wissenschaftlicher Leiter der Galileo-Wissenswelt auf der Ostseeinsel Fehmarn. Neben der Wissenschaftspopularisierung gilt sein Interesse insbesondere der Paläontologie und Sedimentologie des oberen Paläozoikums sowie der Paläoökologie mesozoischer Wirbeltiere.
Über die Bearbeiterin der 2. Auflage
Dr. Sonja L. Philipp promovierte im Fach Geologie an der Universität Bergen, Norwegen. Sie war Juniorprofessorin im Fachbereich Strukturgeologie an der Georg-August-Universität Göttingen und ist dort heute außerplanmäßige Professorin. Sie lebt in Frankfurt am Main, leitet als freiberufliche Geologin Exkursionen und Kurse und unterrichtet am Gymnasium. Neben Angewandter Geologie und Tektonik interessiert sie sich besonders für die Regionale Geologie von Island und Deutschland und bloggt auf geophil.net über diese Themen.
Für die 2. Auflage hat Sonja Philipp einen gesamten neuen Teil zur regionalen Geologie, insbesondere von Deutschland, hinzugefügt sowie eine frühere Top-Ten-Liste über geologische Gefahren in eine umfangreiche Liste über angewandte Geologie umgewandelt. Weiterhin hat sie den gesamten Inhalt aktualisiert, korrigiert und an einigen Stellen ergänzt.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autorin
Widmung
Danksagung der Autorin
Über die Übersetzerin
Über den Fachkorrektor
Über die Bearbeiterin der 2. Auflage
Einführung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Was Sie nicht lesen müssen
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I: Das Studium der Erde
Kapitel 1: Steine – nicht nur was für Sammler
Entdecken Sie den Forscher in sich
Bildung und Umbildung von Gesteinen
Plattenbewegung in Slow Motion
Die Reise der Gesteine über die Erdoberfläche
Die lange Geschichte der Erde verstehen
Die Verteilung der Gesteine verstehen
Kapitel 2: Die Erde durch die wissenschaftliche Brille betrachtet
Wissenschaft ist nicht nur etwas für Wissenschaftler
Ein methodischer Ansatz: Die wissenschaftliche Methode
Das A und O: Eine wissenschaftliche Theorie
In fremden Zungen reden: Warum Geologen eine andere Sprache zu sprechen scheinen
Kapitel 3: Von jetzt an bis in alle Ewigkeit: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus geologischer Sicht
Eine Katastrophe nach der anderen
Frühe Annahmen über die Entstehung von Gesteinen
Die Entwicklung des modernen geologischen Verständnisses
Aktua-was? Die Erde mithilfe des Aktualismus verstehen
Alles in Zusammenhang bringen: Die Theorie der Plattentektonik
Zu neuen Grenzen vorstoßen
Kapitel 4: Trautes Heim: Planet Erde
Die Sphären der Erde
Untersuchung der irdischen Geosphäre
Teil II: Elemente, Minerale und Gesteine
Kapitel 5: Von elementarer Bedeutung: Eine sehr kurze Einführung in die Chemie der Elemente und Verbindungen
Die kleinste Materie: Atome und Atomstruktur
Freunden Sie sich mit dem Periodensystem an
Chemische Bindung für Anfänger
Verbindungen in chemischen Formeln ausdrücken
Kapitel 6: Minerale: Die Bausteine der Gesteine
Anforderungen an ein Mineral
Kristalle formen
Minerale mithilfe ihrer physikalischen Eigenschaften bestimmen
Silikate: Die häufigsten Minerale in Gesteinen
Nicht zu vergessen: Nichtsilikate
Edelsteine
Kapitel 7: Gesteine bestimmen: Magmatite, Sedimentite und Metamorphite
Auskristallisiert – so oder so: Magmatite
Eine Vereinigung vieler einzelner Sandkörner: Sedimentgesteine
Irgendwas dazwischen: Metamorphite
Eine Reise durch den Gesteinskreislauf
: Die Verwandlung der Gesteine
Und wenn etwas von oben kommt? Meteorite und Impaktgesteine
Teil III: Eine Theorie, die alles erklärt: Plattentektonik
Kapitel 8: Zahlreiche Beweise für die Plattentektonik
Sie driften auseinander: Wegeners Idee der Kontinentaldrift
Übereinkunft: Wie die Technologie Licht in die Plattentektonik bringt
Kapitel 9: Wenn Lithosphärenplatten aufeinandertreffen, ist alles relativ
Die Dichte
ist der Schlüssel
Zwei von einer Sorte: Kontinentale und ozeanische Kruste
Warum die Dichte wichtig ist: Isostasie
Plattengrenzen durch relative Plattenbewegungen festlegen
Topografische Erscheinungsformen mit Plattenbewegungen erklären
Kapitel 10: Welche Antriebskraft steckt dahinter? Mantelkonvektion und Plattenbewegung
Alles dreht sich im Kreis: Modelle der Mantelkonvektion
Konvektion als Erklärung für Magma, Vulkane und untermeerische Gebirge
Schütteln und Rütteln: Wie Plattenbewegungen Erdbeben
verursachen
Teil IV: Oberflächlich betrachtet: Oberflächenprozesse
Kapitel 11: Die Schwerkraft fordert ihren Tribut: Massenbewegungen
Festhalten oder hinunterfallen: Reibung gegen Schwerkraft
Betrachtung der beteiligten Materialien
Massenbewegungen auslösen
Wasserzufuhr
Schnelle Bewegungen großer Erdmassen
Eine weitaus bedachtsamere Vorgehensweise: Bodenkriechen und Bodenfließen (Solifluktion)
Kapitel 12: Wasser: Über und unter der Erdoberfläche
Der Wasserkreislauf
Fließgewässer
: Sedimenttransport in Richtung Meer
Abtragung eines Flussbetts bis zur Erosionsbasis
Nach einer Veränderung der Erosionsbasis das Gleichgewicht wiederfinden
Spuren hinterlassen: Wie Fließgewässer Landschaften formen
Was unter unseren Füßen fließt: Grundwasser
Kapitel 13: Langsam, aber sicher Richtung Meer: Gletscher
Drei Gletschertypen erkennen
Eis als geologische Kraft
Erosion im Schneckentempo: Durch glaziale Erosion geschaffene Landschaftsformen
Alles zurücklassen: Glaziale Ablagerungen
Sag mir, wo die Gletscher sind
Kapitel 14: Vom Winde verweht: Sedimenttransport ohne Wasser
Wassermangel: Aride Regionen der Erde
Windtransport
Deflation und Korrasion: Erosionsformen, die durch Wind entstehen
Dünen und andere Windablagerungen
Steinpflaster
: Ablagerung oder Erosion?
Kapitel 15: Entwicklung von Küstenlinien
Befreiungsschlag: Wellen und Wellenbewegung
Küstenlinien formen
Küstenlinien
klassifizieren
Teil V: Vor langer, langer Zeit
Kapitel 16: Die geologische Zeit in den Griff bekommen
Die Schichttorte der Zeit: Stratigrafie und relative Altersdatierung
Verrate mir die Zahlen: Absolute Datierungsmethoden
Relativ absolut: Die besten Ergebnisse mit einer Kombination aus Methoden erzielen
Äonen, Ären und Epochen (meine Güte!): Die Gliederung der geologischen Zeits
kala
Kapitel 17: Gesteine erzählen die Geschichte des Lebens
Den Wandel erklären, nicht den Ursprung: Die Evolutionstheorie
Die Evolution einer Theorie
Die Evolution auf die Probe stellen
Allen Widrigkeiten zum Trotz: Die Fossilisation von Lebensformen
Berücksichtigung der Verzerrung im Fossilbericht
Hypothetische Beziehungen: Kladistik
Kapitel 18: Die Zeit, bevor die Zeit begann: Das Präkambrium
Am Anfang … Die Entstehung der Erde aus einer Nebelwolke
Archaische Gesteine zurate ziehen
Gemeinsam mit Gebirgen entstanden: Die Superkontinente des Proterozoikums
Einzeller, Algenmatten und die frühe Atmosphäre
Kapitel 19: Es wimmelt von Leben: Das Paläozoikum
Explodierendes Leben: Das Kambrium
Riffe, überall Riffe
Die Entwicklung der Wirbelsäule: Tiere mit Rückgrat
Pflanzen mit Wurzeln: Die frühe Evolution der Pflanzen
Verfolgung der geologischen Ereignisse im Paläozoikum
Kapitel 20: Mesozoic Park: Als Dinosaurier die Welt beherrschten
Pangäa zerbricht
Die Neubesiedlung der Meere nach dem Aussterbeereignis
Die Symbiose der Blütenpflanze
n
Unterscheidungskriterien der mesozoischen Reptilien
Der Stammbaum der Dinosaurier
Das Fundament für die spätere Vorherrschaft: Die frühe Evolution der Säugetiere
Kapitel 21: Das Känozoikum: Säugetiere übernehmen die Weltherrschaft
Die Kontinente in ihre richtige (okay, heutige) Position bringen
Wir betreten das Zeitalter der Säugetiere
Tiere mit Übergröße: Große Säugetiere damals und heute
Hier und jetzt: Die Herrschaft des Homo sapiens
Kapitel 22: Und dann gab's keines mehr: Massenaussterbeereignisse in der Erdgeschichte
Ursachen für Aussterbeereignisse
Endzeitstimmung – mindestens fünfmal
Heutiges Aussterben und Biodiversität
Teil VI: Welche Gesteine sind wo und warum?
Kapitel 23: Woher wir wissen, was wo ist
Geologische Karten und Profilschnitte
Was früher wo war – Paläogeografische Rekonstruktion
Kapitel 24: Regionales Beispiel: Deutschland
Geologischer Aufbau Deutschlands
Überreste von den Anfängen
Ein ehemaliges Hochgebirge schaut hier und da heraus: Das Variszikum
Nachvariszische (permomesozoische) Schichtstufenlandschaften
Mittendurch – Mineralgänge
Mitten drin – Impaktkrater
Hohe Berge ringsumher: Alpen und Alpenvorland
Vom Aufbrechen und Einsinken: »Tertiäre« Senken
Jüngere Vulkangebiete
Was die Eiszeiten hinterließen
Beständig ist nur der Wandel – was heute passiert
Teil VII: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 25: Zehn (plus 1) Wege, über die der Mensch als geologische Kraft wirkt
Staudämme
Begradigung und Eintiefung von Wasserläufen
Strandaufspülung
Veränderung von Küstenlinien
Destabilisierung von Hängen
Erdgasförderung
durch Fracking
Abtragung von Berggipfeln
Entwicklung von Wüsten
Künstlich geschaffene Hohlräume
Transport von geologischem Material
Klimawandel
Kapitel 26: Zehn Anwendungen geologischer Kenntnisse
Standsicherheit
Rohstoffe für alles Mögliche: Steine, Erden, Erze und Salze
Energierohstoffe: Kohle, Erdöl und Erdgas
Geothermie – Energie der Erde nutzen!
Sauberes Trinkwasser
für alle
Der Boden
, auf – von – dem wir leben
Vulkanausbrüche
vorhersagen
Erdbeben und Tsunamis vorhersagen
Den Klimawandel verstehen – und bremsen
Die »richtige« Nutzung finden
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 5
Tabelle 5.1: Die häufigsten Elemente der Erdkruste
Kapitel 6
Tabelle 6.1: Silikatgruppen
Tabelle 6.2: Häufige Carbonate
Tabelle 6.3: Sulfide und Sulfate
Tabelle 6.4: Häufige Oxide
Tabelle 6.5: Häufige Minerale gediegener Elemente
Kapitel 7
Tabelle 7.1: Klassifikation magmatischer Gesteine
Tabelle 7.2: Detritische Sedimentgesteine
Tabelle 7.3: Chemische Sedimentgesteine
Tabelle 7.4: Metamorphe Gesteine
Kapitel 9
Tabelle 9.1: Charakteristische Eigenschaften ozeanischer und kontinentaler Kruste
Kapitel 16
Tabelle 16.1: Häufig für die Altersdatierung verwendete radioaktive Isotope
Kapitel 18
Tabelle 18.1: Ein Vergleich von Bändereisenerzen und kontinentalen Red Beds
Kapitel 19
Tabelle 19.1: Bedeutende Entwicklungsschritte in der paläozoischen Pflanzenevolut...
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Kreisdiagramm (a); Streudiagramm (b); Säulendiagramm (c); Liniendi...
Kapitel 3
Abbildung 3.1: In dieser Skizze ist A das älteste und E das jüngste Gestein.
Abbildung 3.2: Hutton-Diskordanz am Siccar Point, Schottland. Horizontale Sandste...
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Die fünf Sphären des Systems Erde
Abbildung 4.2: Der Weg der Erdbebenwellen, wenn das Erdinnere durchgehend fest wä...
Abbildung 4.3: Der tatsächliche Weg von P- und S-Wellen
Abbildung 4.4: Der Schalenbau der Erde
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Der Aufbau eines Atoms
Abbildung 5.2: Ein Kästchen aus dem Periodensystem der Elemente und was es uns zu...
Abbildung 5.3: Das Periodensystem der Elemente © 2014 Stefanie Ortanderl & Ulf Ri...
Abbildung 5.4: Die ionische Bindung zwischen Natrium und Chlor, die zusammen ein ...
Abbildung 5.5: Kovalente Bindung in einem Wassermolekül
Abbildung 5.6: Metallische Bindung zwischen Atomen in einem Meer von Elektronen
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Von links nach rechts und oben nach unten: gediegenes Kupfer; Azur...
Abbildung 6.2: Die Mohssche Härteskala der Minerale – eine relative Skala
Abbildung 6.3: Spaltflächen von Muskovit
, Feldspat
, Halit
und Fluorit
Abbildung 6.4: Feuerstein (Flint) mit muscheligem Bruch
Abbildung 6.5: Der Silizium-Sauerstoff-Tetraeder
Abbildung 6.6: Ein Gruppensilikat
Abbildung 6.7: Ein Kettensilikat
Abbildung 6.8: Ein Bandsilikat
Abbildung 6.9: Ein Schichtsilikat
Abbildung 6.10: Ein Gerüstsilikat
Abbildung 6.11: Ein Ringsilikat
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Phaneritischer Granit, ein Plutonit mit ähnlich großen Kristallen ...
Abbildung 7.2: Porphyrischer Andesit, ein Vulkanit mit Einsprenglingen von Feldsp...
Abbildung 7.3: Glasiger (hyaliner) Obsidian, ein Vulkanit mit muscheligem Bruch (...
Abbildung 7.4: Blasiger Basalt, ein Vulkanit. Im Magma eingeschlossene Gase trete...
Abbildung 7.5: Erscheinungsformen eines Vulkans
Abbildung 7.6: Merkmale eines Schildvulkans
Abbildung 7.7: Bei der explosiven Eruption des Mount St. Helens im Jahr 1980 wurd...
Abbildung 7.8: Merkmale eines Strato- oder Schichtvulkans
Abbildung 7.9: Merkmale eines Aschenkegels
Abbildung 7.10: Plutonische Erscheinungsformen
Abbildung 7.11: Mechanische Verwitterung eines Gesteins zu Sediment
Abbildung 7.12: Der Granitberg Enchanted Rock, Texas, mit deutlicher Verwitterung...
Abbildung 7.13: Schlecht sortiertes und gut sortiertes Sediment
Abbildung 7.14: Tonstein mit Abdrücken von Regentropfen © Roger Weller
Abbildung 7.16: Schrägschichtung
Abbildung 7.17: Gradierte Schichtung
Abbildung 7.18: Strömungsrippel
Abbildung 7.19: Trockenrisse © Ulrich –
stock.adobe.com
Abbildung 7.20: Kontaktmetamorphose
Abbildung 7.21: Indexminerale bei der Metamorphose eines Tonsteins
Abbildung 7.22: Ungerichteter und gerichteter Druck (Spannung)
Abbildung 7.23: Die Schieferung von Mineralen durch gerichteten Druck
Abbildung 7.24: Glimmerschiefer, ein metamorphes Gestein, das vor allem aus Glimm...
Abbildung 7.25: Migmatit, ein metamorphes Gestein mit Lagen von hellen und dunkle...
Abbildung 7.26: Hornfels © vvoe –
stock.adobe.com
Abbildung 7.27: Der Gesteinskreislauf
Abbildung 7.28: Steinmeteorit (Chondrit), dessen Impakt 2013 im russischen Tschel...
Abbildung 7.29: Moldavit © Björn Wylezich –
stock.adobe.com
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Die heutige Lage der Kontinente © max_776 –
stock.adobe.com
Abbildung 8.2: Verbindung zwischen Südamerika und Afrika
Abbildung 8.3: Die Verbreitung fossiler Zeugnisse auf Gondwana
Abbildung 8.4: Stratigrafische Schichtsequenzen der Kontinente, die vermutlich ei...
Abbildung 8.5: Rekonstruktion der miteinander verbundenen Kontinente, basierend a...
Abbildung 8.6: Nordkontinent Laurasia und Südkontinent Gondwana © designua –
stoc
...
Abbildung 8.7: Das relative Alter der ozeanischen Kruste entlang des Mittelatlant...
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Die Gleichgewichtslinie von kontinentaler und ozeanischer Kruste
Abbildung 9.2: Ein Mittelozeanischer Rücken mit Rift-Valley © Graphithèque –
stoc
...
Abbildung 9.3: Verwerfung am Westrand des Grabenbruchs Thingvellir, Island © Mich...
Abbildung 9.4: Eine Region mit aktiver Riftbildung zwischen der Arabischen Halbin...
Abbildung 9.5: Eine konvergierende Kontinent-Ozean-Plattengrenze mit Subduktionsz...
Abbildung 9.6: Geologische Erscheinungsmerkmale an einer konvergierenden Ozean-Oz...
Abbildung 9.7: Eine konvergierende Kontinent-Kontinent-Plattengrenze und die mit ...
Abbildung 9.8: Versatz an einer Transformstörung © Naeblys –
stock.adobe.com
Abbildung 9.9: San-Andreas-Störung in Kalifornien © Stocktrek – Getty Images
Abbildung 9.10: Transformstörungen entlang eines Mittelozeanischen Rückens
Abbildung 9.11: Druck- und Zugspannung bei Gesteinen
Abbildung 9.12: Antiklinale und Synklinale © madscinbca –
stock.adobe.com
Abbildung 9.13: Dom- und Beckenstruktur
Abbildung 9.14: Bezeichnungen an einer Verwerfung
Abbildung 9.15: Vertikalverschiebungen
Abbildung 9.16: Akkretion von vulkanischen Inseln an ein Stück kontinentale Krust...
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Drei Querschnitte durch die Erde, die den Blickwinkel jedes Model...
Abbildung 10.2: Entstehung eines vulkanischen Inselbogens
Abbildung 10.3: Entstehung eines Kontinentalrandbogens
Abbildung 10.4: Bewegung der Pazifischen Platte über einen vulkanischen Hotspot, ...
Abbildung 10.5: Ein Seismometer
Abbildung 10.6: Ein Seismogramm mit P-Wellen, S-Wellen und Oberflächenwellen
Kapitel 11
Abbildung 11.1: (a) Die Reibung ist größer als die Schwerkraft, sodass das Materi...
Abbildung 11.2: Sedimente unterschiedlicher Korngrößen und Rundung besitzen auch ...
Abbildung 11.3: Strömungserosion, bei der der Böschungswinkel unterspült wird, fü...
Abbildung 11.4: Mure (Schlammlawine) © elmar gubisch –
stock.adobe.com
Abbildung 11.5: Rutschung einer großen Gesteinsmasse im Vergleich zu einer Rotati...
Abbildung 11.6: Bergstürze ereignen sich, wenn sich Material von einem steilen od...
Abbildung 11.7: Durch Bodenkriechen beginnen sich die im Boden verankerten Objekt...
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Der Wasserkreislauf der Erde © casaltamoiola –
stock.adobe.com
Abbildung 12.2: Ein Einzugsgebiet
Abbildung 12.3: (a) laminare Strömung; (b) turbulente Strömung
Abbildung 12.4: (a) dendritische Entwässerung; (b) rechtwinklige Entwässerung; (c...
Abbildung 12.5: Ein verflochtenes Fließgewässer (Skeidará, Island) © Carola Vahld...
Abbildung 12.6: Ein mäandrierendes Fließgewässer (Lech, Bayern) mit beginnender A...
Abbildung 12.7: Ein Blick unter die Erdoberfläche, wenn Wasser in Sediment- und G...
Abbildung 12.8: Quellen treten oft an Hängen auf, wo Grundwasser an der Erdoberfl...
Abbildung 12.9: Gespannte und ungespannte Grundwasserleiter mit einer artesischen...
Abbildung 12.10: Grundwasser, das durch Magma erhitzt wurde, steigt zur Erdoberfl...
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Akkumulations- und Ablationszone eines Gletschers
Abbildung 13.2: Trogtal, Alaska, der Gletscher ist fast verschwunden. © Thomas –
Abbildung 13.3: Landschaftsformen, die durch glaziale Erosion im Gebirge geschaff...
Abbildung 13.4: Ein Eisschild formt einen Rundhöcker.
Abbildung 13.5: Aletschgletscher, Schweiz, bei dem die Seiten- und Mittelmoränen ...
Abbildung 13.6: Landschaftsformen aus glazialen Ablagerungen
Abbildung 13.7: Milanković-Zyklen: (a) Exzentrizität, (b) Neigung ...
Kapitel 14
Abbildung 14.1: Kriechende und springende Geröllfracht mit Suspensionsfracht in e...
Abbildung 14.2: Entstehung eines Windkanters durch Korrasion
Abbildung 14.3: Eine typische Sanddüne
Abbildung 14.4: Bildung von Sedimentschichten am Rutschhang der Düne und Erschein...
Abbildung 14.5: Dünentypen
Abbildung 14.6: Typischer Lössboden © eliasbilly –
stock.adobe.com
Abbildung 14.7: Bildung eines Steinpflasters durch Erosion
Abbildung 14.8: Bildung eines Steinpflasters durch Ablagerung
Kapitel 15
Abbildung 15.1: Teile einer Welle
Abbildung 15.2: Orbitalbewegung von Oszillationswellen
Abbildung 15.3: Übergang von Oszillations- zu Translationswellen im Flachwasser
Abbildung 15.4: Durch die Anziehungskraft des Monds wölbt sich das Wasser auf der...
Abbildung 15.5: Erzeugung einer Küstenlängsströmung
Abbildung 15.6: Bewegung einer Ripströmung
Abbildung 15.7: Kap Arkona, Insel Rügen © Chemnitz von oben –
stock.adobe.com
Abbildung 15.8: Erosive Erscheinungsformen an einer Küste
Abbildung 15.9: Ablagerungsstrukturen an einer Küste
Kapitel 16
Abbildung 16.1: Entstehung einer Winkeldiskordanz
Abbildung 16.2: Winkeldiskordanz in einem Straßenanschnitt © Roger Weller
Abbildung 16.3: Entstehung einer Erosionsdiskordanz
Abbildung 16.4: In den Gesteinen des Grand Canyon sind etwa anderthalb Milliarden...
Abbildung 16.5: Der Grand Canyon zeigt eine nichtkonforme Lagerung (1), eine Wink...
Abbildung 16.6: Alpha-Zerfall eines radioaktiven Isotops
Abbildung 16.7: Beta-Zerfall eines Isotops
Abbildung 16.8: Elektroneneinfang eines Isotops
Abbildung 16.9: Die geologische Zeitskala
Kapitel 17
Abbildung 17.1: Spuren, Gänge und Bauten
Abbildung 17.2: Zwei Darstellungsformen eines Kladogramms oder phylogenetischen S...
Kapitel 18
Abbildung 18.1: Die Kratone der heutigen Kontinente
Abbildung 18.2: Eine eukaryotische und eine prokaryotische Zelle im Vergleich © u...
Abbildung 18.3: Der biologische Prozess der Fotosynthese © Ольга Погорелова –
sto
...
Abbildung 18.4: Bildung eines Stromatolithen durch Sedimente, die von Algenfäden ...
Abbildung 18.5: a) Lebende Stromatolithen, Shark Bay, Australien © Kathie Atkinso...
Abbildung 18.6: Bändereisenerz © helmutvogler –
stock.adobe.com
Kapitel 19
Abbildung 19.1: Trilobiten, Marokko © Roger Weller
Abbildung 19.2: Kalkstein mit vielen Fossilien aus dem späten Paläozoikum wie ein...
Abbildung 19.3: Ein Eurypterid © auntspray –
stock.adobe.com
Abbildung 19.4: Veränderungen der Suturen von Ammonitenschalen im Laufe der Zeit
Abbildung 19.5: Ammoniten © Roger Weller
Abbildung 19.6: Ein paläozoischer Nautilid mit gerader Schale
Abbildung 19.7: Cephalaspis – Ein Vertreter der Ostracodermen
Abbildung 19.8: Gepanzerter Kopf eines Dunkleosteus © CHATCHAI –
stock.adobe.com
Abbildung 19.9: Dimetrodon-Skelett © Roger Weller
Abbildung 19.10: Häufige Pflanzen der karbonischen Kohlesümpfe: a) Lepidodendron ...
Abbildung 19.11: Ablagerungsmuster von Sedimentgesteinen im Meer
Abbildung 19.12: Gesteinsabfolge, die bei einer marinen Transgression entsteht
Abbildung 19.13: Gesteinsabfolge, die bei einer marinen Regression entsteht
Kapitel 20
Abbildung 20.1: Die Anordnung der heutigen Kontinente im damaligen Superkontinent...
Abbildung 20.2: Nordamerika während des Mesozoikums
Abbildung 20.3: Planktonische Foraminiferen © ekaterinabrovi –
stock.adobe.com
Abbildung 20.4: Der Stammbaum der Reptilien
Abbildung 20.5: Ein fliegendes mesozoisches Reptil – der Pteranodon
Abbildung 20.6: a) Archaeopteryx, Solnhofener Plattenkalk © natursports –
stock.a
...
Abbildung 20.7: Beckenstrukturen von Vogelbecken- und Echsenbeckendinosauriern
Abbildung 20.8: Vogelbeckendinosaurier
Abbildung 20.9: Echsenbeckendinosaurier
Kapitel 21
Abbildung 21.1: Der Alpen-Himalaya-Gürtel
Abbildung 21.2: Der Zirkumpazifische Gürtel – auch Pazifischer Feuerring genannt
Abbildung 21.3: Geografische Strukturen in Nordamerika, die sich im Känozoikum bi...
Abbildung 21.4: Das Uintatherium – ein Säugetier aus dem Eozän
Abbildung 21.5: Ein Moeritherium
Abbildung 21.6: Zahn eines Mammuts und eines Mastodons
Abbildung 21.7: Entwicklungsstadien der Walevolution vom land- zum meeresbewohnen...
Kapitel 22
Abbildung 22.1: Von Flutbasalten bedeckte Regionen der heutigen Kontinente
Abbildung 22.2: Aussterberaten der fünf größten Aussterbeereignisse
Abbildung 22.3: Die Lage des Chicxulub-Kraters im Golf von Mexiko
Kapitel 23
Abbildung 23.1: Ausschnitt aus einer geologischen Karte © Виктория Котлярчук –
st
...
Abbildung 23.2: Arbeitsmaterial für kartierende Geologen: Hammer, Lupe und Gefüge...
Abbildung 23.3: Geologischer Profilschnitt des Hirschberg (Kaufunger Wald, Osthes...
Kapitel 24
Abbildung 24.1: Geologische Karte von Deutschland mit angrenzenden Gebieten © Ser...
Abbildung 24.2: Stark vereinfachte geologische Karte Deutschlands © Sonja Philipp
Abbildung 24.3: Buntsandstein auf Helgoland © Eberhard –
stock.adobe.com
Abbildung 24.4: Steinbruch im Taunusquarzit © Cezanne-Fotografie –
stock.adobe.co
...
Abbildung 24.5: Quarz-Drusen (teilweise Amethyst) in basaltischen Vulkaniten des ...
Abbildung 24.6: Der Teufelstisch, ein Buntsandsteinfelsen im Pfälzer Wald
© wsf-f...
Abbildung 24.7: Plattenkalk (»Lithografenschiefer«), Altmühltal © Guntar Feldmann...
Abbildung 24.8: Basteibrücke in der Sächsischen Schweiz © Mike Mareen –
stock.ado
...
Abbildung 24.9: Bayerischer Pfahl © traveldia –
stock.adobe.com
Abbildung 24.10: Suevit (»Schwabenstein«), ein Impaktgestein aus dem Nördlinger R...
Abbildung 24.11: Die Zugspitze, höchster Gipfel der Deutschen Alpen © herculaneum...
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autorin
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
5
6
7
8
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
Einführung
Geologie ist die Wissenschaft der Erde. Üblicherweise denkt man, dass die Geologie ein umfangreiches, komplexes und kompliziertes Fachgebiet ist. Doch »umfangreich, komplex und kompliziert« muss nicht unbedingt schwierig bedeuten. Viele, die sich für Geologie interessieren, wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Minerale? Gesteine? Gletscher? Vulkane? Fossilien? Erdbeben? Die vielen unterschiedlichen Themenbereiche, die unter der Überschrift »Geologie« zusammengefasst werden, sind überwältigend.
Schlagen Sie das Buch Geologie für Dummies auf! Ziel dieses Buchs ist es, das riesige Spektrum an geologischem Wissen zu durchbrechen und einen schnellen Bezug zu den Kerngedanken der Geologie herzustellen.
Ich hoffe, Sie finden dieses Buch genauso interessant wie hilfreich – egal, ob Sie es erstanden haben, weil Sie es für ein Seminar benötigen oder weil Sie nach Antworten auf Fragen suchen, die Sie über den Planeten haben, auf dem Sie leben.
Über dieses Buch
In Geologie für Dummies können Sie an jeder beliebigen Stelle mit dem Lesen beginnen. Dieses Buch ist eine Einführung in die häufigsten Themengebiete der Geologie. Folgen Sie Ihren Interessen von einem Thema zum nächsten oder beginnen Sie am Anfang und lesen Sie die Kapitel der Reihe nach. Das Buch ist so geschrieben, dass Sie es auf jeder Seite aufschlagen und etwas lernen können. Sollten Sie jedoch am Anfang mit dem Lesen beginnen, werden Sie in logisch gegliederter Reihenfolge mit den unterschiedlichen Themen vertraut gemacht und (so hoffe ich!) Ihre Fragen unverzüglich beantwortet finden, sobald sie auftauchen.
Überall im Buch finden Sie Querverweise auf andere Kapitel. Diese sind nötig, da es unmöglich ist, ein geologisches Thema zu ergründen, ohne dabei ein anderes zu streifen. Die zahlreichen Querverweise verknüpfen die verschiedenen Themenbereiche der Geologie zu einem großen Ganzen.
Zum besseren Verständnis werden die Erklärungen in diesem Buch von vielen Abbildungen begleitet. Geologie ist überall um Sie herum. Deshalb soll das Buch Sie auch dazu ermutigen, sich umzuschauen und Beispiele aus der realen Welt für die Prozesse und Erscheinungen zu suchen, mit denen Sie sich hier beim Lesen beschäftigen.
Konventionen in diesem Buch
Wie jede Wissenschaft hat auch die Geologie ihren eigenen Fachjargon, den Sie kennen müssen, um die Kerngedanken zu verstehen. Daher wurde in diesem Buch bei jeder Einführung eines neuen Begriffs, den Sie vermutlich nicht kennen, dieser kursiv gedruckt und auch gleich die passende Definition mitgeliefert.
Was Sie nicht lesen müssen
Die grau unterlegten Kästen in diesem Buch können Sie beim Lesen überspringen, da sie nicht wesentlich für die Informationen des jeweiligen Kapitels sind. In ihnen finden Sie Zusatzinformationen oder besonders interessante Leckerbissen, die Sie amüsieren könnten.
Textabschnitte, die mit einem Techniker-Symbol gekennzeichnet sind, erklären oder beschreiben eine Sache detaillierter und vermitteln Ihnen zusätzliches Wissen, das über das Grundverständnis hinausgeht. Sind Sie also nur an den Grundlagen interessiert, so können Sie getrost auch diese Abschnitte überspringen oder überfliegen.
Törichte Annahmen über den Leser
Beim Schreiben dieses Buchs musste ich mir einige Vorstellungen vom Leser – also von Ihnen – machen. Ich gehe davon aus, dass Sie auf der Erde leben und mit Gesteinen, Gewässern und Wetter (Regen, Wind und Sonne) vertraut sind. Weiterhin nehme ich an, dass Sie Grundkenntnisse in Geografie besitzen – also die Kontinente, Ozeane und großen Gebirgszüge kennen.
Ich gehe nicht davon aus, dass Sie mit irgendwelchen wissenschaftlichen Grundlagen der Chemie vertraut sind. Diese könnten allerdings hilfreich sein, wenn Sie tiefer in die Materie der Gesteinsbildung und -umwandlung eintauchen wollen. Auch beim Thema Evolution erwarte ich von Ihnen keinerlei Vorkenntnisse in Biologie oder Anatomie (und nichts davon ist notwendig, um die hier gemachten thematischen Ausführungen zu verstehen). Sollte Ihr Interesse an der Evolution geweckt worden sein, so werden Sie Ihre Fragen sicherlich dazu bewegen, andere Bücher zu diesem Thema in die Hand zu nehmen.
Wenn Ihr Interesse an der Geologie durch dieses Buch weiter angeheizt wird, empfehle ich Ihnen die Anschaffung eines Lexikons für Erdgeschichte oder Geologie. In der Geologie wimmelt es von Begriffen, die alle eine genaue und aussagekräftige Bedeutung haben. Mithilfe eines solchen Lexikons können Sie selbst die verwirrendsten geologischen Erklärungen problemlos verstehen.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Dieses Buch ist in mehrere Teile gegliedert, in denen die Themen logisch miteinander verknüpft sind. Hier eine kurze Beschreibung dessen, was Sie in den einzelnen Teilen von Geologie für Dummies erwartet.
Teil I: Das Studium der Erde
Teil I macht Sie mit der Wissenschaft im Allgemeinen und mit Geowissenschaften im Besonderen vertraut. Dieser Teil beginnt mit einem Überblick über die wissenschaftliche Vorgehensweise und wie man diese im alltäglichen Leben anwendet. Hier lernen Sie auch die Unterschiede zwischen Hypothesen, Theorien, Gesetzen und Modellen kennen.
Kapitel 3 gibt einen kurzen Einblick in die geologische Denkweise und die Entwicklung moderner Vorstellungen über unseren Planeten. Hier werden auch aktuelle geologische Themen wie Schneeball Erde und Massenaussterben aufgegriffen.
In Kapitel 4 lernen Sie die verschiedenen Schalen kennen, aus denen die Erde aufgebaut ist. Hier erfahren Sie auch, auf welche Weise die Wissenschaftler herausfanden, wie das Innere der Erde aussieht, obwohl sie es nicht wirklich betrachten können.
Teil II: Elemente, Minerale und Gesteine
Elemente, Minerale und Gesteine sind die Bausteine der Erde. Sie werden in Teil II näher betrachtet. Wir beschäftigen uns zunächst mit einigen chemischen Grundlagen und lernen, wie Atome sich miteinander verbinden, Minerale bilden und wie sich Minerale zu Gesteinen zusammenschließen. In Kapitel 7 stelle ich Ihnen die verschiedenen Gesteinstypen der Erde vor und zeige Ihnen, wie und wo diese gebildet werden.
Teil III: Eine Theorie, die alles erklärt: Plattentektonik
Die Plattentektonik ist die Theorie in der Geologie, die alles miteinander vereint. Sie verdeutlicht mit einer einzigen Erklärung, wie durch Plattenbewegungen Gesteine gebildet, zerstört und recycelt werden. In Teil III erfahren Sie, wie Geologen viele Jahrzehnte lang daran arbeiteten, die Hypothese der Plattentektonik in die Theorie der Plattentektonik zu verwandeln. Daneben stelle ich Ihnen die verschiedenen Typen von Krustengesteinen vor, die die Erde bedecken, und zeige Ihnen, wie sich durch das Zusammenstoßen und Auseinanderdriften der tektonischen Platten unterschiedliche Gesteinseigenschaften ausbilden. Im letzten Kapitel dieses Teils beschäftigen wir uns mit den drei Haupttheorien, die den Antriebsmechanismus der Plattenbewegungen zu erklären versuchen.
Teil IV: Oberflächlich betrachtet: Oberflächenprozesse
In Teil IV werden die geologischen Oberflächenprozesse in fünf Hauptkategorien unterteilt. Sie lernen die Kräfte von Gravitation, fließendem Wasser, Eis, Wind und Wellen kennen und sehen, wie diese die Erdoberfläche formen, indem sie Gesteine und Lockersedimente in Bewegung versetzen.
Teil V: Vor langer, langer Zeit
In Teil V gebe ich Ihnen eine kurze Einführung in die historische Geologie und beginne damit, wie Geologen mithilfe von relativen und absoluten Datierungsmethoden das Alter von Gesteinen bestimmen. Im Anschluss daran stelle ich Ihnen die geologische Zeitskala vor – eine unterteilte zeitliche Abfolge, die mehr als 4,5 Milliarden Jahre umfasst. Dieser Teil beinhaltet außerdem eine Beschreibung der wichtigsten geologischen und evolutionären Ereignisse – vom Präkambrium über das Paläozoikum und Mesozoikum bis hin zum Känozoikum.
Teil VI: Welche Gesteine sind wo und warum?
Teil V ist eine kurze Einführung in die regionale Geologie. Zunächst erfahren Sie, wie geologische Karten und Profilschnitte erstellt werden und die Entwicklung einzelner Regionen rekonstruiert werden kann. In Kapitel 24 erhalten Sie dann eine übersichtliche Beschreibung der Geologie von Deutschland. Sie erfahren dabei genauso, wie die Vielfalt Mittelgebirge zustande kommt, als auch, wie weitere Regionen nach den vorkommenden Gesteinen miteinander verglichen werden können.
Teil VII: Der Top-Ten-Teil
Im letzten Teil dieses Buchs finden Sie zwei Auflistungen. Die erste ist eine Top-Ten-Liste, die aufzeigt, wie wir Menschen als geologische Stellvertreter fungieren, indem wir die Erdoberfläche neu formen oder umstrukturieren. Die zweite gibt einen kleinen Einblick in die praktische Anwendung geologischer Kenntnisse – die angewandte Geologie – und geht dabei auch auf die häufigsten geologischen Gefahren, wie Erdrutsche, Erdbeben und Tsunamis, ein.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
In diesem Buch werden Symbole verwendet, die Ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Informationen lenken.
Informationen mit Erinnerungs-Symbol sind grundlegend, um das Erklärte zu verstehen. Manchmal kennzeichnet dieses Symbol eine Definition oder prägnante Erklärung, manchmal eine Information, die Ihnen dabei hilft, verschiedene Ideen miteinander zu verknüpfen.
Dieses Symbol sagt Ihnen, dass die Information dahinter ein wenig über die Grundkenntnisse hinausgeht und einige technische Details zum Thema vermittelt. Diese sind nicht für das allgemeine Verständnis des Stoffs notwendig, doch sie können für Sie interessant und informativ sein.
Hinter dem Tipp-Symbol verbergen sich Informationen, die für Sie besonders hilfreich sein könnten, wenn Sie sich auf eine Geologie-Prüfung oder -Arbeit vorbereiten oder wenn Sie in Eigenregie mit dem Studium der Geologie beginnen.
Dieses Symbol, das nur selten im vorliegenden Buch zu finden ist, weist auf eventuelle Gefahrensituationen hin.
Wie es weitergeht
Sie haben sich dieses Buch höchstwahrscheinlich zugelegt, weil Sie bereits eine Frage zu einem geologischen Thema im Hinterkopf haben. Sollte dies der Fall sein, möchte ich Sie dazu ermutigen, beim Lesen einfach Ihren Interessen zu folgen. Schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis oder in den Index, um herauszufinden, an welcher Stelle Ihre Frage beantwortet wird, schlagen Sie die entsprechende Seite auf und fangen Sie an, zu lesen!
Sollten Sie keine spezielle Frage im Kopf haben – hier einige besonders interessante Themen, die Sie mit dem Studium der Geologie vertraut machen:
Kapitel 8
»Zahlreiche Beweise für die Plattentektonik«
: In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Alfred Wegener – ein geologischer Pionier – über Plattenbewegungen nachzudenken begann. Obwohl er zahlreiche Beweise zusammentrug, um seine Ideen zu untermauern, dauerte es viele Jahre, bis die Theorie der Plattentektonik von der Wissenschaftsgemeinde anerkannt wurde. Dieses Kapitel zeigt auf, was sich in der Wissenschaft tatsächlich abspielt, und gibt außerdem einen Überblick über die grundlegende Theorie der modernen Geologie.
Kapitel 12
»Wasser: Über und unter der Erdoberfläche«
: Wenn Sie mit einem Thema beginnen möchten, zu dem Sie eine Beziehung haben, dann fangen Sie beim fließenden Wasser an. Ströme und Flüsse wickeln die häufigsten geologischen Prozesse auf der Erde ab. Egal, wo Sie leben – Sie haben bestimmt schon beobachtet, wie fließendes Wasser Lockersediment oder Gesteine in Bewegung versetzt. In diesem Kapitel erfahren Sie in allen Einzelheiten, wie Wasser Partikel aufnimmt und abtransportiert und auch wie sich Flüsse in die Landschaft einschneiden und dabei Canyons und Höhlen formen. Wir beschäftigen uns hier ebenso mit dem Thema Grundwasser – dem Wasser, das wir am häufigsten trinken.
Kapitel 18
»Die Zeit, bevor die Zeit begann: Das Präkambrium«
: In der tiefen, dunklen und düsteren Vergangenheit der Erde liegt der Ursprung des Lebens. Dieses Kapitel beschreibt die ersten Milliarden Jahre der Existenz unseres Planeten. Es beginnt mit seiner Entstehung aus einer gasförmigen Wolke heraus und endet mit den frühesten Indizien für Leben, in Form von Spurenfossilien – den
Stromatolithen
.
Kapitel 24
»Regionales Beispiel: Deutschland«
: Interessieren Sie sich besonders dafür, warum welche Gesteine an einer bestimmten Stelle auftreten, ist dieses Kapitel ein geeigneter Einstieg. Egal, ob Sie selbst aus Deutschland kommen, die Geologie dieses Lands ist besonders vielfältig und abwechslungsreich. Sie erhalten einen knappen Überblick über die Alter und Typen der vorkommenden Gesteine und können darüber im Rest des Buchs dann noch mehr Details erfahren.
Teil I
Das Studium der Erde
IN DIESEM TEIL …
Willkommen auf dem Planeten Erde, Ihrem schönen Zuhause. Die Wissenschaft der Geologie bietet Einblicke in die Vorgänge im Inneren als auch in die äußeren Erscheinungsformen dieses – von der Sonne aus gesehen – dritten Planeten. In diesem Teil mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Sie bereits ein Forscher sind, indem Sie jeden Tag Fragen stellen und nach Antworten suchen. In den letzten Jahrhunderten haben Geologen immer wieder Fragen über die Erde gestellt und Antworten darauf gefunden. Hier erfahren Sie etwas über die Geschichte und Entwicklung der geologischen Forschung. Zum Abschluss dieses Teils bekommen Sie eine Führung durch die Systeme der Erde – von der Atmosphäre bis zum inneren Kern und durch alles, was dazwischen liegt.
Kapitel 1
Steine – nicht nur was für Sammler
IN DIESEM KAPITEL
Geowissenschaften für sich entdeckenUmwandlung von Gesteinen im GesteinskreislaufDie Theorie der Plattentektonik kennenlernenOberflächenprozesse verstehenEintauchen in die Geschichte der ErdeDie Verteilung der Gesteine verstehenGeologie und andere Geowissenschaften haben den Ruf, leichte Fächer an Schule und Universität zu sein oder zumindest die am wenigsten schweren aller Wissenschaften. Möglicherweise liegt das daran, dass man die Objekte, die man in der Geologie betrachtet und studiert – Steine –, in der Hand halten und ohne Hilfsmittel wie Mikroskop oder Teleskop sehen kann.
Geologie ist die Wissenschaft, die sich mit unserem Planeten befasst – damit, woraus er besteht und wie er zu dem wurde, was er heute ist. Geologie zu studieren bedeutet, auch alle anderen Wissenschaften, zumindest ein kleines bisschen, zu studieren. Chemie, Physik, Biologie und Astronomie (um nur einige zu nennen) sind die Grundlagen, die man braucht, um das geologische System der Erde zu verstehen – sowohl die Prozesse, die in diesem System ablaufen, als auch die Ergebnisse, zu denen sie führen.
Nicht nur Menschen, die komplizierten physikalischen Berechnungen oder langwierigen Experimenten in einem Chemielabor aus dem Weg gehen wollen, entdecken die Geologie für sich. Geologie ist eine Wissenschaft für alle. Es ist die Wissenschaft über den Planeten, auf dem wir leben – die Welt, in der wir leben –, und dies ist Grund genug, mehr über sie in Erfahrung bringen zu wollen.
Entdecken Sie den Forscher in sich
Sie sind bereits ein Forscher. Vielleicht haben Sie dies noch gar nicht bemerkt, aber indem Sie sich umschauen und Fragen stellen, verhalten Sie sich wie einer. Okay, Forscher bezeichnen ihr Vorgehen, Fragen zu stellen und Antworten auf diese zu finden, als wissenschaftliche Methode, aber was Sie jeden Tag tun, ist genau das Gleiche. Es wird nur nicht so schick benannt. In Kapitel 2 stelle ich Ihnen die wissenschaftliche Methode im Detail vor. An dieser Stelle gebe ich Ihnen zunächst einen kurzen Überblick, was sie beinhaltet.
Wir machen Beobachtungen – Tag für Tag
Beobachtungen sind lediglich Informationen, die wir mit unseren fünf Sinnen aufnehmen. Wir können nicht durch die Welt gehen, ohne Informationen zu sammeln und Entscheidungen zu treffen, die sich auf diese Informationen stützen.
Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Sie stehen an einer Kreuzung, schauen nach beiden Seiten, um festzustellen, ob ein Auto kommt und ob das herannahende Auto langsam genug fährt, damit Sie die Straße sicher überqueren können, bevor es da ist. Sie haben eine Beobachtung gemacht, Informationen gesammelt und eine Entscheidung getroffen, die auf diesen Informationen beruht – genau wie ein Forscher!
Wir ziehen Schlüsse
Andauernd benutzen wir unsere gesammelten Beobachtungen, um Schlussfolgerungen aus ihnen zu ziehen. Je mehr Informationen wir sammeln (je mehr Beobachtungen wir also machen), umso stichhaltiger wird unsere Folgerung sein. Der gleiche Prozess läuft auch bei einer wissenschaftlichen Untersuchung ab. Forscher sammeln durch Beobachtungen Informationen, entwickeln eine wohlbegründete Vermutung (eine sogenannte Hypothese) dazu, wie die Sache funktionieren könnte, und versuchen dann über eine Reihe von Experimenten, ihre Vermutung zu belegen.
Kein Wissenschaftler will eine voreilige, falsche Schlussfolgerung ziehen! Gute Forschung basiert auf vielen Beobachtungen und wird immer und immer wieder durch Experimente überprüft. Für gewöhnlich beruhen die bedeutendsten wissenschaftlichen Entdeckungen auf fundierten Vermutungen, Experimenten und kontinuierlichem Infragestellen durch eine ganze Reihe von Forschern.
Bildung und Umbildung von Gesteinen
Wie wir in Teil II dieses Buchs im Einzelnen sehen werden, basiert die Geologie auf der Betrachtung und Untersuchung von Gesteinen. Gestein ist dabei das, woraus ein Stein besteht. Steine sind, im wahrsten Sinne des Wortes, die Bausteine der Erde und ihrer Erscheinungsformen (wie Berge, Täler und Vulkane). Das Material, aus dem die Gesteine im Erdinneren und an der Erdoberfläche bestehen, verändert ständig seine Gestalt. Dieser Kreislauf und die Prozesse der Gesteinsbildung und -verformung können anhand bestimmter Eigenschaften von Gesteinen, die heute an der Erdoberfläche liegen, zurückverfolgt werden.
Wie sich Gesteine bilden
Merkmale wie Form, Farbe und Lage eines Gesteins erzählen uns die Geschichte seiner Entstehung. Ein großer Teil unseres geologischen Wissens basiert auf dem Verständnis der gesteinsbildenden Prozesse und der Bedingungen, unter denen sie ablaufen. Manche Gesteine entstehen beispielsweise tief unter der Erdoberfläche, bei großer Hitze und hohem Druck. Andere bilden sich nach jahrelanger Akkumulation und Kompaktion am Boden des Ozeans. Die drei Grundtypen von Gesteinen, die wir im Einzelnen in Kapitel 7 besprechen, sind:
Magmatische Gesteine
: Kühlt flüssiges Gesteinsmaterial (
Magma
oder
Lava
) ab, entstehen magmatische Gesteine (oder
Magmatite
). In den meisten Fällen stehen sie in Zusammenhang mit Vulkanismus.
Sedimentgesteine
: Die meisten Sedimentgesteine (oder
Sedimentite
) bilden sich durch die Kompaktion von Sedimentpartikeln, die sich am Grund eines Wasserkörpers – eines Ozeans oder Sees – abgesetzt haben. (Daneben gibt es chemische Sedimentgesteine, deren Bildung anders verläuft, wie wir in
Kapitel 7
sehen werden.)
Metamorphe Gesteine
: Metamorphe Gesteine (oder
Metamorphite
) entstehen, wenn Sedimentgesteine, magmatische Gesteine oder andere metamorphe Gesteine hohem Druck oder starker Hitze (jedoch nicht so heiß, dass es zum Aufschmelzen reicht) ausgesetzt sind, wodurch sich ihre Mineralzusammensetzung verändert.
Jedes Gestein zeigt Merkmale, die auf bestimmte Prozesse und Umgebungsbedingungen (wie zum Beispiel eine bestimmte Temperatur) zurzeit seiner Entstehung zurückzuführen sind. So gibt jeder Stein Hinweise auf Ereignisse, die in früher Vergangenheit auf unserem Planeten stattgefunden haben. Kenntnisse über die Vergangenheit helfen uns, die Gegenwart zu verstehen und möglicherweise auch die Zukunft.
Eine Reise durch den Gesteinskreislauf
Der Gesteinskreislauf beschreibt die Folge von Ereignissen, die ein Gestein in ein anderes verwandeln. Da es weder Anfang noch Ende gibt, spricht man von einem Kreislauf. Der Gesteinskreislauf schließt alle Gesteinstypen sowie die verschiedenen gesteinsbildenden Prozesse ein und veranschaulicht, wie Gesteinsmaterial bewegt und recycelt wird – sowohl an der Erdoberfläche als auch darunter. Wenn Sie den Gesteinskreislauf verstehen, verstehen Sie auch, dass sich jedes an der Erdoberfläche befindliche Gestein lediglich in einer Phase der Umwandlung befindet und dasselbe Material eines Tages ein völlig anderes Gestein bilden wird!
Plattenbewegung in Slow Motion
Die meisten gesteinsbildenden Prozesse, denen wir im Gesteinskreislauf begegnen, beruhen auf der Kraft von Bewegung, Hitze oder Druck. Die Bildung eines Gebirges beispielsweise erfordert Druck aus zwei Richtungen, der die Gesteine anhebt oder auffaltet. Dieser Bewegungstyp und die mit ihm verbundenen Kräfte sind das Ergebnis von Plattenbewegungen. Die Vorstellung, dass die äußere Schale der Erde in verschiedene puzzleartige, sich bewegende Stücke unterteilt ist, beschreibt die geowissenschaftliche Theorie der Plattentektonik (das Thema von Teil III in diesem Buch).
Geologie und Plattentektonik im Einklang
Jahrzehntelang erforschten Geowissenschaftler verschiedene Bereiche der Erde, ohne zu wissen, wie all die Erscheinungen und Prozesse, die sie untersuchten, zusammenhängen. Die Idee, dass Teile der Erdkruste sich bewegen, kam bei den Geologen schon früh auf. Es dauerte jedoch eine Weile, bis überzeugende Beweise dafür gesammelt waren, wie wir in Kapitel 8 sehen werden.
Mitte des 20. Jahrhunderts lieferten Informationen über das Alter von Gesteinen am Ozeanboden, die während des Zweiten Weltkriegs gesammelt wurden, den Beweis, den die Wissenschaftler brauchten, um die Theorie der Plattentektonik zu entwerfen. Nachdem sie herausgefunden und anerkannt hatten, dass an den Plattengrenzen der Mittelozeanischen Rücken (an denen sich zwei Platten voneinander wegbewegen) neuer Ozeanboden gebildet wird, konnten die Forscher erklären, wie sich die Platten über die Erde bewegen.
Sie erkannten, dass die tektonischen Platten auf unterschiedliche Weise interagieren. Dieses Zusammenspiel zeigt sich in den 3 Typen von Plattengrenzen:
Konvergierende Plattengrenzen
: An konvergierenden Plattengrenzen bewegen sich zwei Platten aufeinander zu und treffen zusammen. Abhängig von ihrer Dichte bilden sich durch diese Kollision Gebirge, Vulkane, oder es kommt zur
Subduktion
einer der beiden Platten (was bedeutet, dass eine Platte unter die andere abtaucht).
Divergierende Plattengrenzen
: An divergierenden Plattengrenzen trennen sich zwei Platten und bewegen sich voneinander weg. Dies ist für gewöhnlich am Ozeanboden zu beobachten, wo abkühlendes Magma entlang der Plattengrenze einen Mittelozeanischen Rücken formt. Doch auch auf Kontinenten können divergierende Plattengrenzen auftreten, wie beispielsweise im Ostafrikanischen Grabensystem
.
Transformstörungen
: An Transformstörungen kommt es weder zur Kollision noch zur Trennung zweier Platten. Hier bewegen sie sich lediglich aneinander vorbei.
In Kapitel 9 beschäftigen wir uns eingehender mit den verschiedenen Eigenheiten der tektonischen Platten – damit, wie sie auf ihrer Reise über die Erde miteinander wechselwirken, sowie mit den einzelnen geologischen Erscheinungen, die mit jedem Typ von Plattengrenze einhergehen.
Die Suche nach dem Mechanismus, der alles antreibt
Unter Wissenschaftlern herrscht traute Einigkeit über die Theorie der Plattentektonik. Jedoch müssen die Geologen noch eine Übereinkunft finden, was genau die Platten zur Bewegung antreibt.
Im Wesentlichen gibt es drei Hypothesen, die eine Erklärung dafür liefern, was die tektonischen Platten in Bewegung versetzt. Sie alle beziehen sich auf die Konvektion des Erdmantels – die Zirkulation von heißem Gesteinsmaterial unter der Erdkruste –, doch jede konzentriert sich auf einen anderen Teil des Kreislaufs:
Mantelkonvektion
: Diese Hypothese geht davon aus, dass heißes Gesteinsmaterial im Erdinneren zirkuliert, indem es nach oben aufsteigt, abkühlt und wieder absinkt (wie das Wachs in einer Lavalampe), und die tektonischen Platten, die auf diesem Material schwimmen, in Richtung der Zirkulation mitbewegt werden.
Rückendruck
(ridge push
)
: Diese Hypothese besagt, dass die Bildung von neuem Gesteinsmaterial entlang der Mittelozeanischen Rücken die ozeanischen Platten kontinuierlich nach oben und außen drückt, sodass die äußeren Plattenränder mit anderen Platten kollidieren.
Plattenzug
(slab pull
)
: Diese Hypothese ist das Gegenteil des Rückendruck-Modells. Sie besagt, dass die schweren, dichten Außenränder einer tektonischen Platte an den Subduktionszonen in den Erdmantel absinken und den Rest der Platte mit sich ziehen.
Viele Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Bewegung der Platten auf eine Kombination aller drei Antriebsmechanismen zurückzuführen ist. Lesen Sie Kapitel 10 und entscheiden Sie selbst, welche treibende Kraft wohl am wichtigsten für die Plattenbewegungen ist.
Die Reise der Gesteine über die Erdoberfläche
Gesteine werden kontinuierlich auf der Erdoberfläche umherbewegt. Unter Oberflächenprozessen verstehen wir in der Geologie Veränderungen, die durch die Erdanziehungskraft sowie durch Wasser, Eis, Wind und Wellen hervorgerufen werden. Diese Kräfte formen die Oberfläche der Erde. Sie schaffen Landschaftsformen und -bilder auf eine Weise, die viel leichter zu beobachten ist als die weitreichenden Prozesse der Gesteinsbildung und Tektonik. Oberflächenprozesse sind außerdem geologische Prozesse, mit denen wir im täglichen Leben viel häufiger in Berührung kommen.
Erdanziehung
: Für uns auf der Erde ist die Schwerkraft etwas Selbstverständliches. Sie ist aber auch eine gewaltige Kraft, die feste Gesteine und Lockersedimente in Bewegung versetzt. Erdrutsche sind beispielsweise die Folge, wenn die Schwerkraft über die Reibungskraft siegt und Materie nach unten zieht. Das Resultat dieser Anziehung sind
Massenbewegungen
, die wir in
Kapitel 11
näher betrachten.
Wasser
: Zu den häufigsten Oberflächenprozessen gehört der Transport von Gesteinen und Lockersedimenten durch fließendes Wasser in einem Flussbett. Das Wasser bahnt sich seinen Weg über die Erdoberfläche, wobei es Sediment abträgt und ablagert und dabei die Landschaft neu formt. Dies tut es auf unterschiedliche Weise, wie wir in
Kapitel 12
sehen werden.
Eis
: Ähnlich wie fließendes Wasser, nur kraftvoller, kann Eis Gesteine transportieren. Gletscherbewegungen können das Landschaftsbild eines ganzen Kontinents umgestalten. Das Kriechen von Gletschern und seine Auswirkungen auf die Landschaft werden in
Kapitel 13
beschrieben.
Wind
: Die Kraft des Winds ist in trockenen Regionen der Erde vorherrschend. Sicherlich kennen Sie die Landschaftsformen, die durch den Wind gestaltet werden –
Dünen
–, doch möglicherweise wissen Sie nicht, dass abhängig von der Windgeschwindigkeit und Windrichtung viele verschiedene Typen von Dünen erzeugt werden. Mit diesen befassen wir uns in
Kapitel 14
.
Wellen
: Entlang der Küste ist Wasser in Gestalt von Wellen verantwortlich für die Formung der Uferlinie und die Bildung (oder Zerstörung) von Stränden. Die unterschiedlichen Landschaftsformen der Küste, die geschaffen werden, indem Wellen Sedimente abtragen oder anhäufen, sind im Einzelnen in
Kapitel 15
beschrieben.
Die lange Geschichte der Erde verstehen
Ein Vorteil des Geologiestudiums ist es, die in den Gesteinen verborgenen Geheimnisse der Vergangenheit zu erforschen. Sedimentgesteine, die sich, Schicht für Schicht, über lange Zeiträume hinweg gebildet haben, offenbaren uns die Geschichte der Erde. Sie erzählen von Klima- und Umweltveränderungen sowie von der Evolution – beginnend bei Einzellern bis hin zur heutigen Vielfalt des Lebens.
Relative oder absolute Datierung?
Um das Alter von Gesteinen und Gesteinsschichten zu bestimmen, benutzen Wissenschaftler zwei Methoden: die relative und die absolute Datierung.
Bei der relativen Datierung wird das Alter einer Gesteinsschicht mit dem Alter einer anderen Schicht verglichen – die Schicht ist beispielsweise älter oder jünger als eine andere. Die Untersuchung von Gesteinsschichten oder Strata nennt man Stratigrafie. In relativen Datierungsmethoden finden stratigrafische Gesetze wie diese Anwendung:
Unten liegende Gesteinsschichten sind im Allgemeinen älter als Schichten, die über ihnen liegen.
Alle Schichten aus Sedimentgestein wurden ursprünglich horizontal abgelagert.
Werden Schichten von einem anderen Gestein durchkreuzt, so ist dieses Gestein jünger als die Schichten, die es durchschneidet.
Diese und einige andere Gesetze, die in Kapitel 16 beschrieben werden, helfen den Geologen, die sich Stratigrafen nennen, dabei, die Abfolge von Gesteinsschichten so zu interpretieren, dass sie eine relative Abfolge von Ereignissen, die im Laufe der Erdgeschichte stattgefunden haben, darstellen können.
Manchmal reicht es jedoch nicht aus, einfach nur zu wissen, ob etwas älter oder jünger ist als irgendetwas anderes. Absolute Altersdatierungen nutzen daher radioaktive Atome (Isotope), um das tatsächliche Alter verschiedener Gesteine und Gesteinsschichten zu bestimmen. Mithilfe absoluter Datierungsmethoden findet man beispielsweise heraus, dass ein Gestein 2,6 Millionen Jahre alt ist. Diese Methoden basieren auf der aus Laborexperimenten gewonnenen Erkenntnis, dass manche Atome innerhalb einer bestimmten Zeit in andere Atome zerfallen. Nach Messung dieser Zerfallszeit im Labor können Wissenschaftler nun den Anteil der verschiedenen Atome in einem Gestein bestimmen und somit ein nahezu genaues Alter für die Entstehung des Gesteins angeben.
Die Bestimmung des absoluten Alters mithilfe von Isotopen mag kompliziert erscheinen, doch keine Bange: In Kapitel 16 erfahren Sie in allen Einzelheiten, wie absolute Alter ermittelt und wie diese mit relativen Altern kombiniert werden, um die geologische Zeitskala zu erstellen – eine Abfolge, die die geologische Geschichte unseres Planeten in verschiedene Zeiträume (wie Perioden, Epochen und Äonen) unterteilt.
Zeugen der Evolution im Fossilbericht
Die faszinierendste Geschichte, die Gesteine uns erzählen, ist die Geschichte über die Entwicklung der Erde. Entwicklung oder Evolution bedeutet einfach nur Veränderung mit der Zeit – und in der Tat hat sich die Erde in den 4,5 Milliarden Jahren seit ihrer Entstehung entwickelt.
Sowohl die Erde selbst als auch die Organismen, die auf ihr leben, haben sich im Laufe der Zeit verändert. In Kapitel 17 bekommen Sie eine kurze Erklärung, was Biologen unter Evolution verstehen. Vieles, was wir heute über die Entwicklung der Arten wissen, basiert auf versteinerten oder in Gesteinsschichten konservierten Lebewesen, die wir Fossilien nennen. Zwar gibt es verschiedene geologische und chemische Prozesse, die zu einer Fossilisation führen, jedoch nur zwei Formen von Fossilien:
Körperfossilien
: Körperfossilien sind entweder die Überreste eines Lebewesens selbst, ein Negativabdruck im Gestein, eine Sedimentfüllung des Fossilinnenraums (
Steinkern
) oder ein Rückabdruck des Negativabdrucks auf diese Sedimentfüllung (
Prägesteinkern
).
Spurenfossilien
: Spurenfossilien sind Überreste, die von der Aktivität eines Lebewesens zeugen – beispielsweise von seiner Bewegung (Trittsiegel und Fährten) oder seiner Lebensweise (Bauten und Grabgänge). Da viele Tiere ähnliche Spuren erzeugen, kann man in den meisten Fällen nicht von einem Spurenfossil auf dessen Erzeuger schließen.
Nicht immer gab es Leben auf der Erde. In Kapitel 18 werden Sie sehen, dass die frühe Erde zur Zeit der Bildung unseres Sonnensystems ein lebloser, heißer Planet ohne Atmosphäre war. Es dauerte Milliarden von Jahren, bis primitive, einzellige Organismen in Erscheinung traten, deren Ursprünge heute immer noch ein wissenschaftliches Rätsel darstellen.
Primitive, einzellige Lebewesen beherrschten die Erde viele Millionen Jahre lang – bis zur Kambrischen Explosion. In Kapitel 19 erfahren Sie mehr über diese Periode, in der es zu einer relativ plötzlichen Zunahme der Artenvielfalt und Individuenzahl kam. Dort werden auch die folgenden Millionen Jahre beschrieben, in denen Leben fast ausschließlich im Meer zu finden war, bevor die ersten Amphibien begannen, das Land zu besiedeln.
In Kapitel 20 tauchen wir in das Zeitalter der Reptilien ein, in dem Dinosaurier die Welt regierten und andere Reptilien den Himmel und die Meere bevölkerten. In dieser Zeit fanden sich alle Kontinente wie Puzzlestücke zusammen und bildeten den Superkontinent Pangäa. Südamerika und Afrika zeugen heute noch von der Existenz Pangäas – ihre Küstenlinien zeigen, wo die beiden Kontinente einmal miteinander verbunden waren.
Vor – geologisch gesehen – relativ kurzer Zeit übernahmen die Säugetiere die Herrschaft auf der Erde und lösten damit die Reptilien ab. Das Känozoikum, das vor 66 Millionen Jahren begann und in dem wir heute noch leben, ist das jüngste Erdzeitalter. Daher ist es auch anhand der Gesteine, die sich in ihm bildeten, am genauesten von allen zu beschreiben. Alle geologischen Landschaftsformen, die wir heute auf der Erde bewundern, wie der Grand Canyon oder die Berge des Himalayas und der Alpen, bildeten sich in diesem jüngsten Zeitabschnitt heraus. In Kapitel 21 beschäftigen wir uns mit der Evolution der Säugetiere (uns Menschen eingeschlossen) und den geologischen Veränderungen, die seitdem bis heute eintraten.
Durch sogenannte Massenaussterbeereignisse verschwanden im Laufe der Erdgeschichte mehrfach viele unterschiedliche Arten von der Bildfläche. In Kapitel 22 schauen wir uns die fünf größten dieser Aussterbeereignisse genauer an. Wir beschäftigen uns auch mit den häufigsten Ursachen für Massenaussterben, wie zum Beispiel Klimaveränderungen und Meteoriteneinschläge. Am Ende erfahren Sie, wie es durch uns Menschen zu einem erneuten Massenaussterben kommen könnte.
Die Verteilung der Gesteine verstehen
Sicherlich wird es sich nun nicht mehr überraschen, dass die Gesteine nicht zufällig auf der Erde verteilt sind. Jeder Ort hat seine Entstehungsgeschichte, und daher kommen dort genau diejenigen Gesteine vor, die wir an diesem Ort finden können. Die heutige Verteilung der Gesteine ist dabei nur eine Momentaufnahme. Prozesse wie Erosion oder Gebirgsbildung sorgen dafür, dass die Gesteine an jedem Ort der Erde sich laufend verändern.
In Kapitel 23
Kapitel 2
Die Erde durch die wissenschaftliche Brille betrachtet
IN DIESEM KAPITEL
Entdecken Sie den Forscher in sichDie wissenschaftliche Methode anwendenDer Unterschied zwischen Gesetz und Theorie in der WissenschaftDie Sprache der Geologie verstehenDie Geologie ist eine von vielen Naturwissenschaften. Bevor wir uns eingehender mit ihr befassen, möchte ich ein wenig Zeit darauf verwenden, herauszustellen, was Wissenschaft eigentlich ist und wie sie funktioniert. In diesem Kapitel lernen Sie die Grundlagen der Wissenschaft und die wissenschaftliche Methode kennen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie jeden Tag Wissenschaft betreiben, ohne es überhaupt zu merken!
Wissenschaft ist nicht nur etwas für Wissenschaftler
Wissenschaft ist kein Geheimbund für Leute, die gerne Laborkittel tragen und Stunden damit verbringen, durch ein Mikroskop zu starren. Wissenschaft ist einfach nur das Stellen und Beantworten von Fragen. Jedes Mal, wenn Sie eine Entscheidung treffen, indem Sie sich vergegenwärtigen, was Sie wissen, neue Informationen sammeln, eine begründete Vermutung äußern und herauszufinden versuchen, ob Ihre Vermutung richtig ist, betreiben Sie eine Art von Wissenschaft.