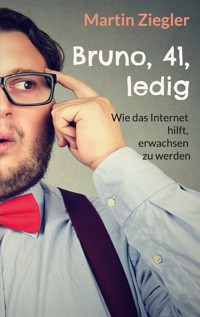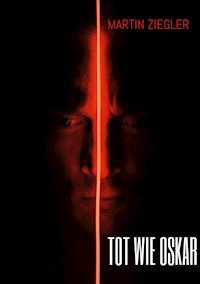52,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Bauingenieur-Praxis
- Sprache: Deutsch
www.ernst-und-sohn.de
Mit der Veröffentlichung der deutschen Fassung des Eurocodes 7-1: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik Teil 1: Allgemeine Regeln als DIN EN 1997-1:2009 und des zugehörigen Nationalen Anhangs DIN EN 1997-1/NA:2010 mit den Ergänzenden Regelungen in DIN EN 1054:2010 liegt das geschlossene neue europäische Normenwerk für die Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau nun für die Anwendung in Deutschland vor. Die in einem Normenhandbuch zusammengefassten Regelungen ersetzen die bisherige DIN 1054:2005.
In dem vorliegenden Buch werden die Grundlagen und Begriffe der Nachweisführung vorgestellt. Soweit nötig wird dabei auch auf die mit geltenden Normen und Empfehlungen wie die Geländebruchnorm DIN 4084 oder die Erddrucknorm DIN 4085 sowie die EAB, EAU, EA-Pfähle und die EBGEO eingegangen. Die erforderlichen Nachweise werden erläutert und anhand von Ablaufdiagrammen und zahlreichen Beispielen verdeutlicht. Dabei werden alle gängigen geotechnischen Aufgaben wie Flächengründungen, Pfahlgründungen, Baugrubenwände, Verankerungen, Stützbauwerke sowie die Versagensformen durch Grundbruch, Geländebruch und hydraulisch bedingtes Versagen angesprochen.
Im Juli 2012 sollen die Eurocodes ohne Übergangsfrist bauaufsichtlich eingeführt werden. Die Beispielsammlung im Buch ermöglicht einen schnellen Einstieg in das neue Normenwerk und bildet so für Geotechniker und Bauingenieure ein unverzichtbares Hilfsmittel bei der Anwendung des Regelwerks in der praktischen Tätigkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 3. Auflage
Vorwort zur 2. Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
Hinweise zum Gebrauch dieses Buches
1 Einführung und Begriffe
1.1 Historischer Rückblick
1.2 Anwendungsbereich
1.3 Baugrunderkundung und Geotechnische Kategorien
1.4 Erläuterungen wichtiger Begriffe
1.5 Sicherheitskonzepte
1.6 Grenzzustände
1.7 Beispiel für eine Anwendung der Kombinationsregeln in der Geotechnik
2 Erddruckermittlung
2.1 Allgemeines
2.2 Aktiver Erddruck
2.3 Erdruhedruck
2.4 Passiver Erddruck (Erdwiderstand)
2.5 Sonderfälle
2.6 Erddruckansatz in Abhängigkeit von der Verschiebung
2.7 Beispiele
3 Gesamtstandsicherheit
3.1 Allgemeines
3.2 Zuordnung zu den Geotechnischen Kategorien
3.3 Versagensmechanismen
3.4 Gleitkreisberechnung
3.5 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
3.6 Beispiele
4 Flächengründungen
4.1 Erforderliche Nachweise
4.2 Zuordnung zu den Geotechnischen Kategorien
4.3 Einwirkungen
4.4 Charakteristische Beanspruchungen
4.5 Bemessungswerte der Beanspruchungen
4.6 Charakteristische Widerstände des Baugrunds
4.7 Bemessungswerte der Widerstände
4.8 Nachweise
4.9 Beispiele
5 Pfahlgründungen
5.1 Allgemeines
5.2 Pfahlsysteme
5.3 Zuordnung zu den Geotechnischen Kategorien
5.4 Einwirkungen
5.5 Beanspruchungen
5.6 Axiale Pfahlwiderstände
5.7 Bemessungswert der axialen Pfahlwiderstände
5.8 Pfahlwiderstände quer zur Pfahlachse
5.9 Nachweise der Tragfähigkeit
5.10 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
5.11 Beispiele
6 Stützbauwerke
6.1 Einteilung der Stützbauwerke
6.2 Einstufung in die Geotechnischen Kategorien
6.3 Grenzzustände
6.4 Einwirkungen
6.5 Bemessung
6.6 Besonderheiten konstruktiver Böschungssicherungen
6.7 Beispiele
7 Baugrubenwände
7.1 Grenzzustände
7.2 Statische Systeme
7.3 Einwirkungen und Beanspruchungen
7.4 Widerstände
7.5 Statische Berechnung
7.6 Nachweise der Grenzzustände
7.7 Beispiele
8 Verankerungen
8.1 Allgemeines
8.2 Zuordnung zu den Geotechnischen Kategorien
8.3 Einwirkungen und Beanspruchungen
8.4 Widerstände
8.5 Nachweise
8.6 Hinweise zu DIN EN 1537 und DIN SPEC 18537
8.7 Beispiel: Verpressanker für Baugrubenverbau
9 Hydraulisch verursachtes Versagen
9.1 Allgemeines
9.2 Nachweis der Sicherheit gegen Aufschwimmen
9.3 Nachweis der Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch
9.4 Innere Erosion und Piping (Erosionsgrundbruch)
9.5 Ergänzungen zur Abgrenzung zwischen Aufschwimmen und hydraulischem Grundbruch
Zitierte Normen und Empfehlungen
Literaturverzeichnis
Univ. Prof. Dr.-Ing. Martin Ziegler
Lehrstuhl für Geotechnik im Bauwesen und
Institut für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Verkehrswasserbau
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Mies-van-der-Rohe-Straße 1
52074 Aachen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2012 Wilhelm Ernst & Sohn, Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Rotherstr. 21, 10245 Berlin, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publisher.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie als solche nicht eigens markiert sind.
Umschlaggestaltung: stilvoll° | Werbe- und Projektagentur, Waldulm Produktion: NEUNPLUS1 – Verlag + Service, Berlin
3. vollständig überarbeitete Auflage
Print ISBN: 978-3-433-02975-6
ePDF ISBN: 978-3-433-60209-6
ePub ISBN: 978-3-433-60208-9
mobi ISBN: 978-3-433-60207-2
oBook ISBN: 978-3-433-60122-8
Vorwort zur 3. Auflage
Gemäß einem Schreiben der Fachkommission Bautechnik der Bauministerkonferenz der Länder (ARGEBAU) soll zum 1. Juli 2012 das erste Paket der Eurocodes, das mit dem EC 7 auch die Geotechnik umfasst, bauaufsichtlich eingeführt werden. Da es sich voraussichtlich um eine Stichtagsregelung handelt, wird der Anwender gezwungen sein, spätestens ab diesem Zeitpunkt die neuen Regelwerke DIN EN 1997-1:2009-09 als deutsche Fassung des EC 7-1 in Verbindung mit dem Nationalen Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 und den Ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 zu benutzen. Neben den relativ wenigen inhaltlichen Änderungen und einer ganzen Reihe von Modifikationen bei den Bezeichnungen wird die größte Umstellung für den Anwender darin bestehen, dass ihm nicht mehr wie bisher mit DIN 1054 in der Fassung von 2005 ein einziges, in sich abgeschlossenes Regelwerk für seine tägliche Arbeit zur Verfügung steht, sondern dass er zukünftig alle drei genannten Regelwerke gleichzeitig beachten muss.
Allein der Regelungsumfang hat sich dadurch mehr als verdoppelt. Auch wenn die Anwendung durch das vom DIN e.V. herausgegebene Normenhandbuch, in dem alle Regelwerke drucktechnisch zusammengefasst sind, gegenüber der parallelen Nutzung der drei Regelwerke nebeneinander vereinfacht wird, bleibt die Schwierigkeit, aus dem Normenhandbuch mit einem gegenüber der bisherigen DIN 1054 mehr als doppelt so hohen Regelungsumfang die für Deutschland verbindlichen Regelungen herauszufiltern.
Das vorliegende Buch will helfen, dabei die Übersicht zu behalten. Das Konzept der vorausgegangenen beiden Auflagen wird auch in der jetzigen Auflage beibehalten. Für die wichtigsten geotechnischen Anwendungsfälle werden zunächst, soweit notwendig, die geotechnischen Zusammenhänge und darauf aufbauend die Nachweisführung erläutert. Daran anschließend finden sich Rechenbeispiele, mit denen die Sicherheitsnachweise nach dem EC 7-1 zahlenmäßig nachvollzogen werden können.
In diesem Zusammenhang gilt mein Dank den Mitarbeitern, die bei der Entstehung dieses Buches tatkräftig mitgearbeitet haben und insbesondere die Berechnungsbeispiele beigesteuert haben. Besonders erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang Dipl.-Ing. Benjamin Aulbach, AOR Dipl.-Ing. Martin Feinendegen, Dipl.-Ing. Marcus Fuchsschwanz, Dipl.-Ing. Felix Jacobs, Dipl.-Ing. Sylvia Kürten, Dipl.-Ing. Rebecca Schüller, Dipl.-Ing. Philipp Siebert, Dipl.-Ing. Julian Sprengel, Dipl.-Ing. Elias Tafur und Dipl-Ing. Judith Tschörtner.
Mein Dank geht ferner an die verschiedenen studentischen Hilfskräfte, die bei der Erstellung der Abbildungen mitgeholfen haben, an Oscar Juarez, M.Sc. und Dipl.-Ing Tobias Krebber für die Durchführung von Vergleichsrechnungen sowie an Frau Herkens, die die Beiträge zu einer druckfähigen Vorlage zusammengeführt hat.
Aachen, im März 2012
M. Ziegler
Vorwort zur 2. Auflage
Mit der Neufassung von DIN 1054 vom Januar 2005 wurden alle Hindernisse beseitigt, die einer bauaufsichtlichen Zulassung von DIN 1054 im Wege standen. Für die bisherige Fassung von November 1976 gilt noch eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2007. Damit wird es für jeden im Bereich der Geotechnik tätigen Ingenieur Zeit, sich intensiv mit den neuen Regelungen zu beschäftigen. Dies umso mehr, als in Kürze mit der Veröffentlichung des Eurocodes DIN EN 1997-1 zu rechnen ist, für den DIN 1054 die Grundlage für die Formulierung eines Nationalen Anwendungsdokuments bildet.
Die Anpassung an die bauaufsichtlichen Anforderungen betreffen insbesondere den Sachverständigen für Geotechnik, der in der jetzigen Fassung von DIN 1054 nicht mehr explizit genannt wird. Verantwortlich für die Planung ist vielmehr der Entwurfsverfasser nach § 54 der Musterbauordnung, der nur bei fehlender Sachkunde und Erfahrung auf dem Gebiet der Geotechnik einen entsprechend qualifizierten Sachverständigen beizuziehen hat. Es bleibt zu hoffen, dass die geotechnischen Anforderungen an eine Bauaufgabe vom Entwurfsverfasser richtig erkannt und eingeschätzt werden und er trotz der überall knappen Finanzmittel die Einschaltung eines Sachverständigen für Geotechnik im Bedarfsfall auch nachdrücklich vom Bauherrn einfordert. Dies ist umso wichtiger, als DIN 4020 „Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke“ als maßgebende Vorschrift für die Baugrunduntersuchung formal nicht bauaufsichtlich eingeführt wird. Allerdings findet sich bei der Aufnahme von DIN 1054 in die Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen in der Fassung von Februar 2005 der Hinweis, dass in DIN 1054 wiederholt Bezug auf die Ergebnisse von Baugrunduntersuchungen genommen wird, die den Anforderungen von DIN 4020:2003-09 genügen müssen. Dabei wird außerdem gefordert, dass die Baugrunduntersuchungen vor der konstruktiven Bearbeitung der baulichen Anlage vorliegen müssen. Dadurch sind, wenn auch leider etwas versteckt, eindeutige Vorgaben an die Art, den Umfang und den Zeitpunkt einer qualifizierten Baugrunduntersuchung formuliert, deren konsequente Beachtung sicher zu einem konflikt- und schadensärmeren Bauen führen würde.
Die sonstigen Änderungen in der Neufassung von DIN 1054 betreffen im Wesentlichen die Regelungen für Zugpfahlgruppen und verankerte Konstruktionen beim Nachweis gegen Abheben und indirekt den Nachweis der Tiefen Gleitfuge, der jetzt durch die zwischenzeitlich erschienene 10. Auflage der Empfehlungen des Arbeitsausschusses „Ufereinfassungen“ konkretisiert werden konnte und entsprechend überarbeitet in die neue Auflage dieses Buches aufgenommen wurde.
Dank sagen möchte ich meinen Mitarbeitern, die mich wie schon bei der 1. Auflage tatkräftig unterstützt haben. Mein Dank geht auch an die Fachkollegen des für DIN 1054 zuständigen Normenausschusses, namentlich an die Herren Dr. Schuppener, Prof. Vogt, Prof. Walz, Prof. Weißenbach und Dr. von Wolffersdorff für ihre wertvollen Hinweise und Interpretationshilfen für den neuen Normungstext.
Aachen, im Juli 2005
M. Ziegler
Vorwort zur 1. Auflage
„Sicherheit ist in der Geotechnik nicht eindeutig bestimmbar“, so die Kernaussage eines Dialogs zwischen Clever und Smart in einer Glosse zum Thema Sicherheit in der Geotechnik1. Clever weiter: „Ingenieure müssen ihre Entscheidungen umsichtig treffen unter Berücksichtigung aller denkbaren Entwicklungen sowie aller vorliegenden Erfahrungen. Sie müssen vor allem wissen, dass sie die Sicherheit eines Bauwerks nicht durch eine Zahl ausdrücken können. Sie können ihre Verantwortung nicht auf eine Norm oder einen Berechnungsalgorithmus abschieben.“ Diese von Clever an einen Ingenieur gestellten Anforderungen sind sicher uneingeschränkt zu bejahen. Auch wird man schwer die Aussage widerlegen können, dass die Sicherheit eines Bauwerks sich nicht durch eine einzige Zahl ausdrücken lässt. Brauchen wir also überhaupt Normen und darüber hinaus sogar Bücher, die diese Normen noch erklären? Reicht es nicht aus, ein Bauwerk auf der Grundlage fundierten Ingenieursachverstands zu dimensionieren?
Folgt man den Gedankengängen von Clever so ist man versucht, diese letzte Frage zu bejahen. Aber müsste man dann nicht in der Lage sein, Ingenieursachverstand als objektive Größe zu beschreiben? Dies wird einem nicht gelingen, denn bei zwei Menschen wird der Wissenshintergrund und Erfahrungshorizont immer unterschiedlich sein, so dass sie trotz konsequenter Anwendung ihres Sachverstands zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können. Und genau hieraus gründet sich die Notwendigkeit von Normen. Normen vereinheitlichen Berechnungsansätze und spiegeln mit ihren Vorgaben für bestimmte Vorgehensweisen, Bauteilabmessungen oder Materialkennwerte die über Jahrzehnte gesammelten Erfahrungen der Fachwelt wider. So kann bis zu einem gewissen Grad vermieden werden, dass erkannte Fehler aus der Vergangenheit von einem unerfahrenen oder nicht wissenden Ingenieur wiederholt werden. Im Prinzip gelangt auch Clever zu dieser Einsicht, wenn er fordert: “Normen sollen Konventionen vereinheitlichen und ansonsten einfach bleiben. Ingenieure sollen ihr Denkvermögen zum Verstehen der mechanischen Vorgänge einsetzen und nicht mit dem Verstehen von komplizierten Normen vergeuden“.
Genau an dieser Stelle liegt der Grund für das Entstehen dieses Buches. Normentexte bleiben auf Grund ihres allgemeinverbindlichen und abschließenden Charakters abstrakt. Da Normen keine Lehrbücher sein sollen und daher weitgehend auf erläuternden Text verzichten, wird das Verständnis von Normentexten oftmals sehr erschwert. Die vielen Querverweise innerhalb eines Normentextes tragen ein Übriges dazu bei.
Diesem Manko soll DIN 1054 betreffend durch dieses Buch abgeholfen werden. Deshalb sind jedem Kapitel vor den Zahlenbeispielen textliche Erläuterungen zu den bodenmechanischen Zusammenhängen vorangestellt, die dazu dienen sollen, die eine oder andere unkommentierte Regelung oder Festlegung von DIN 1054 zu verstehen. Dies gelingt nicht in allen Fällen, da manche Regelungen nur deshalb eingeführt wurden, damit das bislang mit dem globalen Sicherheitskonzept (zahlenmäßig) erreichte Sicherheitsniveau auch weiterhin erhalten bleibt.
Wer sich eingehender mit dem Teilsicherheitskonzept von DIN 1054 beschäftigt, wird im übrigen feststellen, dass die Aufgabe eines Sicherheitsnachweises für die Tragfähigkeit nicht darin besteht, eine definierte Sicherheitszahl anzugeben, sondern vielmehr nachzuweisen, dass ein bestimmter Mindestabstand vom Grenzzustand der Tragfähigkeit eingehalten wird. Dies erfolgt durch den Nachweis, dass die in die Grenzzustandsgleichung eingesetzten Bemessungswiderstände immer größer als die Bemessungseinwirkungen bleiben. Bei den Bemessungsgrößen handelt es sich um fiktive Größen, die bei den Widerständen durch eine Verminderung und bei den Einwirkungen durch eine Erhöhung mit einem definierten Sicherheitsfaktor aus den tatsächlich vorhandenen, aber vorsichtig abgeschätzten charakteristischen Größen erhalten werden. Die Norm legt somit lediglich die Rechengänge für die Berechnung der Bemessungsgrößen und ggf. die Formulierung der Grenzzustandsgleichung fest.
Was sie definitiv nicht festlegt, ist die Zuweisung charakteristischer Werte bei einem geotechnischen Randwertproblem. Hierfür werden lediglich allgemeine Hilfestellungen angeboten. Die wesentliche Ingenieuraufgabe besteht daher darin, die tatsächlich vorhandenen komplexen Verhältnisse durch ein möglichst einfaches, aber dennoch ausreichend genaues Tragsystem abzubilden, und die charakteristischen Größen sowohl auf der Einwirkungs- als auch auf der Widerstandsseite zutreffend festzulegen. Dabei sind der ganze Sachverstand und die Erfahrung des entwerfenden Ingenieurs und des Sachverständigen für Geotechnik gefordert. Die von ihnen getroffenen Festlegungen definieren die eigentliche Sicherheit einer Konstruktion. Die darauf aufbauende Anwendung der Norm zeigt unter Verwendung festgelegter Konventionen lediglich, welcher rechnerische Sicherheitsabstand zum Grenzzustand besteht.
Wer sich diese Zusammenhänge verdeutlicht, wird auch keine Schwierigkeiten damit haben, den von Clever geforderten Ingenieursachverstand und die von ihm im Prinzip abgelehnten Normen in Einklang zu bringen.
An der Entstehung dieses Buches haben die Mitarbeiter am Lehrstuhl, Herr Dipl.-Ing. Christian Baier, Herr Dipl.-Ing. Martin Feinendegen, Herr Dipl.-Ing. Steffen Giese, Frau Dipl.-Ing. Alla Prokhorova, Herr Dipl.-Ing. Parviz Sadegh-Azar, Herr Dipl.-Ing. Volker Timmers und Herr Dipl.-Ing. Bernd Ulke durch Textbeiträge und die Ausarbeitung der Zahlenbeispiele in erheblichem Maße beigetragen. Dafür sei ihnen an dieser Stelle herzlich gedankt. Danken möchte ich auch Frau Gertrud Stahl, die sich der großen Mühe unterzog, den Text druckreif zu formatieren. In diesen Dank möchte ich auch die studentischen Hilfskräfte einschließen, von denen ich stellvertretend Herrn Christian Topler nennen möchte, der einen Großteil der Abbildungen anfertigte. Ein ganz besonderer Dank geht an meinen Kollegen Prof. Dr.-Ing. Konrad Kuntsche, der den Entwurf dieses Buches mit großer Sorgfalt und konstruktiver Kritik kommentiert hat. Nicht in meinem Dank vergessen will ich auch meine Familie, die durch ihre Nachsicht und Geduld erst die Freiräume schuf, die es mir ermöglichten, dieses Buch zu schreiben.
Aachen, im Juni 2004
M. Ziegler
1 Kolymbas, D. und Fellin, W.: Zwischenruf: Ein Dialog über die Sicherheit in der Geotechnik, Bautechnik 80 (2003), Heft 7, Ernst & Sohn
Hinweise zum Gebrauch dieses Buches
Dieses Buch erläutert in insgesamt neun Kapiteln den Eurocode EC 7-1 in Verbindung mit dem Nationalen Anhang und den Ergänzenden Regelungen der DIN 1054 in der Fassung von Dezember 2010. Neben den allgemein gültigen Regelungen des EC 7-1 liegt der Fokus dabei auf der Vorstellung der nationalen Regelungen der DIN 1054. Die einzelnen Kapitel können weitgehend unabhängig voneinander gelesen werden. Allerdings empfiehlt es sich, mit dem ersten Kapitel zu beginnen, da dort zunächst eine allgemeine Übersicht über die Grundsätze und Begriffe der neuen Normen gegeben wird, die sich dann präzisiert für die einzelnen Themen in den folgenden Kapiteln wieder finden. Anschließend sollte Kapitel 2 über die Erddruckermittlung gelesen werden, da diese in den Folgekapiteln immer wieder benötigt wird.
Generell bezieht sich der Verweis auf eine Kapitelnummer auf die entsprechende Passage dieses Buches, während der Verweis auf einen Abschnitt den jeweiligen Abschnitt der zitierten Norm meint. Zitate aus der Norm sind in Anführungszeichen gesetzt.
Den Zahlenbeispielen ist eine textliche Erläuterung vorangestellt, die soweit nötig und möglich, die bodenmechanischen Zusammenhänge erläutert, die hinter den einzelnen Regelungen von EC 7-1 und DIN 1054 stecken. Soweit notwendig, wird auch auf die wesentlichen mitgeltenden Normen und Empfehlungen wie z. B. DIN 4085, EAB oder EAU eingegangen.
Um die Lesbarkeit zu fördern, wird weitgehend darauf verzichtet, Querverweise zur Norm nur durch die Angabe des jeweiligen Abschnitts zu geben. Stattdessen wird die zugehörige Regelung im Text erläutert. Der Bezug zum betreffenden Abschnitt der Norm wird durch eine entsprechende Fußnote hergestellt. Soweit nicht explizit anders bezeichnet, wird unter DIN 1054 die im Dezember 2010 erschienene Neufassung verstanden. Eine Zusammenstellung aller zitierten Normen und Empfehlungen findet sich am Ende dieses Buches.
An mehreren Stellen des Buches sind Hinweise eingearbeitet, die in Kursivschrift gehalten sind. Sie brauchen für das Verstehen der Neuregelungen nicht zwingend gelesen zu werden, fördern aber das Verständnis, da sie oft die Unterschiede zu den bisherigen Regelungen erläutern oder Hintergründe der neuen Regelungen vertieft erläutern.
1
Einführung und Begriffe
1.1 Historischer Rückblick
Seit mehr als 20 Jahren bemüht man sich auf europäischer Ebene, ein verbindliches Nachweisverfahren für die Bestimmung der Sicherheit im Bauwesen zu finden. Dabei wird die Harmonisierung der unterschiedlichen Vorschriften innerhalb der Europäischen Union durch das europäische Normeninstitut CEN (Comité Européen de Normalisation) vorgenommen. Die Normen werden in so genannten Technischen Komitees entwickelt, unter denen das Technische Komitee TC 250 die Aufgabe hat, mit den Eurocodes EC 0 bis EC 9 ein einheitliches Sicherheitskonzept für das gesamte Bauwesen zu erarbeiten (Bild 1-1).
In EC 0 sind die allgemein gültigen Grundsätze des neuen Sicherheitskonzeptes beschrieben. In EC 1 finden sich die Vorgaben zu den Einwirkungen und Lastfällen. Es folgen die fachspezifischen Eurocodes, wobei für die Geotechnik EC 7 maßgebend ist. Er untergliedert sich zukünftig in
Bild 1-1 Organisation des europäischen Normeninstituts CEN
Neben dem TC 250 ist das TC 288 für den Bereich der Geotechnik wichtig. Dort wird unter dem Überbegriff „Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau)“ eine Reihe von Fachnormen erarbeitet, die sich mit der Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau beschäftigen (z.B. DIN EN 12699 „Verdrängungspfähle“). Ähnlich wie DIN 1054 in der Fassung vom Dezember 20101 nur noch die national festzulegenden ergänzenden Regelungen zum EC 7-1 enthält, stellen die Normen der DIN SPEC-Serie die nationalen ergänzenden Regelungen zu den Ausführungsnormen dar.
Zwei Jahre nach der Veröffentlichung des englischen Textes von EC 7 erschien 1996 die deutsche Übersetzung als deutsche und europäische Vornorm DIN V-ENV 1997-1 unter dem Titel „Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik; Teil 1: Allgemeine Regeln2“. Gleichzeitig wurde DIN V 1054-1003 mit ihren Fachnormen als zugehöriges nationales Anwendungsdokument (NAD) in der Normenreihe mit dem Zusatz -100 ebenfalls als Vornorm veröffentlicht.
Aufgabe der damals noch als NAD bezeichneten Ausarbeitung war es, die zum Teil recht allgemein gehaltenen Grundsätze im EC 7-1 länderspezifisch mit konkreten Inhalten zu hinterlegen, insbesondere dort, wo EC 7-1 Alternativen zulässt. Ein Blick in DIN V 1054-100 zeigt allerdings, dass es sich dabei um eine eigenständige und vollständige Norm zur Betrachtung der Sicherheit in der Geotechnik handelte, die zudem einige gravierende inhaltliche Unterschiede zum EC 7-1 enthielt.
Diese betrafen z.B. die Berechnung des Erddrucks oder die Zuordnung der geotechnischen Nachweise zu einem Grenzzustand. Auf deutscher Seite hat man darauf bestanden, die überwiegende Anzahl der geotechnischen Nachweise wie z.B. Gleiten und Grundbruch für den Grenzzustand GZ 1B (heutige Bezeichnung GEO-2) zu führen. Nach EC 7-1 in der Fassung von 1996 hingegen erfolgen diese Nachweise ausschließlich für den Grenzzustand GZ 1C (heutige Bezeichnung GEO-3). Hätte man dieses Konzept übernommen, wäre das in Deutschland bewährte Sicherheitsniveau aufgegeben worden. Auf die Unterschiede der Nachweisführung in den verschiedenen Grenzzuständen wird später noch im Einzelnen eingegangen.
Die zuvor genannten Gegensätze führten konsequenterweise zur Entwicklung einer zunächst eigenständigen DIN 1054. Sie erschien als Entwurf4 im Dezember 2000. Bis auf die Nachweise der Gesamtstandsicherheit (GZ 1C) und der Lagesicherheit (GZ 1A) war darin durchgängig die Philosophie zu finden, die Nachweise im Grenzzustand GZ 1B zu führen, bei dem das System zunächst mit charakteristischen Größen durchgerechnet wird und die Teilsicherheitsbeiwerte erst unmittelbar vor Auswertung der Grenzzustandsgleichung in die Berechnung aufgenommen werden. Der Gelbdruck von E DIN 1054 enthielt allerdings noch sehr viele Fehler, die erst mit ihrer Veröffentlichung im Weißdruck5 im Januar 2003 bereinigt wurden.
1 DIN 1054:2010-12
2 DIN V-ENV 1997-1:1996-04
3 DIN V 1054-100:1996-04
4 E DIN 1054:2000-12
5 DIN 1054:2003-01
Bereits zwei Jahre später ist DIN 1054 in zweiter Auflage1 erschienen. Grund für die Neuauflage war neben der Berichtigung von Schreib- und kleineren inhaltlichen Fehlern insbesondere die Anpassung an die Erfordernisse für die bauaufsichtliche Einführung. Diese betrafen neben der Abgleichung der normativen Verweise in erster Linie die Rolle des Sachverständigen für Geotechnik, der in der Fassung von Januar 2005 nicht mehr explizit genannt wurde. Des Weiteren enthielten zwei neu aufgenommene Anhänge F und G Übergangsregelungen für Normen und Technische Baubestimmungen, die bis zum damaligen Zeitpunkt noch nicht auf das neue Teilsicherheitskonzept umgestellt worden waren. Nach diesen Anpassungen wurde DIN 1054 zügig in die Musterliste der Technischen Baubestimmungen der Fachkommission Bau aufgenommen und durch die Länder bauaufsichtlich eingeführt.
Nach der bauaufsichtlichen Einführung von DIN 1054 in der Fassung von 2005 konnte die alte Norm aus dem Jahr 1976 mit ihren Fachnormen noch während einer Übergangsfrist von drei Jahren weiter angewendet werden, sofern der Auftraggeber nicht explizit die Anwendung der neuen Norm forderte. Generell bestand allerdings ein Mischungsverbot zwischen Normen der alten und der neuen Generation.
Im Gegensatz zur Fassung von 2005, die als übergeordnete Grundsatznorm der Geotechnik betrachtet werden konnte, war die alte Ausgabe von 1976 keineswegs so umfassend. Sie stellte eher eine „Gründungsnorm“ dar, was auch schon durch den Titel „Zulässige Belastung des Baugrunds“ zum Ausdruck kommt. Viele Regelungen zur Nachweisführung und zur Berechnung der Sicherheit waren dabei nicht in der alten Ausgabe von DIN 1054 selbst, sondern in den einzelnen Fachnormen enthalten.
Generell wurde bei der alten Normenreihe von 1976 das globale Sicherheitskonzept angewendet, bei dem die maximal mobilisierbaren charakteristischen Widerstände Rk den vorhandenen charakteristischen Beanspruchungen Ek gegenübergestellt wurden. Zum Teil war aber auch schon alternativ die Nachweisführung nach dem Teilsicherheitskonzept mit abgeminderten Scherparametern erlaubt, so z.B. in DIN 4017:1979-08 (Grundbruch) und in DIN 4084:1981-07 (Gelände- und Böschungsbruch).
Im Gegensatz dazu wird in den nachfolgenden Versionen von DIN 1054 durchgängig das Teilsicherheitskonzept angewendet. Dabei werden die mit individuellen Teilsicherheitsbeiwerten erhöhten Bemessungsbeanspruchungen Ed den mit anderen individuellen Teilsicherheitsbeiwerten verminderten Bemessungswiderständen Rd gegenübergestellt. Wie später noch ausführlich erläutert wird, werden dabei die Teilsicherheitsbeiwerte je nach betrachtetem Grenzzustand erst unmittelbar vor Auswertung der Grenzzustandsgleichung (Grenzzustand GEO-2) oder bereits vor der eigentlichen Berechnung (Grenzzustand GEO-3) eingeführt. Ausreichende Sicherheit ist gegeben, wenn Rd - Ed ≥ 0 gilt.
Parallel zur Neufassung von DIN 1054 war mit der Überarbeitung des Eurocode EC 7-1 begonnen worden, der in Deutschland im Oktober 2005 als deutsche Norm DIN EN 1997-1 erschien.
1 DIN 1054:2005-01
In dieser Fassung des EC 7-1 stehen verschiedene Nachweiskonzepte gleichberechtigt nebeneinander, so u.a. auch die Vorgehensweise nach DIN 1054:2005-01. Die Hauptkonfliktpunkte, die zur Parallelentwicklung von DIN 1054 geführt hatten, waren damit beseitigt.
Mit der Ratifizierung des EC 7-1 begann die eigentlich nur zweijährige Kalibrierungsphase, innerhalb derer die nationalen Normen an den EC-7-1 anzupassen waren und ein Nationaler Anhang (NA) geschaffen werden musste.
Direkt anschließend sollte die so genannte Koexistenzperiode von drei Jahren beginnen, innerhalb derer die nationalen Normen noch parallel neben dem Eurocode hätten angewendet werden dürfen. Die im Januar 2005 erschienene Fassung von DIN 1054 hätte nach diesem Zeitplan dann bereits im Jahr 2010 wieder zurückgezogen werden müssen (Bild 1-2).
Bild 1-2 Ursprünglicher und aktueller Zeitplan für die Einführung des Eurocodes DIN EN 1997-1 (nach Schuppener, 2005)
Dieser Zeitplan konnte nicht eingehalten werden. Es kam vielmehr im Jahr 2008 zu einer Neufassung und schließlich im September 2009 zu einer überarbeiteten Fassung von DIN EN 1997-11. Der dazu gehörende Nationale Anhang erschien im Dezember 2010 als DIN EN 1997-1/NA mit den in DIN 1054:2010-12 niedergeschriebenen ergänzenden Regelungen.
Da der Nationale Anhang mit den Ergänzenden Regelungen aber nur noch Informationen zu den Punkten enthalten darf, die im Eurocode einer nationalen Festlegung vorbehalten sind, und keine Festlegungen mehr aufgenommen werden dürfen, die bereits im EC 7-1 geregelt sind, mussten sehr viele Textpassagen aus DIN 1054 in der Fassung von 2005 entfallen.
1 DIN EN 1997-1:2009-01
Zu den Punkten, die national geregelt werden dürfen zählen z.B. Verfahren und Werte, bei denen der Eurocode Alternativen zulässt. Außerdem gehören geografisch und klimatisch bedingte Kenngrößen, wie z.B. Erdbebenstärken oder Schneehöhenwerte zu den national zu regelnden Elementen. Darüber hinaus kann im NA entschieden werden, ob informative Anhänge verpflichtend zur Anwendung kommen sollen oder nicht. Erlaubt sind ferner ergänzende Hinweise zu den einzelnen Regelungen, sofern sie dem Inhalt der Regelung im Eurocode nicht widersprechen. Insbesondere dürfen auch die Teilsicherheitsbeiwerte national festgelegt werden.
Der Anwender muss zukünftig drei Regelwerke gleichzeitig betrachten. Die übergeordneten Regelungen enthält der EC 7-1 bzw. DIN EN 1997-1 als deutsche Übersetzung. Der Anwender muss dann prüfen, ob an der Stelle, wo eine nationale Regelung möglich ist, eine entsprechende Festlegung im Nationalen Anhang getroffen wird. Trifft dies zu, muss er weiter dem Verweis im NA auf die Ergänzenden Regelungen in DIN 1054 folgen. Im schlimmsten Fall trifft er dort auf weitere Verweise zu mit geltenden Normen oder Empfehlungen.
Bild 1-3 Verknüpfung von DIN EN 1997-1, Nationalem Anhang und Ergänzenden Regelungen in einem Normenhandbuch (nach Schuppener, 2005)
Da die beschriebene gleichzeitige Anwendung dreier Regelwerke die Anwendung in der Praxis erheblich erschweren würde, wurde seitens des DIN e.V. ein sogenanntes Normenhandbuch herausgebracht, in dem alle drei Regelwerke drucktechnisch in einem Werk zusammengefasst sind. Die Nationalen Regelungen und Ergänzungen stehen dabei genau an der Stelle, wo der EC 7-1 eine nationale Regelung eröffnet, und sie sind farblich vom Text des EC 7-1 abgesetzt. Durch dieses Normenhandbuch wird die Anwendung erheblich erleichtert. Einen Überblick, wie der EC 7-1, der Nationale Anhang mit den Ergänzenden Regelungen in DIN 1054 zukünftig nebeneinander stehen und wie diese im Normenhandbuch zusammengefasst werden, gibt Bild 1-3.
Die nachfolgenden Ausführungen in diesem Buch beschränken sich auf die allgemeingültigen Regelungen des EC 7-1 sowie die national festgelegten Regelungen wie sie im Normenhandbuch zu finden sind. Mögliche Alternativen nach EC 7-1 werden nur dort kurz angerissen, wo sie zum besseren Verständnis der in Deutschland getroffenen Festlegungen dienen.
1.2 Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich von EN 1997 ist in Abschnitt 1 der Norm geregelt: Sie soll die geotechnischen Gesichtspunkte bei der Planung von Hoch- und Ingenieurbauwerken behandeln. Sie gilt in Verbindung mit EN 1990:2002, in der Grundsätze und Anforderungen für Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit festgelegt sind. Zahlenwerte für die Einwirkungen bei der Planung von Hoch- und Industriebauten kommen aus EN 1991. Einwirkungen aus dem Baugrund wie Erddrücke ergeben sich aus EN 1997. Ergänzende Regelungen für einen erdbebensicheren Entwurf finden sich in EN 1998.
Der Anwendungsbereich von DIN 1054 ist der gleiche wie von EN 1997-1. Ebenso wie der nationale Anhang DIN EN 1997-1/NA gilt DIN 1054 nur in Verbindung mit DIN EN 1997-1, der deutschen Übersetzung von EN 1997-1. Der Anwendungsbereich der Norm auf Braunkohletagebauten wird in DIN 1054 explizit ausgenommen. Ebenso wird die Gebrauchstauglichkeit durch Qualitätssicherung, z.B. der Nachweis der Einhaltung ausreichender Dichtigkeit, ausgenommen.
Prinzipiell unterscheidet EN 1997-1 zwischen Grundsätzen und Anwendungsregeln. Den Grundsätzen wird im Text der Buchstabe P vorausgestellt. Sie umfassen
Anwendungsregeln sind Beispiele allgemein anerkannter Regeln, die den Grundsätzen und den Anforderungen entsprechen. In diesem Sinne stellen die ergänzenden Regelungen von DIN 1054 Anwendungsregelungen dar. Generell dürfen auch alternative Anwendungsregelungen verwendet werden, wenn sie den einschlägigen Grundsätzen entsprechen und ein gleiches Niveau an Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit ergeben wie bei Anwendung des Eurocodes.
1.3 Baugrunderkundung und Geotechnische Kategorien
Die Anwendung der im Normenhandbuch beschriebenen Sicherheitsnachweise setzt voraus, dass eine ausreichende Erkundung und Untersuchung des Baugrunds stattgefunden hat. Die Regelungen, wie diese zu erfolgen hat, finden sich in DIN EN 1997-2 in Verbindung mit dem Nationalen Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 und den Ergänzenden Regelungen in DIN 4020:2010-12. Auch diese drei Regelwerke wurden in einem Normenhandbuch Eurocode 7, Band 2: Erkundung und Untersuchung zusammengefasst.
Es ist die Aufgabe des Entwurfsverfassers, den Bauherrn rechtzeitig auf die Notwendigkeit einer geotechnischen Untersuchung hinzuweisen. Diese sind vom Bauherrn zu beauftragen. Falls der Entwurfsverfasser nicht selbst über die notwendige Sachkunde verfügt, ist zur Durchführung ein Sachverständiger für Geotechnik einzuschalten. Seine Aufgabe ist es, die erforderlichen geotechnischen Untersuchungen und Messungen zu planen und die fachgerechte Durchführung der Feld- und Laborarbeiten zu überwachen. Aus den Ergebnissen dieser Untersuchungen hat er die charakteristischen Werte für die Baugrundkenngrößen und Grundwasserstände festzulegen, die später Eingang in die Berechnung zur Überprüfung der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit finden. Es ist weiter seine Aufgabe, aus den Ergebnissen der Baugrunduntersuchung Wechselwirkungen zwischen Bauwerk und Boden und daraus resultierende Folgerungen für die Planung und Konstruktion aufzuzeigen und dem Bauherrn und den beteiligten Fachplanern mitzuteilen.
Die Ergebnisse ihrer Bewertung und die sich daraus ergebenden Gründungsempfehlungen und Hinweise auf die Bauausführung sind in einem Geotechnischen Bericht zusammenzufassen. Aufbau und inhaltliche Anforderungen an diesen Bericht sind ausführlich in Kapitel 7 des Normenhandbuchs zum EC 7-2 beschrieben.
Die Mindestanforderungen an Umfang und Qualität der durchzuführenden geotechnischen Untersuchungen, Berechnungen und Überwachungsmaßnahmen richten sich nach der Geotechnischen Kategorie. Dabei wird eine Aufteilung in drei Kategorien vorgenommen:
Geotechnische Kategorie GK 1
Sie umfasst Baumaßnahmen mit geringem Schwierigkeitsgrad hinsichtlich Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit, die mit vereinfachten Verfahren aufgrund von Erfahrungen hinreichend beurteilt werden können. Sie setzt einfache und überschaubare Baugrundverhältnisse voraus.
Geotechnische Kategorie GK 2
Sie umfasst Baumaßnahmen mit mittlerem Schwierigkeitsgrad im Hinblick auf Bauwerke und Baugrund. Sie erfordern eine ingenieurmäßige Bearbeitung und einen rechnerischen Nachweis der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit auf der Grundlage von geotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Geotechnische Kategorie GK 3
Sie umfasst Baumaßnahmen mit hohem Schwierigkeitsgrad. Insbesondere Bauwerke, bei denen die Beobachtungsmethode zum Nachweis der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit zum Einsatz kommt, sind in die Geotechnische Kategorie GK 3 einzustufen. Bauwerke der Geotechnischen Kategorie GK 3 erfordern eine ingenieurmäßige Bearbeitung und einen rechnerischen Nachweis der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit auf der Grundlage von zusätzlichen Untersuchungen und von vertieften Kenntnissen und Erfahrungen in dem jeweiligen Spezialgebiet.
Die Einordnung einer Baumaßnahme in eine Geotechnische Kategorie erfolgt zu Beginn der Planungen. Eine spätere Änderung aufgrund der beim Bau vorgefundenen Verhältnisse ist möglich und u.U. notwendig.
Detaillierte Zuordnungen geotechnischer Konstruktionen zu den Geotechnischen Kategorien finden sich in den jeweiligen Abschnitten des Normenhandbuchs, in denen die zugehörigen Sicherheitsnachweise behandelt werden. Weitere Beispiele der Zuordnung in die einzelnen Geotechnischen Kategorien finden sich in Anhang AA von DIN 1054. Die Einstufung erfolgt dort nach Kriterien, die sich aus
ergeben. Tabelle 1-1 zeigt Beispiele für die Konkretisierung dieser Kriterien.
Tabelle 1-1 Beispiele für die Zuordnung zu Geotechnischen Kategorien nach, Tabelle AA.1 (Auszug) von DIN 1054:2010-12
Hinsichtlich der Baugrundbeschaffenheit unterscheidet DIN 1054 zunächst zwischen Festgesteinen und Lockergesteinen1. Festgesteine werden mit dem Sammelbegriff „Fels“ und Lockergesteine mit dem Sammelbegriff „Boden“ benannt.
Bild 1-4 Einteilung in nichtbindige und bindige Böden in Anlehnung an DIN 18196:2011-05
1 DIN 1054:2010-12, 3.3.2
Die Bodenarten sind nach DIN EN ISO 14688-1 zu beschreiben, nach DIN 4023 darzustellen und nach DIN EN ISO 14688-2 und DIN 18196 zu klassifizieren1. Die Einteilung in nichtbindige, bindige und organische bzw. organogene Böden folgt in Anlehnung an DIN 18196. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen bindigen und nichtbindigen Böden ist dabei der Massenanteil M0,06 an Bodenbestandteilen mit Korngrößen < 0,06 mm. Als weiteres Unterscheidungsmerkmal wird bei gemischtkörnigen Böden herangezogen, ob das plastische Verhalten durch den Feinkornanteil bestimmt wird oder nicht. Die vereinfachte Einteilung der Böden in bindige und nichtbindige Böden nach DIN 1054 mit Zuordnung zu den Bodengruppen nach DIN 18196 ist aus Bild 1-4 ersichtlich.
Böden wie Torf und Faulschlamm, die den Bodengruppen HN, HZ und F nach DIN 18196 zuzuordnen sind, werden als organische Böden bezeichnet. Sie sind brenn- oder schwelbar. Nicht brenn- oder schwelbare Böden mit organischen Beimengungen werden als organogene Böden bezeichnet. Sie entsprechen den Bodengruppen OU, OT, OH und OK nach DIN 18196. Organische und organogene Böden sind für die meisten bautechnischen Zwecke nicht oder nur sehr eingeschränkt einsetzbar.
1.4 Erläuterungen wichtiger Begriffe
In diesem Kapitel folgt eine Erläuterung der wichtigsten Begriffe in DIN EN 1997-1 und DIN 1054, die für das Verständnis des neuen Sicherheitskonzepts notwendig sind und die sich durchgängig in den einzelnen Abschnitten der Regelwerke wiederfinden.
1.4.1 Einwirkungen
Der Begriff der Einwirkung ist übergeordnet in DIN EN 19902 geregelt. In ihr werden Einwirkungen unterschieden in
Weiter wird unterschieden in
1 DIN 1054:2010-12, 3.3.2 A (3)
2 DIN EN 1990:2010-12, 15.3
Diese vielfältigen Einwirkungsarten werden in DIN 1054 gemäß Bild 1-5 auf die drei Hauptgruppen
beschränkt. Eine Sonderrolle nehmen Einwirkungen aus Erdbeben ein, für die DIN EN 1998-5/NA zu beachten ist und die in einer eigenen Bemessungssituation berücksichtigt werden.
Generell muss bei den Einwirkungen zwischen ständigen und veränderlichen Einwirkungen unterschieden werden, da diese bei den meisten Nachweisen mit unterschiedlichen Teilsicherheitsbeiwerten belegt werden. Die veränderlichen Einwirkungen sind ferner in günstige und ungünstige Einwirkungen aufzuteilen. Im Gegensatz zu den allgemeinen Empfehlungen des EC 7-1 wird in Deutschland bei den ständigen Einwirkungen eine solche Aufteilung nur bei Zugpfählen mit gleichzeitiger Druckbeanspruchung vorgenommen1.
Bild 1-5 Einteilung der Einwirkungen in der Geotechnik ohne Erdbebenbelastung
Gründungslasten
Gründungslasten2 werden nach DIN 1054 als Schnittgrößen aus der statischen Berechnung des aufliegenden Tragwerks am Übergang zur Gründungskonstruktion definiert. Sie sind als charakteristische bzw. repräsentative Schnittgrößen für jede kritische Bemessungssituation anzugeben.
Die Übernahme von charakteristischen Gründungslasten aus der Tragwerksplanung bedarf einer engen Abstimmung zwischen dem Tragwerksplaner und dem Sachverständigen für Geotechnik, da im Konstruktiven Ingenieurbau im Gegensatz zu den meisten Nachweisen der Geotechnik die statische Berechnung bereits mit Bemessungswerten durchgeführt wird. Dies bedeutet, dass die Einwirkungen noch vor der Ermittlung der Schnittgrößen mit den jeweiligen Teilsicherheitsbeiwerten erhöht werden. Hinzu kommt, dass im Hochbau die ständigen und die verschiedenen veränderlichen Einwirkungen nicht einfach addiert, sondern über Kombinationsbeiwerte ψi < 1,0 gekoppelt werden, die zum Ausdruck bringen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht alle Einwirkungen gleichzeitig und in voller Höhe wirken. Die auf diese Weise erhaltenen Kombinationen der Einwirkungen werden repräsentative Werte genannt. Sofern die statische Berechnung auf einer linear-elastischen Schnittgrößenermittlung beruht, können die charakteristischen bzw. repräsentativen Werte für die Beanspruchungen aus ständigen Einwirkungen und denen aus (kombinierten) veränderlichen im Prinzip dadurch erhalten werden, dass die als Ergebnis mit Bemessungsgrößen erhaltenen entsprechenden Anteile wieder durch die jeweiligen Teilsicherheitsbeiwerte dividiert werden. Voraussetzung dafür ist, dass die im Ergebnis der statischen Berechnungen erhaltenen Schnittgrößen tatsächlich auch aus derselben Lastkombination stammen und nicht nur eine Zusammenstellung der jeweils ungünstigsten Schnittgrößen aus verschiedenen Lastkombinationen enthält, wie sie von vielen Rechenprogrammen ausgegeben werden.
1 DIN 1054:2010-12, 7.6.3.1 A (2)
2 DIN 1054:2010-12, A 2.4.2.3 A (1)
In der Praxis beobachtet man oft, dass die Bemessungsgrößen aus der statischen Berechnung durch den Mittelwert der Teilsicherheitsbeiwerte für ständige und veränderliche Einwirkungen dividiert werden für den Grenzzustand GEO-2 in der Bemessungssituation BS-P. Diese Vorgehensweise liegt nur dann auf der sicheren Seite, wenn die Auswirkungen aus den veränderlichen Einwirkungen überwiegen, da dann der „echte“ Wert des gemittelten Teilsicherheitsbeiwerts über 1,42 (GEO-2, BS-P) liegen würde. Bei stärkerem Einfluss der ständigen Einwirkungen liegt man mit hingegen auf der unsicheren Seite. Sofern im Ergebnis der statischen Berechnung die Anteile aus ständigen und veränderlichen Einwirkungen getrennt ausgegeben sind, sollte man daher auf die Mittelwertbildung verzichten und direkt die jeweiligen Anteile durch die zugehörigen Teilsicherheitsbeiwerte dividieren.
Wurde die statische Berechnung mit einem nichtlinearen Verfahren, z.B. nach der Plastizitätstheorie, aber noch nach Theorie 1. Ordnung durchgeführt, so darf die Aufteilung in ständige und veränderliche Auswirkungen so vorgenommen werden, wie es sich bei linearer Berechnung oder am statisch bestimmten Tragwerk ergeben hätte. Die so bestimmten Anteile der Bemessungswerte EG,d und EQ,d dürfen dann durch die zugehörigen Teilsicherheitsbeiwerte γG und γQ nach Tabelle A 2.1 von DIN 1054 dividiert werden, um die äquivalenten charakteristischen Werte EG,k und EQ,k bzw. EQ,rep zu erhalten.
Geotechnische Einwirkungen
Zu den wichtigsten geotechnischen Einwirkungen1 zählen:
1 DIN EN 1997-1:2009-09, A 2.4.2.1 (4) und DIN 1054:2010-12, A 2.4.2.2
Besondere Aufmerksamkeit erfordert in der Geotechnik neben dem Wasserdruck vor allem der Ansatz des Erddrucks. Sowohl die Größe als auch die Verteilung des Erddrucks hängen von den infolge einer Beanspruchung stattgefundenen Verschiebungen im Erdreich ab. Bild 1-6 zeigt qualitativ die Entwicklung der resultierenden Erddruckkraft E bei einer Fußpunktdrehung der Wand. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Grenzwerte des aktiven Erddrucks Ea bzw. des passiven Erddrucks (Erdwiderstands) Ep erst nach einer gewissen Mindestverschiebung erreicht werden, die im passiven Fall allerdings deutlich größer ist als im aktiven Fall. Um die Verformungen in akzeptablen Grenzen zu halten, kann es bei empfindlichen Bauwerken notwendig werden, den charakteristischen Wert des Erdwiderstands durch einen Anpassungsfaktor η < 1,0 von vorneherein zu begrenzen. Dies kann z.B. bei der Einbindung einer Baugrubenwand in weichem Boden der Fall sein1.
Der passive Erddruck stellt in der Regel eine Widerstandsgröße dar. In einzelnen Nachweisen wird er aber auch als günstige Einwirkung angesetzt (z.B. Grundbruchnachweis). Näheres zu seiner Ermittlung findet sich in Kapitel 2 Erddruckermittlung.
Bild 1-6 Abhängigkeit der resultierenden Erddruckkraft von der Verschiebung der Wand bei einer Fußpunktdrehung
Im aktiven Fall kann es notwendig werden, einen erhöhten aktiven Erddruck anzusetzen und zwar dann, wenn die Verformungen einer Stützkonstruktion begrenzt bleiben sollen und dies durch die Wahl der Stützkonstruktion (z.B. massive Schlitzwand) auch bautechnisch realisiert wird. Häufig wird der erhöhte aktive Erddruck E'a als Mittelwert zwischen dem Ruhedruck E0 (keine Wandverschiebung) und dem aktiven Erddruck Ea festgelegt. Neben der Höhe des anzusetzenden Erddrucks ist die Verformbarkeit der Wand auch bei der Festlegung der erforderlichen Vorspannkraft von Ankern zu berücksichtigen. Näheres hierzu und zur Festlegung und Bestimmung des ggf. erhöhten aktiven Erddrucks findet sich in den Kapiteln 6 Stützbauwerke, 7 Baugrubenwände und 8 Verankerungen.
1 DIN 1054:2010-12, 9.8.2 A (2)
Für die Ermittlung des charakteristischen Wasserdrucks ist sowohl ein höchster als auch ein niedrigster Wasserstand festzulegen, da beide Wasserstände bei der Bemessung von Bauwerken zu den maßgebenden Beanspruchungen beitragen können. Die Festlegung dieser für die Bemessung relevanten Wasserstände kann sich an den Extremwasserständen orientieren, die während der voraussichtlichen Vertrags- oder Lebensdauer eines Bauwerks oder während eines vorgegebenen Zeitraums auftreten. Die Bemessungswasserstände können aber auch vertraglich festgelegt werden, z.B. durch Angabe eines Wasserstandes, ab dem eine Baugrube zur Verhinderung größerer Schäden geflutet werden soll1.
Der festgelegte niedrigste Bemessungswasserstand wird als ständige Einwirkung behandelt. Darüber hinausgehende Wasserstände werden je nach ihrer Eintretenswahrscheinlichkeit als regelmäßig veränderliche (Bemessungssituation BS-P), seltene (BS-T) oder außergewöhnliche Einwirkungen (BS-A) betrachtet. Je nach getroffenem Ansatz werden diese in den Sicherheitsnachweisen dann mit unterschiedlich hohen Teilsicherheitsbeiwerten beaufschlagt. Unabhängig von dieser Anordnung darf bei der Ermittlung der Bemessungswerte der Beanspruchungen der gesamte Wasserdruck mit den Teilsicherheiten für ständige Einwirkungen nach Tabelle A 2-1 von DIN 1054 belegt werden2.
Bei unterschiedlichen Wasserständen vor und hinter einer Baugrubenwand findet im Boden eine Strömung statt. Durch sie wird einerseits der hydrostatische Druck längs des Strömungsweges abgebaut, andererseits wird aber die effektive Wichte des Bodens je nach Strömungsrichtung erhöht oder auch vermindert, was dann bei der Berechnung des aktiven Erddrucks bzw. des Erdwiderstands entsprechend berücksichtigt werden muss. Nur in einfachen Fällen ist es zulässig, vereinfachend den hydrostatischen Wasserdruck auf beiden Seiten der Wand anzusetzen3. Sofern durch bauliche Maßnahmen wie Dräns oder Entspannungsbrunnen eine dauerhafte Begrenzung des Wasserdrucks erreicht werden soll, darf eine solche Wirkung nur angesetzt werden, wenn sie dauerhaft sichergestellt werden kann, regelmäßig überwacht wird und im Havariefall zusätzliche Flutungs- oder Ballastierungsmöglichkeiten vorgesehen sind4. Weitere Erläuterungen zu den Wirkungen von Wasser im Boden finden sich in den Kapiteln 7 Baugrubenwände und 9 Hydraulisch verursachtes Versagen.
Dynamische Einwirkungen
Zu den dynamischen Einwirkungen zählen u.a.:
1 DIN 1054:2010-12, 9.3.2.3 A (1a)
2 DIN 1054:2010-12, 9.6 A (4)
3 DIN 1054:2010-12, 9.6 A (8)
4 DIN 1054:2010-12, 9.6 A (6)
Übliche Dynamische Einwirkungen dürfen in der Regel als veränderliche statische Einwirkungen berücksichtigt werden. Im Einzelfall muss aber geprüft werden, ob nicht die Massenträgheitskräfte oder Verformungs- oder Porenwasserdruckakkumulationen in den Berechnungen mit berücksichtigt werden müssen. Für die Berücksichtigung von Erdbeben ist DIN EN 1998-5/NA zu beachten. Dynamische Einwirkungen und Einwirkungen aus Erdbeben werden im Rahmen dieses Buches nicht weiter behandelt1.
1.4.2 Widerstände
Widerstände werden durch die Festigkeit des beanspruchten Materials hervorgerufen. Beispielhaft seien hier die Betondruckfestigkeit bei der Bemessung einer Schlitzwand genannt (Bild 1-7a). Materialwiderstände werden prinzipiell in der jeweiligen Bauteilnorm behandelt. Eine Ausnahme stellt lediglich der Materialwiderstand des Stahlzuggliedes bei einem Anker dar, für den explizit noch in einer Fußnote von Tabelle A 2.3 von DIN 1054 ein Teilsicherheitsbeiwert genannt wird.
Bild 1-7 Widerstände: a) Materialwiderstände, b) direkte Scherwiderstände, c) abgeleitete summarische Widerstände
1 DIN 1054:2010-12, A 2.4.2.1, A (8a) bis A (8c)
Die Festigkeit des Bodens wird durch die Scherparameter Reibung und Kohäsion beschrieben. Bei manchen Nachweisen werden - wie im Beispiel des abrutschenden Erdkeils - direkt die Scherparameter auf die Bemessungsgrößen abgemindert und die damit berechneten Reibungs- und Kohäsionskräfte in der Gleitfuge angesetzt (Bild 1-7b). Bei anderen Nachweisen werden aber auch daraus abgeleitete summarische Größen, die zudem mit unveränderten, d.h. charakteristischen Scherparametern ermittelt wurden, als Widerstände bezeichnet. Wichtige Vertreter dieser Gruppe sind der Erdwiderstand, der Grundbruchwiderstand, der Pfahlwiderstand (Bild 1-7c) oder auch der Hausziehwiderstand eines Ankers. Die Abminderung dieser Widerstände findet erst bei der direkten Gegenüberstellung mit den Bemessungsbeanspruchungen statt.
Im Vorgriff auf Kapitel 1.5 sei hier erwähnt, dass es sich bei der Vorgehensweise nach Bild 1-7b um die Nachweisführung gemäß Grenzzustand GEO-3 handelt, während die Vorgehensweise nach Bild 1-7c der Nachweisführung im Grenzzustand GEO-2 entspricht. Letztere ist auch in der Neufassung von DIN 1054 weiterhin für die meisten geotechnischen Nachweise, wie z.B. Gleiten und Grundbruch vorgesehen.
Problematisch ist in der Geotechnik, dass sich Widerstände und Einwirkungen nicht immer sauber voneinander trennen lassen. Ein einfaches Beispiel ist der Erddruck auf eine Baugrubenwand (Bild 1-8a). Hier hängen sowohl der aktive Erddruck auf der Wandrückseite als Einwirkung als auch der passive Erddruck vor dem Wandfuß als Erdwiderstand vom Reibungswinkel ab, wobei sich beide Erddrücke formal auch noch nach den gleichen Formeln - nur mit umgekehrten Vorzeichen - ergeben.
Des Weiteren hat es einen direkten Einfluss auf die Erddruckberechnung, ob die Teilsicherheitsbeiwerte gleich zu Beginn auf die Scherparameter angewendet oder erst nach Berechnung der Erddruckkräfte herangezogen werden.
Mindert man vor der Berechnung der Erddrücke den charakteristischen Reibungsbeiwert tan φk auf den Bemessungswert tan φd ab, erhält man andere Erddruckgrößen, als wenn man zunächst mit dem charakteristischen Reibungswinkel φk den charakteristischen Erddruck Ea,k und den charakteristischen Erdwiderstand Ep.k berechnet und daraus nachträglich die Bemessungsgrößen Ea,d und Ep,d bildet, indem man den aktiven Erddruck mit dem Teilsicherheitsbeiwert γG multipliziert und den Erdwiderstand durch den Teilsicherheitsbeiwert γR,e dividiert. Für den Erdwiderstand neben Gründungen wird in DIN 1054 die Bezeichnung Rp verwendet, an anderer Stelle aber weiterhin Ep. Allerdings wurde γEp generell in γR,e umbenannt.
Die erste Methode entspricht wieder der Vorgehensweise im Grenzzustand GEO-3, während der zweite Weg im Grenzzustand GEO-2 angewendet wird. Die Teilsicherheitsbeiwerte γG für die Einwirkungen, γφ für die geotechnischen Größen und γR,e für die Widerstände sind den Tabellen A2.1 bis A2.3 von DIN 1054 entnommen.
Es ist offenkundig, dass nach den beiden Methoden unterschiedliche Abmessungen für die Fußeinspannung der Wand erhalten werden, wobei aufgrund der Nichtlinearität der Erddruckformeln keine allgemeine Regel angegeben werden kann, welches Verfahren im Einzelfall die kleineren Abmessungen ergibt.
Bild 1-8 Nichteindeutigkeit von Einwirkungen und Widerständen a) beim Erddruck auf eine Baugrubenwand, b) bei einem Fundament
Eine Steigerung der Einwirkung P bewirkt eine Steigerung der ungünstigen Horizontalkomponente Ph und gleichzeitig aber auch den Aufbau einer vergrößerten Normalkraft N, die dann wiederum eine größere Reibungskraft R ermöglicht.
Diese beiden einfachen Beispiele machen deutlich, dass in den einzelnen Grenzzustandsnachweisen klare Regelungen über den Ansatz der Einwirkungen und Widerstände getroffen werden müssen, um berechnete Sicherheiten auch bewerten und vergleichen zu können.
1.4.3 Auswirkung von Einwirkungen (Beanspruchungen)
Die Auswirkung von Einwirkungen wird auch als Beanspruchung bezeichnet. Sie stellt sich in Form von Schnittgrößen, Spannungen oder Verformungen am betrachteten Bauwerk infolge der Einwirkungen dar. Bei den Sicherheitsnachweisen werden die Bemessungswerte der Beanspruchungen dann direkt den Bemessungswerten der Widerstände gegenüber gestellt.
Bild 1-9 Einwirkungen, Beanspruchungen und Widerstände bei einer Spundwand
Im Beispiel der einfach verankerten, frei aufgelagerten Spundwand (Bild 1-9) stellt der aktive Erddruck Eah, der selbst wiederum aus dem Eigengewicht des Bodens und der Oberflächenlast ermittelt wird, die Einwirkung auf die Baugrubenwand dar. Bei Vorgabe der Einbindetiefe kann das statische System als Balken auf zwei Stützen betrachtet werden. Die sich aus der statischen Berechnung ergebenden Auflagerkräfte A und B stellen die Beanspruchungen für den Anker bzw. das Bodenwiderlager dar. In der Grenzzustandsbetrachtung werden der Herausziehwiderstand des Ankers und der aktivierbare Erdwiderstand vor dem Fuß der Baugrubenwand als Widerstände diesen Beanspruchungen gegenübergestellt. Ebenso wird das aus der statischen Berechnung erhaltene Moment ME als Beanspruchung mit dem von der Geometrie und dem Werkstoff der Baugrubenwand abhängigen maximal aufnehmbaren Moment MR verglichen.
Auf die Einzelheiten der Nachweisführung und dabei insbesondere die Einführung von Teilsicherheitsbeiwerten wird später noch im Detail bei den Ausführungen zu den einzelnen Grenzzuständen eingegangen.
1.4.4 Charakteristische Werte
Als charakteristischer Wert einer Einwirkung wird der Wert bezeichnet, von dem angenommen wird, dass er mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit im Bezugszeitraum unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Bauwerks und der entsprechenden Bemessungssituation nicht überschritten wird1. In DIN EN 1990 wird der charakteristische Wert einer Baustoffeigenschaft als ein Wert beschrieben, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bei unbegrenzter Probenzahl auftritt. Meist entspricht dieser Wert dann einer bestimmten Fraktile aus einer statistischen Verteilung. Charakteristische Größen werden durch den Index „k“ gekennzeichnet.
Schwieriger gestaltet sich die Festlegung von charakteristischen geotechnischen Kenngrößen. Sie zählt zu den schwierigsten Aufgaben in der Geotechnik. Dies liegt zum einen an der natürlichen Inhomogenität der Böden und zum anderen daran, dass der Baugrund nur nadelstichartig durch Bohrungen und Sondierungen erkundet werden kann und von daher meist keine gesicherte Basis für eine seriöse statistische Auswertung zur Festlegung der Bodenkennwerte gegeben ist.
Aufgrund der genannten Schwierigkeiten wird die Festlegung der charakteristischen Werte in der Regel durch einen Sachverständigen für Geotechnik erfolgen. Es obliegt seinem Wissen und seiner Erfahrung, wie groß er das Vorhaltemaß zwischen dem von ihm festzulegenden charakteristischen Wert und dem rechnerischen Mittelwert einer Größe wählt (Bild 1-10).
Einflussparameter auf die Größe des Vorhaltemaßes sind die
Eine konkrete Verfahrensanweisung zur quantitativen Festlegung der charakteristischen Werte wird in DIN 1054 nicht gegeben.
1 DIN EN 1990:2010-12, 1.5.3.14
Bild 1-10 Festlegung der charakteristischen Werte und der Bemessungswerte geotechnischer Größen