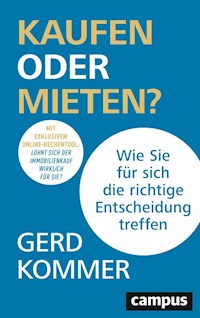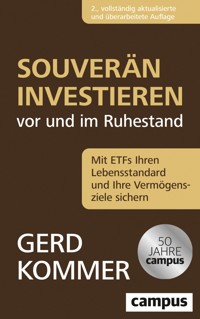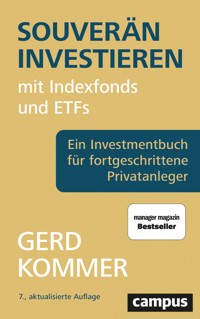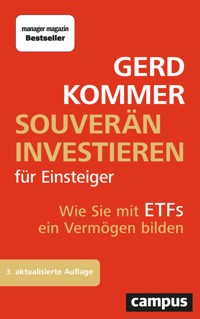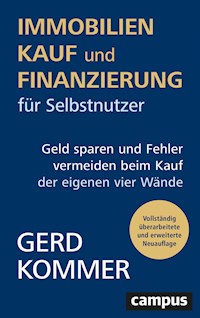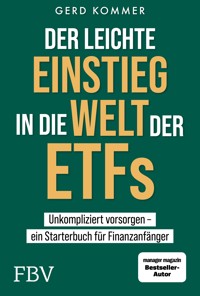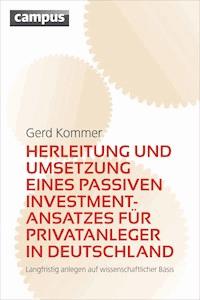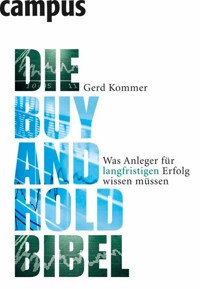Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Souverän investieren für Einsteiger« (3. Auflage 2024) ist der perfekte Einstieg in die Vermögensplanung. ETF-Experte Gerd Kommer präsentiert die besten Strategien für eine solide Altersvorsorge und die finanzielle Unabhängigkeit. Nutzen Sie seine Tipps für die renditestarke Geldanlage und risikoarme Anlagestrategie. Für alle, die ihre Kapitalmarktstrategie bis ins kleinste Detail planen möchten, ist »Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs« (7. Auflage 2025) das optimale Add-on. Sie erfahren, wie Sie Ihr Weltportfolio aufbauen, wann Investitionen in Rohstoffe wie Gold eine sinnvolle Ergänzung sind und wie Sie Kryptowährungen als zusätzlichen Renditetreiber nutzen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1200
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses E-Book ist erhältlich als:
ISBN 978-3-593-46286-8 E-Book (EPUB)
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Verlagsgruppe Beltz behält sich die Nutzung ihrer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.© 2025. Alle Rechte bei Campus Verlag in der Verlagsgruppe BeltzWerderstr. 10, 69469 Weinheim, [email protected]
Zwei Bände:
Souverän investieren für Einsteiger. Wie Sie mit ETFs ein Vermögen bilden © 2024, 3. aktualisierte Auflage, Campus Verlag
Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Ein Investmentbuch für fortgeschrittene Privatanleger © 2025, 7. aktualisierte Auflage, Campus Verlag
Umschlaggestaltung EBundle: Marlen Frieling
Umschlaggestaltung der Print-Ausgaben: total italic, Thierry Wijnberg, Amsterdam/Berlin
www.campus.de
Campus Verlag®
Gerd Kommer
Souverän investieren für Einsteiger
Wie Sie mit ETFs ein Vermögen bilden
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Das aktualisierte Bestseller-Know-how des ETF-Experten – für Einsteiger!Machen Sie Geld zu Ihrem Freund. Setzen Sie nicht auf windige Trends.Private Vermögensbildung ist mittlerweile unverzichtbar, wenn Sie im Alter Ihren gewohnten Lebensstandard beibehalten wollen. Gut, dass eine freundliche und einfache Art der Geldvermehrung existiert: die Anlage in ETFs (Exchange Traded Funds).Damit wirklich jede Privatperson nach ihren eigenen Möglichkeiten von der wichtigsten Finanzinnovation der vergangenen 50 Jahre profitieren kann, gibt es dieses Grundlagenwerk vom Top-Experten. Kurz, kompetent und frisch aktualisiert.ETFs sind Fonds, die einen Aktienindex nachbilden. Anders als die meisten Investmentfonds haben sie keinen Ausgabeaufschlag und sehr geringe laufende Kosten. Das ist gut, denn die Bank verdient nicht mit.Kurz: ETFs sind das Sparbuch der Zukunft.»Niemand hat für die Finanzbildung in Deutschland mehr geleistet als Dr. Gerd Kommer.«Dr. Andreas Beck, ETF-Experte, Fondsmanager und Mathematiker»Kommers Einsteiger-Buch ist der Schlüssel zu langfristigem Anlageerfolg ohne viel Arbeit und mit reduziertem Risiko. Jeder, der mehr als 10 000 Euro besitzt oder einmal besitzen will, sollte es lesen.«Dipl.-Kfm. Alfred Gesierich, Steuerberater, Gilching bei München
Übersicht
Titel
Über das Buch
Inhalt
Inhalt
Wie Ihnen dieses Buch helfen kann – eine Einleitung
1
Warum überhaupt sparen, investieren, anlegen?
2
Acht Börsenkonzepte, die Sie kennen müssen
3
ETFs – die wichtigste Finanzinnovation für Privatanleger seit 50 Jahren
4
In was man mit ETFs investieren kann
5
Was ETFs für Privatanleger so besonders macht
6
Warum ETF-Investments rechtlich sicher sind
7
Echte und unechte ETFs unterscheiden
8
Aktiv oder passiv investieren: Warum passiv besser ist
9
Die wichtigsten Anti-ETF-Argumente
10
Dreizehn Grundprinzipien erfolgreicher Vermögensbildung
10.1
Prinzip 1: Geld zum Freund machen
10.2
Prinzip 2: Humankapital – Ihr größtes Asset verstehen und managen
10.3
Prinzip 3: Schulden sind tabu (mit drei Ausnahmen)
10.4
Prinzip 4: In jedem Quartal gilt: Einnahmen > Ausgaben
10.5
Prinzip 5: Den Erzfeind Interessenkonflikte bekämpfen
10.6
Prinzip 6: Realistische Renditevorstellungen haben
10.7
Prinzip 7: Nebenkosten so wichtig nehmen, wie sie sind
10.8
Prinzip 8: Die Macht der Langfristigkeit für sich nutzen
10.9
Prinzip 9: Erkennen, dass Zinssparen allein nicht zum Ziel führen wird
10.10
Prinzip 10: Nicht auf Omas Immobilienlegende reinfallen
10.11
Prinzip 11: Ohne Aktien oder Immobilien geht es nicht
10.12
Prinzip 12: Verpackung und Inhalt bei Finanzprodukten auseinanderhalten
10.13
Prinzip 13: Investmentpornografie nicht auf den Leim gehen
11
Risiko bei Vermögensanlagen – eine Einführung
11.1
Risiko ist subjektiv
11.2
Gutes versus schlechtes Risiko
11.3
Renditen sind in erster Linie Risikoprämien
11.4
Volatilität: Das für Kapitalmarktanlagen am meisten verbreitete Risikomaß
11.5
Diversifikation: Die cleverste Form der Risikoreduktion
11.6
Shortfall-Risk: Bei Aktien sinkt es mit der Länge des Betrachtungszeitraums
11.7
Sichtbares und unsichtbares Risiko
11.8
Einzelwertrisiko versus Asset-Klassen-Risiko
11.9
Buchverluste versus realisierte Verluste
11.10
Hat Aktienrisiko in den letzten Jahren zugenommen?
11.11
Crash-Risiko existiert in allen Asset-Klassen
11.12
Ein Überblick über die relativen Risiken von Asset-Klassen und Finanzprodukten
12
Das Weltportfolio-Konzept von Gerd Kommer
12.1
Was es ist und auf welchen Prinzipien es basiert
12.2
Ihre persönliche Liquiditätsreserve – der erste Schritt
12.3
Ein simpler Weltportfolio-Vorschlag
12.3.1
Die »Level-1-Asset-Allokation« festlegen
12.3.2
Die »Level-2-Asset-Allokation« festlegen und umsetzen
12.4
Vier erwägenswerte Beimischungen für Ihr Weltportfolio
12.4.1
Gold
12.4.2
Rohstoffe
12.4.3
Kryptowährungen (Bitcoin & Co)
12.4.4
Ein Eigenheim
12.5
Steuern sparen durch Buy and Hold
12.6
Fondssparen mit ETFs: Regelmäßig kleine Beträge anlegen
12.7
Die Frage des Einstiegszeitpunktes und des Einstiegsmodus
12.8
»Rebalancing« – das Portfolio auf Kurs halten
12.9
Was das Weltportfolio-Konzept nicht ist
13
Praktische Umsetzungsfragen beim Weltportfolio-Konzept
13.1
Sozial verantwortlich investieren mit ETFs
13.2
Ausschüttende oder thesaurierende ETFs – was passt besser für mich?
13.3
Wechselkursrisiko – wie damit umgehen?
13.4
Die für mich passenden ETFs finden
13.5
Die betriebliche Altersvorsorge in die Vermögensbildung integrieren
14
Wenn ich nicht im Do-it-yourself-Modus anlegen kann oder möchte
14.1
Mit einer Bank, einem Vermögensverwalter oder einem Anlageberater arbeiten
14.2
Der Robo-Advisor von Gerd Kommer
14.3
Der ETF von Gerd Kommer
15
Steuern: Die Basics, die Sie kennen müssen
16
Anlageprodukte, von denen Sie die Finger lassen sollten
16.1
Bankguthaben oberhalb der gesetzlichen Einlagensicherung
16.2
Kapitalbildende Lebensversicherungen
16.3
Private Rentenversicherungen
16.4
Aktiv gemanagte Aktienfonds, Branchenfonds, Mischfonds, Dachfonds, Anleihenfonds
16.5
Branchen-ETFs, Themen-ETFs, Leveraged ETFs, Short ETFs
16.6
Zertifikate
16.7
Offene Immobilienfonds
16.8
Vermietungsimmobilien
17
Wie mit Ihren bereits vorhandenen Vermögensanlagen umgehen?
18
Was tun im Crash?
19
Eine kurze Zusammenfassung
20
Anhang
20.1
Wie Sie Ihr Geldwissen weiterentwickeln
20.2
Literatur und Quellen
20.3
Glossar
20.4
Register
Wie Ihnen dieses Buch helfen kann – eine Einleitung
Dieses Buch richtet sich an Leser, die schon ein Basisinvestmentwissen besitzen, sich aber noch nicht als fortgeschrittenen Anleger betrachten. Jenen, die in Bezug auf die faszinierende und wichtige Welt von Börse & Co. noch ganz am Anfang stehen, empfehle ich mein einfacheres Buch Der leichte Einstieg in die Welt der ETFs. Leser, die auf den Ruhestand zusteuern oder sich bereits in ihm befinden, mögen mein Buch Souverän investieren vor und im Ruhestand besser geeignet finden.
Souverän investieren für Einsteiger will Sie, liebe Leserin, lieber Leser, mit ETFs vertraut machen. ETFs sind die wichtigste Finanzinnovation für Privatanleger seit 50 Jahren. Sie werden sich nach der Lektüre dieses Buches so weit damit auskennen, dass Sie Ihr Geld – ob 25 Euro monatlich oder 500 000 Euro einmalig – selbstsicher in ETFs anlegen können, über unterschiedliche Anlageklassen hinweg.
Erfolgreich Vermögen bilden ist nicht nur eine Frage des »Was tun?«, sondern auch eine Frage von »Was unbedingt vermeiden oder abstellen?«. Auch auf diesen Gesichtspunkt gehe ich ausführlich ein.
Mein Ziel ist es, Sie in die Lage zu versetzen, jetzt in das Thema »Geld mit ETFs anlegen« einzusteigen und mit diesem wunderbaren Finanzprodukt einen zentralen Teil Ihrer privaten Finanzvorsorge mit dem geringstmöglichen Aufwand zu planen und einzurichten.
Die Abkürzung ETF klingt im ersten Moment kompliziert und abschreckend. In Wirklichkeit sind ETFs (Exchange Traded Funds, zu Deutsch börsengehandelte Indexfonds) gradlinige und transparente Anlageprodukte, die jeder verstehen kann und die einfacher sind als jedes andere Finanzprodukt, ausgenommen Bankguthaben.
Ich glaube, dass ETFs in Deutschland über die nächsten 25 Jahre die Rolle übernehmen werden, die in den vergangenen 70 Jahren das Sparbuch und die kapitalbildende Lebensversicherung hatten.
Bevor ich im ersten Kapitel mit einem ETF-Überblick beginne, noch sieben kurze Hinweise:
Viele Ratgeberbücher haben ein eher blutarmes, oberflächliches Inhaltsverzeichnis mit maximal zwei Ebenen und wenig aussagekräftigen Kapitel- und Abschnittsüberschriften. Angeblich soll das bewirken, dass potenzielle Leser nicht von »Komplexität« abgeschreckt werden. Ich verfolge in meinen Büchern eine ganz andere Philosophie. Man kann sie an dem hierarchisch tiefen und nummerierten Inhaltsverzeichnis und an den präzisen Abschnittsüberschriften erkennen. Aus meiner Sicht erhöht das den Praxisbezug und die Umsetzbarkeit für die Leser, und darauf kommt es mir an.
Mein Anliegen war es, dieses Buch einigermaßen kurz und einfach zu halten. Das bedeutet, dass ich viele interessante Spezialaspekte nur kurz anreißen kann. Bei diesen Spezialaspekten erwähne ich oft Blog-Beiträge oder YouTube-Videos, die ich gemeinsam mit Kollegen geschrieben oder gedreht habe. Wenn Sie sich für das betreffende Thema besonders interessieren, können Sie den jeweiligen Blog-Beitrag oder das YouTube-Video in Sekunden per Suchmaschine ausfindig machen und sich damit detaillierter über den Sachverhalt informieren. Alle genannten Blog-Beiträge und Videos von »Kommer + Kollege« sind kostenlos und frei zugänglich. Dafür einfach die beiden Autorennamen und den Titel des Blog-Beitrags (siehe Literaturverzeichnis) googeln.
Dieses Buch soll ein echtes How-to-Buch mit einer hohen Informationsdichte sein, das aber gleichzeitig eine für normale Menschen verdaubare Länge hat. Daher kommen in vielen Abschnitten Querverweise vor. Sie helfen, platzverbrauchende Wiederholungen zu vermeiden, und geben Ihnen die Möglichkeit, inhaltliche Querverbindungen zwischen verschiedenen Sachverhalten nachzuvollziehen. Die Querverweise können Sie aber genauso gut einfach überlesen und ignorieren.
Das Buch hat rund 80 Fußnoten, im Durchschnitt eine alle drei Seiten. Ich verwende Fußnoten, weil sich mit ihnen Zusatzinformationen liefern lassen, die für manche Leser wichtig sind, ohne den Leserfluss für diejenigen Leser zu stören, die sich nicht für die Fußnoten interessieren. Wenn Sie die Fußnoten nicht mögen, überlesen Sie sie einfach.
Alle in diesem Buch verwendeten Fachbegriffe, die man als Anleger mit Basiskenntnissen noch nicht zwangsläufig kennt und die nicht im laufenden Text erklärt werden, erläutere ich im Glossar am Ende des Buches. Diese Wörter sind im laufenden Text mit diesem Pfeil → gekennzeichnet.
Im Interesse der Lesbarkeit und Textökonomie verzichte ich auf die Nutzung sprachlicher Femina-Formen von Hauptwörtern wie »der Anleger« oder »der Steuerzahler«. Ebenso verzichte ich auf Gender-Doppelpunkte und -Sternchen. Stattdessen benutze ich das generische Maskulinum, beispielsweise »der Autofahrer«. Weibliche Akteure sind selbstverständlich in allen Fällen ebenfalls gemeint.
Zum Schluss noch eine wichtige Offenlegung: Ich bin Gesellschafter und Geschäftsführer der Gerd Kommer Invest GmbH (GKI) und der Gerd Kommer Capital GmbH (GKC). Die GKI ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen für vermögende Privatkunden, die GKC ein digitaler Vermögensverwalter (Robo-Advisor). Mein gesamtes Privatvermögen ist nach den Grundsätzen investiert, die in diesem Buch dargestellt werden.
1Warum überhaupt sparen, investieren, anlegen?
»Der Sinn und Zweck von Investieren besteht nicht darin, die Rendite zu maximieren und reich zu werden. Der Sinn und Zweck ist, nicht arm zu sterben.« (Finanzbuchautor und Neurologe William Bernstein)
Die sprichwörtlichen Spatzen pfeifen es inzwischen von den Dächern: Allein aus der gesetzlichen Rente werden normale Arbeitnehmerhaushalte ab etwa Geburtsjahrgang 1960 und jünger ihren unmittelbar vor Eintritt in den Ruhestand erreichten Lebensstandard mit großer Wahrscheinlichkeit nicht halten können. In den kommenden Jahrzehnten wird sich die zu erwartende Rentenlücke für jeden neuen Jahrgang, der in die Rentenbezugsphase eintritt, wahrscheinlich noch vergrößern. Die Hauptursachen: eine niedrige Geburtenrate in Kombination mit einer steigenden Lebenserwartung, einem zu niedrigen durchschnittlichen Renteneintrittsalter und einem seit vielen Jahren zu anämischem Wirtschaftswachstum. Man kann es auch etwas anders formulieren: Das sogenannte → Umlageverfahren, auf dem die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern beruht, ist strukturell fehlkonstruiert. Angesichts der oben genannten Faktoren kann es zwangsläufig und unreparierbar nur durch eine weitere Erhöhung der schon seit Langem erfolgenden – ja eigentlich systemwidrigen – Quersubventionierung aus Steuermitteln, aus Rentenkürzungen, weiteren Erhöhungen des Renteneintrittsalters oder eine irgendwie geartete Kombination aus diesen Maßnahmen vor dem Finanzkollaps bewahrt werden.
Doch halten wir uns nicht mit Klagen auf, sondern wenden uns möglichen Lösungen zu. Wer aus dieser großen Bevölkerungsgruppe den Wunsch hat, seinen vor Eintritt in den Ruhestand erreichten Lebensstandard zu halten, muss vermutlich, wenn er nicht auf ein unwahrscheinliches Wunder vertrauen will, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen:
(a)
Er oder sie muss zu der Minderheit gehören, die auf einem von fünf Wegen vermögend geworden sind: durch (i) eine große Erbschaft, (ii) die Heirat eines reichen Partners, (iii) die erfolgreiche Vermarktung einer angeborenen künstlerischen oder sportlichen Spitzenbegabung, (iv) einen nennenswerten Lotteriegewinn1 oder (v) Unternehmertum. Die ersten vier Wege sind gar nicht oder nur schwer von Ihnen direkt beeinflussbar, der fünfte Weg – ein Unternehmen gründen – ist statistisch risikoreich, typischerweise beschwerlich und aus vielerlei Gründen für die meisten Menschen nicht gangbar.
(b)
Er oder sie muss mehrere Jahre über das heutige durchschnittliche Renteneintrittsalter hinaus arbeiten. Für Männer liegt das derzeit bei 64,2 Jahren, für Frauen minimal höher. Dieser Weg ist – sofern es die persönliche Gesundheit erlaubt – grundsätzlich realistisch.2 Dennoch ist Umfragen zufolge die Mehrheit der Bundesbürger von diesem Weg zur Schließung ihrer Rentenlücke wenig angetan.
(c)
Er oder sie muss ein Eigenheim erworben haben (Haus oder Wohnung) und den etwaigen Kredit bei Renteneintritt ganz oder größtenteils abbezahlt haben. In diesem Buch zeige ich, dass das Eigenheim eine gute, aber im Allgemeinen nicht die renditemäßig beste Route zur sinnvollen Altersvorsorge ist, obwohl das viele Bundesbürger seit anno Tobak glauben. Außerdem ist ein Eigenheimerwerb für viele Haushalte aus finanziellen oder anderen Gründen keine gute Lösung oder einfach unmöglich (siehe hierzu meine beiden Bücher Kaufen oder mieten, 2021 und Immobilienkauf und -finanzierung für Selbstnutzer, 2022).
(d)
Er oder sie muss über Geld- bzw. Finanzanlagen ein »kleines Vermögen« aufgebaut haben. Darum geht es in diesem Buch. Wie hoch dieses Finanzvermögen bei Eintritt in den Ruhestand sein muss, hängt vom Lebensstandard des Haushaltes und anderen Faktoren ab. Als grobe Faustregel sollen Arbeitnehmer, die mehr oder weniger ihr gesamtes Berufsleben in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, zusätzlich etwa 10% bis 20% ihres laufenden Nettoeinkommens über mindestens 20 bis 30 Jahre hinweg sparen und in eine Geldanlage investieren, die nach Inflation, Kosten und Steuern eine dauerhaft positive Rendite produziert. Wer nicht mindestens zwei Jahrzehnte so spart und investiert, wird aufgrund des verkürzten Zeitraums mehr als die genannten Prozentsätze aufwenden müssen. Das gilt noch mehr für diejenigen, die nicht die Möglichkeit hatten, ein ganzes Berufsleben lang in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen.
Eine langfristig positive, inflationsbereinigte (reale) Rendite nach Steuern und Kosten kann man mit Sparbüchern, Tagesgeldern, Festgeldern, Bausparen, den allermeisten kapitalbildenden Lebensversicherungen oder privaten Rentenversicherungen und Bausparen – daran bestehen wenig Zweifel – nicht erreichen. Leider sind ausgerechnet das – neben dem Eigenheim – die bevorzugten Investmentformen der Deutschen.
Eine dauerhaft positive, reale Rendite nach Steuern und Kosten kann man nur mit Geldanlagen erreichen, die zumindest teilweise Investments in Aktien, also Eigenkapital an börsennotierten Unternehmen, darstellen. Genau das geht mit ETFs, und zwar einfacher als mit jedem anderen Anlagevehikel und in den allermeisten Fällen auch billiger. Dieses Buch zeigt, warum das so ist und wie man es macht.
3ETFs – die wichtigste Finanzinnovation für Privatanleger seit 50 Jahren
»Fundamental betrachtet sind ETFs einfach eine neue Technologie. Sie sind ein Mechanismus, um bestimmte Ziele zu erreichen, wie z. B. Telefone. Traditionelle Wählscheibentelefone entsprechen traditionellen [aktiven] Investmentfonds, ETFs entsprechen Smartphones. Sie tun das gleiche wie Wählscheibentelefone, aber in einem besseren Paket.« (Dave Nadig, ETF-Pionier und -Experte beim US-Finanzportal Vettafi.com)
Das Kürzel ETF steht für »Exchange Traded Fund«, zu Deutsch börsengehandelter Fonds. Trotz dieses abschreckend technisch klingenden Namens sind ETFs simple, leicht zu verstehende Investmentprodukte, wie dieses Buch zeigen wird.
Weil ETFs besonders einfache Anlageprodukte sind, die gegenüber ihren Alternativen aber erstaunliche Vorteile besitzen, existiert heute kein Finanzprodukt – das kreditfinanzierte Eigenheim eingeschlossen –, das sich besser für die langfristige Altersvorsorge und Vermögensbewahrung von Privathaushalten eignet als ETFs – egal, ob der Haushalt arm oder reich ist.
Was genau sind ETFs?
Zunächst einmal sind ETFs ganz normale Investmentfonds, aufsichtsrechtlich auch »Publikumsfonds« genannt. Das Wort »Publikum« bezieht sich hier auf die allgemeine Öffentlichkeit, also Verbraucher oder Privatanleger in Abgrenzung zu gewerblichen Investoren oder Profianlegern.
Ein Investmentfonds bündelt die individuellen Anlagebeträge vieler einzelner Anleger und investiert dieses Geld als »Pool« gemäß seiner veröffentlichten Strategie in börsengehandelte Kapitalmarktanlagen. Das sind vor allem Aktien oder Anleihen. Ein Investmentfonds ist also ein kollektives Investmentvehikel für Privatanleger – so ähnlich wie ein Mehrfamilienhaus ein kollektives Immobilieninvestment für mehrere Eigentümer oder Investoren sein kann.
Abbildung 1 gibt einen Überblick über die wichtigsten Fondstypen. Ihnen allen gemeinsam ist das Bündelungs- oder Pooling-Prinzip. Es wird im Finanzmarkt nicht nur für Fonds genutzt, sondern auch bei kapitalbildenden Lebensversicherungen und bei Immobilienprojekten mit mehr als einem Eigentümer.
Abbildung 1: Wie sich Investmentfonds und ETFs in das Universum aller Fondstypen einordnen lassen
► Zur Erläuterung von »UCITS-Fonds« siehe Infobox »Investmentfonds und ihr rechtlicher Hintergrund« weiter unten in diesem Abschnitt. ► Institutionelle Fonds umfassen → Hedgefonds, → Private-Equity-Fonds, → Sovereign-Wealth-Fonds, → US Pension Funds, deutsche → geschlossene Fonds und sonstige institutionelle Fonds. ► Klassische Indexfonds werden zwar in den USA und in der Schweiz auf dem Privatanlegermarkt angeboten, nicht jedoch in Deutschland. Weltweit haben klassische Indexfonds immer noch einen Marktanteil von über 40% an allen Indexfonds.
Investmentfonds für Privatanleger wurden 1924, also vor fast 100 Jahren, in den USA erfunden. Es handelt sich somit um eine sehr alte, lang etablierte Anlageform. Investmentfonds verbreiteten sich danach in Europa und Asien. Im Verlauf dieser 100 Jahre sind sie in Bezug auf Transparenz und Sicherheit ihrer rechtlichen Struktur immer weiter verbessert worden.
Indexfonds als eine Variante der Investmentfonds entstanden Anfang der 1970er-Jahre, sind also schon rund 50 Jahre alt. ETFs als eine Sonderform von Indexfonds wurden vor über 30 Jahren Anfang der 1990er-Jahre erfunden.
Die britische Wirtschaftszeitschrift The Economist bezeichnet Indexfonds und ETFs als die bedeutendsten Finanzinnovationen der vergangenen fünf Jahrzehnte (The Economist, 2019). Es ist in der Tat schwer, sich eine andere finanzielle Erfindung vorzustellen, die ähnlich clever wäre. Clever, weil sie wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse auf praxisrelevante, simple Weise umsetzt – und das innerhalb einer robusten rechtlichen Struktur. Erfolgreicher als Indexfonds war ohnehin keine andere Finanzinnovation seit 1970. Von Indexfonds und ETFs wird zu Recht gesagt, sie haben Börseninvestments demokratisiert und ermöglichten Privatanlegern das, was zuvor nur institutionellen Großinvestoren möglich war.
Geld via Investmentfonds anzulegen, hat für normale Privatanleger vier große Vorteile: (a) Es erfordert weniger Fachkenntnisse, als direkt in Einzelwertpapiere zu investieren; (b) es macht weniger Arbeit als Einzelwertpapiere; (c) es erlaubt Kleinanlegern mit Anlagebeträgen ab 25 Euro, eine risikoreduzierende Streuung (Fachjargon Diversifikation, siehe Abschnitt 11.5) zu erzielen, die mit Direktanlagen so billig und so einfach niemals möglich wäre; und (d) im Falle von ETFs senkt es die Nebenkosten des Investierens auf ein Niveau, das von keinem anderen Finanzprodukt unterboten wird, sofern man systematisch und breit diversifizieren möchte – ein Ziel, das eigentlich jeder Privatanleger haben sollte.
Schätzungen zufolge dürften Anleger in den etwa 45 Jahren seit Erfindung der Indexfonds durch deren großen Kostenvorteil mehr als 5 000 Milliarden Dollar an laufenden Gebühren und Kaufkosten gespart haben – 5 000 Milliarden, die ansonsten in die Taschen der Finanzbranche geflossen wären.
Viele Leser werden aktiv gemanagte, sprich normale oder traditionelle Investmentfonds, besser kennen als ETFs. Bei einem normalen Investmentfonds, wie z. B. einem Aktien- oder einem Anleihenfonds (auch altmodisch Rentenfonds genannt), gibt es einen Fondsmanager. Sein Job besteht darin, das Geld der Anleger auf der Basis einer festgelegten Anlagestrategie möglichst erfolgreich zu investieren. (Gegenüber den Anlegern wird diese Anlagestrategie fast ausnahmslos nur diffus in blumigen Worten festgelegt.) »Erfolgreich investieren« heißt in diesem Zusammenhang, eine relativ zur sinnvoll vergleichbaren Konkurrenz attraktive Rendite-Risiko-Kombination zu erzielen.
Normale Investmentfonds werden als »aktiv gemanagte« oder einfach nur als »aktive Fonds« bezeichnet; »aktiv« deswegen, weil der Fondsmanager »aktiv« versucht, attraktive Wertpapiere herauszupicken bzw. unattraktive zu vermeiden. Dabei ist er bestrebt, gute Börsenphasen mitzunehmen und schlechte zu umgehen, also das Fondsvermögen vor deren Beginn in risikoarme Cash-Anlagen umzuschichten. Aktives Investieren basiert stets und notwendigerweise auf Prognosen, also Spekulation, selbst wenn sich der Anleger (Privatanleger oder Fondsmanager) nicht als Prognostiker oder Spekulant wahrnimmt. Ein aktiver Investor versucht somit, »den Markt zu schlagen«. Aktives Investieren ist die normale, die traditionelle Form zu investieren.
Bei einem ETF existiert kein teurer, hoch bezahlter Fondsmanager, der jeden Morgen nach einem bemühten Blick in seine Glaskugel entscheidet, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind – und dabei in statistisch über 50% der Fälle falschliegt. Stattdessen bildet der ETF nur ganz unspektakulär, einfach und »passiv« einen Börsenindex ab. Fachjargon: Der ETF repliziert den Index.
In Kapitel 8 werde ich genauer erläutern, warum aktives Investieren bei Börsenanlagen wenig Sinn macht und warum passives Investieren mit ETFs viel schlauer ist.
Bekannte Aktienindizes sind der DAX für Deutschland und der S&P 500 Index für die USA oder der MSCI World Index für den globalen Aktienmarkt. Statt »bilden einen Börsenindex ab« könnte man geringfügig vereinfacht auch sagen »bilden den Markt ab«. Weil ETFs einen Index abbilden, sind sie Indexfonds. Mit einem Börsenindex misst man die Rendite und die Renditeschwankungen einer definierten Gruppe von Wertpapieren im Zeitablauf.
Der DAX beispielsweise repräsentiert als Index die Aktien der 40 größten deutschen Unternehmen (Large Caps), der »MSCI World Standard Index« Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen (Large Caps und Mid Caps) mit einem primären Börsen-Listing in einem von 23 Industrieländern, der »MSCI Emerging Markets Index« Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen in rund 25 Schwellenländern.9
Das Gewicht eines einzelnen Unternehmens im Aktienindex bemisst sich in den meisten Fällen nach seinem Börsenwert, seiner Marktkapitalisierung (engl. market capitalisation, daher die englischen Bezeichnungen »Large Cap«, »Mid Cap«, »Small Cap« für unterschiedlich große Unternehmen).
Börsenindizes, oder allgemeiner Finanzmarktindizes, existieren für jede Art von Kapitalmarktanlage: für Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, → Derivate, Kryptowährungen und sogar für Kunst, beispielsweise Gemälde klassischer Meister oder historische Musikinstrumente. Ein Index kann sich geografisch auf ein Land, eine Region oder die gesamte Weltwirtschaft oder länderübergreifend auf Branchen beziehen. Auch Themenindizes existieren, beispielsweise ein Index auf Unternehmen zum Thema künstliche Intelligenz, Blockchain, Cannabis-bezogene Unternehmen oder Unternehmen im Bereich alternde Gesellschaft.
Börsenindizes werden auch als Benchmark (Vergleichsmarke) für aktiv gemanagte Portfolios, inklusive Fonds, verwendet.
Infobox:Investmentfonds und ihr rechtlicher Hintergrund
Was in Deutschland häufig einfach Investmentfonds genannt wird, ist in der Rechtssprache ein UCITS-Fonds. UCITS steht für »Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities« oder im Amtsdeutsch »Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren« (OGAW). Bei allen ETFs, die in den EU-Staaten grenzüberschreitend zum Vertrieb an Privatanleger (Verbraucher) zugelassen sind, handelt es sich um UCITS-Fonds; dasselbe gilt für alle konventionellen (aktiv gemanagten) Investmentfonds. (Nicht-UCITS-ETFs werden in Europa sehr selten vertrieben, wenn überhaupt wohl nur in der Schweiz.) Seit 1985 hat die EU fünf sogenannte UCITS-Richtlinien erlassen, die die 27 EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen hatten. (Die Schweiz, Liechtenstein und Norwegen schließen sich bei solchen Sachverhalten in der Regel freiwillig an.) In Deutschland geschah dies zuletzt 2013 in Gestalt des Kapitalanlagengesetzbuchs (KAGB-Gesetz). Die UCITS-Richtlinien haben die primären Ziele, (a) den europäischen Binnenmarkt für Fonds, die an Privatanleger vertrieben werden, zu stärken, also den Wettbewerb zu intensivieren (z. B. durch EU-weite, einheitliche aufsichtsrechtliche Standards) und (b) hierbei einen hohen Anlegerschutz zu gewährleisten. Ein UCITS-Fonds, der in einem einzelnen EU-Mitgliedstaat eine rechtliche Zulassung erworben hat und dort der staatlichen Aufsicht unterliegt, darf in allen anderen EU-Mitgliedstaaten an Privatanleger vertrieben werden. UCITS-Fonds sind in gewisser Weise die am schärfsten und engsten regulierten Anlageprodukte überhaupt. Besonders wichtig für Anleger ist auch, dass das Fondsvermögen als »Sondervermögen« nicht dem Insolvenzrisiko der Fondsgesellschaft ausgesetzt ist (mehr zum Aspekt Sondervermögen in Kapitel 6). Auf die genaue Abgrenzung zwischen echten ETFs und »unechten ETFs« (ETNs, ETCs) komme ich in Kapitel 7 zu sprechen.
Wie sich ein Index zusammensetzt und von wem er in welchen Abständen (z. B. minütlich oder in längeren Zeitabständen) neu berechnet und veröffentlicht wird, ist nach einer verbindlichen, schriftlich fixierten, transparenten, regelgebundenen, sachlogischen Methodik festgelegt. Diese Methodik erstellt ein anderes Unternehmen als dasjenige, das den Indexfonds auflegt. Jeder Anleger kann die Methodik des Index nachprüfen, denn sie ist öffentlich zugänglich. Nach der anfänglichen Festlegung ändert sich die Methodik normalerweise nie mehr. Börsenindizes sind somit keine willkürliche und schon gar keine »firmeninterne« Angelegenheit der Fondsgesellschaft, die von der schwankenden Meinung und dem nie abschließend bestimmbaren Kompetenzniveau, dem Gesundheitszustand und der Motivation einer einzelnen Person wie einem Fondsmanager abhängen.
In Deutschland werden derzeit etwa 1 800 ETFs an Privatanleger vertrieben. Mit diesen 1 800 ETFs lassen sich fast alle für Privatanleger relevanten Indizes und dadurch alle wesentlichen Anlageklassen, neudeutsch Asset-Klassen, abdecken: Aktien einschließlich Immobilienaktien, Geldmarktanlagen, Anleihen, Edelmetalle, Rohstoffe und Kryptowährungen wie etwa Bitcoin. Zum Vergleich: In Deutschland werden mehr als 9 000 aktiv gemanagte Investmentfonds angeboten.
Investmentfonds- oder ETF-Anteile sind hochliquide. Das heißt, sie können – wie eine Aktie – jederzeit innerhalb von einem oder wenigen Werktagen zum Marktpreis verkauft und damit in Bargeld umgewandelt werden. Im Vergleich zu Immobilien, kapitalbildenden Lebensversicherungen und offenen Immobilienfonds (siehe Abschnitt 16.7) ist das an sich schon ein beträchtlicher Vorteil.
Es gibt noch einen anderen, sehr grundsätzlichen Unterschied zwischen normalen oder klassischen Investmentfonds und ETFs. ETFs sind – wie Aktien und Anleihen – börsennotiert, klassische Investmentfonds sind das nicht. Was bedeutet dieser Unterschied?
Wer einen ETF-Anteil kauft, tut das immer über die Börse. Konkret gibt die betreffende Person einen Kaufauftrag (im Börsenslang »Order«) über eine Bank (der Mittelsmann) an eine bestimmte Börse, sagen wir, die Börse in Frankfurt. Die Börse ist ein regulierter Marktplatz, an dem sich Angebot und Nachfrage treffen. Nach den Vorgaben des Anlegers kauft die Bank dann für besagte Person eine bestimmte Anzahl von ETF-Anteilen oder ETF-Anteile in einem bestimmten Gesamtwert und bucht diese nach Vollzug des Kaufs in das Depot des Anlegers ein. (Der ETF-Kurs wird rund alle zwei Minuten aktualisiert und der Käufer weiß im Moment des Kaufes – je nach Order-Typ – ziemlich exakt, zu welchem Kurs er kauft.) Die Anteile, die der Anleger gekauft hat, existierten schon vorher. Von wem der Anleger gekauft hat, ist unbekannt und irrelevant. Der Kaufpreis wird vom Anlegerkonto bei der Bank abgebucht. Das Ganze dauert (werktags) zumeist nur 24 Stunden und selten länger als 48 Stunden. Der Kaufvorgang wäre bei Aktien grundsätzlich genau derselbe wie bei einem ETF. Ein Verkauf läuft naturgemäß andersherum.
Bei einem klassischen, nicht börsennotierten Investmentfonds verläuft dieser Prozess anders, in gewisser Weise altmodischer, umständlicher, langsamer und teurer. Der Anleger bestellt – typischerweise über seine Bank – Anteile eines Fonds bei einer bestimmten Fondsgesellschaft.10 Die Fondsanteile existieren in diesem Moment noch nicht (ein entscheidender Unterschied zum ETF-Kauf). Der Anleger weiß im Vorhinein auch nicht, zu welchem Anteilskurs er kaufen wird. Er kennt lediglich den Anteilskurs (Schlusskurs) vom Vortag um 16 Uhr. Die Bank überweist die Kaufsumme an die Fondsgesellschaft. Diese erwirbt mit dem ihr soeben zugeflossenen Cash nun Wertpapiere an der Börse gemäß der in den Marketing-Unterlagen des Fonds (ungenau) formulierten Anlagestrategie. Sobald sie die Wertpapiere hat, entstehen die Fondsanteile des Anlegers. Diese werden nun in sein Depot bei der Bank eingebucht. Erst jetzt weiß der Anleger, zu welchem Kurs er gekauft hat. Der ganze Kaufvorgang dauert typischerweise drei oder vier Werktage, manchmal länger. Die gesamten Nebenkosten des Kaufes einschließlich des im Regelfall anfallenden Ausgabeaufschlags liegen zehn- bis fünfzigmal höher als bei einem ETF. Immerhin ist der Verkauf der Anteile (korrekt formuliert »die Rückgabe«) im Regelfall nicht teurer als bei einem ETF. Der Rückgabeprozess dauert ebenfalls ungefähr drei Werktage und wieder weiß der Anleger ex ante (im Vorhinein) nicht, zu welchem Kurs er verkauft.
Eine Zahlenillustration zum Aspekt Kosten: Wir vergleichen die Kosten des größten deutschen aktiv gemanagten Aktienfonds, des DWS Top Dividende (WKN 984811), mit den Kosten eines durchschnittlichen ETFs auf den MSCI World. Es ergibt sich folgendes Bild:
DWS Top Dividende (WKN 984811): (a) Kaufkosten in Gestalt des Ausgabeaufschlags 5%. (b) Laufende Kosten 1,45% p.a. (Stand Dezember 2022)
Beliebiger ETF auf den MSCI World Index: (a) Ein Ausgabeaufschlag existiert bei ETFs nicht. Sonstige Kaufkosten ca. 0,15% – bei einer Anlagesumme oberhalb 10 000 Euro weniger. (b) Laufende Kosten 0,2% p.a. (die preisgünstigsten ETFs auf diesen Index hatten im Dezember 2022 laufende Kosten von 0,12% p.a.)
Ergo hat der aktiv gemanagte Aktienfonds gut 33-mal so hohe Kaufkosten und siebenmal so hohe laufende Kosten. Diese Verhältnisse treffen im Großen und Ganzen auf alle aktiv gemanagten Fonds und ETFs zu, sowohl im Bereich Aktien als auch Anleihen.11
Insgesamt sind die Transaktionskosten (Kosten für den Kauf und Verkauf) von ETFs im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds, zu kapitalbildenden Lebensversicherungen oder zu Immobilien mikroskopisch klein.
Mit ETFs kann man schon ab sehr kleinen Beträgen investieren, beispielsweise in Gestalt eines monatlichen ETF-Sparplans ab 25 Euro pro Monat. Bei keinem anderen renditeträchtigen Investment sind die erforderlichen Minimumbeträge kleiner. Viele Direktbanken (Onlinebroker) offerieren Sparpläne auf populäre ETFs ganz ohne Ausführungskosten, also kostenlos.
Auch die Umsetzung eines Auszahlplans, mit dem man sich beispielsweise im Ruhestand eine »private Rente« schafft, ist mit ETFs leichter möglich als mit nahezu jeder anderen Finanzanlage und unendlich viel leichter als mit einem Immobilieninvestment.
Wenn ETFs so viele Vorteile besitzen, wie kommt es dann, dass man von seinem Bankbetreuer oder Finanzberater so wenig über ETFs hört? Warum raten die meisten konventionellen Banken ihren Kunden von ETFs sogar ab? Die Antwort darauf ist simpel: Banken, konventionelle Vermögensverwalter und Fondsvermittler verdienen an ETFs nur ein Zehntel bis ein Fünftel dessen, was sie am Verkauf und der Vermittlung konventioneller Investmentfonds oder anderer Finanzprodukte verdienen. Deswegen finden diese Finanzdienstleister ETFs gar nicht lustig und versuchen, sie gegenüber ihren Kunden entweder totzuschweigen oder, wenn Totschweigen bei manchen Kunden nicht mehr funktioniert, sie mit – aus wissenschaftlicher Sicht – oft haarsträubenden Argumenten schlechtzureden. In Kapitel 9 gehe ich auf diese und andere in den Medien und in Diskussionsforen im Internet immer wieder aufpoppende Kritik an ETFs ein.
4In was man mit ETFs investieren kann
»Die fundamentalen Prinzipien, die mit dem ersten Indexfonds [für Privatanleger] 1976 eingeführt wurden, sind simpel: Kaufen Sie den gesamten Aktienmarkt und halten ihn ›für immer‹, eliminieren Sie hohe Beratungsgebühren, minimieren Sie Betriebskosten und Portfolioumschlag. Diese einfachen Regeln haben sich bewährt.« (John Bogle, Indexfonds-Pionier, legendärer Anlegerschützer und ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Vanguard, der zweitgrößten Fondsgesellschaft der Welt)
Anlegen in ETFs wird bewusst oder unbewusst oft mit einem Investment in Aktien gleichgesetzt. Das ist zu kurz gegriffen. Mit ETFs kann man, wie oben erwähnt, auch in andere Asset-Klassen investieren. Dieser Abschnitt gibt darüber einen schnellen Überblick.
Asset-Klasse Aktien: Aktien sind Unternehmensbeteiligungen, also Anteile am Eigenkapital eines börsennotierten Unternehmens. Nicht börsennotiertes Eigenkapital ist dagegen eine direkte Unternehmensbeteiligung, z. B. ein Anteil an einer GmbH. Letztere spielen für normale Privatanleger typischerweise keine Rolle, weil sie nicht frei erwerbbar sind. Zudem ist ihre Bewertung komplex und ihre Veräußerung schwer und langwierig. Der erwartete Ertrag (Rendite) aus einer Aktie (die Gesamtrendite) besteht aus einer Kombination von Dividendenerträgen und Kurssteigerungen. Mit ETFs kann man einfach und zu niedrigen Kosten in die Anlageklasse Aktien investieren. Weltweit existieren etwa 50 000 börsennotierte Unternehmen. Rund 10 000 davon werden kontinuierlich an den wesentlichen Börsen der Welt gehandelt und sind für normale Privatanleger tatsächlich zugänglich. Rund 40 0000 sind Micro Caps (Kleinst-Aktiengesellschaften), die nur sehr geringen Transparenz- und Offenlegungsvorschriften unterliegen. Deren Aktien sind faktisch nicht im freien Börsenhandel verfügbar, und ihr Kauf oder Verkauf ist mit hohen Nebenkosten verknüpft. Das globale Aktienuniversum lässt sich in vielfältige Sub-Asset-Klassen aufteilen: nach Ländern, Regionen, Branchen, »Themen«, Nachhaltigkeits-Ratings und anderen Kriterien. Viele dieser Sub-Asset-Klassen sind über spezielle Aktienindizes und damit über ETFs investierbar. Aktien-ETFs sind für die meisten Privatanleger der wichtigste ETF-Typ. Im März 2022 wurden in Deutschland rund 1 800 ETFs zum Vertrieb an Privatanleger angeboten (weltweit sind es etwa 8 500). Rund zwei Drittel der in Deutschland vertriebenen ETFs sind Aktien-ETFs, das verbleibende Drittel verteilt sich auf die folgenden sieben Asset-Klassen.
Asset-Klasse Unternehmensanleihen: Die Grundmerkmale von Anleihen erläutert die Infobox in diesem Abschnitt. Die meisten börsennotierten Unternehmen geben Anleihen aus (sie »emittieren« Anleihen), um sich Fremdkapital zu besorgen. Aktien repräsentieren hingegen Eigenkapital.12Die Welt der Unternehmensanleihen ist weitaus breiter gefächert als die der Aktien. Beispielsweise gab es von der Siemens AG im März 2022 eine Aktie (einen Aktientypus) und 39 verschiedene Anleihen.
Infobox:Was sind eigentlich Anleihen?
Obwohl der weltweite Anleihenmarkt gemessen an der Marktkapitalisierung größer ist als der Aktienmarkt, wissen viele Privatanleger weniger über Anleihen als über Aktien. Altmodische Bezeichnungen für Anleihen sind »festverzinsliche Wertpapiere«, »Schuldscheine«, »Schuldverschreibung« oder »Renten«. In der Schweiz ist auch der Begriff »Obligationen« üblich. Eine Anleihe ist letztlich ein Kredit, den der Anleger (der »Kreditgeber« oder Gläubiger) an den Anleihenemittenten (den Schuldner) ausreicht – allerdings ein Kredit, der von vornherein zum freien Handel vorgesehen ist. Der Anleihenbesitzer kann seine Kreditforderung jederzeit zum Marktkurs verkaufen, er braucht dafür nicht die Zustimmung des Kreditnehmers wie bei einem normalen Bankkredit. Der Emittent einer Anleihe kann ein Unternehmen oder ein Staat sein.
Wer eine normale Anleihe bis zur Fälligkeit (dem Rückzahlungsdatum) hält, weiß – anders als bei einer Aktie – exakt, was sein Gesamtertrag sein wird (unter der Annahme, dass der Emittent nicht vorher zahlungsunfähig wird). Anleihen eines Unternehmens sind risikoärmer; ihr Kurs schwankt weniger als die Aktien des Unternehmens. Staatsanleihen sind risikoärmer als die Anleihen und Aktien von Unternehmen im betreffenden Staat.
Asset-Klasse Staatsanleihen: Wenn Staaten Schulden machen (Fremdkapital aufnehmen), dann tun sie das vorwiegend durch die Emission von Staatsanleihen. Innerhalb eines gegebenen Staates sind dessen Anleihen normalerweise die risikoärmsten Investments, gemessen am Risiko von Kursschwankungen (Volatilität) und dem Ausfallrisiko. Auch Bankguthaben haben ausnahmslos ein höheres Ausfallrisiko als die Anleihen des betreffenden Staates.
Asset-Klasse Geldmarktanlagen: Geldmarktanlagen stellen eine spezifische Anleihenkategorie dar, die man als eigene Asset-Klasse betrachten kann. Geldmarktanlagen sind Staats- und Unternehmensanleihen (a) sehr hoher Bonität, (b) sehr kurzer Restlaufzeit (typischerweise unter 18 Monaten, also geringem → Zinsänderungsrisiko) und (c) ohne Wechselkursrisiko. Geldmarktanlagen sind quasi mit Cash gleichzusetzen. Innerhalb einer gegebenen Währung stellen Geldmarktanlagen im Wesentlichen das Investment dar, bei dem sowohl das Ausfallrisiko als auch das Kurs- oder Wertschwankungsrisiko nicht mehr weiter reduzierbar sind (siehe auch die ergänzenden Bemerkungen zu Bankguthaben weiter unten in diesem Abschnitt).
Asset-Klasse Immobilien: Mit ETFs kann man in Immobilienaktienindizes investieren (nicht in einzelne Immobilienobjekte). Ein Beispiel für eine Immobilienaktie ist die der Vonovia SE (DAX-Mitglied und größter Wohnungsvermieter in Europa). Immobilienaktien-ETFs sind die überlegene Alternative zu offenen Immobilienfonds (siehe Abschnitt 16.7).
Asset-Klasse Edelmetalle: Mit ETFs kann man in die Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium investieren. Naturgemäß hat Gold in der Anlegerpraxis die größte Bedeutung. Gold-ETFs sind streng genommen keine ETFs im Sinne der rechtlichen Struktur von UCITS-Fonds (siehe Infobox »Investmentfonds und ihr rechtlicher Hintergrund« in Kapitel 3), sondern sogenannte ETCs (Exchange Traded Commodities, zu Deutsch: börsengehandelte Rohstoffe). Auf diesen nicht unwichtigen Unterschied komme ich in Kapitel 7 noch genauer zu sprechen. Wie wir später im Buch noch genau sehen werden, ist die langfristige Rendite von Gold deutlich schlechter ist als die von Aktien – bei gleich hohem oder höherem Risiko. Silber stellt eine noch schlechtere Rendite-Risiko-Kombination als Gold dar. Platin und Palladium sind unklare Fälle.
Asset-Klasse Rohstoffe: Lässt man Edelmetalle außen vor, existieren vier weitere Rohstoffkategorien: Agrarrohstoffe (z. B. Weizen, Mais, Reis, Schweinebäuche, Baumwolle, Holz), Basismetalle (z. B. Kupfer, Nickel, Zink, Aluminium, seltene Erden), Energie (Kohle, Erdöl, Erdgas) und Mineralien (z. B. Bauxit, Phosphat, Schwefel). Was manchem Privatanleger nicht bewusst ist: In Rohstoffe kann man als Privatanleger direkt gar nicht investieren, weil die damit verknüpften Lager- und Versicherungskosten jede denkbare Rendite langfristig auffressen würden. Als Privatanleger kann man lediglich in (besicherte) Rohstofftermingeschäfte investieren, engl. Collateralized Commodity Futures (CCFs). Die vielen verschiedenen Rohstoff-ETFs (bzw. ETCs), die heute verfügbar sind, bilden jeweils einen von mehreren Dutzend Commodity-Futures-Indizes ab. Die eher unattraktiven Renditen von CCFs unterscheiden sich von den zugrundeliegenden Rohstoffen kurz- und mittelfristig beträchtlich. Lesern, die sich genauer über Rohstoff-ETCs informieren wollen, empfehle ich den Blog-Beitrag Kommer/Kanzler 2021.
Asset-Klasse Kryptowährungen: In Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, kann man via Krypto-ETF einfacher, bequemer und mit weniger »operativem Risiko« investieren als über ein Direktinvestment in eine Kryptowährung. Allerdings sind Krypto-ETFs, wie auch Gold-ETFs, keine UCITS-Fonds (zu diesem Unterschied siehe Kapitel 7). Krypto-ETPs (Exchange Traded Products) sind rechtlich betrachtet Bankschuldverschreibungen, die zu 100% durch physische (wenn man dieses Adjektiv hier verwenden darf) Kryptowährungsbestände besichert sind. In Abschnitt 12.4.3 gehe ich genauer auf Krypto-ETPs ein.
Vielleicht werden sich einige Leser wundern, warum Bankguthaben – die in Deutschland volumenmäßig unter Privatanlegern am meisten verbreitete Form für liquide Vermögensanlagen – hier nicht als Asset-Klasse genannt wird. Die Antwort ist einfach: Bankguthaben sind keine Asset-Klasse, sie sind ein Finanzprodukt, eine verpackte Asset-Klasse, genauer eine Verpackung der bereits in Kapitel 2 erwähnten Asset-Klasse Geldmarktanlagen. Aus Investmentperspektive bestehen für Bankguthaben, die betraglich oberhalb der gesetzlichen Einlagensicherung liegen, ein gefährliches, schwer zu beurteilendes Ausfallrisiko (Rückzahlungsrisiko). Von kurzfristigen »Geldparkensituationen« abgesehen ist dieses Risiko grundsätzlich nicht akzeptabel.
Der Vollständigkeit halber sollte ich noch erwähnen, dass in den USA auch aktiv gemanagte ETFs existieren, also ETFs, die nicht einfach passiv einen Index abbilden, sondern wie ein traditioneller aktiv gemanagter Aktienfonds eine aktive, subjektive Anlagestrategie verfolgen, mit einem menschlichen Fondsmanager. Der globale Marktanteil solcher aktiver ETFs an allen ETFs ist winzig klein, und in Deutschland werden sie im Privatanlegermarkt noch überhaupt nicht angeboten.13Die Nutzung eines aktiv gemanagten ETFs würde der in diesem Buch in den Kapiteln 11 bis 13 dargestellten Anlagestrategie widersprechen.
In die für die meisten Menschen wirtschaftlich bedeutendste Asset-Klasse kann man per ETF allerdings nicht investieren – in das eigene Humankapital. Dieses wichtige Asset beschreibe ich in Abschnitt 10.2.
5Was ETFs für Privatanleger so besonders macht
»Auch wenn es schwer zu akzeptieren ist: Die [Finanz-]Märkte sind so weit informationseffizient, dass Spekulation dem normal informierten Privatanleger mehr schadet als nützt.« (Martin Weber, BWL-Professor Universität Mannheim)
Aus meiner Sicht vereinen ETFs einen Blumenstrauß von neun vorteilhaften Eigenschaften, der sie für die Vermögensanlage von Privatanlegern einzigartig geeignet macht.
Eigenschaft 1: Verständlichkeit. ETFs sind – vor allem für Finanzanfänger – leichter zu verstehen als die allermeisten anderen Formen der Vermögensbildung, auch leichter als die Vermögensanlage vermietete Immobilie.
Eigenschaft 2: Transparenz. Bei einem ETF weiß der Anleger zu Beginn und fortlaufend klarer als bei jedem anderen Finanzprodukt, in was sein Geld tatsächlich investiert ist. In Sachen Transparenz liegen die buchstäblichen Welten zwischen ETFs einerseits und beispielsweise kapitalbildenden Lebens- oder Rentenversicherungen oder einem Vermögensverwaltungsvertrag mit einer Bank andererseits.
Eigenschaft 3: Geringer Arbeitsaufwand/Bequemlichkeit. Wer als Do-it-yourself-Anleger unterwegs ist, der wird keine Anlageform finden, mit der sich der Arbeitsaufwand im Zeitablauf besser minimieren lässt als mit ETFs.
Eigenschaft 4: Niedrige Nebenkosten. Investieren ist niemals frei von Transaktionskosten für Kauf und Verkauf sowie fortlaufenden Nebenkosten. Die in dieser Hinsicht teuersten Investments sind Immobilien. ETFs gehören zu den billigsten. Selbst ein Portfolio aus einzelnen Aktien auf Buy-and-Hold-Basis (Kaufen und Halten) ist realistisch betrachtet langfristig nicht billiger als ein ETF, wenn man das für jeden rationalen Privatanleger anstrebenswerte Ziel »breite Streuung« (Diversifikation) zugrunde legt.
Eigenschaft 5: Sicherheit der rechtlichen Struktur. Die rechtliche Struktur eines ETFs ist in Bezug auf ihre Robustheit unübertroffen. Im folgenden Kapitel 6 zeige ich, was ETFs rechtlich so robust macht und was das für den Anleger bedeutet.
Eigenschaft 6: Universalität. ETFs sind in ihrer praktischen Anwendbarkeit so vielfältig wie die ikonischen roten Schweizer Taschenmesser von Victorinox. Mit keinem Finanzprodukt kann man in mehr verschiedene Asset-Klassen und trennschärfer investieren als mit ETFs.
Eigenschaft 7: Wissenschaftliche Herleitung. Indexfonds wurden Anfang der 1970er-Jahre erfunden, um die Ergebnisse einiger bahnbrechender Forschungsergebnisse aus den vorhergehenden 20 Jahren in die Praxis umzusetzen.14 Eine vergleichbar unmittelbare Ableitung aus der Wissenschaft statt aus Marketing-Erwägungen der Finanzbranche kann kein anderes Finanzprodukt für sich reklamieren.
Eigenschaft 8: Modulares Baukastenprinzip. ETFs bilden Asset-Klassen direkt, rein und transparent ab. Daher eignen sie sich konkurrenzlos gut zur Ergänzung der anderen Vermögensanlagen, die bei einem Privathaushalt unweigerlich schon vorhanden sind (darunter beispielsweise Humankapital – siehe Abschnitt 10.2 – oder ein Anspruch an die gesetzliche Rentenversicherung). Diese Ergänzung ist quasi modular – ohne nachteilige Konzentrationsrisiken aus Überlappungen oder Doppelabbildungen.
Eigenschaft 9: »Aktiv-Passiv-Flexibilität«. Von ETFs heißt es in den Medien, dass sie »das Werkzeug für passives Investieren« seien.15 Das stimmt zwar, ist aber nur die halbe Wahrheit. Mit ETFs kann man auch aktiv investieren. Der größere Teil der rund 10 000 Milliarden US-Dollar, die Anfang 2022 weltweit in ETFs steckten, repräsentiert aktives, nicht passives Investieren. Wer also spekulativ (aktiv) investieren möchte, der kann das auch mit ETFs umsetzen.
Nun habe ich eine Reihe von Vorteilen von ETFs genannt. Daraus folgt zwangsläufig die Frage: Und was sind die Nachteile von ETFs? Bekanntlich hat sehr wenig im realen Leben ausschließlich Vorteile, und das gilt natürlich auch für ETFs.
In Kapitel 9 gehe ich auf die 18 in den Medien und im Internet am häufigsten vorgetragenen Argumente gegen ETFs und ihre angeblichen oder tatsächlichen Risiken ein. Einige dieser Argumente sind falsch, einige zwar nicht falsch, aber irrelevant, einige Nachteile sind schrill übertrieben und einige bewegen sich auf der rein volkswirtschaftlichen Ebene, betreffen also von vornherein nicht Sie als individuellen Anleger. Wenn Sie, lieber Leser, an dieser Stelle auf diese Kritik neugierig sind, dann blättern Sie einfach vor zu Kapitel 9.
6Warum ETF-Investments rechtlich sicher sind
In Bezug auf die Sicherheit der rechtlichen Struktur eines ETF-Investments stellen sich zwei Fragen: (a) Habe ich als ETF-Anleger ein Risiko im Hinblick auf die Fondsgesellschaft als meine Gegenpartei, also ein Ausfallrisiko, wenn der ETF-Anbieter pleitegeht? Und (b) habe ich als ETF-Anleger ein Risiko im Hinblick auf die Depotbank (die Verwahrerin meiner ETF-Anteile) als meine Gegenpartei?
Zur Frage (a): Sicherlich haben Sie schon einmal von dem Konstrukt des Sondervermögens bei Investmentfonds gehört, das ich schon in der Infobox »Investmentfonds und ihr rechtlicher Hintergrund« in Kapitel 3 kurz erwähnt habe. Was hat es damit auf sich? Die Anlegergelder in einem ETF (allgemeiner in einem UCITS-Fonds) bilden aus der Perspektive der Fondsgesellschaft eine Art Treuhandvermögen. Das Anlegervermögen in einem gegebenen einzelnen Fonds ist rechtlich vom Vermögen der verwaltenden Fondsgesellschaft und auch vom Vermögen der anderen Fonds getrennt, die die Fondsgesellschaft sonst noch verwaltet – daher der Begriff »Sondervermögen«. Die Fondsgesellschaft ist nicht Eigentümerin der Anlegergelder, sondern nur ihre Verwalterin oder Treuhänderin.
Für rechtlich in Deutschland ansässige Fonds sind die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen dafür die §§ 92 ff. im Kapitalanlagengesetzbuch (KAGB). Für Fonds, die in anderen EU-Ländern ansässig sind, bestehen vergleichbare Regelungen im nationalen Wirtschaftsrecht. Die Vorgaben für diese nationalen Regelungen kommen – das wird keinen Leser überraschen – von der EU. Fast 90% der in Deutschland und in ganz Europa vertriebenen ETFs haben ihren rechtlichen Sitz in Irland oder Luxemburg..16 Der kleine Rest verteilt sich auf Großbritannien, Frankreich, die Schweiz und Deutschland. Für Aktien-ETFs (nicht für ETFs auf andere Asset-Klassen) hat der Standort Irland quellensteuerliche Vorteile, auf die ich in Kapitel 15 über Steuern näher eingehe.
Und nun die gute Nachricht: Sollte die verwaltende Fondsgesellschaft in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und Gläubiger auf ihr Vermögen zugreifen, ist das für die Vermögensposition der Anleger in den einzelnen Fonds unerheblich. Das ist der Kern des Konzepts Sondervermögen bei UCITS-Fonds.
Die Sondervermögen-Struktur ist keine deutsche oder europäische Erfindung, sondern eine amerikanische. Sie ist steinalt, hat sich während Dutzender schwerer Marktkrisen in den vergangenen 90 Jahren sehr gut bewährt und ist die globale Norm bei Investmentfonds für Privatanleger.
Die Trennung des Sondervermögens vom Vermögen der Fondsgesellschaft wird technisch auch dadurch sichergestellt, dass das Fondsvermögen bei einer separaten Depotbank verwahrt wird (nicht zu verwechseln mit der Depotbank des Anlegers). Diese Depotbank der Fondsgesellschaft unterliegt ihrerseits der nationalen Bankenaufsicht. Sowohl ein Konkurs der Fondsgesellschaft als auch der Konkurs der Depotbank der Fondsgesellschaft wäre aus Anlegersicht unmaßgeblich, weil Anleger davon schlicht nicht betroffen sind.
Im Zusammenhang mit der Frage der Sicherheit und Stabilität der Fondsgesellschaft begegnet mir in der Praxis gelegentlich folgende Anlegerfrage: »Sollte ich bei meinen ETF-Investments in Bezug auf die Fondsgesellschaft diversifizieren (streuen)?« Beispiel: Anleger Julian hat sein liquides Vermögen in drei Aktien-ETFs auf die Indizes MSCI North America, MSCI Europe und MSCI Emerging Markets (Schwellenländer) angelegt, sowie in einen Anleihen-ETF, der weltweit in kurzlaufende Unternehmensanleihen hoher Bonität in Euro investiert. Alle vier ETFs kommen von der Fondsgesellschaft BlackRock (einem großen ETF-Anbieter). Unterstellen wir, dass Julian der Meinung ist, die BlackRock-ETFs seien in Bezug auf die für ihn zählenden Produkteigenschaften (z. B. niedrige Kosten und physische Replikation) gut geeignet. Sollte Julian aus Risikogründen nun bestrebt sein, stattdessen über mehrere verschiedene ETF-Fondsgesellschaften zu streuen (also nicht nur BlackRock-ETFs zu kaufen)? Antwort: Nein, Julian kann diese vermeintliche Vorsichtsmaßnahme getrost ignorieren. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass BlackRock in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sollte, ist sein Vermögen genauso sicher, wie wenn er die entsprechenden ETFs von vier verschiedenen Anbietern hielte.
Infobox:Der Creation-Redemption-Prozess bei ETFs
Der Vorgang, wie ein gegebener ETF-Anteil juristisch und technisch entsteht, bevor er an die Börse gebracht wird und dort von Anlegern gekauft werden kann, nennt sich »Creation-Redemption-Prozess« (Erzeugungs- und Rücknahmeprozess). Normale Privatanleger brauchen diese Details nicht zu verstehen, genauso, wie ein Autokäufer keine KFZ-Mechanikerkenntnisse braucht, um mit seinem Fahrzeug gut fahren zu können. Wer sich dennoch über den Creation-Redemption-Prozess informieren möchte, kann zwei Artikel dazu auf den ETF-Portalen extraETF.com oder justETF.com lesen – einfach »Creation Redemption extraETF« oder »Creation Redemption justETF« googeln.
Nun zur Frage (b): Habe ich als ETF-Anleger ein Gegenparteirisiko (Ausfallrisiko) meiner Depotbank? Antwort: Nein, habe ich nicht. Die Insolvenz der Depotbank des Anlegers wäre für dessen Vermögenspositionen und ETF-Bestände unerheblich, da die Wertpapiere und Fondsanteile in einem Wertpapierdepot wiederum nicht Eigentum der Bank sind, sondern nur von ihr verwahrt werden. Per Analogie: Der Inhalt eines Bankschließfachs ist nicht Eigentum der Bank, sondern wird – wie ETF-Anteile in einem Depot – ebenfalls nur von ihr verwahrt. Im Falle der Insolvenz der Bank verbleibt der Inhalt des Schließfaches natürlich beim Schließfachinhaber. Weil die Depotbank kein Ausfallrisiko repräsentiert, ist es auch sinnlos, sein Wertpapiervermögen zur Minderung des Risikos auf verschiedene Banken zu verteilen.17
Wichtig: Dieser Schutzmechanismus (dass die Bank bei Depots als reine Verwahrstellen fungiert) gilt nicht für Kontoguthaben (Girokonten, Sparkonten, Tagesgelder, Festgelder) und auch nicht in Bezug auf das zum Depot gehörende Verrechnungskonto, das die Depotbank des Anlegers führt. Mehr zum Thema »Gegenparteirisiko Bank« in Abschnitt 16.1.
Die Kombination aus Sondervermögen und dem Verwahrstellenstatus der Depotbanken existiert als Struktur nunmehr seit fast 100 Jahren und hat sich durch eine kaum noch zählbare Abfolge von internationalen und nationalen politischen und wirtschaftlichen Krisen bewährt. Wir erinnern nur an die jüngsten zurückliegenden Marktkrisen, den Dotcom-Crash ab Anfang 2000, die große Finanzkrise ab Anfang 2008 und den Corona-Crash im ersten Halbjahr 2020. Diese drei Stresstests hätten kaum härter sein können, und alle drei haben ETFs als rechtliche Struktur mit Bravour bestanden.
Auch Ausfälle und Krisen individueller Banken oder Fondsgesellschaften konnten der rechtlich betonharten Kombination Sondervermögen + Verwahrstellenstatus nichts anhaben.