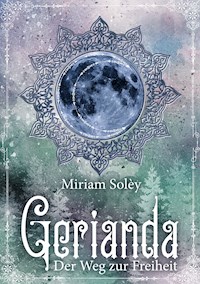
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mireille bekommt seit Jahren kaum Freiheiten von ihrem Vater. Sie weiß, dass es mit dem Verschwinden ihrer Mutter Anita zusammenhängt, zu dem er ihr keine klaren Antworten gibt. Die 18-Jährige sehnt sich nach einer Veränderung, doch damit meint sie keineswegs, nachts mit ihrer besten Freundin Kelly in die Elfenwelt Gerianda zu gelangen. Noch ahnen sie nicht, in welch großer Gefahr sie dort schweben, bis sie von Sanios erfahren. Der Elf ist überzeugt, dass alle Menschen eine Bedrohung sind. Ausgerechnet in ihm erkennt Mireille eine Verbindung zu ihrer Mutter und begreift, dass nicht nur ihr eigenes Leben auf dem Spiel steht. In Gerianda laufen alle Fäden zusammen: Das Geheimnis um Anitas Vergangenheit ist untrennbar mit Mireille und der Zukunft aller Elfen verbunden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Miriam Solèy wurde 1999 geboren und wuchs in Niederbayern auf. Bücher spielten in ihrem Leben schon immer eine große Rolle. In ihrer Kindheit begann sie, sich Geschichten auszudenken, die zunächst aufgemalt und mit Sprechblasen versehen und später aufgeschrieben wurden.
Hauptberuflich arbeitet sie als Erzieherin und interessiert sich neben dem Lesen und Schreiben fürs Korrekturlesen, für Malerei, Musik und Psychologie.
Triggerwarnung
Dieses Buch enthält einzelne Szenen, die für manche Leser*innen eventuell triggernd sein könnten.
Eine genaue Benennung dieser Themen findet sich am Ende des Buches.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Nachwort
1
Mireille
Für einen Moment wollte ich der Realität entfliehen, einfach nur im Gras liegen, die Sonne auf der Haut spüren, nichts tun und vor allem … meine Ruhe haben. Unbeobachtet sein. Allein.
Ein schrilles Klingeln riss mich aus den Gedanken. Hektisch tastete ich nach meinem Handy und erschrak. Schon so spät? Schnell nahm ich den Anruf entgegen.
»Mireille, wo bleibst du?«, ertönte die Stimme meiner besten Freundin Kelly. Ich klemmte mir das Handy zwischen Schulter und Ohr, klopfte rasch das Gras von meiner Jeans und sprintete los.
»Beeil dich!«, rief Kelly, »nicht, dass wir auffliegen!«
»Tut mir leid, ich muss eingeschlafen sein! Bis jetzt ist alles gut, er hat sich noch nicht gemeldet. Bin unterwegs. Wie immer am Waldrand?«
»Ja, bis gleich.« Kelly legte auf und ich sah, dass soeben mehrere Nachrichten auf dem Bildschirm aufgeploppt waren – alle von meinem Vater.
Wo bist du? Geht es dir gut? Mache mir Sorgen … Melde dich bitte.
Ich verlangsamte meine Schritte und tippte eine Antwort. Tut mir leid, Kelly und ich haben die Zeit vergessen. Bin spätestens in 30 Minuten zu Hause.
Dann steckte ich das Handy ein und beeilte mich, Kellys und meinen üblichen Treffpunkt zu erreichen – die alte Bank am Waldrand.
Kelly kam mir schon entgegen. »Alles okay?«
»Ja. Entschuldige, dass du warten musstest. Lass uns gehen, bevor mein Vater durchdreht.«
Sie hakte sich bei mir ein. »Kommst du zurecht? Ich meine, weil heute doch –«
»Ja, ich komme klar. Wirklich. Es hat nichts damit zu tun, was für ein Tag heute ist.«
Kelly nickte knapp. Den Rest des Weges legten wir schweigend und in hohem Tempo zurück. Wie immer fühlte es sich an wie der Eintritt in eine andere Welt, als wir den Waldweg hinter uns gelassen hatten und zurück in der Zivilisation waren. Wie ich es hasste. Der Anblick des Asphalts, der sich leblos an den immer wieder gleich aussehenden Häusern vorbeizog, erstickte mich. Nur in der Natur konnte ich mich frei fühlen.
»Warte mal.« Bevor wir in unsere Straße einbogen, blieb ich stehen. »Ich brauche einen Moment.«
Kelly warf einen Blick auf ihre schwarze Armbanduhr. »Aber dein Vater …«
»Es ist okay. Wir haben uns so beeilt, dass wir auf jeden Fall noch eine Minute Zeit haben.«
»Alles klar.«
»Am liebsten würde ich gar nicht nach Hause gehen«, sagte ich leise. »Nur einmal in meinem Leben möchte ich die Freiheit haben, meine Zeit zu verbringen, wie ich will, und draußen allein sein, ohne meinen Vater belügen zu müssen.«
Sofort plagte mich ein schlechtes Gewissen wegen meines bitteren Tonfalls. »Aber ich darf mich nicht beschweren.«
»Das ist kein Beschweren, Mireille. Es ist belastend, wie du lebst. Jeder würde verzweifeln! Du wirst behandelt wie ein Baby.« Sie kniff die Augen zusammen. »Auch, wenn es schrecklich ist, dass deine Mutter starb: Du wirst nicht sofort verloren gehen, wenn du allein einen Spaziergang machst. Irgendwann muss dein Vater das begreifen.«
Natürlich hatte Kelly recht. Aber wie oft hatten wir diesen Dialog bereits geführt? Letztendlich wusste ich ja doch nicht, wie ich meinem Vater diese Argumente überzeugend und zeitgleich schonend beibringen konnte.
Als hätte Kelly meine Gedanken gelesen, fragte sie: »Willst du vielleicht, dass ich mal mit ihm darüber rede? Oder meine Eltern?«
»Bloß nicht«, entfuhr es mir. »Du bist die einzige Person, der er vertraut und mit der er mich mit gutem Gewissen allein lässt. Nicht, dass er mir dann verbietet, mit dir unterwegs zu sein. Nein, lieber bleibt es, wie es ist, und wir führen unsere Strategie fort. So kann ich wenigstens ab und zu allein sein.« Ich seufzte. »Auch wenn es auf einer Lüge basiert.«
Die Strategie, die wir schon vor einigen Jahren entwickelt hatten, war folgende: Damit mein Vater dachte, ich sei mit Kelly unterwegs, holte sie mich an der Haustür ab – was nicht schwer war, denn wir waren Nachbarinnen. Wenn ich allein sein wollte, kapselte ich mich ab und ging im Wald spazieren. Wir vereinbarten stets eine Zeit, zu der wir uns an der Bank am Waldrand wieder trafen, um brav gemeinsam zurückzugehen. Kelly lieferte mich dann, wie von meinem Vater erwünscht, an der Haustür ab, als wäre sie die ganze Zeit bei mir gewesen.
Wir wirkten wie die Unschuldslämmer in Person. Es war eine Lüge, aber für mich war sie notwendig, um nicht verrückt zu werden.
»Na komm.« Kelly legte den Kopf schief. »Sonst ruft er gleich an.«
Ich nickte und wir bogen gemeinsam in unsere Straße.
»Falls Papa fragt: Wir waren spazieren, haben noch ein Eis gegessen und hatten dabei die Zeit nicht im Blick«, schärfte ich Kelly ein.
»Klar.« Schmunzelnd gab sie mir einen Klaps auf die Schulter und blieb auf Höhe meines Hauses stehen.
»Lieferservice beendet – einmal aussteigen, bitte. Hey, ich sollte Geld von deinem Vater dafür verlangen. Da würde ich glatt reich werden.«
Scherzhaft streckte ich ihr die Zunge heraus, doch sie kicherte bloß.
»Ben hat echt Glück, dass ich nebenan wohne und es mir keine Umstände macht, dich andauernd an der Haustür abzusetzen.«
»Nein«, erwiderte ich, »ich bin es, die Glück hat.«
Kelly umarmte mich. »Du schaffst den heutigen Tag. Und ich überlege mir was Nettes für morgen, okay? Wir könnten mal wieder übernachten.«
Sie malte Anführungszeichen in die Luft und zwinkerte. Ich grinste schief. »Ich freue mich drauf.«
Sobald ich den Schlüssel ins Schloss steckte, wurde die Haustür von innen geöffnet.
»Da bist du ja«, sagte mein Vater erleichtert und winkte kurz Kelly zu, die gewartet hatte, damit er keinen Verdacht schöpfte.
»Danke fürs Begleiten.«
»Immer gern, Ben!« Kelly winkte zurück und verschwand mit beschwingtem Schritt in der Einfahrt nebenan.
»Gut, dass du zu Hause bist.« Papa ging in Richtung Küche. »Ich habe Kaffee gemacht, falls du auch welchen willst.«
»Natürlich«, erwiderte ich mit einem gezwungenen Lächeln und schloss die Tür hinter mir mit Nachdruck.
Willkommen in meinem Leben.
***
Papa schenkte zwei Tassen Kaffee ein. »Wo wart ihr so lange?« Er schob mir eine davon zu, als ich mich zu ihm an den Küchentisch setzte.
»Wir waren noch Eis essen und haben dabei nicht auf die Zeit geschaut.« Ich bemühte mich um einen unbekümmerten Tonfall.
»Ich habe mir Sorgen gemacht.«
»Entschuldige, ich … brauchte Ablenkung.« Unter dem Tisch bohrte ich meine Fingernägel in die Handflächen, als könnte der Schmerz mein schlechtes Gewissen betäuben.
»Ja, ich weiß.« Papa nippte an seinem Kaffee. »Gerade heute fällt mir auch alles besonders schwer, deshalb habe ich besonders viel Angst um dich.« Gedankenverloren schaute er aus dem Fenster. »Ich bin es deiner Mutter schuldig, dich zu beschützen.«
Mein vorheriges Gespräch mit Kelly kam mir in den Sinn. »Das verstehe ich. Aber ich bin achtzehn, Papa. Ich werde nicht für immer hierbleiben können.« Ich kratzte meinen Mut zusammen und fuhr fort: »Manchmal fühle ich mich wie ein eingesperrtes Tier. Ich denke, es wäre Zeit für ein paar mehr Freiheiten.« Mit angehaltenem Atem erwartete ich einen Widerspruch. Doch er blieb aus.
»Papa?«
Als er sich zu mir drehte, schimmerten Tränen in seinen Augen. Sofort verfluchte ich mich dafür, meinen Mund nicht gehalten zu haben. »Tut mir leid, Mireille.« In seinem Tonfall schwang bereits das Aber mit. »Ich weiß, es ist schwer für dich und du hältst mich für einen übertriebenen Kontrollfreak. Aber ich kann kein Risiko eingehen. Dir könnte dasselbe zustoßen wie deiner Mutter und ich würde mir nie verzeihen, dich auch zu verlieren.«
Seine Stimme brach. »Du bist alles, was mir noch wichtig ist …«
Voller Reue, die Konversation in diese Richtung gelenkt zu haben, stand ich auf und umarmte meinen Vater als Zeichen einer stillschweigenden Entschuldigung.
»Ich möchte sie nachher besuchen«, sagte er schließlich. »Begleitest du mich?«
»Ja, natürlich.«
***
Am späten Nachmittag gingen wir nebeneinander den Schotterweg entlang, der sich durch den Friedhof zog und die Gräber teilte. Dann machten wir Halt. Mein Vater stellte die Blumen ab, die er nach der Arbeit besorgt hatte.
Ich starrte den Namen auf dem Grabstein an, als hätte ich ihn noch nie zuvor gesehen. Anita Winter.
Meistens kam Papa allein her, denn nachdem wir vier Umzüge hinter uns hatten, war der Friedhof beinahe zweihundert Kilometer von dem entfernt, was ich mein Zuhause nennen sollte. Durch die ständigen Wechsel fühlte sich kaum noch irgendetwas nach Zuhause an.
Nur an Mams Todestag begleitete ich ihn immer hierher. Für ihn war es mehr als eine Geste, diesen Friedhof zu besuchen und Blumen zu besorgen. Für sein Empfinden spielte es eine Rolle, hier ab und zu mit Mam zu sprechen.
Wenn ich dagegen vor dem kalten, grauen Stein stand, tat sich ein riesiges Loch in meiner Brust auf, das nicht zu füllen war. Dieser stille Ort gab mir nichts. Vermutlich, weil Mams Leiche nie gefunden worden war und das Grab somit nur als symbolische Gedenkstätte diente. Nicht einmal ihr toter Körper war geblieben. Sie war einfach weg.
Ich hatte keinen Platz, an dem ich Mam noch spüren konnte. Nicht einmal zu Hause, denn in unserem jetzigen Haus war sie nie gewesen. Hier lebten wir nun seit fünf Jahren und endlich schien sich mein Vater damit arrangiert zu haben, sesshaft zu werden. Ich war froh darüber, denn sonst würde ich Kelly verlieren und somit den einzigen Menschen, der mir das Gefühl gab, halbwegs normal zu sein.
Mein Vater zückte ein Taschentuch. Ich schämte mich für meine unausgesprochenen Gedanken und dafür, dass ich nicht so intensiv trauern konnte wie er. Doch seit Mams mysteriösem Verschwinden war mein Leben kein Leben mehr.
Es war ein leidliches Thema, über das er niemals offen sprach. Auf jede Nachfrage hatte er nur vage gesagt, dass Mams Verschwinden kein Zufall gewesen sei und dass mir das Gleiche geschehen könnte. Früher hatte ich angefangen zu diskutieren, hatte verzweifelt gerufen: »Was genau ist ihr passiert? Erklär es mir, dann wüsste ich wenigstens, worauf ich aufpassen soll!«
Nach Jahren war die Suche nach meiner Mutter eingestellt worden. Aus irgendeinem Grund war mein Vater absolut überzeugt, dass ihr Überleben ausgeschlossen sei und hatte diesen Grabstein organisiert. Das waren alle Fakten, die ich kannte.
Ich berührte das Seidentuch, das ich heute trug.
Der grüne Stoff bildete einen schönen Kontrast zum Kastanienbraun meiner Haare und war, genau wie bei Mam, perfekt auf meine Augen abgestimmt.
Sie hatte mir das Tuch zu meinem siebten Geburtstag geschenkt, der letzte, an dem sie noch bei mir gewesen war, und es bedeutete mir erheblich mehr als diese leere Gedenkstätte. Sie selbst hatte das gleiche grüne Tuch im Haar getragen, als sie mir das meine überreichte. Bis heute erinnerte ich mich genau an ihre Worte.
»Das Tuch zeigt, dass wir verbunden sind. Wann immer wir es tragen, denken wir ganz besonders daran, wie lieb wir uns haben.«
Dann hatte sie es mir an den Pferdeschwanz geknotet, mir einen Kuss gegeben und gesagt: »Ich hab dich so lieb.«
Für mich war es zu einer Art Ritual geworden, das Tuch immer an ihrem Todestag zu tragen.
Mein Vater legte mir tröstend einen Arm um die Schulter. Ich ließ ihn gewähren, in dem Wissen, dass eigentlich er derjenige war, der Trost suchte.
»Wir lieben dich«, sagte er leise an das Grab gewandt und drückte mich leicht an sich.
»Wir lieben dich«, wiederholte ich ausdruckslos. Ja, ich liebte sie. Aber ich hasste den Stein, zu dem ich es sagte.
Papa küsste seine Fingerspitzen und berührte sacht Mams Namen, bevor er sich abwandte. Ich berührte mein Seidentuch. Ich hab dich lieb.
Dann folgte ich meinem Vater zum Auto.
***
Auf der langen Rückfahrt hatte ich nicht wirklich Lust, mich zu unterhalten und war froh, dass mein Vater das auch nicht von mir erwartete. Stattdessen schrieb ich mit Kelly.
Hab einen Plan für morgen, hatte sie getextet. Du übernachtest bei mir und wir schleichen uns raus.
Wohin?, antwortete ich.
Nur bisschen was Trinken mit ein paar Freunden. Du musst mal wieder unter Leute kommen, sonst gehst du ein.
Ich warf einen Seitenblick auf Papa und fühlte mich sofort wieder schuldig. Dann aber beschloss ich, das zu ignorieren.
Wann mache ich so etwas schon, dachte ich. Es ist okay, jeder würde es verstehen. Und ich bin erwachsen.
Während mein Freundeskreis ausschließlich aus Kelly bestand, hatte sie zahlreiche Personen, die sie als Freunde und Freundinnen bezeichnen konnte, und einen noch größeren Radius an Bekannten.
Manchmal hätte ich gern mit ihr getauscht. Dass sie mich heimlich auf ihre abendlichen Treffen mit Gleichaltrigen mitnahm, kam so selten vor, dass es jedes Mal etwas Neues für mich darstellte. Und immer hatte ich das Gefühl, nicht zugehörig zu sein. Ich wusste, dass ich von meinen Klassenkameraden als stille Eigenbrötlerin betrachtet wurde. Mit der Zeit hatte ich mir eingeredet, keine Freunde außer Kelly zu brauchen. Auf diese Weise konnte ich wenigstens so tun, als wäre es meine freie Entscheidung, allein zu sein.
Dennoch waren die wenigen Male im Jahr, wo Kelly und ich uns heimlich irgendwohin schlichen, meine einzige Gelegenheit, außerhalb der Schule mal mehr Menschen als nur Kelly zu sehen. Auch wenn mich der Gedanke immer etwas einschüchterte, käme es mir nie in den Sinn, ihre Idee zu verwerfen.
»Papa, ist es in Ordnung, wenn ich morgen bei Kelly übernachte?«
»Ja, okay.«
»Danke«, sagte ich und schickte Kelly einen Daumen hoch.
***
Gegen Abend ging ich auf der Suche nach etwas Essbarem nach unten. Die Wohnzimmertür stand einen Spalt offen und ich sah, dass mein Vater auf dem Sofa eingenickt war. Auf dem niedrigen Tisch vor ihm lag ein handliches Buch mit ledernem Einband.
Auf Zehenspitzen kam ich näher und griff nach einer Wolldecke, um sie Papa überzulegen. Dabei warf ich einen Blick auf das Buch und nahm es neugierig in die Hand, wobei ich einen Finger in die geöffnete Seite legte.
Beim groben Durchblättern stellte ich fest, dass die Seiten allesamt mit der kleinen, schnörkeligen Handschrift meiner Mutter beschrieben waren. Ich schlug wieder die offene Seite auf.
Unsere Tochter ist bezaubernd. Ich glaube, es ist unmöglich, dieses Kind nicht zu lieben. Ben sagt, sie habe meine Augen und meine Nase. Ich finde, man kann das noch nicht beurteilen, aber sie ist wirklich das Schönste, was ich je gesehen habe. Es dauerte nicht lange, bis ich den Namen unserer Tochter klar vor mir hatte: Mireille.
Mams Tagebuch – eindeutig. Warum hatte Papa es mir nie zuvor gezeigt, wo es doch eine wundervolle Erinnerung an sie zu sein schien?
Meine Augen tränten vor Rührung, aber gleichzeitig spürte ich einen scharfen Stich der Enttäuschung in meinem Herzen. Mein Vater hatte sich anscheinend dazu entschieden, mir diese Verbindung vorzuenthalten, die weitaus lebendiger wirkte als der blöde Grabstein.
Ich blätterte weiter, diesmal bis fast nach hinten. An dieser Stelle war die Tinte schlechter zu lesen und stellenweise verwischt.
Mir bleibt keine Wahl. Es bricht mir das Herz, aber …
»Mireille!«
Ich zuckte zusammen und fast rutschte mir das Buch aus der Hand.
»Tut mir leid, Papa, ich –«
Doch er wartete meine Erklärung nicht ab, entriss mir das Buch und presste es schützend an seine Brust. »Was ist in dich gefahren? Das ist nicht für deine Augen bestimmt!«
Ein heißes Gefühl der Scham gemischt mit Unverständnis ließ mich erstarren. Ich rang um Worte, denn ich hatte ihn lange nicht mehr so erlebt. Besser gesagt, noch nie.
»Ich … Ich habe gesehen, dass es Mams Tagebuch ist. Warum hast du es mir nie gezeigt?«
Mein Vater atmete ein paar Mal tief ein und aus, bevor er antwortete. »Ich habe meine Gründe. Du brauchst sie nicht zu wissen.«
Sein harscher Ton trieb mir erneut Tränen in die Augen. Als er diese sah, wurde sein Gesicht etwas milder.
»Entschuldige, ich wollte dich nicht anfahren. Ich habe mich nur furchtbar erschrocken, als ich das Buch in deinen Händen gesehen habe.«
»Schon okay«, murmelte ich, obwohl die Fragezeichen zu Dutzenden über meinem Kopf standen. Aber Papas Reaktion schien keiner dieser Fragen Raum zu geben.
»Ich will das Beste für dich. Vertraust du mir?«, fragte er und ich nickte.
»Gut. Lass uns das einfach vergessen, in Ordnung?«
Wieder nickte ich und ging dann rückwärts hinaus, zurück nach oben. Noch auf der Treppe hielt ich inne, als ich meinen Vater in sein Arbeitszimmer gehen hörte, wo er vermutlich das Buch verstaute. Warum dieses Geheimnis?
Ich schloss meine Tür hinter mir. Der Appetit war mir gänzlich vergangen.
***
In jener Nacht lag ich lange wach, warf mich von links nach rechts und wieder zurück. Diese Sache ließ mich nicht ruhen, ich musste wissen, was es mit dem Tagebuch auf sich hatte. Der Eintrag, den ich gelesen hatte, war bewegend. Warum wollte mein Vater nicht, dass ich solche Worte von meiner Mutter zu Gesicht bekam?
Ich erinnerte mich an die Zeilen, die ich nicht hatte zu Ende lesen können. Im Vergleich zum ersten Eintrag hatte in diesem trotz der Kürze eine verzweifelte Stimmung gelegen. Die Bettdecke lag plötzlich zu schwer auf meiner Brust; ich schlug sie zurück und setzte mich auf.
Ich warf einen Blick auf mein Handy. Es war bereits nach drei – inzwischen sollte mein Vater längst schlafen … konnte ich es wagen?
Entschlossen schwang ich die Beine aus dem Bett. Ja, ich konnte. Ich hatte ein Recht auf die Wahrheit.
Im schwachen Schein meines Handys ging ich die Treppe hinunter. Bis auf das Tappen meiner nackten Füße auf den Stufen herrschte vollkommene Stille.
Nur die Tür zum Arbeitszimmer meines Vaters gab beim Öffnen ein leises Knarren von sich. Ich traute mich nicht, die Lampe anzuschalten, deshalb beließ ich es beim Handylicht.
Eingehend ließ ich dieses über das große Bücherregal schweifen, obwohl ich kaum dachte, dass Papa es dort verwahrte, wenn es doch so ein Geheimnis für ihn war. Aber ich wollte sichergehen.
Als Nächstes zog ich nacheinander vorsichtig die Schreibtischschubladen auf. Mir war klar, dass ich damit das Vertrauen meines Vaters missbrauchte. Nie zuvor wäre es mir in den Sinn gekommen, seine privaten Dinge zu durchwühlen, aber ich hatte keine Wahl.
Mir bleibt keine Wahl.
Eine Gänsehaut überzog meinen Rücken, als ich an diese Worte aus dem Tagebuch dachte. Sie beflügelten mich, weiterzusuchen. Ich musste unbedingt wissen, warum und wobei Mam keine Wahl geblieben war.
Endlich, ich hatte Glück. Unter einem Stapel Briefkuverts kam das Tagebuch zum Vorschein. Behutsam nahm ich es heraus, meine Hände zitterten beim Durchblättern.
Mir bleibt keine Wahl. Es bricht mir das Herz, aber die beiden in Sicherheit zu wissen, ist mehr wert als mein eigenes Wohl. Ich wünschte, ich könnte mich ihnen anvertrauen.
Ich weiß nicht, ob ich überleben werde. Nein … ich bin sogar sicher, dass ich sterben werde. Könnte ich doch nur bleiben …
Das war die letzte beschriebene Seite. Ich konnte die Gedanken kaum fassen, die mir nach diesen Zeilen durch den Kopf wirbelten. Sie musste uns in Sicherheit wissen? Wann waren wir nicht in Sicherheit gewesen?
Und überhaupt: Ihre Formulierung klang, als sei sie kein Entführungsopfer. Es klang, als wäre sie gegangen. Freiwillig. Sie hatte uns verlassen … und damit ihren eigenen Tod in Kauf genommen?
Das Arbeitszimmer verschwamm vor meinen Augen und ich hielt ich mich an der Schreibtischkante fest. Ich blinzelte ein paar Mal, bis sich mein Blick klärte, und öffnete die Kamera-App auf meinem Handy, um den letzten Eintrag zu fotografieren.
Dann schob ich das Tagebuch tief durchatmend wieder unter die Briefumschläge, genauso, wie ich es vorgefunden hatte. Mit dröhnendem Herzen verließ ich den Raum.
2
Mireille
Papa? Ich geh rüber zu Kelly.«
»Warte mal.« Papa blickte von seiner Zeitung auf. »Du hast heute bedrückt gewirkt. Kann ich irgendwie helfen?«
Ja, hätte ich ihm am liebsten entgegengeschleudert, du könntest endlich ehrlich zu mir sein!
»Falls es wegen gestern Abend ist«, fuhr er zögernd fort, »es tut mir wirklich leid, dass ich dich angegangen bin. Ich hoffe, du verzeihst mir.«
Mit Mühe schluckte ich meine brodelnde Wut hinunter und zwang mich zu einem halbherzigen Lächeln. »Ist längst vergessen. Alles in Ordnung.«
»Okay … wenn du das sagst. Pass auf dich auf, ja?«
»Natürlich. Außerdem bin ich nur nebenan. Was soll mir schon passieren?«
Papa lächelte. »Ich weiß, Schatz. Wir sehen uns morgen.«
Eine Hand zum Abschied gehoben, schulterte ich meine Tasche und verließ das Haus.
***
»Ich freu mich total auf den Abend«, platzte es aus Kelly heraus, sobald sie mir die Tür öffnete. »Ich werde Jess schreiben, wenn meine Eltern schlafen, dann treffen wir uns beim Imbiss und essen erst ne Kleinigkeit. Danach gehen wir wahrscheinlich irgendwo was Trinken.«
Nach einer übermütigen Pirouette, bei der sie fast über die eigenen Füße stolperte, schlang sie die Arme um mich. »Heute wird es noch cooler als sonst, weil du dabei bist.«
Wieder setzte ich ein Lächeln auf, obwohl mir nicht danach war, denn ich wollte Kellys Aufregung nicht verderben. Aber eigentlich wartete ich nur auf eine passende Gelegenheit, ihr von der Entdeckung des Tagebuchs zu erzählen. Und von all den Zweifeln, die sich seitdem in mir aufgetan hatten wie der gierige Schlund eines wilden Tieres. Ich wartete nur darauf, davon verschluckt zu werden.
»Klingt super«, murmelte ich.
»Du bist mit deinen Gedanken ganz woanders«, stellte Kelly fest. Auf frischer Tat ertappt.
»Entschuldige. Irgendwie bin ich nicht in der richtigen Stimmung, um auszugehen.«
»Warum nicht?«
Kelly stupste mich am Arm, als ich keine Anstalten machte, zu antworten. »Hey, was ist mit dir?«
»Ich muss dir etwas erzählen«, flüsterte ich, doch dann schnürte sich mir die Kehle zu und ich brachte kein weiteres Wort heraus.
Kelly musterte mich eingehend. Als ihr Blick an dem grünen Seidentuch hängenblieb, wurde dieser weich und mitfühlend. »Du trägst es normalerweise nur an ihrem Todestag. Also muss es einen Grund haben, warum du es heute trägst. Es ist etwas wirklich Wichtiges, nicht wahr?«
Ich nickte nur, aus Angst, in Tränen auszubrechen, wenn ich eine Erklärung wagen würde.
»Okay«, sagte Kelly, »ich sage den anderen ab. Vielleicht war das heute keine besonders gute Idee.«
Sie machte es sich auf ihrem Bett bequem und klopfte neben sich, damit ich mich zu ihr setzte.
»Wir machen uns einen gemütlichen Abend zu zweit, bestellen Pizza und wenn meine Eltern schlafen, gehen wir draußen ein Stück. Klingt das besser?«
»Viel besser.«
***
Als im Haus Stille eingekehrt war, schlichen wir unbemerkt hinaus. Kaum waren wir um die Ecke gebogen, entspannte ich mich. Endlich war ich der Enge des Hauses entkommen und nahm die Weite in meinem Brustkorb wahr, die sich mit jedem tiefen Atemzug verstärkte.
Der Frieden der Nacht und das Licht des Vollmonds, das alles in einen geheimnisvollen Glanz tauchte, waren der beste Balsam für meine wilden Gedanken. Wenn man nicht genau hinsah, wurde der Asphalt zu unseren Füßen zu einem silbernen Fluss, dem ich bereitwillig folgte. Zum ersten Mal seit gestern Abend kam ich ein wenig zur Ruhe.
Wir strebten auf unseren Lieblingsplatz zu: die alte Bank, die gebadet in Mondlicht wie ein stiller Freund wirkte. Kelly setzte sich und zog mich sanft am Ärmel. »Erzähl mir, was los ist.«
Seufzend streckte ich die Füße von mir und sammelte mich.
»Gestern habe ich Mams Tagebuch im Wohnzimmer liegen sehen. Weil Papa auf dem Sofa schlief, habe ich darin gelesen. Du hättest seine Reaktion sehen sollen, als er aufwachte und mich sah.« Die Erinnerung ließ mich den Kopf schütteln. »Danach versteckte er es, aber ich habe heimlich danach gesucht. Ich musste unbedingt mehr wissen. Ich zeige dir, warum.«
Zum Beweis zog ich mein Handy heraus und zeigte Kelly das Foto, das ich gestern gemacht hatte. Mit gerunzelter Stirn las sie den Abschnitt. Schließlich reichte sie mir mein Telefon zurück und sah mich an. »Du denkst, sie hat euch von sich aus verlassen«, schlussfolgerte sie.
Wieder fühlte ich mich, als würde mir jemand die Luftzufuhr abschneiden. »Es ist offensichtlich, oder? Aber warum? … Und warum wusste sie, dass sie sterben muss? Was hat sie nur getan?«
»Hast du deinen Vater darauf angesprochen?«
»Nein.«
»Aber du hast ein Recht darauf, die Wahrheit zu kennen. Jetzt noch mehr!«
»Ich kann ihm nicht sagen, dass ich nachts seine Schubladen durchwühlt habe. Außerdem: Würde mein Vater wollen, dass ich die Wahrheit kenne, hätte er mir nicht all die Jahre dieses Tagebuch verschwiegen.«
»Verteidigst du ihn etwa?«, fragte Kelly entgeistert. »Nein, Mireille, das geht so nicht weiter! Das Ganze frisst dich innerlich auf. Die Fragen in deinem Kopf bleiben und dein Vater ist der einzige Mensch, der Antworten hat.« Sie ballte die Hände zu Fäusten. »Es gibt etwas, das er bewusst nicht preisgibt. Bist du denn gar nicht wütend?«
»Doch«, sagte ich leise. »Ich bin wütend. So sehr, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Mein Vater hat es nicht leicht und ich möchte ihn nicht verletzen. Ich kann ihn nicht überrumpeln. Vielleicht ergibt sich bald eine bessere Gelegenheit, das anzusprechen.«
»Warte nicht zu lang damit«, schärfte Kelly mir ein und rüttelte an meinem Arm. »Du musst unbedingt die Fakten kennen. Und dass du sie mir dann brühwarm weitererzählen musst, ist dir hoffentlich klar.« Selbst jetzt schaffte sie es, mich mit ihrer scherzhaften Art minimal aufzumuntern.
Ich senkte den Blick auf das Display meines Smartphones, in dem sich der Vollmond spiegelte. Das Bild verschwamm. Stutzend zog ich die Brauen zusammen und sah zum Himmel.
»Alles okay?«, fragte Kelly. Ich fixierte den Mond, der wolkenlos am Himmel prangte.
»Ja … ich dachte nur, ich hätte gesehen, dass …«
Ich stockte, als ich wieder auf mein Handy schaute. Der Mond flimmerte weiterhin darin, nun aber um einiges stärker. Ich ließ das Handy fallen, als hätte ich mich daran verbrannt. Hektisch sprang ich auf und betrachtete abwechselnd misstrauisch mein Telefon und den Mond.
Kelly erhob sich und legte mir die Hand auf die Schulter. »Was ist los mit dir? Du verhältst dich gerade ziemlich sonderbar. Also … sonderbarer als sonst.« Sie lachte nervös.
Mein Blick glitt über die Wiese, die dunklen Schemen der Bäume im Hintergrund. Nichts. Ich sah auf den Weg zurück, den wir gekommen waren, dann wieder zu meinem Handy.
Es konnte doch nicht –
Ein Stechen in meinen Schläfen unterbrach meine Gedanken. Ich fasste mir an den Kopf, in dem sich ein merkwürdiges Summen ausbreitete. Meine Finger kribbelten. »Irgendwas stimmt nicht.«
Ich schnappte mir mein Handy und hielt es Kelly prüfend vors Gesicht. »Sieh dir an, wie der Mond sich spiegelt«, forderte ich sie auf.
»Ähm … schön?«, erwiderte Kelly verwirrt.
»Verschwimmt das Bild?«
Kelly wirkte mehr als konfus. »Keine Ahnung, was du meinst. Gehts dir nicht gut? Setz dich vielleicht kurz. Langsam mach ich mir Sor–«
»Schau!«, unterbrach ich sie und deutete an den Waldrand. Es sah aus, wie es bei großer Hitze manchmal auf den Straßen zu beobachten war. Aber jetzt war es viel zu kühl – und mitten in der Nacht.
»Da ist gar nichts!« Überfordert warf sie die Arme in die Luft.
»Aber siehst du das Flimmern nicht?« Ich beharrte auf dem, was ich sah. Solch ein unbekanntes, faszinierendes Phänomen konnte einfach nicht meiner Fantasie entsprungen sein.
Kelly umfasste mein Handgelenk und zog mich in die Richtung, in die ich gedeutet hatte.
»Da ist nichts. Nur Bäume. Wenn du einen Beweis brauchst, nur zu. Sieh dir die Bäume an und dann gehen wir nach Hause. Ich denke, du bist übermüdet.«
Je näher wir kamen, desto stärker flackerte die Luft und umso silbriger erschien mir der Fleck, so als würde sich das Mondlicht darin sammeln. Winzige, silberne Funken sonderten sich davon ab, gefolgt von weißen Nebelschwaden, die gemächlich umherschlängelten. Wieso sah Kelly es nicht? Was stimmte nicht mit mir?
Etwa zwei Schritte von der merkwürdigen Erscheinung entfernt hielt ich Kelly zurück. »Es ist direkt vor uns. Siehst du es jetzt?«
»Direkt vor uns ist nichts!« Sie zog mich weiter.
»War–« Mir blieben die Worte im Hals stecken, als wir wie durch magnetische Anziehung mitten in das Flimmern gesogen wurden.
Kühler Nebel umschloss mich und sogleich fühlte ich mich absolut schwerelos. Silbrige Funken tanzten über meinen ganzen Körper. Ich glaubte lauthals zu schreien, doch kein einziger Ton verließ meine Kehle. Kellys Hand klammerte sich weiterhin an meinen Arm, aber ich spürte ihre Berührung kaum auf der Haut.
Wohin ich sah, war silbernes Licht. Es gab weder oben noch unten, weder Himmel noch Erde.
Fühlt es sich so an, zu sterben?
Unvermittelt war es vorbei.
Langsam kehrte die Schwerkraft in meine Gliedmaßen zurück. Mein Atem ging flach. Ich rappelte mich auf und fasste mir an die Brust. Von der silbernen Luft war nichts mehr zu sehen, stattdessen fand ich mich auf einer Lichtung wieder, die von knorrigen, hohen Bäumen gesäumt war. Der Geruch von modrigem Laub stieg zu mir auf, während der Vollmond unschuldig auf mich hinabschaute.
»Mireille?« Kelly neben mir klang dumpf wie durch eine Glasscheibe. Allmählich lichteten sich meine Sinne und ließen mich ihre Stimme klar hören. »Was war das?«
»Keine Ahnung«, murmelte ich, »aber du hast es auch gespürt und gesehen, oder?«
»Kurz bevor … Ja, ich habe das komische Silberzeug gesehen. Wie …« Kelly drehte sich einmal im Kreis. »Was zur Hölle …?«
Das, was sich in ihren Augen widerspiegelte, fasste mein eigenes Empfinden gut zusammen. Verwirrung. Panik. Absoluter Unglaube.
»Ich habe nicht den leisesten Schimmer, was gerade passiert ist.« Dieser Satz aus ihrem Mund war eine Seltenheit, denn normalerweise fand Kelly auf jede Frage eine logische Antwort. Kaum etwas hasste sie mehr als ungelöste Rätsel.
»O Gott, glaubst du, UFOs sind doch real?« Ihre Stimme klang mindestens eine Oktave höher als sonst.
»Ach, Blödsinn!« Ich sträubte mich gegen den Gedanken, auch wenn ich keine bessere Erklärung hatte.
»Aber was war das dann eben?«
»Keine Ahnung …«
Wir wechselten einen Blick, ehe wir uns wieder der Umgebung widmeten. Es könnte eine Lichtung in unserem Wald sein, so gut war es in der Dunkelheit nicht auszumachen, aber wie erklärten wir uns, dass wir uns überhaupt auf einer Lichtung befanden? Die Bank stand am Waldrand, nicht mittendrin.
»Wir sollten sehen, dass wir den Weg nach Hause finden«, schlug ich um Ruhe bemüht vor.
»Okay. Hast du dein Handy?«
Ich erschrak. Am liebsten hätte ich mich selbst geohrfeigt, weil ich es aus der Hand gelegt hatte. »Es liegt auf der Bank, schätze ich …«
Kelly plusterte beim Nachdenken die Backen auf und stieß langsam die Luft aus. »Dann tun wir das Nächstbeste: Wir gehen hundert Schritte und schauen, ob uns etwas bekannt vorkommt. Wenn nicht, kehren wir hierher zurück und versuchen eine andere Richtung. Wir finden sicher hier raus.«
Es knackte im Unterholz. Ängstlich sah ich mich um, doch Kelly marschierte bereits willkürlich in eine Richtung los. Mangels einer besseren Idee folgte ich ihr.
Je weiter wir gingen, umso dichter lehnten sich die Bäume aneinander und verschluckten mit ihren Kronen jegliches Licht. Es war, als würden sie uns bewusst am Weiterkommen hindern und uns zum Stehenbleiben zwingen. Tiefhängende Zweige streiften immer wieder mein Gesicht und zogen an meinem Haar. Diese Berührung ließ mich an raue, knochige Finger denken und jedes Mal zusammenzucken.
»Siehst du was, Mireille?«
»Nein, ich erkenne nichts wieder. Lass uns umkehren und eine andere Richtung einschlagen, sonst geraten wir nur immer tiefer in den Wald hinein.«
Kelly stimmte mir zu. Es war schwer, den Weg zurückzufinden, doch ich atmete auf, als die Bäume nicht mehr so eng standen und wir auf derselben kleinen Lichtung landeten. Wir überquerten diese, um in entgegengesetzter Richtung unser Glück zu versuchen. Aber auch dort kamen wir nicht wirklich weiter. Dies war definitiv nicht unser Wald.
Angst rumorte in meinen Eingeweiden. Normalerweise war der Wald mein Ruheort, doch jetzt wirkte die Undurchdringlichkeit der Natur wie ein Gefängnis.
Als wir nach diesem zweiten Versuch ein weiteres Mal auf der Lichtung landeten, hatten dicke Wurzeln sowie dorniges Gestrüpp ihre Spuren hinterlassen. Meine Füße schmerzten und auch das Brennen der aufgeschürften Waden war nicht zu ignorieren.
Kelly schnaubte frustriert. »So ein verdammter Mist!«
»Was nun?«, fragte ich vorsichtig, »Gehen wir –«
»Vergiss es, ich laufe keinen Meter mehr«, fiel sie mir ins Wort. »Ich sags ungern, aber das bringt nichts. Es ist zu dunkel.«
»Du hast wohl recht.« Ich strich mir ein paar Haarsträhnen hinter die Ohren. »Aber was, wenn … wenn es gar keinen Weg hier fort gibt? Was, wenn uns das seltsame Flimmern ins Nirgendwo gebracht hat?«
Während unserer Versuche aus dem Wald hinaus war es mir teilweise gelungen, dieses unerklärliche Erlebnis beiseitezuschieben, aber nun war es nicht länger zu ignorieren.
»Nee. Mitten in diesem Silberdings, das war das Nirgendwo. Aber das ist ein Wald. Also: Selbst wenn wir an den Arsch der Welt teleportiert wurden, sind wir irgendwo.«
Teleportiert.
Sie hatte ausgesprochen, was nach bisherigem Wissen unmöglich gewesen war und dennoch geschehen sein musste. Wie sehr wünschte ich, das alles wäre nur ein Albtraum.
»Machen wir das Sinnvollste aus der Situation: Wir bleiben hier, bis die Sonne aufgeht.« Kelly kickte einen trockenen Tannenzapfen ins Gebüsch. »Wenn wir weiter herumrennen, verirren wir uns am Ende noch mehr. Jetzt haben wir wenigstens diese Lichtung als Orientierungspunkt.«
Zugegeben: Der Plan leuchtete mir ein. Dennoch machte ich mir große Sorgen. »Hoffentlich merken deine Eltern nicht, dass wir nicht da sind. Und mein Vater …«
»Keine Sorge. Die denken alle, dass wir lange pennen, weil wir die ganze Nacht Filme geguckt haben. Vor zwölf Uhr mittags wird niemand in mein Zimmer sehen, glaub mir. Bis dahin … finden wir sicher einen Weg.«
Sie legte sich rücklings ins Moos und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. »Wir sollten versuchen, ein paar Stündchen Schlaf zu kriegen.«
»Hier?«
»Nein, in dem 5-Sterne-Hotel da drüben.« Ich konnte Kellys Augenrollen förmlich hören.
»Mireille, du weißt, ich bin eigentlich kein Naturmensch, aber jetzt habe sogar ich keine andere Möglichkeit, als mir einen Haufen Blätter als Kopfkissen zu gönnen. Da du von uns beiden die Naturliebende bist, sollte dir das leichter fallen als mir.« Dann wurde ihre Stimme sanfter. »Ich weiß, du hast Angst und ein schlechtes Gewissen wegen deines Vaters. Aber ich verspreche dir, dass er nichts davon mitkriegen wird.«
Nicht sonderlich überzeugt legte ich mich neben sie. Ihr Versprechen spendete keinen Trost. Wie sollte es auch? Niemand konnte eine Lösung für etwas finden, das über die Grenzen der Realität hinausging.
Ein Windhauch fuhr über mich hinweg und ließ mich frösteln. Ich schlang die Arme um meinen Oberkörper und zog die Beine an. Leises Rascheln in den Büschen hinderte mich daran, überhaupt die Augen zu schließen. Unruhig warf ich mich hin und her, bis ich von Kelly einen leichten Stoß zwischen die Rippen erntete.
»Ich schlafe«, nuschelte sie und war schon wieder abgedriftet. Hätte ich nur dieselbe Ruhe verspürt wie sie. Stattdessen wucherten die Sorgen in mir wie Unkraut und erstickten jeden hoffnungsvollen Keim.
Ich war sicher gewesen, die ganze Nacht keinen Schlaf zu finden, doch irgendwann übermannte mich die Müdigkeit.
3
Mireille
Geweckt wurde ich von lautem Vogelgezwitscher. Die Sonne begann gerade, den Himmel zu erklimmen und hüllte die Wolken in satte Rot- und Gelbtöne.
Die vergangene Nacht war eine der schlimmsten gewesen, die ich je erlebt hatte. Wenn mich nicht ein Geräusch aus dem Schlaf gerissen hatte, war die Kälte schuld gewesen, die auch jetzt in meinen Knochen steckte. Verschlafen setzte ich mich auf, drückte den Rücken durch und legte den Kopf von links nach rechts, um meinen verspannten Nacken zu dehnen.
Mein Magen knurrte so laut, dass ich befürchtete, Kelly damit zu wecken.
Ich konnte nicht länger liegen bleiben. Kaum aufgestanden, zupfte ich meine Kleidung zurecht, die genauso klamm war wie das Moos, auf dem ich gelegen hatte. Ich rieb mir die eiskalten Finger und blickte mich um.
Nebelschwaden krochen über den Boden und die von Tautropfen benetzten Spinnweben funkelten sanft im Schein der morgendlichen Sonnenstrahlen.
Erst im Hellen bemerkte ich das sonderbare Aussehen mancher Bäume: Ihre knorrigen Stämme wanden sich in engen Spiralen um sich selbst und verzweigten sich in ausladende Baumkronen, die wohl das gesamte Spektrum der existierenden Grüntöne durchliefen.
Mit wachsendem Staunen betrachtete ich ein schmetterlingsförmiges Blatt. Es war dünner als jedes Blatt, das ich zuvor gesehen hatte und seine feinen Adern wirkten wie mit einem Skalpell hineingeritzt. Ich hob es auf und sah mich genauer um, auf der Suche nach dem zugehörigen Baum. Ich entdeckte einen kleinen Strauch, der diese Blätter trug, und ging ehrfürchtig darauf zu. Mir schoss durch den Kopf, dass ich unbedingt nach dem Namen dieser fremden Pflanze suchen musste, sobald ich wieder zu Hause war. Wenn ich jemals wieder nach Hause kam.
Das seltsame Licht und dessen starker Sog wanderten wieder in den Vordergrund meiner Erinnerungen.
Nein. Mit einem Kopfschütteln verjagte ich den Gedanken. Natürlich kommen wir wieder zurück.
Als ich meine Hand nach dem Busch ausstreckte, entpuppten sich einige der Blätter tatsächlich als grüne Schmetterlinge, die ich durch meine Berührung aufschreckte. Erschrocken schnappte ich nach Luft und hörte Kelly, die soeben aufgewacht war, leise darüber lachen. Ich sah den Schmetterlingen nach und vergaß für eine Sekunde, dass ich unbedingt nach Hause wollte.
»Was gäbe ich jetzt für ein Frühstücksbuffet …« Kelly blickte sich um, als hoffte sie, zwischen den Bäumen eines zu finden.
Im Gegensatz zu mir fand sie die Umgebung deutlich weniger faszinierend, aber so war es meistens. Kelly wollte Fakten und Lösungen.
»Bäume, Bäume, Bäume! Es ist eindeutig zu grün hier.«
Sie drehte sich einmal um die eigene Achse, während sie den umgebenden Wald ins Visier nahm. »Noch mal wegen den UFOs …«
»Das kann einfach nicht sein.«
»Klasse, was ist deine Erklärung?«
»Ich denke …« Nicht einmal einen Satz konnte ich beenden. Ja, was war meine Erklärung? Ich hatte schlichtweg keine. Schenkte ich Kellys UFO-Theorie Glauben, müsste ich mich damit anfreunden, dass auch alles andere möglich wäre, was ich aus Büchern und Filmen kannte.
»Siehst du – UFOs ergeben auf einmal Sinn.« Aufregung schlich sich in ihren Blick. »Stell dir vor, einfach alles wäre real. Gleich kommt Legolas vorbei und rettet uns. Oder wir finden das Haus der sieben Zwerge und essen von ihren Tellerchen und so.«
»Dann könnten uns auch Orks begegnen oder eine böse Hexe.« Ein Schauer überlief mich bei der Vorstellung.
Mit einem Schulterzucken wandte Kelly sich mir zu. »Okay, ich gebe mich geschlagen. Selbst wenn meine Theorie stimmt, wie sollten wir es herausfinden?«
Sie seufzte. »Tut mir leid, Mireille. Ich glaube, wir schaffen es nicht rechtzeitig nach Hause. O Mann. Dein Vater …«
»… wird durchdrehen«, beendete ich den Satz und verbarg das Gesicht in den Händen. »Ich wünschte, ich hätte niemals die Regeln gebrochen.«
Tröstend rieb Kelly mir über den Rücken. »Es ist schwer, ich weiß. Aber wir können die Situation nicht ändern.«
Sie schaute sich um. »So ein Mist!« Ihre Stimme wurde immer lauter. »Was für ein blödes Spiel ist das? Ich will wissen, wo wir sind und wie wir hier raus kommen!«
Die letzten Worte hatte sie nahezu gebrüllt, doch sie wurden von den Bäumen verschluckt, die kein Echo zuließen. Für einen Augenblick schienen selbst die Vögel zu verstummen.
Ich konnte Kelly ihre Wut nicht verübeln. Ich war selbst wütend – allerdings nur auf mich selbst – und fühlte mich so schuldig wie schon lange nicht mehr. Papa würde mir nie mehr vertrauen. Damit konnte ich dem letzten Rest Freiheit gleich zum Abschied winken. Vielleicht konnte ich das aber ohnehin, wenn es aus dieser grünen Unendlichkeit kein Entkommen gab.
Aus dem Augenwinkel erhaschte ich eine Bewegung. Schnell drehte ich mich um und fixierte einen Baum, hinter dem ich etwas verschwinden gesehen hatte.
»Kelly«, flüsterte ich. »Hier ist etwas.«
Sie folgte meinem Blick. »Was hast du gesehen?«
»Ich weiß es nicht, aber … hoffentlich kein wildes Tier!«
Die Nervosität, die mich ununterbrochen begleitet hatte, wandelte sich in Panik. Ich spürte die Spannung in meinen Muskeln, bereit zum Wegrennen. Sicher würde ich bald meinem Tod begegnen, in Form einer Bestie, die mich zerfleischen wollte.
Mein Vater würde nie wieder etwas von mir hören, geschweige denn sehen, und sich bis an sein Lebensende fragen, was geschehen war … oder er wäre enttäuscht von mir, weil ich mich nicht an seine Regeln gehalten hatte.
Bevor meine Gedanken weiter ausuferten, hob Kelly einen Stein vom Boden auf, zielte auf den Baum, auf den ich gedeutet hatte, und warf ihn überraschend präzise genau dorthin. Nichts geschah.
»Wenn es ein Tier wäre, hätte es sich bestimmt bewegt«, erklärte Kelly nüchtern. »Hier ist nicht etwas, hier ist jemand.« Sie fasste mich ums Handgelenk und legte den Zeigefinger an ihre Lippen. Wer auch immer sich hinter dem Baum verbarg, konnte sich ausgezeichnet verstecken.
»Mir wird das zu blöd«, murmelte Kelly nach einem Moment des Lauschens und rief ungeduldig: »Wer auch immer da ist: Lass dieses Spielchen und zeig dich!«
»Kelly«, zischte ich, doch sie zuckte nur mit den Schultern.
Hinter dem Baum raschelte es. Ein blasses, schmales Gesicht kam zum Vorschein, umrahmt von dunkelviolettem Haar.
»Wer seid ihr?«, fragte das Mädchen.
»Ich bin Kelly, das ist Mireille«, stellte Kelly uns knapp vor. »Wir haben absolut keine Ahnung, wo wir sind. Könntest du uns den Weg aus dem Wald zeigen?«
Das Mädchen löste sich von dem Baum und kam nun ganz zum Vorschein. Sie trug ein halblanges, beiges Kleid, das fließend ihren Körper umspielte. Darunter war eine eng anliegende dunkelbraune Hose zu erkennen, die Füße steckten in hohen Lederstiefeln. Sie fixierte uns weiter eindringlich, jedoch nicht unfreundlich mit ihren veilchenfarbenen Augen und kam langsam auf uns zu.
»Kannst du uns den Weg zeigen?«, wiederholte Kelly.
Das Mädchen blieb stehen. »Wohin wollt ihr genau?«
»Wie gesagt, einfach heraus aus dem Wald.«
Das Mädchen musterte uns von oben bis unten und hob eine Augenbraue. »Kann es sein, dass ihr nicht von hier kommt? Seid ihr«, sie senkte die Stimme, »Menschen?«
Kelly lachte hysterisch und warf die Arme in die Luft. »Nein, selbstverständlich sind wir keine Menschen. Wir sehen nur so aus.«
Das Mädchen schien Kellys Sarkasmus nicht folgen zu können. »Was seid ihr dann?«
Kelly verstummte. »Das war ernst gemeint? Klar sind wir Menschen.«
Das Mädchen sog scharf die Luft ein, während Kelly verständnislos den Kopf schüttelte.
»Eine Frage: Was sollten wir sonst sein?«
»Elfen«, sagte das Mädchen knapp.
Meine Kinnlade klappte herunter. »Sagtest du Elfen?«
Obwohl Kelly und ich längst verstanden hatten, dass an diesem Ort alles möglich war, konnte ich kaum glauben, dass die Person vor uns kein Mensch war. Sondern … eine Elfe. Ein existierendes Fabelwesen.
»Natürlich. Gerianda ist die Welt der Elfen.« Ihre Mundwinkel hoben sich fast unmerklich. »Mein Name ist Jolanthe. Mit Menschen habe ich nicht unbedingt gerechnet.«
Sie kniff die Augen zusammen. »Wie seid ihr hergekommen?«
»Ehrlich gesagt haben wir selbst keine Ahnung«, erklärte ich vorsichtig. »Wir waren nachts am Waldrand unterwegs und ich sah auf einmal etwas ganz Seltsames. Es war wie … ein runder, silbriger Fleck in der Luft.«
Fragend hob ich die Augenbrauen und war erleichtert, dass die Elfe mich nicht verständnislos ansah, sondern wissend nickte. Es war keine Einbildung gewesen.
»Ihr seid auf ein Portal gestoßen«, meinte sie. »Eigentlich erscheinen sie nicht mehr ohne Zauberspruch, aber es gibt immer noch einen Fehler in der Magie, wodurch sie manchmal von allein entstehen. Die meisten Menschen sind aber ohnehin nicht empfänglich genug, um diese Portale zu sehen.«
Kelly kratzte sich an der Nase. »Ein Portal? So richtig … magisch?«
Jolanthe nickte und wandte sich an mich. »Manche, so wie du anscheinend, sind besonders sensibel für Magie, selbst, wenn sie es nicht wissen. Deshalb verirren sich hin und wieder noch Menschen nach Gerianda, aber es kam schon eine Ewigkeit nicht mehr vor.«
Kellys skeptischer Gesichtsausdruck sagte mir stumm, dass sie noch überlegte, ob wir dem Glauben schenken sollten oder ob uns hier ein Märchen aufgetischt wurde.
Mein Kopf surrte wegen der neuen Informationen. Wir waren in einer komplett anderen Welt, die noch dazu magisch war? Trotz Jolanthes Erklärung suchte ich ungläubig nach anderen Lösungen – ohne Ergebnis. Einen Traum schloss ich aus. Noch nie hatte ich so klar und lebendig geträumt.
Es war auch kein Abtauchen in eine Fantasiewelt, wie wenn ich beim Lesen alles um mich herum vergaß. Nein, ich war ganz mit meinem Körper hier. Es fühlte sich viel zu real an, um nicht echt zu sein.
Und überhaupt: Wir waren teleportiert worden, das hatte ich am eigenen Leib erfahren. Wenn das möglich war, warum dann nicht auch die Existenz von Elfen?
Aber der Gedanke, wirklich die Welt gewechselt zu haben, wur de unweigerlich von einer ganz bestimmten Frage begleitet.
»Wie kommen wir wieder zurück in unsere eigene Welt?« Vielleicht gab es dafür eine simple Lösung. Doch meine Hoffnung wurde schnell zerschlagen.
»Leider ist das kompliziert«, meinte Jolanthe. Vorsichtig linste sie nach links und rechts. »Der Ruvinden-Wald ist außerdem nicht der richtige Ort, um das zu besprechen. Kommt mit mir auf die Espenlichtung, wo ich mit einer Gruppe Elfen lebe. Dort können wir euch tarnen. Und dann könnt ihr alle Fragen stellen, die ihr habt.«
Ohne ein weiteres Wort marschierte sie los. Kelly und ich sahen uns an und fassten stillschweigend den Entschluss, dass wir wohl kaum eine andere Wahl hatten, als ihr hinterherzulaufen. Wir brauchten Antworten und ehrlich gesagt war es mir lieber, einer fremden Elfe – ich konnte es immer noch nicht fassen – zu folgen, statt eine weitere Nacht in diesem beunruhigenden Wald zu verbringen.
Kelly holte zu Jolanthe auf, die zügig voranschritt.
»Ist eure Lichtung in der Nähe?« Unverblümt starrte sie die Elfe an.
Diese warf Kelly einen Seitenblick zu und zog für eine Sekunde die Augenbrauen zusammen. »Nein, im Shyn-Wald. Er grenzt direkt an den Ruvinden-Wald, ist aber weniger dicht und dadurch heller. Es ist noch ein ganzes Stück von hier, wir werden erst am Abend ankommen.«
»Was tust du dann hier, wenn dein Zuhause viel weiter weg ist?«
»Ich war mit ein paar Leuten aus meiner Gruppe unterwegs, um etwas auszukundschaften. Wir ziehen regelmäßig los, um verdächtige Aktivitäten in der Gegend so früh wie möglich zu bemerken. Es ist wichtig, um zu wissen, dass wir auf unserer Lichtung weiterhin in Sicherheit sind. Wir werden bald auf die anderen stoßen, die bei mir waren.«
Sie warf einen Blick über die Schulter. »Ihr beide habt unwahrscheinliches Glück, dass ich euch gefunden habe. Der Ruvinden-Wald ist nicht sicher für Menschen. Ihr hättet leicht auf die falsche Sorte Elfen stoßen können.«
Kelly schnaubte. »Wir hätten nie gedacht, jemals auf irgendwelche Elfen zu stoßen. Woher sollen wir wissen, ob du nicht zur falschen Sorte gehörst?«
Sie blieb vor Jolanthe stehen und zwang damit auch diese zum Anhalten.
Ich war froh über Kellys Anwesenheit. Gerade schätzte ich ihr manchmal zu großes Mundwerk sehr, denn dadurch hatte sie keine Scheu, viele Fragen – und in dem Fall eine sehr wichtige – zu stellen.
»Ganz einfach«, erwiderte Jolanthe trocken, »sie würden euch unter Gewalt an den Berg Moloyac bringen. Ihr Anführer Sanios würde euch vermutlich foltern und gefangen halten – oder, wenn ihr Glück im Unglück habt, sofort töten.«
Darauf wusste selbst Kelly nicht viel zu sagen. »Oh. Dann war das Glück wohl tatsächlich auf unserer Seite.«
»Meine Rede.«
***
Was ich vorher als dichten Wald bezeichnet hatte, wandelte sich in einen düsteren, grünen Korridor. Immer wieder ließ ich meine Finger staunend über die ineinander verschlungenen Stämme gleiten, die wie braun-grüne Wände an mir vorbeizogen. Könnte ich nicht spüren, dass ich abwechselnd glatte und raue Rinde berührte, hätte ich kaum erkannt, wo ein Baum endete und der nächste begann.
Die Baumkronen neigten sich einander zu und ergaben ein Dach über mir, das nur vereinzelte Sonnenstrahlen durchließ. Eine Erinnerung lebte in mir auf, in der meine Eltern und ich im Wald gezeltet hatten. Ich war beeindruckt gewesen, weil Mam alle Bäume benennen konnte. Papa hatte sie liebevoll seine Waldkönigin genannt. Mein Herz schmerzte beim Gedanken an das vergangene Familienglück.
Papa. Könnte ich ihn doch jetzt umarmen und ihm seine Sorgen nehmen …
Ein Tier, das aussah wie eine weiße Maus mit Eichhörnchenschwanz, huschte an meinen Füßen vorbei und ich zuckte zusammen.
»Wie süüüß!« Kelly blieb stehen und sah zu, wie es im Unterholz verschwand. Jolanthe warf einen Blick über die Schulter.
»Bitte trödelt nicht, wir wollen ankommen, bevor es dunkel wird.«
»Geht klar, Boss.«
Kelly grinste mich an, runzelte aber dann die Stirn. »Woran denkst du? Du lässt total die Schultern hängen.«
Ich richtete mich ein wenig auf. »An Papa. Unser Verschwinden muss ihm eine Höllenangst einjagen.«
»Ja, vermutlich. Und ich frage mich, was meine Eltern denken. Die würden mir zutrauen, dass ich durchgebrannt bin und dich gleich mitgeschleift habe.«
Sie deutete auf Jolanthe. »Aber weißt du, was mich noch beschäftigt?«
»Was?«
»Sie hat gar keine spitzen Ohren.«
Das entlockte mir ein Schmunzeln. »Vielleicht ist einfach die Vorstellung von spitzohrigen Elfen falsch.«
»Ja, aber … sie sieht so normal aus. Bis auf die Haare. Und die krasse Augenfarbe. Und die Kleidung. Aber sonst? Kaum ein sichtbarer Unterschied zu uns.«
Ich kam nicht mehr zum Antworten, weil ich in der Nähe gedämpfte Stimmen vernahm. Mein Herzschlag beschleunigte sich.
Feindliche Elfen?
Aber Jolanthe blieb ruhig und steuerte direkt darauf zu. Ich bemerkte, dass es vor uns wieder etwas sonniger wurde. Endlich ließen wir die finstere Allee hinter uns und betraten einen neuen Waldabschnitt.
»Wir befinden uns nun im Shyn-Wald«, sagte Jolanthe.
Ich blinzelte einige Male, bis sich meine Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten. Die Bäume standen weniger dicht und ließen mehr Raum für die Sonne, die goldene Kringel auf den Boden malte.
Ein paar Schritte weiter wartete eine Gruppe von sieben Personen, die sich angeregt unterhielten. Als sie uns sahen, verstummten sie.
»Wen bringst du mit?«, fragte ein Mädchen mit honig blondem Haar.
»Das sind Kelly und Mireille«, sagte Jolanthe knapp. »Die beiden sind nicht aus Gerianda.«
Bedeutungsvoll hob sie die Augenbrauen. Die anderen schienen sofort zu wissen, was Jolanthe damit ausdrücken wollte. Doch vermutlich war auch allein an unserer Kleidung zu erkennen, dass wir Fremde waren. Während sie allesamt einen ähnlichen Stil wie Jolanthe trugen, standen Kelly und ich in Pulli und Jogginghose hier.
»Ich habe den beiden gesagt, dass sie mit uns kommen können.«
»Ist das eine gute Idee?«, fragte ein Mann besorgt. »Ich weiß nicht, ob sie dort in Sicherheit sein werden.«
»Allemal sicherer, als wenn wir sie allein im Ruvinden-Wald herumirren lassen, Edward«, konterte Jolanthe schroff. »Stell dir vor, sie hätten den Weg Richtung Norden eingeschlagen. Sie hätten direkt zum Moloyac spazieren können.«
Niemand widersprach ihr.
Meine Aufmerksamkeit fiel auf den geflochtenen Beutel, den Edward gerade öffnete. Ihn daraus trinken zu sehen, machte mir noch mehr bewusst, dass sich mein Hals anfühlte wie Schmirgelpapier.
Er streifte meinen Blick. Der Durst musste sehnsüchtig aus meinen Augen sprechen, denn nach kurzem Zögern hielt er mir den Trinkbeutel hin.
»Danke, du … du glaubst nicht, wie dringend ich etwas zu trinken gebraucht habe«, stammelte ich und trank gierig ein paar Schlucke. Das Wasser war lauwarm, aber das spielte keine Rolle. Es war eine Wohltat, endlich die Trockenheit in meinem Mund loszuwerden.
»Darf ich auch?«, fragte Kelly, doch sie riss mir den Beutel schon aus der Hand, bevor Edward antworten konnte.
Er lächelte. »Behaltet ihn, bis wir ankommen. Ihr braucht es dringender.«
Jolanthe klatschte in die Hände. »Lasst uns weitergehen! Ich fühle mich nicht wohl damit, so lange mit den Menschen mitten im Wald zu sein.«
Die Elfen nahmen uns in ihre Mitte, sodass ich mir wie von Bodyguards umgeben vorkam. Unsere Begleiter schienen kaum auf den Weg achten zu müssen, glitten leichtfüßig dahin und selbst ihre teilweise recht langen Gewänder und Umhänge verfingen sich nie in den tiefer hängenden Zweigen.
Kelly und ich dagegen strauchelten immer wieder über Wurzeln und blieben mit der Kleidung oder den Haaren hängen, wenn wir uns zwischen dichten Sträuchern durchschlugen. Ich schämte mich für unser vergleichsweises plumpes Auftreten, mit dem wir die Gruppe sicher erheblich aufhielten und ihr zur Last fielen.
Die drei, die hinter uns gingen, verlangsamten sich gezwungenermaßen, wohingegen sich die Vorderen nicht sonderlich Mühe gaben, ihr Tempo zu drosseln.
Kelly schnaufte genauso laut wie ich. Schon lange hatten wir unsere leisen Gespräche eingestellt, um Kraft und Atem zu sparen. Sie schlurfte durch das gefallene Laub, sodass das Schweigen vom Rascheln begleitet wurde.
Auch meine Füße schienen mit jedem Schritt schwerer zu werden. Mein Pulli klebte schweißnass an meinem Rücken. So kalt mir nachts und am Morgen gewesen war, so sehr schwitzte ich jetzt trotz der Kühle des Waldes. Die Sonne war weit über den Himmel gewandert. Es waren Stunden vergangen, ohne dass wir pausiert hatten. Mein Magen beschwerte sich grummelnd über seine Leere, meine Kehle schrie noch schlimmer nach Wasser als zuvor. Den Wasserbeutel hatten wir längst geleert. Das leise Plätschern, das in der Nähe zu hören war, machte es nicht besser.
»Meine Füüüße«, jammerte Kelly außer Atem, als die vorderen Elfen langsamer wurden. Ich schöpfte Hoffnung, dass wir vielleicht bald das Ziel erreicht hatten.
Meine Vermutung bestätigte sich, als sich vor uns ein freies Feld auftat – viel geräumiger als die Lichtung, auf der wir die Nacht verbracht hatten.
»Willkommen auf der Espenlichtung«, sagte Jolanthe.
Mit wachsendem Staunen sah ich mich auf der von gewundenen Bäumen umrahmten Lichtung um. Einige davon waren über und über mit emporkletterndem Efeu bewachsen.
In der Mitte knisterte ein Feuer in einer von Steinen umlegten Feuerstelle munter vor sich hin. Darüber hing der wohl größte Topf, den ich jemals gesehen hatte. Ein unwiderstehlicher Duft, den ich nicht zuordnen konnte, stieg daraus auf und ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Egal, was in diesem Topf war: Mein Hunger war so riesig, dass ich gerade alles gegessen hätte. Unwillkürlich leckte ich mir über die Lippen, schmeckte aber natürlich nur salzigen Schweiß.
Vereinzelt waren kleine Hütten auf der Lichtung verteilt, doch sicher nicht genug für alle Bewohner. Es verschlug mir den Atem, als ich den Kopf in den Nacken legte und in den riesigen Baumkronen zahlreiche Baumhäuser erblickte. Selbstgeknüpfte Strickleitern luden zum Hinaufsteigen ein. Manche Häuschen waren mit Hängebrücken aus dickem Seil und flachen Holzbrettern miteinander verbunden. Ich fühlte mich in einen Film hineinversetzt, so übernatürlich und zauberhaft wirkte die gesamte Konstruktion.
Zwischen den Hängebrücken sowie an den Wänden der Hütten rankten sich feine Pflanzen entlang, deren Stiele sich schnörkelig verwuchsen. Unzählige handtellergroße Knospen, die allesamt geschlossen waren, hingen daran und präsentierten ihre perlmuttweiße Außenseite.
»Wow«, hauchte Kelly neben mir, während mir die Worte fehlten. Noch nie hatte ich etwas Schöneres gesehen.
Einige Leute arbeiteten auf großflächigen Beeten und schauten auf, als wir uns näherten. Kelly und ich wurden sofort ins Visier genommen. Die Elfen legten ihre Arbeiten nieder und kamen uns entgegen. Die einen wirkten neugierig, andere eher skeptisch.
»Luna karela mora«, sagte eine Frau mit flammend rotem Haar. »Luna schütze euch. Wer sind die Fremden?«
»Schön, dich wiederzusehen, Enya«, erwiderte Jolanthe und neigte den Kopf zum Gruß. »Dies sind Kelly und Mireille aus der Menschenwelt.«
Enya presste die Lippen zusammen. »Menschen?«
»Es wird einen Grund haben, dass sie die beiden hierher gebracht haben«, warf eine Elfe mit nachtblauem Haar und ebenso dunklen Augen ein.
»Richtig, Nuray«, meinte Jolanthe dankend. »Beide haben sich nach Gerianda verirrt, wie es scheint. Ich konnte sie im Ruvinden-Wald nicht ihrem Schicksal überlassen.«
Ein kleines Mädchen kam, gefolgt von einer erwachsenen Elfe, auf Edward zugelaufen. »Papa, du bist wieder da!«
Edward grinste breit, ging in die Knie und öffnete die Arme, um die Kleine darin einzuschließen. Diese einfache, aber so liebevolle Szene berührte mich tief im Herzen und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als auch meinem Vater in die Arme zu fallen und ihm zu sagen, wie leid mir alles tat.
Plötzlich blickte das Mädchen auf und sah mir direkt in die Augen.
Sei nicht traurig, hörte ich seine kindliche Stimme in meinem Kopf.
»Was?«, stammelte ich und blickte irritiert um mich.
Die Frau, die mit dem Mädchen gekommen war, lächelte und wusste anscheinend sofort, was passiert war.
»Wundere dich nicht.« Sie strich dem Kind übers Haar. »Unsere Tochter Zoé hat sehr ausgeprägte Zauberkräfte. Sie hat die Fähigkeit, Gedanken zu lesen und gedankliche Botschaften zu überbringen. Sie ist äußerst hervorragend darin, obwohl sie erst fünf Jahre alt ist. Übrigens, mein Name ist Lynette.«
»Schön, euch kennenzulernen«, erwiderte ich höflich. »Wir wollen wirklich keine Unannehmlichkeiten bereiten«, fuhr ich dann zögernd fort, »aber wir möchten so schnell es geht nach Hause. Alle werden sich Sorgen machen.«
»Das leuchtet uns ein«, sagte Enya und musterte Kelly und mich von oben bis unten. »Doch zunächst kleiden wir euch neu ein, damit ihr unter uns besser getarnt seid. Danach werdet ihr Ashley kennenlernen. Sie ist die Älteste hier im Dorf und unser Oberhaupt. Sie wird über das weitere Vorgehen entscheiden.«
***
Wir sahen an unseren neuen Kleidern hinunter. Kelly hatte ein dunkelblaues, wadenlanges Kleid bekommen, dessen Zipfelsaum mit Stickereien in einem etwas helleren Blau geziert war, dazu einen schiefergrauen Umhang. Mir war ein schilfgrünes, etwas kürzeres Kleid mit silbernen Applikationen am Kragen und an den spitz zulaufenden Ärmeln überreicht worden, kombiniert mit einer engen, dunklen Hose und einem silberweißen Umhang. Dazu trugen wir beide einen weißen, geflochtenen Gürtel und hohe Lederschuhe. Netterweise hatten uns die Elfen noch ein paar weitere Kleider zusammengesucht, die nun uns gehören sollten.
»Affig«, stellte Kelly fest und musterte mich neidisch. »Bei mir sieht’s aus, als wäre ich verkleidet. Ich könnte jetzt in ›Herr der Ringe‹ mitspielen. Aber an dir wirkt es, als hättest du nie etwas anderes getragen.« Sie zog die Augenbrauen zusammen und prustete los.
»Das könnte sowohl ein Kompliment als auch eine Beleidigung sein. Es war nett gemeint, keine Sorge. Du siehst klasse aus.«
Tatsächlich fühlte ich mich wohl in meinem neuen Kleid, wenngleich es ungewohnt war. Ich kam mir vor, als wäre ich nicht nur in neue Kleidung geschlüpft, sondern in eine neue Haut.
Es klopfte an der Tür des Baumhauses, in das wir zum Umziehen geschickt worden waren. Schnell öffnete ich.
»Wenn ihr soweit seid, bitten wir euch in die große Hütte hinüber. Ashley ist dort, sie kann euch jetzt empfangen«, erklärte Jolanthe.
An der Westseite der Lichtung befand sich eine Hütte, die um einiges größer war als die anderen. Es gab eine Art überdachte Terrasse davor, welche von hohen, hölzernen Säulen gestützt wurde, die ebenso verschlungen waren wie die Stämme vieler umliegender Bäume. Beim Näherkommen sah ich die feinen Schnitzereien an den Säulen.
Als wir eintraten, war eine Diskussion im Gange. Kurz war ich eingeschüchtert von der Menge an Fremden; ich schätzte etwa fünfundzwanzig Leute, die allesamt durcheinanderredeten. Sobald wir näher kamen, verstummten sie und ließen uns wie durch ein Spalier nach vorne gehen.
»Willkommen in Gerianda, Kelly und Mireille aus der Menschenwelt«, sagte eine Elfe. Das musste Ashley sein. Obwohl Enya gemeint hatte, Ashley sei die Älteste, wirkte sie kaum älter als die anderen. Einzig in ihren Augenwinkeln machten sich feine Fältchen bemerkbar, als sie lächelte, und ihr Haar war vollständig in einem gräulich-blonden Ton, als wäre die Farbe verblasst. Doch ob dies wirklich an ihrem Alter lag, war unklar abzusehen.
»Bitte, setzt euch zu mir.«
Wir folgten ihren Worten. Ashley fokussierte zuerst Kelly, anschließend blieben ihre grauen Augen an mir haften. Etwas flackerte in ihrem Gesicht auf.
»Du erinnerst mich an jemanden«, sagte sie und schaute mich weiter unverwandt an. Ich hatte das Gefühl, von ihrem durchdringenden Blick verschluckt zu werden und wusste nicht, welche Antwort ich geben sollte.
Schließlich riss Ashley sich los, als wäre nichts gewesen.
»Ihr möchtet hören, wie ihr wieder nach Hause könnt. Die kürzeste Antwort darauf lautet: Es ist gerade nicht möglich.«
Mit diesen Worten zog sie mir den Boden unter den Füßen weg. »Was soll das bedeuten? Ihr könnt uns doch hier nicht festhalten!«





























