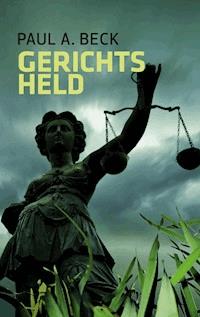
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Feller liebt Pflanzen und sein beschauliches Leben als Gärtner bis zu dem Tag, an dem ihn ein banales Ereignis völlig aus der Bahn wirft. Dafür verlangt er Gerechtigkeit. Er hofft auf ein schnelles Urteil in Erwartung eines Geldsegens. Unentwegt ruft er bei der jungen Richterin Eva Brandes an, die Wichtigeres zu tun hat, als sich seiner Sache anzunehmen. Sie selbst braucht dringend einen Anwalt. Je ungeduldiger Feller wird, desto weniger scheinen sich die Richter um seine Klage zu kümmern. Als sich auch nach Jahren immer noch nichts getan hat, bringt Feller mit einer gehörigen Portion Dreistigkeit Bewegung ins Spiel. Alles entscheidet sich an einem einzigen Tag innerhalb weniger Minuten im Gerichtssaal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Gerichtsluft
November 1999
Gartenlaube
Streitlust
Intermezzo
Faxe, Faxe, Faxe
Szenen
Rendezvous
Lektionen
Königinnen
Anwaltsstrategien
Weihnachtsstimmung
Hauptverhandlung
Justizsüchtig
Oh my God
Missgeschick
Präsidiales
Im freien Fall
Gerechtigkeit
Gerichtsluft
1
Am Montagmorgen gegen neun Uhr betrat Eva Brandes das Gerichtsgebäude. In der gläsernen Drehtür spiegelten sich ihre weiße Bluse und der beige, schmal geschnittene Sommerrock, die ihrer Erscheinung zusammen mit den Wildlederpumps und den matten Seidenstrümpfen etwas Offizielles gaben. Die Farben ihrer Kleidung setzten einen Kontrast zu dem braunen schulterlangen Haar, das sie im Gericht zusammengebunden trug. Die Strickjacke, die sie im Sommer fast immer bei sich hatte, fehlte heute. Schon die morgendlichen Temperaturen kündigten wieder diese drückende Hitze an. In der rechten Hand trug sie ihre mit Akten gefüllte Ledertasche, aus der die Tageszeitung hervorlugte. Sie grüßte die hinter schusssicherem Glas sitzende Pförtnerin mit einem freundlichen Kopfnicken, um dann im Fahrstuhl in die erste Etage zu verschwinden, wo sich ihr Büro befand. Sie schloss die Tür ihres Zimmers auf und hatte sofort den Duft in der Nase, der Gerichtsakten eigen war und der sie seit Jahren begleitete. Es war die Mischung von Papier, Staub und Pappe, hinzu kam der penetrante Geruch von kaltem Rauch, der sich in den Akten verfangen hatte, wenn die Sekretärinnen die Diktate der Richter mit Zigarette geschrieben hatten. Wie jeden Morgen öffnete sie die Fenster, spürte die warme Luft und wandte sich für einen Moment dem Innenhof zu.
Das Telefon klingelte. Sie schaute auf das Display, das den 4.7.2011 und die Rufnummer 201 anzeigte. Sie wusste sofort, dass es die Präsidentin war, die wie jeden-Montagmorgen an den jour fixe um 10.00 Uhr erinnerte. Nicht etwa, dass das Obergericht neben dem Präsidenten noch eine Präsidentin an der Spitze des Hauses gehabt hätte. Die Bezeichnung »Präsidentin« war dem einfachen Umstand geschuldet, dass der Präsident seit Jahren eine außereheliche Beziehung mit seinem Vorzimmer unterhielt. Die symbiotischen Gepflogenheiten des Liebespaares und ihre Vertrautheit miteinander hatten bei den Gerichtsangehörigen nicht nur den Eindruck eines Ehepaars entstehen lassen, sondern dass die Weichenstellung für so manche bedeutende Angelegenheit letztendlich auf der Einflussnahme der Präsidentin beruhte.
Zu Beginn der Montagsbesprechung begrüßte der Präsident Eva mit den knappen Worten: »Ein schönes Wochenende gehabt, Frau Brandes«. Dies war mehr die Feststellung als die Frage, denn der Präsident wusste, dass Eva seit geraumer Zeit wieder allein lebte, was für ihn, der mit zwei Frauen lebte, eine schier unvorstellbare Situation war. »Ja, danke, das Wetter war sehr schön«. Mehr gab es aus Evas Sicht hierzu nicht zu bemerken. Es hätte auch niemanden interessiert und war auch keiner besonderen Erwähnung wert, wie ein sonniges Wochenende war, an dem sie hauptsächlich Arbeitsrückstände der vergangenen Woche erledigt hatte. Der Präsident fuhr fort: »Der Arbeitsplan für diese Woche – bislang nichts Besonderes. Meine Termine können Sie dem elektronischen Kalender entnehmen«, auf den Eva uneingeschränkten Zugriff hatte. »Heute ist wieder eine Unmenge von Beschwerden und anderem Unsinn in der Post …, die hatten bei dem schönen Wetter am Wochenende wieder nichts Besseres zu tun als sich über die Justiz zu beschweren. Schauen Sie mal in Ruhe durch, ob was mit Substanz dabei ist; Sie wissen schon …, muss in einer halben Stunde im Ministerium sein, bin erst morgen wieder im Hause«. Und schon war er mit einer geschmeidigen Bewegung aus seinem Präsidentenzimmer verschwunden. Obwohl der Präsident kurz vor dem Ruhestand war, hatte er immer noch eine bemerkenswert stattliche Figur. Wahrscheinlich war es das unaufhörliche Interesse an Frauen, das ihn äußerlich diszipliniert hatte und den Festpolstern keinen Raum ließ.
Eva ging zurück in ihr Büro. Die prallgefüllte Mappe mit der Gerichtspost vom Wochenende nahm sie mit und legte sie in die Mitte ihres Schreibtisches. Sie schlug die Ledermappe auf und fing an, den Stapel an Briefen und Faxen durchzusehen. Manche Schreiben überflog sie nur, bei anderen hielt sie inne und las jeden Satz genau. Das Telefon klingelte, ohne dass das Display eine Rufnummer anzeigte. Sie wunderte sich, weil sie keinen Anruf erwartete. An sich war es Aufgabe des Vorzimmers, externe Anrufe an sie durchzustellen. Doch sobald der Präsident nicht im Hause war, hielt sich die Präsidentin für Stunden andernorts als im Vorzimmer auf und konnte keine Telefonate entgegen nehmen. Eva hatte dann jedenfalls Ruhe vor ihr. Ihr Verhältnis zueinander war mehr als angespannt. Zwischen den beiden Frauen stand die fortwährende Konkurrenz um die Gunst des Präsidenten. Während Eva um Respekt und ihre Anerkennung als Präsidialreferentin kämpfte, buhlte die Präsidentin jeden Tag um diese einzigartige Aufmerksamkeit, die sich eine Frau von einem Mann erhofft. Der Präsident aber hatte ihr in all den Jahren nie die Gewissheit gegeben, dass seine Hinwendung zu ihr ungeteilt sein könnte. Im Arbeitsalltag führte diese Situation zu ständiger Missgunst und Neid.
Mit ihren erst 38 Jahren konnte Eva bereits jetzt auf eine beeindruckende Justizkarriere zurückblicken und hatte eine Perspektive, die noch mehr in Aussicht stellte. Sie war Richterin am Obergericht und seit einiger Zeit dem Gerichtspräsidenten als Präsidialreferentin direkt unterstellt. Mit dieser Vertrauensstellung waren Aufgaben verbunden, die ihr der Präsident meistens persönlich übertrug. Hierzu gehörte es auch, sich um die Angelegenheiten ihrer Richterkollegen zu kümmern. Die unmittelbare Nähe zum Präsidenten neideten ihr die Anderen. Im ständigen Umfeld des Präsidenten zu agieren, war in den Augen ihrer Kollegen ein solcher Vorsprung auf der Karriereleiter, der kaum noch einzuholen war, falls nicht ein Desaster ihr den Weg nach oben zunichtemachen sollte. Und das schien zu diesem Zeitpunkt noch im höchsten Maße unwahrscheinlich zu sein. Mit ihrer Umsicht und Klugheit, ihrer Diplomatie und nicht zuletzt mit ihrem Charme hatte sie schon so manche verfahrene Situation gerettet. Sie hatte ohne Zweifel eine privilegierte Stellung im Gericht. Der Preis für diese Begünstigung aber war, dass sie die heikelsten Aufgaben im Gerichtsalltag bewältigen musste, manchmal fast unlösbare Probleme, die sich im Verlauf des Tages einstellten. Meistens waren es Konstellationen, die dem Ansehen des Gerichts erheblich schaden konnten, wenn es Beschwerden über ihre Richterkollegen gab, wenn verzweifelte Bürger zeitnahe Entscheidungen einforderten oder sich das Justizministerium über besondere Vorfälle berichten ließ. Daneben hatte sie, wie alle anderen Richter, über die in erster Instanz getroffenen Urteile zu entscheiden, die als Berufungen am Obergericht auf ihrem Schreibtisch landeten.
Das Telefon klingelte wieder mit diesem Ton, der verriet, dass der Anruf von außerhalb des Gerichts kam. Sie sah auf das Display; mittlerweile war es 11.30 Uhr. Eine Rufnummer wurde nicht angezeigt. Eva hob den Telefonhörer ab und sagte »Brandes«. Wenn sie Anrufe direkt auf ihren Apparat erhielt, meldete sie sich nie mit dem Namen des Obergerichts, denn Anrufe von Bürgern kamen ausschließlich über die hausinterne Vermittlung oder über das Vorzimmer. Am anderen Ende war es erst still, dann hörte sie einen Atem und plötzlich zischte jemand mit scharfer Stimme in ihr Ohr: »Feller hier«. Stille am anderen Ende. Eva war sofort konzentriert. Mit abwartender Stimme sagte sie »Guten Tag Herr Feller«. Wieder Stille am anderen Ende, dann sehr laut: »Na, haben Sie schon die Post durch?« Eva war sehr kurz gehalten »Herr Feller was wollen Sie?« »Was ich will? «,brauste er auf. »Das wissen Sie ganz genau! Ich will endlich eine Entscheidung in meinen Sachen, ich will ein Wiederaufnahmeverfahren, ich will eine Entschädigung für all das, was Sie und ihre Richter mir angetan haben, wegen Nichtstun und Schlamperei an ihrem Gericht. Ich will, dass Sie über meine Berufungen, Dienstaufsichtsbeschwerden, Befangenheitsanträge, Anhörungsrügen und alles andere, was immer noch offen ist, endlich entscheiden, und das alles sehr plötzlich!«
Eva blätterte währenddessen die Postmappe weiter durch. Tatsächlich, da waren sie, etliche per Telefax eingegangene Schreiben von Horst Feller, c/o Kleingartenkolonie e.V. »Zur Glückseligkeit«, alle datiert am Sonntag, den 3.7.2011. Sie erkannte seine Schreiben sofort an dem auffälligen Schriftbild, das durch Unterstreichungen, Ausrufezeichen, Blockschrift, Fettschrift in 16er Größe auffiel und sich am Ende in haltlosen Anschuldigungen und Beleidigungen gegen Richter erging. Derweil ließ sie Feller am anderen Ende weiter ins Telefon brüllen, hielt den Hörer fern von ihrem Ohr und überflog kursorisch Fellers Faxe, deren Inhalt und Sinn sich ihr auch an diesem Tag kaum erschloss. So waren viele Telefonate in den letzten Jahren verlaufen.
Es war leider einem Zufall geschuldet, dass Feller an die Telefonnummer ihres Apparats gelangt war. Riefen Bürger im Gericht an, um sich zu beschweren oder nach dem Bearbeitungsstand ihres Rechtsstreits zu fragen, bekamen sie so gut wie nie Richter zu sprechen. Meistens waren sie ohnehin nicht im Gericht. An sich war es Aufgabe der Geschäftsstelle, Bürger zu vertrösten. Einmal hatte eine neue Justizangestellte einen Fehler gemacht. Als Eva nicht im Gericht war, rief Feller an. Sie gab ihm arglos Evas Durchwahl als er danach fragte und wusste nicht, dass Feller inzwischen ein gerichtsbekannter Dauerkläger war. In letzter Zeit waren viele seiner Anrufe sehr aggressiv verlaufen. Da Feller keiner Argumentation zugänglich war, hatte es auch keinen Sinn, mit ihm zu diskutieren. Die Telefonate endeten immer auf dieselbe Art und Weise. Irgendwann kündigte Eva an: »Herr Feller, ich sehe keinen Sinn darin, dass wir weiter telefonieren. Ich werde das Gespräch jetzt beenden.« Ohne dass sie irgendeine Reaktion Fellers abwartete, geschweige denn, dass dieser seinen Redefluss unterbrach, legte sie den Telefonhörer auf.
Diese Telefonate waren belastend und machten Eva wütend, auch wenn sie ihre Gefühle nicht offen zeigte, sondern inzwischen akzeptiert hatte, dass dieser Ärger Teil des Jobs war. Doch hatte das alles noch irgendetwas mit jener Idee von Gerechtigkeit zu tun, an die sie als Studentin geglaubt und sich später mit Leidenschaft für die Justiz entschieden hatte? Selbst diesem Gedanken konnte sie nicht weiter nachhängen, da fing das Telefon wieder an zu klingeln. Jeder andere Anrufer hätte spätestens nach viermaligem erfolglosen Läuten aufgelegt, doch nicht Feller, dessen Hartnäckigkeit und Verbissenheit grenzenlos war. Er ließ das Telefon endlos läuten. Nahm Eva den Hörer ab, hatte er gewonnen. All das gehörte zu seiner Strategie und war Teil seines persönlichen Kleinkriegs mit der Justiz. Doch diesen Triumph gönnte sie ihm heute nicht. Sie schaute auf ihre Uhr. Es war schon nach 12.00 Uhr, also Zeit für die willkommene Mittagspause, die heute eben etwas früher als gewohnt stattfinden musste. Sie stand auf, packte einige Akten in ihre Tasche und schloss ihr Büro ab. Sofort verstummte der Klingelton hinter der schallgedämmten Holztür. Da der Präsident heute Nachmittag ohnehin nicht im Gericht sein würde, konnte sie auch zu Hause auf ihrer Terrasse arbeiten. In der Mittagshitze verließ sie das Gerichtsgebäude durch den Seiteneingang.
2
Von der Hitze des vorangegangenen Tages war nach einem nächtlichen Gewitter kaum noch etwas zu spüren. Als Eva am Dienstagmorgen wie üblich im Gericht war und die Fenster ihres Büros öffnete, damit sich der stickige Duft von Akten verflüchtigte, rief das Vorzimmer an. »Frau Brandes, der Präsident möchte Sie sprechen«. »Wann bitte?«, fragte Eva. »Sofort«, entgegnete die Stimme am anderen Ende im bestimmenden Ton.
Mit einem Gefühl von Unbehagen betrat sie die Räume des Präsidenten. Die Intimität eines Wohnzimmers, die Präsident und Präsidentin in ihrer Zweisamkeit geschaffen hatten, berührte Eva unangenehm und passte nicht zu einer neutralen Arbeitsumgebung. »Bitte nehmen sie Platz, Frau Brandes«. Eva setzte sich auf ein Sofa mit blumigen Muster, das mit Sicherheit auf die Auswahl und Vorliebe der Präsidentin zurückging. Der Präsident nahm ihr gegenüber auf einem Sessel mit demselben bunten Stoffbezug Platz. »Der Besuch gestern beim Staatssekretär war wenig erfreulich«, fing der Präsident direkt und ohne einleitende Worte an. »Das Ministerium hält die Dauer unserer Gerichtsverfahren für viel zu lang und die Erledigungszahlen im Vergleich zu anderen Gerichten für zu gering. In letzter Zeit häufen sich Beschwerden von Bürgern, die Petitionen im Ausschuss des Landtags einlegen, weil sie eine schnellere Gerichtsentscheidung einfordern. Das ist politisch brisant und kann der Regierung schaden. Das Ministerium bittet um einen umfassenden Bericht mit Vorschlägen, wie das Problem in den Griff zu bekommen ist – Punkt 1«. Eva machte sich nebenbei Notizen über den soeben an ihre Adresse gerichteten Arbeitsauftrag. »Punkt 2«- fuhr der Präsident fort, dann kam eine Pause, währenddessen er sich räusperte. Eva blickte auf und meinte eine Unsicherheit in der Stimme des ansonsten so souverän wirkenden Präsidenten zu hören. »Ich habe über meine Nachfolge mit dem Staatssekretär gesprochen«. Der Präsident sprach diesen Satz mit leiser, fast heiserer Stimme; er schien ihn kaum über die Lippen zu kommen. Eva sah nach unten. Am liebsten hätte sie den Präsidenten gefragt: Wer soll’s denn werden? Doch das wäre distanzlos und unpassend gewesen. »Wir werden das Bewerbungsverfahren um meine Nachfolge sofort gerichtsintern bekanntgeben. Es soll ein offenes Verfahren werden. Frau Brandes, ich möchte Sie bitten, das Notwendige hierfür zu veranlassen. Wegen des Berichts zur Verfahrensdauer an das Ministerium komme ich noch auf Sie zu. Die Ausschreibung hat jetzt erste Priorität. Das ist alles für heute. Vielen Dank«.
Auf diese Nachricht hatte das Gericht schon seit Wochen gewartet. Der Präsident hatte den bevorstehenden Wechsel in der Gerichtsleitung zum ersten Mal von sich aus erwähnt. Keiner der Mitarbeiter des Gerichts hatte es bisher gewagt, das Wort Ruhestand in seiner Nähe auch nur auszusprechen. Ungeachtet dessen war dieses Thema bei den Gerichtsangehörigen schon seit Monaten in aller Munde. Eva war sich sicher, dass einige ihrer Kollegen bereits Wetten auf den potentiellen Nachfolger abgegeben hatten. Für ihre Richterkollegen würde die Stellenausschreibung der offizielle Startschuss für einen subtilen Konkurrenzkampf untereinander sein, der fortan den Gerichtsalltag bis zur Ernennung des Nachfolgers bestimmen würde. Eva ging zurück in ihr Büro. Sie wusste, die Zeit stand jetzt auf Veränderung.
Sie setzte sich auf ihren ledernen Drehstuhl, hatte das Fenster weit geöffnet und schaute auf eine Reihe von großen alten Kastanien. Dabei gingen ihr einige Gedanken durch den Kopf. Der bevorstehende Wechsel in der Präsidentschaft könnte auch für sie unkalkulierbare Folgen haben. Würde sie überhaupt noch das Privileg der Präsidialreferentin haben oder musste sie sich wieder in die Reihe ihrer Kollegen stellen, die unermüdlich gegen Aktenberge kämpften, ohne dass Aussicht auf Besserung bestand? Der Arbeitsauftrag des Präsidenten, dem Justizministerium Vorschläge zur Verfahrensverkürzung zu unterbreiten, war sinnlos, wenn die Politik nicht bereit war, in die Justiz zu investieren und die Gerichte mit einer ausreichenden Anzahl von Richtern auszustatten; nur so konnte die Effizienz des Rechtsstaats deutlich gestärkt werden. Wenn es als Richter kaum noch möglich war, sich ausreichend Zeit für die sorgfältige Bearbeitung eines Rechtsstreits zu nehmen, so blieb erst Recht keine Zeit, sich mit dem Unsinn von renitenten Bürgern zu befassen, die nichts Besseres zu tun hatten, als jeden Mist einzuklagen. Menschen wie Feller, und der war nicht der Einzige, konnten das System lahm legen, indem sie die Justiz überschütteten und den Richtern die wertvolle Zeit raubten, die sie benötigten, um dort Rechtsschutz zu gewähren, wo er wirklich benötigt wurde. Sie hatte nicht zehn Jahre akademische Ausbildung hinter sich gebracht, um ihre Zeit mit hirnrissigem Blödsinn auf niedrigstem Niveau zu vergeuden.
Zu solcher Einsicht hatte Eva erst die Routine des Gerichtsalltags gebracht. An sich hatte sie ein sehr ausgeprägtes, fein differenziertes und ausgewogenes Gerechtigkeitsgefühl. Sie war sich ihrer Verantwortung als Richterin bewusst und hatte ein treffsicheres Gespür, das ihr half, die Bedürfnisse und Wünsche von Menschen lebensnah zu erfassen. Im Referendariat hatte sie die Ausbildungsstationen beim Gericht besonders geliebt. Die Hektik auf den Gerichtsfluren, die vor den Gerichtssälen wartenden Menschen, die unermüdlich telefonierenden Rechtsanwälte in ihren schwarzen Roben hatten bei ihr irgendwann das Gefühl aufkommen lassen, »dazugehören« und Teil des Justizsystems werden zu wollen. Nach zwei hervorragenden Staatsexamina hatte sie wählen dürfen, auf welcher Seite sie stehen und welche Rolle sie zukünftig spielen wollte. Sie hatte sich für den Richterberuf entschieden und den Richtereid auf die Verfassung geschworen, denn mit der Idee des modernen demokratischen Rechtsstaats konnte sie sich bedingungslos identifizieren. An manchen Tagen bezweifelte sie jedoch, ob ihre Berufswahl noch ihren Idealen entsprach, mit denen sie damals ihren Beruf engagiert aufgenommen hatte.
Ein starker Windzug ließ das Holzfenster plötzlich laut zufallen und holte sie aus ihren Gedanken zurück. Sie musste sich um die interne Ausschreibung der Präsidentenstelle kümmern. Das nahm nur wenig Zeit in Anspruch. Sie schrieb lediglich Arbeitsaufträge in einen Aktenvorgang, die von ihren Mitarbeitern erledigt wurden. Schon vor geraumer Zeit hatte sie sich alte Bewerbungsvorgänge um die Präsidentenstelle aus dem Archiv des Gerichts kommen lassen, weil sie wusste, dass es irgendwann schnell gehen musste. Spätestens morgen früh würden aller Richterinnen und Richter eine e-mail in ihrem elektronischen Postfach vorfinden, die sie zu einer Bewerbung um die Nachfolge des Präsidenten einlud, vorausgesetzt, sie meinten, das Anforderungsprofil eines so bedeutenden Amtes erfüllen zu können. Eva schloss die Akte »Präsidentennachfolge«, fuhr ihren Computer herunter und verließ das Gerichtsgebäude mit einem vergnüglichen Schmunzeln im Gesicht. Wahrscheinlich würden sich mindestens zwei Drittel der Richter ihres Gerichts auf die Ausschreibung bewerben. Dies war ungefähr die Größenordnung jener Richter die meinten, das Gericht viel besser leiten zu können, als es der Präsident in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten getan hatte.
3
Bewerbungsgesuche um die Nachfolge auf die Präsidentenstelle ließen nicht lange auf sich warten. Etwa vier Wochen später, nachdem alle Richterinnen und Richter über die Stellenausschreibung informiert waren, sichtete Eva die Eingänge. Wie nicht anders zu erwarten war, hatten sich mehr als zehn Richter und nur eine Richterin des Obergerichts um das hohe Amt beworben. Sie blätterte den Stapel der Bewerbungen durch und legte jene Gesuche nach unten, von denen sie glaubte, dass die Bewerber völlig ungeeignet waren. Dann nahm sie zwei Bewerbungen, die ihrer Meinung nach am Erfolgversprechendsten zu sein schienen und legte sie ganz nach oben auf den Stapel. Der Präsident würde sie in Kürze um einen Vorschlag bitten, wer als aussichtsreichster Kandidat dem Justizministerium präsentiert werden könnte. Darauf musste sie vorbereitet sein. Deshalb ließ sie sich zwei Personalakten aus der Registratur bringen. Auf den Vorblättern las sie die Namen: Vorsitzender Richter am Obergericht Dr. Walther und Vorsitzende Richterin am Obergericht Koenig. Sie fing an, in den Personalakten zu blättern, bis sie auf die aktuelle Beurteilung von Dr. Walther stieß.
Das Telefon klingelte. Sie blickte auf das Display, das Mittwoch den 3. 8. 2011, 14.30 Uhr und einen externen Anruf anzeigte. Der Präsident war nicht im Hause; das Vorzimmer war wie üblich nicht besetzt. Eva ließ es klingeln. Nach viermaligem Läuten verstummte das Telefon. Inzwischen hatte Eva auch die aktuelle Beurteilung der Richterin Koenig in deren Personalakte gefunden. Sie legte beide Beurteilungen nebeneinander, um einen Eindruck zu bekommen, welche Beurteilung zuletzt besser ausgefallen war. Sollte der Präsident an dem Plan eines wirklich offenen Bewerbungsverfahrens festhalten, war die Qualität der jeweils letzten Beurteilung ein wichtiger Faktor bei der Bestenauslese. Das Telefon klingelte wieder; das Display zeigte keine Rufnummer an. Noch bevor es dreimal läuten konnte, drückte sie das Gespräch weg und legte den Telefonhörer kurze Zeit auf ihren Schreibtisch. Eine neue Auseinandersetzung mit Feller wollte sie vermeiden. Sie musste die wenigen ruhigen Stunden in der Abwesenheit des Präsidenten nutzen, um konzentriert zu arbeiten. Aber allein der Gedanke an Feller lenkte sie von ihrem ursprünglichen Arbeitsplan ab. Anstelle über die Konkurrenzsituation zwischen Dr. Walther und Frau Koenig nachzudenken, war Feller wieder in ihrem Kopf.
Sie stand auf, ging zum offenen Fenster und atmete die warme Sommerluft ein. War es jetzt schon so weit gekommen, dass sie Feller auswich, weil sie seine verbalen Attacken fürchtete? Wie konnte es sein, dass ihr ein einziger Mensch so viel Ärger bereitete. Feller war seit Jahren für sein unverschämtes Auftreten und seine schriftlichen Entgleisungen gerichtsbekannt. Vor ihrer Zeit als Präsidialrichterin hatte sie einige Male über Fellers Klagen in der ersten Instanz entscheiden müssen. Irgendwie hatte sie es geschafft, seine Verfahren einfach und schnell im schriftlichen Verfahren zu erledigen, ohne dass sie ihn auch nur ein einziges Mal in einer Gerichtsverhandlung persönlich hätte erleben müssen. Zu dieser Verfahrensweise hatten ihr die Kollegen geraten. Auch jetzt am Obergericht hatte sie Feller noch nie zu Gesicht bekommen. Da sie als Präsidialreferentin für Beschwerden jeder Art zuständig war, hatte sich der Kontakt zu ihm durch die Bearbeitung seines endlosen Schriftverkehrs und die ständigen Telefonate zwangsläufig intensiviert. Anfangs gab es Momente, in denen Eva den Eindruck hatte, dass Feller einfach nur ihre Stimme am Telefon hören wollte, die angenehme Telefonstimme einer jungen Frau. Wann ergab sich schon die Möglichkeit, eine Richterin persönlich zu sprechen? Dies ging solange gut, bis Feller sich wieder an irgendeiner Stelle in der Banalität seiner Themenlosigkeit verfing, seine Stimme scharf wurde und er ins Telefon schrie, dass er Gott und die Welt für die Unfähigkeit der Justiz verantwortlich machen und alle zur Rechenschaft ziehen werde.
Auch wenn sich Eva durch ihn nicht bedroht fühlte, so empfand sie sein Verhalten als empfindliche Störung ihres Arbeitsalltags. Es war ein Ärgernis, dass er ihre wertvollen Arbeitskapazitäten und auch die ihrer Richterkollegen stahl. Hinzu kam die Sorge, dass Feller außerhalb der Gerichtsbarkeit mit seinem Anliegen Gehör finden könnte, weil er dazu übergegangen war, seinen Unmut über die Justiz überall zu verbreiten und er inzwischen auch die Politik behelligte. So konnte sie nie sicher sein, dass er andernorts Verbündete oder Unterstützung fand. Ob all dies ihrer Karriere schaden könnte, fragte sie sich des Öfteren, ohne darauf eine Antwort zu wissen. Ihre Kollegen bearbeiteten seine Verfahren schon lange nicht mehr mit jener Sorgfalt, wie sie anderen Klägern zu Teil wurde. Grobes Unrecht war Feller dadurch aber nicht widerfahren. Justiz funktionierte nur, wenn man sich an ihre Regeln hielt. Und genau die ignorierte und bekämpfte er. Feller hatte sich seine eigene Logik von Recht erschaffen und überschwemmte die Gerichte mit dem, was er meinte, Recht zu sein. Das war jenseits philosophischen Ursprungs oder eines respektablen Wertesystems. Es waren vielmehr die Exkremente einer irren Idee, die sich in Fellers Kopf verfestigt hatte. Alles diente nur einem einzigen Selbstzweck und dafür missbrauchte er das Recht. So war er der Parasit geworden, der sich in den Gängen der Justiz eingenistet hatte. Alle Anstrengungen des Wirts, ihn aus dem Rechtssystem zu vertreiben, waren bisher fehlgeschlagen.
November 1999
1
E





























