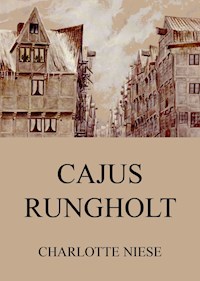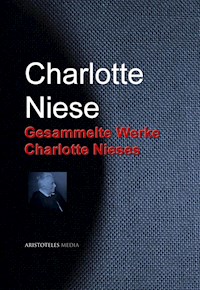
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: aristoteles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Werke von Charlotte Niese in E-Book-Ausgabe. Diese umfangreiche Sammlung der Werke der berühmten deutschen Schriftstellerin, Heimatdichterin und Lehrerin enthält: Reifezeit Die Geschichte von einem, der nichts durfte Er und Sie Von denen, die da waren Kaspar und sein Hund Es war gut so Corisande Geschichten aus Holstein Die erste Liebe Corisande Der langweilige Kammerherr Die Geschichte des Etatsrats Die erste Liebe Kajus Rungholt Erzählung aus dem siebzehnten Jahrhundert Mamsell van Ehren Über Charlotte Niese Von Herman Krüger-Westend Mamsell van Ehren Mein Freund Kaspar. Georg. Die Nadel. Der Orgelpeter. Eine Weihnachtsgeschichte aus der Eifel. Schiffer Linns Erbschaft. Die Rückkehr der Waldenser. Weihnachtswunder. Aus dänischer Zeit Bilder und Skizzen Unsere kleine Stadt Tante Feddersen Was Mahlmann erzählte Diebesrache Der Stadtmusikus Großvaters Schreiber Übers Wasser Krambambuli Blasse Rosen Tanzstunde Poltern Das Erlebnis des Stuhlwagens Jahrmarkt und Theater Allerhand Politisches Mamsell van Ehren Reise ins Kloster Onkel Peter Eine Geschichte aus Holstein Die Wiege Geburtstag Um die Weihnachtszeit Das Tagebuch der Ottony von Kelchberg Der verrückte Flinsheim Was der alte Geheimrat erzählte. Als der Mond in Dorothees Zimmer schien Die falschen Weihnachtsbäume
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Charlotte Niese
Gesammelte WerkeCharlotte Nieses
Reifezeit
Erzählung
1908
Heute habe ich alles wieder gesehen, alles, wonach ich mich lange sehnte, und von dem ich immer träumte.
Die kleine Stadt, in der ich meine ersten Kinderjahre verbrachte, den schiefen Kirchturm, von dem die Glocken so besonders klingen, und den kleinen Friedhof, auf dem die Menschen Platz finden, die sich nicht zur römisch-katholischen Kirche halten.
Harald hat sich sehr gewundert. Er hat die Ranken von den Grabsteinen weggeschnitten und dann die Namen gelesen.
Annaluise Pankow, geborne von Falkenberg, und Harald Pankow.
Mutterlieb, das sind ja unsre Namen, rief er. Du heißest Annaluise, und ich Harald, und du bist eine geborne Pankow.
Es sind meine Eltern, die hier ihre Ruhestätte haben, belehrte ich ihn. Sie sind beide jung gestorben. Meine Stimme klingt ruhig. Als ob das, was ich hier sage, mich nichts anginge. Und dennoch habe ich oft mein Herzblut verweint nach dem sanften, milden Vater, der hier unter Ranken und Dornen schläft.
Die Amseln singen kurz und süß, von der Stadt her läuten die Glocken.
Mein Junge kletterte auf die Mauer, die den großen katholischen Kirchhof von diesem armen Eckchen trennt. Er blickte auf den großen Cruciferus, der seine Arme weit über die Welt streckt, auch zu uns her; er betrachtete die kleinen Täubchen, die auf den Kindergräbern aus der Erde wuchsen, die häßlichen Perlkränze, die der Wind leise hin und her bewegte; dann horchte er wieder auf den Amselschlag und sah einem Falter nach, der von unsern Gräbern zu den andern schwebte. Ich aber blickte auf die kleine Stadt, die da unten zwischen den Bergen lag. Es ruht so oft wie ein Schleier auf ihr. Das sind vielleicht die Rauchwolken, die aus den Essen steigen, und bei deren Feuer die Abendsuppen gekocht werden. Ich aber hasse es, an solche Prosa zu denken. Für mich sind diese grauen Schleier der Vorhang über allem Geheimnisvollen, Zarten, das in jedes Menschen Brust ruht. Solch ein Städtchen hat sein Geheimnis wie jede Seele. Viel hat es gesehen und erlebt, aber es plaudert nichts aus. Schweigend liegt es zwischen den runden Kuppen der Eifelberge; und selbst wenn der Teufel einmal wieder zu ihm käme, wie in alten Zeiten, es würde seinen Mund nicht auftun.
Ja, einstmals ist der Teufel über Birneburg dahingefahren und hat den Kirchturm ausreißen wollen. Es ist ihm aber nicht geglückt; nur schief ist das Türmchen geworden und also eine Art Sehenswürdigkeit. Aber der Teufel tat sich weh. Die Hand verrenkte er sich, und in den Eifelwäldern hat es hinterher viel Stöhnen und Geschrei gegeben. Bis der Teufel wieder gesund war und anderswo sein Unheil versuchte.
Glaubst du die Geschichte, Mutterlieb? Harald und ich gingen vom Friedhof zur Stadt hinunter, und ich erzählte ihm vom Teufel. Auch wie er sich doch manchmal wieder nach Birneburg wagte.
Mein Junge macht dann so versonnene Augen und horcht mir zu, als wollte er mir die Worte von den Lippen nehmen.
Es ist eine Sage, Harald. Du weißt, Sagen sind Geschichten, die man nicht gerade zu glauben braucht, die –
Hier stockte ich. Wie ich immer zu tun pflege, wenn meine Rede einen schulmeisterlichen Anstrich erhält. Außerdem weiß ich nicht so recht weiter und freue mich, daß Walter, mein Ehemann, sichtbar wird. Ist er nicht gerade ordentlicher Professor geworden und muß alles wissen? Der Ordinarius hat lange genug auf sich warten lassen. Da war ein alter Vorgänger, der nicht abgehn und auch nicht sterben wollte. Nun hat er sich zu dem ersten entschlossen; und Walter Weinberg ist an seine Stelle getreten.
Also ich überantwortete Harald meinem guten Manne, ließ die beiden zum Gasthaus am Markte gehn und wanderte selbst eine schmale Gasse hinunter, die ich seit mehr als zwanzig Jahren nicht gegangen war. Und ich entsann mich ihrer doch noch so gut, wie ich weinend und in elendem schwarzem Kleide von der Frau Bäckermeisterin in ihr Haus geführt wurde. Mein Vater war meiner Mutter im Tode gefolgt, und ich sollte nicht allein in dem kahlen Zimmer bleiben, in dessen Mitte ein Sarg stand.
Die Straße hat nicht viel Änderung erfahren. An dem einen Hause steht noch die Mutter Gottes mit dem Jesuskindlein aus Porzellan auf dem Arm. Das Kindlein habe ich damals sehr bewundert und hätte so gern damit gespielt. Das aber ging nicht an. Nur aus der Ferne durfte ich es anstaunen.
Der Florian vor dem Wolladen war auch noch da, und die heilige Anna, die den Mädchen zum Manne verhilft. Vor ihrem kleinen Schrein lagen heute ganz frische Blumen. Sind sie ihr von einer dankbaren Seele gebracht worden oder von einer, die das Hoffen nicht lassen kann?
Am Ende der Straße liegt der Laden mit der goldnen Brezel davor, und in ihm hantiert eine starke Frau. Sie hat Silberfäden im Haar und ein freundlich-ruhiges Gesicht.
Ich erkannte sie gleich. Sie ist alt geworden, aber ihre gütigen Augen sind dieselben geblieben.
Es war niemand außer ihr im Laden, und ich trat ein.
Frau Bäckermeisterin, ich bin Anneli Pankow, und ich muß Ihnen die Hand drücken. Sie sind damals so gut mit mir gewesen, so sehr gut –
Die Frau ließ mir die Hand; aber ihr freundliches Gesicht wurde verlegen.
Anneli Pankow? Ich weiß doch nit!
Dann fiel es ihr ein.
Ach, das klein Dingelchen, wo die Mutter sterben mußt, und der Vater auch! Jesus Maria Josepp, so ein armes Kind. Wie gehts Ihnen denn?
Ich saß mit ihr in der kleinen Hinterstube des Ladens und erzählte von mir. Wie ich verheiratet wäre, und es mir gut ginge. Aber ich hätte sie nicht vergessen. Ihre Güte, ihren »Platz«, ihre Trostworte. Ich sprach verworren; aber sie hörte mir freundlich zu, sah mit ihren klaren Augen in mein Gesicht und wiederholte immer wieder:
Ei, da freue ich mich!
Es war ein hübsches Wiedersehen. Die Frau so einfach würdig, ohne falsche Bescheidenheit, innerlich frei von allen Äußerlichkeiten. Ohne sie wäre das arme verwahrloste Kind vielleicht verkommen; davon aber sagte sie kein Wort. Sie freute sich nur, daß ich an sie dachte. Sie hatte mich halb vergessen: nach mir waren wohl andre gekommen, denen sie helfen mußte, denn sie hatte eine offne Hand, und jedermann wußte es. Aber daß ich kam und sie nicht vergessen hatte, freute sie.
Tue Gutes, wirf es ins Meer: Siehts nicht der Fisch, siehts doch der Herr.
Als ich nachher von der Frau Bäckermeisterin wegging, mußte ich an dies Verslein denken. Meine damalige Wohltäterin kennt den Spruch nicht; aber sie handelt danach. Morgen will ich sie noch einmal besuchen und mich dann umsehen, was ich ihr schenken könnte. Eine Freude muß ich ihr doch machen; schon deswegen, damit sie Anneli Pankow nicht wieder vergißt. Walter und Harald hatten sich unterdessen gezankt. Sie tun es oft, wenn sie allein sind, und es kommt vom Lateinischen. Walter ist immer so ein Musterknabe gewesen: Primus in allen Klassen, und die alten Sprachen sind ihm nicht schwer geworden. Daß sein Sohn jetzt Mühe hat, die Sprache der alten Römer zu begreifen, ist ihm unfaßlich. Harald ist eben mein Sohn. Er hat meine Augen, meine Haare, meine träumerische Art, meine Anfälle von Faulheit. Walter ist entrüstet, wenn ich mich faul nenne; er sagt, daß ich eine tätige, sparsame Hausfrau wäre, und daß es für mich überflüssig sei, den ernsten Wissenschaften Gedanken zu widmen. Aber ich habe nie gern lernen mögen. Schon damals nicht, als Onkel Willi mich zur Strafe französische Vokabeln und Gesangbuchverse lernen ließ, und ich lieber den kleinen Vögeln lauschte oder meinen eignen versonnenen Gedanken nachhing. Männer sind ein wunderliches Geschlecht. Walter haßt es, wenn ich meine Fehler bekenne. Nach seiner Ansicht habe ich keine, weil ich seine Frau bin. Aber mein Junge, der auch sein Kind ist, sitzt voll von denselben Fehlern, und der Vater sieht sie mit einer gewissen Erbarmungslosigkeit.
Als ich also in den Gasthof kam, war Walter verstimmt, und Harald sollte gerade zu Bett geschickt werden. Um sieben Uhr, an einem warmen Augustabend, wo der Mond langsam über den Bergen aufging, und eine träumerisch weiche Luft die Stadt einhüllte.
Ich sagte einige begütigende Worte; da erlaubte Walter, daß der Junge noch ein Weilchen neben uns vor der Tür sitzen durfte. Der arme Schelm hatte Tränen in den Augen und eine belegte Stimme. Alles von wegen einer lateinischen Regel, die er als Sextaner hätte wissen müssen und nicht wußte. Auf dem Marktplatz plätscherte ein Brünnlein, und die Leute saßen auf seinem steinernen Rand, unterhielten und neckten sich. Neben uns hatten ein paar Handlungsreisende Platz genommen, die sich abgestandne Witze erzählten und dabei so herzlich lachten, daß man mitlachen mußte. Und dann sang eine junge Stimme irgendein Volkslied.
Solche Stunden liebe ich. Wenn nichts von mir verlangt wird, wenn ich still sitzen und auf das horchen darf, was um mich hergeht, wenn mein Junge seine Hand in die meine schiebt, und wenn mein Mann durch seine stille Gegenwart mir sagt, daß auch er nicht unzufrieden ist mit der Welt.
Aber diese Stunden dauern niemals lange. Gerade als wir prosaisch wurden und vom Abendbrot sprachen, stürzte Bernd Falkenberg auf mich zu und schüttelte mir die Hand, als sollte sie abfliegen.
Bernd Falkenberg ist mein richtiger Vetter. Sein Vater und meine arme Mutter, die hier auf dem Friedhof schläft, sind Geschwister gewesen. Meine Mutter war ein eigenwilliges Kind. Sie lief mit einem armen Studenten, Harald Pankow, davon, heiratete ihn und ist dann jung und im Elend gestorben. Wenige Monate vor meinem Vater, der in dieser Stadt als Advokatenschreiber sein Leben fristete, bis es aufhörte.
Für die Freiherren von Falkenberg war diese Verwandtschaft nicht gerade erhebend, und zuerst haben sie sich auch wohl nur ungern um mich bekümmert. Meines Vaters älterer Bruder, Willi Pankow, nahm mich vorläufig zu sich, war gut zu mir in seiner stillen, verträumten Art und hatte zuerst gewiß die Absicht, mich immer bei sich zu behalten. Aber daraus ist dann doch nichts geworden. Wie es gekommen ist, weiß ich nicht mehr; aber Onkel Willi entdeckte plötzlich, daß er ein Dichter und Schriftsteller war, und hat sich als solcher einen Namen gemacht.
Damals, als der innere Ruf an ihn erging, ist er aus dem alten Schloß gezogen, in dem man ihm eine Freiwohnung gewährte; mich aber nahmen die Falkenbergs auf ihr Gut Falkenhorst, und mit Bernd, dem einzigen Sohn und Erben, habe ich auch immer wie mit meinem Bruder gestanden.
Bernd hat eine Pensionsfreundin von mir geheiratet: Doraline, Freifräulein von Degen. Wir nannten sie Dolly Degen, und wir lachten oft über sie, weil sie so hochmütig war und auch etwas dumm. Meine wirkliche Freundin, Bodild Rosen, und ich hielten uns selbst für sehr viel klüger als Dolly. Aber vielleicht ist sie doch nicht so dumm gewesen; denn jetzt macht sie einen recht verständigen Eindruck, und die Unterhaltung über Stammbaum und Ahnen, die sie einst so liebte, wird nicht mehr geführt. Walter sagt, Dolly mußte erzogen werden, und das Leben hat diesen Auftrag besorgt.
Ach ja, sie tut mir bitterlich leid! Zwei Jungen hatte sie, und die sind ihr beide an der Diphtheritis gestorben. Nun ist ihr nur ein kleines schwächliches, weinerliches Mädchen verblieben, und die Aussichten auf einen andern Erben sollen gering sein.
Vielleicht kommt es davon, daß Dolly jetzt immer verstimmt ist und keine rechte Freude mehr am Leben hat. Aber sie vergißt dabei ihren Mann, der es auch nötig hat, gut behandelt zu werden. So ein armer Kerl will doch noch seine Freude haben nach all dem Leid.
Bernd hat sich in den Reichstag wählen lassen, um nicht immer auf Falkenhorst zu sitzen; und wenn es ihm im Sommer zu langweilig wird mit Dolly und Lita, dann reist er umher, hält Reden in irgendeinem Verein und studiert Land und Leute andrer Gegenden. So war er denn dieses Jahr mit Frau und Tochter in die Eifel gekommen, und in der kleinen, hinter der großen gelegnen Gaststube saßen wir zusammen, tranken Bernkastler Doktor, aßen Forellen und Kramtsvögel dazu und plauderten von alten und von neuen Zeiten.
Walter war ehemals Bernds Lehrer; deshalb kennen sich die zwei so gut und haben sich immer viel zu sagen. Jetzt steckten sie auch gleich die Köpfe zusammen und tauschten ihre politischen Ansichten aus. Bernd ist konservativ; Walter etwas nach links; das geht gut zusammen, und sie werden sich nicht langweilig. Dolly nahm mich natürlich gleich in Beschlag, und Harald mußte Lita unterhalten. Er tat es nicht gern; kleine Mädchen sind ihm oft sehr langweilig, und wenn ich ihm rührend vorzustellen suche, daß seine Mutter ebenfalls ein kleines Mädchen war, dann wird er nicht bewegt.
Dich hätte ich schon gern gehabt, Mutterlieb, erklärt er. Aber die andern Mädchen sind mies!
Ich weiß gar nicht, was »mies« ist; aber wenn ich mir heute abend Lita betrachtete, ein kleines blasses Ding mit roten Augen, dann konnte ich mir ungefähr denken, was er meinte. Die zwei Kinder ließ ich aber doch miteinander fertig zu werden versuchen und horchte auf Dolly Degen und ihre vielen Klagen. Es ist wirklich schade, Dolly hat regelrecht Jagd auf meinen Vetter Bernd gemacht; jetzt, wo sie ihn hat, ist sie nicht zufrieden.
Ach, Anneli, das Leben ist doch schwer! seufzte sie. Bist du eigentlich ganz zufrieden?
Ganz zufrieden? Ich wiederholte das Wort und stutzte ein wenig. War ich ganz zufrieden?
Dolly sprach schon weiter.
Ich habe mir den Ehestand ganz anders vorgestellt. Viel lustiger und mit viel mehr Freuden. Aber Bernd spricht nur von meinen Pflichten. Auf dem Lande ist auch immer soviel zu tun; und man hat beständig Verdruß mit den Leuten. Und dann die Schlachtereien und die Weihnachtsschenkerei. Und dann Litas Gouvernanten, die sich nicht mit dem Kinde stellen können. Und dann meine eigne schlechte Gesundheit. Eigentlich müßte ich auf ein Jahr mal ganz heraus; aber Bernd sagt, dazu habe er kein Geld; dabei geht er ein paarmal im Jahre nach Berlin. Ach ja, der Ehestand ist nicht so, wie man sich ihn in der Pension denkt!
Ich habe mir damals eigentlich gar nichts gedacht, erwiderte ich.
Nein, du machtest nicht viel Pläne; aber weißt du nicht, was Bodild Rosen alles vom Ehestande verlangte? Eine Fürstenkrone zum wenigsten und einen schönen dunkeln Mann dazu. Eine Fürstenkrone hat sie allerdings erhalten; aber der alte Fürst Monreal, dessen Gemahlin sie geworden ist, ist alt und immer krank. Weshalb sie den genommen hat, ist mir ein Rätsel. Aber vielleicht wollte sie von zu Haus weg, wo sich ihr Bruder mit einer reichen Amerikanerin vermählt hat. Die Stellung als Hofdame verlor sie ja nach dem Tode der Großherzogin-Mutter. Aber ich möchte Bodild gern einmal wiedersehen. Weißt du noch, damals in Luzern, wo wir als Pensionskinder deinen Onkel Willi besuchten, wie sich Bodild in ihn verliebte? Sie hätte ihn vom Fleck weg geheiratet, wenn er gewollt hätte. Aber er sah den Unsinn ein und ließ sie abreisen. Er war eigentlich ein reizender Herr, und ich denke noch oft an ihn. Schreibt er noch viel? Sein Name wird kaum mehr genannt.
Ich wollte antworten, daß Onkel Willi, soviel ich wußte, nur seiner stillen Beschaulichkeit lebte, als Bernd meinen Namen rief.
Anneli, so höre doch auch gefälligst, wenn ich mit dir reden will! Ich soll dir einen schönen Gruß von Fred Roland bestellen, du erinnerst dich doch noch seiner? Er paukte mich zum Abiturium ein und besuchte mich damals in Luzern. Damals, als sich Doktor Weinberg hoffnungslos in dich verliebte!
Walter lachte und sah mich freundlich an.
Aber Anneli Pankow verliebte sich nicht in den armen Doktor Weinberg.
Ich war zu jung zu solchen Dingen, entgegnete ich.
Von der Liebe wollte ich auch nicht reden, fuhr mein Vetter fort. Von Fred Roland, der lange schon Doktor der Medizin und der Chirurgie ist, und der jetzt nach Bärenburg ziehn wird, um eine kleine Privatklinik zu übernehmen. Sehr gut scheint es ihm bis dahin nicht ergangen zu sein. Er hat schrecklich früh geheiratet, hat drei Töchter und muß streben, um weiterzukommen. Er freut sich, euch zwei Weinbergs in Bärenburg zu treffen.
Wo haben Sie ihn gesehn? fragte mein Mann.
Hier irgendwo in der Eifel. Er lief mit dem Rucksack umher und wollte sich erholen. Hat irgendwo eine Durchlaucht behandelt, und dabei eine Bekanntschaft gemacht, die es ihm ermöglicht, die Klinik zu übernehmen. Man sieht ihm den Tatendurst am Gesicht an, aber bis dahin scheint er nur zum unsteten Wandern, zum ewigen Wohnungswechsel geführt zu haben.
Die kleine Privatklinik ist ehemals gut gewesen, erzählte mein Mann. Aber dann übernahm sie ein Arzt, dessen Frau nichts von der Hauswirtschaft verstand. Da ist denn das Ganze heruntergekommen. Hoffentlich ist die Doktorin Roland eine gute Hausfrau?
Bernd zuckte die Achseln. Davon weiß ich natürlich nichts. Sie ist eine Pastorentochter aus der Kleinstadt, in der auch Anneli einen Teil ihrer Kindheit verlebte, und sie heißt Rosa. Weißt du noch, Anneli, daß unsre alte Teckelhündin auf Falkenhorst ebenfalls Rosa hieß? Sie hatte, wenn ich nicht irre, vierundsiebzig Kinder, und eins davon hieß Cäsar. Und dieser Cäsar –
Ich stand auf.
Morgen wollen wir weiter plaudern, Bernd. Ich bin sehr müde, und mein Junge ist schon mehr bewußtlos.
So trennten wir uns also, trotz Bernds Sträuben. Aber mein Mann war es auch zufrieden. Er ist denn auch sofort eingeschlafen, und Harald habe ich im Nebenzimmerchen kaum aufs Bett gelegt, als er schon friedlich atmete.
Nur ich hörte noch lange das Wasser des alten Brunnens rauschen.
Fred Roland ist meine Jugendliebe gewesen. Damals, als ich auf dem Schloß bei Onkel Willi wohnte, und Fred mein Freund, mein Ideal war. Er war ein hübscher Junge mit herrischen Augen und Bewegungen, ganz anders als seine Mutter, die demütig ihre Straße ging. Sie arbeitete Hauben und Hüte für die Bewohnerinnen der kleinen Stadt, und wenn sie sich auch Frau nannte, so war dieser Titel ihr weder durch Standesamt noch Kirche verbrieft und versiegelt. Damals habe ich Frau Roland sehr lieb gehabt; und ich würde sie noch lieben. Sie hatte Verständnis für das einsame Kind mit seinem Liebesbedürfnis, und man mußte zu ihr Vertrauen haben.
Fred liebte seine Mutter über alle Maßen; ich merkte es, als ich in ihrem Hause krank war. Denn einmal, an einem bösen Wintertage, brach ich auf dem Eis ein und wäre ertrunken, wenn nicht Fred mich gerettet hätte. Damals brachte er mich zu seiner Mutter; und in dem kleinen behaglichen Wohnzimmerchen bin ich wieder zurechtgepflegt worden.
War es von der Zeit her, daß ich mir einbildete, Fred Roland müßte eines Tages kommen und mich zu seiner Frau machen? Ich weiß es nicht mehr. Nach meinem Unfall kam ich bald zu den Falkenbergs, lernte mich beherrschen und benehmen, wurde aus einem Wildfang ein ganz gewöhnlicher Backfisch und bildete mir ein, sehr vornehm heiraten zu müssen. Aber als ich dann Fred in Luzern wiedersah, wo ich mit meinen Pensionsfreundinnen Onkel Willi besuchte, da hoffte, da wünschte ich – Es war ein Irrtum. Fred, der eben erst Student war, hatte sich schon gebunden. Er vertraute mir an, daß er sich mit Pfarrers Röschen verlobt habe.
Von meiner Kindheit her kannte ich das Röschen. Sie war blond und sanft und immer artig. Sie war zwei Jahre älter als Fred und hatte ihn sich sanft auf einem Abiturientenball erobert.
Von diesem Bekenntnis starb ich natürlich nicht, weiß auch nicht, ob ich zum Sterben unglücklich war. Aber ich weiß doch, daß die Welt, selbst die lachende Schweiz, für mich nicht mehr so strahlend lächelte. Damals war es, daß Bodild Rosen, meine Herzensfreundin, ebenfalls ihren ersten Schmerz erduldete. Sie hatte sich in meinen Onkel, den fast sechzigjährigen Mann verliebt und wollte ihn heiraten, um ihn zu pflegen. Er aber war zu edel und verständig, dies Opfer anzunehmen. So haben wir Jungen zu der Zeit alle unsre Schmerzen gehabt, denn auch Bernd begann der Liebe Gluten zu empfinden und ließ sich von Onkels Hausfräulein beinahe dingfest machen. Diese Sache ging bald vorüber; aber es war immerhin ein Erlebnis, über das Bernd gelegentlich noch spricht. Die einzige, die nichts erlebte, war Dolly Degen. Dafür hat sie dann jetzt den Majoratsherrn von Falkenhorst geheiratet und seufzt über die Enttäuschungen des Ehestandes.
Und ich? Nun, ich habe meinen guten Walter und meinen heißgeliebten Jungen. Walter hat mich immer sehr geliebt, vielleicht zu sehr; aber er kann es nicht ändern. Seine Natur ist weich; er muß lieben. Nur beim Lateinischen wird er hart. Mein armer Harald, was soll doch aus dir werden, wenn du keine Neigung verspürst, Professor und ein gelehrtes Haus zu werden!
Wir werden noch zwei Tage in Birneburg bleiben. Walter hat entdeckt, daß sich hier in der Nähe eine römische Niederlassung befindet, an der jetzt Ausgrabungen gemacht werden. Ein Steuerbeamter, der sich für diese Sachen interessiert, hat sich erboten, ihn zu begleiten, und beide Herren sind schon in der Frühe abmarschiert. Harald sollte eigentlich mit; aber ich habe ihn frei gebeten. Er soll mit mir durch die alten, engen Gassen zur Frau Bäckermeisterin gehn, und wir wollen zwei Kränze aus Rosen auf meine Gräber legen, und dann will ich ihm von meinen Eltern erzählen, die alten Geschichten, die er lange weiß, und die er immer wieder hören mag. Daß sie arm, krank und einsam waren, daß sie nun friedlich schlafen, und daß sie weiter leben im Herzen ihrer Tochter.
Ja, Sie habens besser als die armen Verstorbnen! sagte nachher die Frau Bäckermeisterin zu mir. Da saßen wir zusammen in dem kleinen Hinterstübchen, und sie hatte mir erzählt, wie alles gewesen war. Armut, Krankheit, Tod und zu allem das Leid, das Unglück selbst verschuldet zu haben. Die junge Frau war so eigenwillig gewesen; sie wollte nicht warten, bis der Mann Amt und Brot hatte, sie heiratete ihn, den Eltern zum Trotz.
Ach, ich kannte die Geschichte. Sie war mir auf Falkenhorst noch deutlicher berichtet worden als hier in der behutsamen Sprechart der Frau Bäckermeisterin. Aber ich mochte sie doch nicht hören. Unsre Eltern dürfen keine Fehler haben; unser Gefühl sträubt sich gegen diesen Gedanken. Die Bäckermeisterin sah mich an und legte dann leicht ihre verarbeitete Hand auf die meine.
Der Herrgott und der Heiland nehmen alle Sünd weg! sagte sie tröstend. Danach gingen Harald und ich auf den Kirchhof. Er trug die Kränze, und ich schritt in Gedanken, bis mein Junge mich am Arme zupfte.
Mutterlieb, die Frau Bäckermeisterin hab ich gern! Wenn ich einmal in Not sein werde, dann gehe ich zu der!
Hoffentlich wirst du niemals in Not kommen, Harald!
Man kanns nicht wissen, Mutter. Die Not kommt schnell; Lita sagts auch. Sie sagt, kaum ist die eine Gouvernante aus dem Hause, dann kommt die andre hinterdrein, und bei jeder gibts eine neue Rede von Tante Dolly.
Lita sollte sich recht Mühe mit dem Lernen geben, sagte ich. Als Kind habe ich es gehaßt, wenn die Erwachsnen solche weise Sätze zu mir sprachen; aber jetzt greife auch ich zu diesem Mittel. Kinder verlangen eine Dosis Moral, über die sie nachdenken können.
Lita möchte auch wohl lernen; aber sie sagt, es ist mühsam. Und Mühe mag sie sich nicht geben.
An uns vorüber zieht ein alter Gaul einen mit Steinen beladnen Karren bergan. Der Treiber geht lässig nebenher, knallt mit der Peitsche und flucht.
Da legt mein Junge seine Kränze auf den Karren und schiebt hinterher, daß er dem Pferd die Arbeit erleichtere. Es gelingt ihm nicht, die Ladung ist zu schwer; aber der Treiber schämt sich plötzlich, ruft nicht mehr Hott und hüh, sondern stemmt sich in die Räder. Und dabei lacht er und schlägt Harald ermunternd und zufrieden auf den Rücken.
Wir standen nachher auf dem Kirchhof, legten die Kränze auf ihre Plätze und sahen wieder in den Sonnenschein und auf die stillen Berge. Der alte müde Gaul war seine Straße weitergezogen, und sein Treiber half ihm nach, aus der Ferne konnten wir es sehen. Ich aber dachte, ob meine Eltern mich geliebt hätten, wie ich meinen Knaben liebe. Wie entsetzlich schwer muß es ihnen geworden sein, ihr Kind einsam zurückzulassen.
Ach, wir wissen nicht, wieviel Leid die Welt schon trug. Und wieviel sie weiter tragen muß.
Jetzt sind wir wieder in Bärenburg eingezogen. Es ist keine große Residenz, sondern ein winkliges Universitätlein. Hier ein leeres Schloß mit historischer Vergangenheit; dort einige holprige Gassen; recht ansehnliche Universitätsbauten und dazwischen der Student und der Philister.
Wir gehören natürlich zu den Philistern. Unser Häuschen liegt etwas vor der Stadt; wir haben ein nettes Gärtchen und einen Ausblick auf hübsche Waldberge. Im Sommer sind diese Berge lebendig. Da singt und spielt der Student tagtäglich in ihnen; aber jetzt liegen sie in tiefem Schweigen da. Denn wir haben noch nicht den fünfzehnten Oktober; noch ist kein Student herbeigekommen, der Bärenburger Philister seufzt über seine leeren Zimmer, und manches hübsche Kind über ihr leeres Herz.
Wir sind zeitig heimgekommen. Erstens Haralds wegen, dessen Schule schon lange begonnen hat, und dann hat Walter viel zu arbeiten. Er will populäre Vorträge in mehreren süddeutschen Städten halten, die dann später als Buch erscheinen sollen. Früher hat er immer über die populäre Wissenschaft gelacht, gerade wie Professor Müller, der gefürchtete Kritiker der Fachblätter; aber jetzt will Walter Geld verdienen. Ein wenig nötig hätten wirs schon; als Außerordentlicher war Walter nicht gerade glänzend gestellt, und mein Kapital, das mir von meinem Onkel, Bodo Falkenberg, vermacht wurde, ist allmählich darauf gegangen. Mir macht es nichts aus; aber Walter will anfangen zu sparen für mich und für Harald. Er sagt, wenn er aus der Welt ginge, dann hätten wir nichts. Aber warum sollte er gehn? Er ist noch jung und hat eine gute Gesundheit. Weshalb also die populäre Wissenschaft anrufen, damit unsre Sparkassenbücher inhaltsvoller werden? Walter lächelt zerstreut, wenn ich so mit ihm spreche; und er sitzt hinter seinen dicken Büchern und destilliert einen feinen Tee für höhere Töchter und ernstdenkende Frauen.
Mir ists natürlich recht, wieder daheim zu sein. In meinem Häuschen und im Garten, der voll von Herbstblumen steht. In meinem Wohnzimmerchen, das den Namen Salon nicht ertragen würde, und wo ich hinter Mullvorhängen gerade so glücklich bin wie eine Geheimrätin hinter ihren Spitzenstores. Wir sind sehr einfach eingerichtet; aber jedermann findet es behaglich, sogar die neue Magnifika, die aus einem reichen Fabrikantenhaus ist und sich kaum vorstellen kann, daß man ohne Smyrnateppiche glücklich sein kann. Ich freue mich immer, wenn die Menschen gern zu uns kommen; aber Gesellschaften geben wir nicht. Wir haben nicht die Mittel dazu und verkehren daher nur freundschaftlich in einigen gleichgesinnten Familien. Niemals entbehre ich Mittagsgesellschaften und Abendessen; aber es tut mir leid, daß unsre hiesige Geselligkeit eigentlich nur aus beiden besteht – man ist doch halbwegs ausgeschlossen, wenn man diese Feste nicht mitmacht. Die deutsche Wissenschaft scheint sich gern gut nähren zu wollen.
Heute saß ich in der Laube hinterm Hause, hatte mein letztes Pflaumenmus eingekocht und wollte den Duft der letzten matten Rosen auf mich einströmen lassen, während ich dazu ein Stückchen Shakespeare las. Da erschien Frau Doktor Roland und machte mir ihren Antrittsbesuch. Sie hätte mit ihrem Manne kommen wollen, aber er war heute verhindert, und es drängte sie, mir zu sagen, daß sie mich nicht vergessen hätte. Ich wäre ein so komisches Kind gewesen.
Daß des Pfarrers Röschen mich ein komisches Kind nannte, verdroß mich; aber ich ließ mir nichts merken.
Von Ihnen weiß ich allerdings nichts mehr, Frau Roland, sagte ich freundlich. Nur daß Sie sehr blond waren und sehr artig. Sie waren auch immer viel älter als ich!
Frau Roland errötete. Ihr einst so frisches blondes Gesicht war welk geworden, und ihre Kleidung hatte etwas Kleinstädtisches. Die leise Anspielung auf ihr Alter mißfiel ihr. Ich bereute sie auch schon, und ich beschloß, sehr nett zu werden. Aber unsre guten Vorsätze stiegen schnell davon, wenn die andern Menschen eklig bleiben.
Ich habe Sie wenig gekannt, Frau Professor, fuhr Pfarrers Röschen fort. Gesprochen ist manchmal von Ihnen in unsrer Stadt, damals, als mein Mann Ihnen das Leben rettete –
Waren Sie schon damals mit Fred Roland verheiratet? erkundigte ich mich lachend, und die kleine Frau sah mich unsicher an.
Gewiß nicht, aber ich sage doch immer mein Mann, wenn ich an Fred Roland denke. Er ist doch jetzt schon lange mein Mann. Und wir wohnen hier in Bärenburg, in der Klinik am Schwanenweg, und ich bin fremd hier und möchte gern etwas Rat haben. Sieben Jahre lang sind wir schon herumgezogen, bald hier, bald dort; nirgends ist es uns recht geglückt. Fred ist zu tüchtig: er kann nicht recht in die Höhe kommen! Frau Rosa Roland war in ihrem Element; sie konnte unbehindert von dem sprechen, was sie am meisten beschäftigte, und ich unterbrach sie nicht mehr.
Fred hat leider oft Streit, fuhr sie klagend fort. Er sagt seine Meinung offen und ärgert damit die andern, die sich mehr als er dünken. Aber wenn er doch Recht hat –
Sie sah mich fragend mit ihren matten Augen an, und ich nickte zustimmend. Da erzählte sie mir noch mehr. Von dem vornehmen Chirurgen, der bei einer Operation einen großen Fehler gemacht hatte und von Fred darauf aufmerksam gemacht worden war. Der Mann war sein Feind geworden und würde ihn vernichtet haben, wenn nicht plötzlich ein freundlicher Zufall eingegriffen hätte.
Fred war in Thüringen, um einen kranken Arzt zu vertreten. Da wurde er aufs Schloß zum Fürsten Monreal gerufen, der sich das Knie verletzt hatte. Fred hat ihn zuerst massiert und einem alten Baron Birkstein, der dort zum Besuch war, ebenfalls geholfen. Und dieser alte Herr – er steht allein in der Welt – hat Fred in den Stand gesetzt, die Klinik hier zu übernehmen. Glauben Sie, daß sie gehn wird, Frau Weinberg?
Wenn Sie gute Dienerschaft haben, antwortete ich halb mechanisch.
Die werde ich schon finden. Eine Frau Päpke bringe ich mit. Eine sehr nette, tüchtige Person, die ich durch Zufall in Friedrichroda entdeckte. Sie scheint sparsam und tüchtig. Wir fangen mit sechs Betten an, und dann will Fred eine tägliche Sprechstunde abhalten. Ein Landschullehrer, dem er half, hat ihm dazu geraten.
Frau Roland war noch nicht fertig. Sie saß in meiner Laube, riß die Blätter von den Rosensträuchen, verrieb sie zwischen den Fingern und berichtete weiter. Ich weiß nicht mehr, was sie sagte; sie war so sehr strebsam und wollte so sehr viel Geld verdienen.
Sie haben wohl keine Kinder? erkundigte ich mich in einer Gesprächspause.
O gewiß, drei Mädchen. Die Antwort klang kühl.
Da freut sich Ihre Schwiegermutter sicher über die Mädelchens.
Meine Schwiegermutter – Pfarrers Röschen stand auf und kniff die Lippen zusammen, als unterdrückte sie den Nachsatz. Ich muß jetzt gehn, Frau Professor. Nehmen Sie herzlichen Dank für Ihre gütigen Ratschläge. Vielleicht darf ich einmal wiederkommen!
Ich war gar nicht dazu gekommen, ihr Ratschläge zu geben; aber ich merkte, daß man ihr nicht widersprechen durfte.
Nun brachte ich sie durch den Garten, und sie ging steif und gemessen wie eine Dahlie am Stengel. Kleinstadtwürde, mit einer gewissen Furcht vermischt, die ich nicht verstand.
Nachher hatte ich meine Laube dann wieder für mich. Aber es lagen so viel abgerissene Blätter umher, die mich störten, und dann kam Harald, der in der Schule eine schlechte Zensur erhalten hatte. Da war mir die Stimmung verdorben.
Das Semester hat begonnen, der Student ist reichlich eingetroffen, singt nachts auf der Straße und schwänzt tags im Kolleg. Aber die Professoren breiten ihre ganze Wissenschaft vor ihm aus, und abends tanzt er mit den Professorentöchtern oder spielt Komödie oder macht sonst etwas Lustiges.
Meine Magnifika hat mich wieder besucht. Ich soll Theater spielen. Sie machte mir einige Komplimente über mein Aussehen, und Walter lächelt dazu sein gutes Lächeln. Er ist immer so stolz auf mich, daß ich mich für ihn fürchte, wenn ich mich blamieren sollte.
Die Magnifika setzt natürlich ihren Willen durch. Ich muß ihr versprechen, in irgendeinem Stücklein eine junge Frau zu spielen, die mehrere Liebhaber hat. Von hoher Moral ist das Lustspiel also nicht, aber es wird moralisch enden, und das ist die Hauptsache.
Gestern war schon die erste Leseprobe, und ich fand es ganz behaglich in dem kleinen, mit Teppichen belegten Salon der Frau Rektor, umgeben von fröhlichen Menschen, zu sitzen und zu plaudern. Ich bin wenig in diese Welt gekommen, nun macht sie mir Freude. Aber es ist hier wie überall. Zuerst redet man von hohen Dingen, dann kommen die kleinen an die Reihe.
Nach dem Durchlesen der Rollen sprach ein kleiner hübscher Privatdozent über Michelangelo, über den er eine Arbeit verfaßt hat; dann kam die Unterhaltung auf ein Liebespaar, das sich hier nicht ganz passend beträgt; und dann wurde gefragt: Wer ist eigentlich Doktor Roland, und was bedeutet seine neue Klinik?
Niemand antwortete, nur die Magnifika wußte Bescheid. Ihr Mann ist der erste Chirurg hier; ein vornehmer Herr, der viel auf die Jagd geht, seine Assistenten arbeiten läßt und sich nicht allzusehr überarbeitet.
Doktor Roland soll recht geschickt sein, und die kleine Privatklinik hat immer neben den öffentlichen Anstalten bestanden. Es gibt ja immer Leute, die die großen Krankenhäuser scheuen. Außerdem sind sie oft überfüllt.
Die Magnifika sprach gleichgiltig und etwas von oben herab. Jedermann sollte es merken, daß sie keine Konkurrenz fürchtete. Wie sollte sie auch?
Der Privatdozent, der sich mit Michelangelo beschäftigt, mischte sich jetzt in die Unterhaltung.
Doktor Roland hat am ersten Tage seines Hierseins eine so brillante Heilung ausgeführt. Irgendein armes Schulmeisterlein vom Lande, das anscheinend hoffnungslos dahinsiechte, ist durch ihn wieder gesund gemacht worden. Die Einzelheiten weiß ich nicht, aber da ich am Schwanenweg wohne, sehe ich täglich Hilfesuchende in das kleine häßliche, gelbe Haus gehn, in dem Doktor Roland wohnt.
Die Sache mit der Heilung wird wohl anders zusammenhängen, entgegnete die Frau Rektor gelassen. Aber ich würde mich freuen, wenn Doktor Roland zu tun bekäme. Mein Mann ist sehr überbürdet. Wollen wir jetzt nicht einen kleinen Imbiß einnehmen?
Der kleine Imbiß bestand aus seinen Butterbroten, Salat und so viel Champagner, daß ich fast wie ein Student gesungen hätte, als mich der kleine Privatdozent nachher heimgeleitete. Aber ich nahm mich zusammen, versuchte über Michelangelo zu sprechen und horchte andächtig auf seine weisen Gegenreden. Er ist sehr jung und deshalb über alle Maßen klug.
Walter saß natürlich noch am Schreibtisch und arbeitete an seinen populären Vorträgen. Für jeden erhält er in jeder Stadt dreihundert Mark. Fünf Städte wollen drei haben, also gibt es einen hübschen Batzen Geld. Dann können wir auch einmal Champagner geben und die Leute für uns Theater spielen lassen. Soweit sind wir noch nicht. Vorderhand muß ich meine Rolle spielen und mir natürlich viel Mühe geben. Rektors sind sehr freundlich gegen mich, auch die andern Herrschaften. Sie freuen sich, wie sie sagen, daß wir etwas aus unsrer Zurückgezogenheit herauskommen. Aber gestern und heute ist Harald wieder mit einer schlechten Zensur nach Hause gekommen. Er kann es nicht vertragen, wenn ich nicht mit ihm arbeite, und ich mußte meine Rolle lernen und mir einiges für mein Kostüm besorgen. Ich habe nur ein Dienstmädchen und ein ganzes Haus zu versorgen; wenn das Geld für die Vorträge einkommt, will ich mir lieber etwas Hilfe nehmen, als andre Menschen bei mir Champagner trinken lassen.
Die Gesellschaft beim Rektor ist gewesen und verlief zur Zufriedenheit. Walter sagte mir nachher, daß ich alles am besten gemacht hätte, das Theaterspiel und was sonst mit dem Fest zusammenhing. Er ist immer zufrieden mit mir, ich kenne es schon nicht anders, aber daß sogar der Herr Rektor geruhte, mir einige anerkennende Worte zu sagen, wurde als große Auszeichnung für mich betrachtet; früher war ich nur Luft für den Geheimen Medizinalrat, und ich verdiente es nicht anders. Mein Mann war nur Außerordentlicher, hatte keine Verbindungen und suchte sich keine. Nun, wo er in die Reihe der Ordentlichen eingetreten ist, ist er natürlich mehr Mensch geworden, und ich, als seine Frau, darf mich huldvoller Ansprache rühmen.
Der Geheimrat war in der Tat sehr liebenswürdig.
Man hat Sie immer so wenig gesehen, Gnädigste! Sind Sie wirklich ganz Hausfrau und Mutter?
Ob ich beides ganz bin, Herr Geheimrat, weiß ich nicht. Ich möchte es schon sein.
Er lächelte freundlich. Wie die Männer es an sich haben, wenn sie auf ihr Lieblingsthema kommen.
Der schönste Beruf einer Frau! begann er. – Da fiel sein Blick auf seinen ersten Assistenten, der mit einem fremden Herrn auf ihn zukam. Doktor Roland, stellte er vor und zog sich dann zurück, während sich mein alter Jugendgenosse vor dem Magnifikus verbeugte.
Ich muß um Entschuldigung bitten, zu spät gekommen zu sein. Aber eine eilige Sache –
Der Geheimrat unterbrach ihn lächelnd:
Ich weiß schon, mein Lieber. Als Anfänger muß man immer zu spät erscheinen, um sich den nötigen Nimbus zu geben. Also, meine liebe gnädige Frau –
Da stand der Assistent schon wieder neben dem Gastgeber.
Ihre Durchlauchten, Fürst und Fürstin Monreal betreten gerade den Saal.
Mein Geheimrat machte mir eine eilige Verbeugung und ging dann seinen hohen Gästen entgegen. Ich aber mußte mir Fred Roland betrachten, den ich noch nie in Frack und weißer Halsbinde gesehen hatte, und dem beides sehr gut stand. Er hatte das Gesicht seiner Jugendjahre behalten und sich nur einen dunkeln, spitzen Bart dazu angelegt. Aber er war doch auch älter und sein Ausdruck viel unruhiger geworden. Von einem Fuß trat er auf den andern und sah sich in der Gesellschaft um, nach den fremden Gesichtern, die ihm nichts sagten, und deren Besitzer sich dorthin wandten, wo Durchlauchten zu erwarten waren.
Guten Tag, Doktor Roland! sagte ich, ihm die Hand hinhaltend, und der also Angeredete richtete seine dunkeln Augen erstaunt auf mich. Und dann leuchteten sie auf.
Anneli Pankow! Wahrhaftig! Wie nett, Sie begrüßen zu können.
Heiter schüttelte er mir die Hand und sprach dann, als hätte er mich gestern zum letztenmal gesehen, während doch fünfzehn Jahre vergangen sind.
Ich wollte Sie schon immer besuchen, Frau Anneli! Vielen Dank, daß Sie meine Frau so freundlich aufnahmen, sie hat Ihnen wohl viel vorgeklagt? Ach ja, aller Anfang ist schwer, und Röschen muß die Augen hier über allem offenhalten. Aber ich glaube, daß alles gut gehn wird. Meine sechs Betten sind so sehr besetzt, daß ich mir noch drei dazu kaufen werde. Und jeden Tag drei oder vier Operationen!
Seine Augen strahlten mich zufrieden an. Wie in alten Zeiten, wenn er mir von seinen Zukunftsplänen oder davon erzählte, wie gut er für seine Mutter sorgen wollte; deshalb dachte ich jetzt an sie.
Kommt Ihre Mutter nicht einmal her? Ich würde mich über alle Maßen freuen, sie wiederzusehen!
Doktor Rolands Gesicht wurde dunkel. Dann schüttelte er den Kopf und schien etwas sagen zu wollen; aber der schreckliche erste Assistent erschien jetzt an meiner Seite.
Gnädige Frau, Ihre Durchlaucht, die Fürstin Monreal sucht schon lange nach Ihnen!
Ach, ich hatte wirklich vergessen, daß meine gute Freundin Bodild Rosen jetzt die Fürstin Monreal ist. Da kam sie auf mich zu, vor aller Welt schüttelten wir uns nicht allein die Hände, sondern sie küßte mich herzlich.
Anneli, ich freue mich unbändig, dich zu sehen. Lieber Manfred, dies ist Frau Professor Weinberg, die beste Freundin meiner Jugend!
Manfred verbeugte sich und sagte einige artige Worte. Er ist ein alter Mann mit einem Raubvogelgesicht und eingesunknen Schläfen. Seine Brust flimmerte von Orden, und er trug eine kleine Perücke.
Bodild war sehr heiter. Viel heitrer, als ich sie in Erinnerung hatte. Sie plauderte mit mir von alten guten Zeiten, ließ ihre Hand nicht aus meinem Arm und ging auf diese Weise mit mir durch die Gesellschaft. Jedermann erhielt von ihr ein freundliches Wort, vor allem auch mein Mann, der sich natürlich bescheiden im hintersten Hintergrunde hielt. Aber ich mußte ihn suchen, und Bodild lud uns beide ein, sie auf ihrem Schloß zu besuchen. Es liegt in der Nähe von Bärenburg, und ihr Mann hat es vor kurzem von irgendeinem Vetter geerbt. Es ist nichts Wertvolles; ein alter Kasten aus irgendeinem entlegnen Jahrhundert. Aber natürlich schrecklich historisch und für einen Professor sehr interessant. Walters Augen begannen zu leuchten, als er von der alten Burg Wieden horte, und der Fürst sah ihn wohlwollend an.
Natürlich müssen Sie kommen, lieber Professor! Ich habe alte Bilder und Waffen, die Ihnen vielleicht zu studieren Freude machen werden!
Es war ein hübsches Fest. Als ich mitten in der Nacht mit Walter nach Hause ging, waren wir beide recht befriedigt. Es war alles sehr schön gewesen; aber es tat mir doch leid, nichts mehr von Doktor Roland gesehen zu haben.
Die Magnifika erkundigte sich schon heute morgen in höchsteigner Person nach meinem Befinden.
Es ist Ihnen doch gut bekommen? Sie haben reizend gespielt! Und wie eigenartig, daß Sie eine Freundin der Fürstin Monreal sind.
Sie setzte sich mir gegenüber und sah mich so fragend an, daß ich natürlich antworten mußte.
Solche Sachen sind nicht so wunderbar, wie sie wohl zuerst scheinen. Die Gräfin Rosen und ich trafen uns in einem Pensionat am Genfer See. Sie hat dann mit mir zusammen meinen Onkel Wilhelm Pankow besucht, der in Luzern wohnt, und später ist sie auf dem Gut meiner Verwandten gewesen. Seit ihrer Heirat habe ich allerdings nichts von ihr gesehen. Der Fürst ist schon zweimal verheiratet gewesen, erzählte jetzt mein Besuch. Mein Mann kennt ihn recht gut von einer Orientreise her und ist dann öfters von ihm zur Jagd eingeladen worden. Da wir wußten, daß sie augenblicklich in der Nähe von Bärenburg leben, mußten wir sie einladen. Im übrigen bin ich nicht für so vornehmen Verkehr. Die Leute sehen doch auf uns herab!
Auf diese Bemerkung erwiderte ich nichts. Ich habe Bodild früher sehr lieb gehabt und werde sie weiter lieben. Einerlei, ob sie Fürstin ist oder Gräfin. Ich liebe den treuen, wahrhaftigen, edeln Menschen in ihr. Und aufdrängen werde ich mich ihr nicht.
Haben Sie länger mit Doktor Roland gesprochen? fragte mich die Magnifika weiter, und ich hatte auf der Zunge, mich zu erkundigen, ob sie so zu jedem ihrer Gäste ginge, um sie einer scharfen Prüfung zu unterwerfen. Doch meine artige Natur siegte.
Ich sprach nur kurz mit dem Doktor, er ist ein Kindheitsfreund von mir.
Und wie ist seine Frau?
Sie kenne ich fast gar nicht, kann also nichts sagen.
Frau Roland ist vielleicht nicht ganz präsentabel. Wir hatten sie natürlich beide eingeladen, aber er kam allein und entschuldigte sie kaum. Seine Klinik soll übrigens schon gefüllt sein. Und haben Sie gehört, daß Fürst Monreal gestern bei ihm vorgefahren ist?
Ich wußte es natürlich nicht, obgleich ich mich entsann, von Röschen Roland etwas vom Fürsten Monreal gehört zu haben. Aber ich sagte es nicht. Der Geheime Medizinalrat klagt zwar über Überbürdung, aber einen Fürsten läßt er sich als Patienten gewiß ungern entgehn. Die Magnifika rauschte davon. Sie war reizend mit mir, sagte etwas über meine Augen, und daß wir uns lieb haben wollten, und winkte mir noch, als sie schon auf der Straße war. Ich aber ging zu meinem Jungen und fand ihn in Tränen. Sein Extemporale war wieder schlecht, und der Lehrer drohte ihm mit Nachhilfestunden.
Morgen will ich diesen Lehrer einmal besuchen.
Herr Külpe wohnt am Schwanenweg in einer kleinen häßlichen Mansarde. Die Häuser sind hier alle häßlich und alt, die Treppen wacklig, die Luft schlecht. Aber ich finde mich nach oben, wo eine Visitenkarte mir die richtige Tür zeigt, und eine barsche Stimme auf mein leises Klopfen »Herein« schreit.
Durch Tabakwolken sehe ich ein Männchen im Schlafrock, das bei meinem Anblick entsetzt vom Sofa in die Höhe springt.
Was wünschen Sie? Ich heiße Frau Weinberg und möchte Sie wegen meines Sohnes Harald sprechen. Ist er wirklich so unbegabt?
Schlotternd steht das Männchen vor mir, und ich sehe zu meinem Entsetzen, daß er unter dem Schlafrock sehr, sehr leicht bekleidet ist. Nun wende ich mich zur Flucht. Wie ich glücklich wieder vor der Tür bin, rufe ich durchs Schlüsselloch: Können Sie mich nicht einmal besuchen?
Unten angelangt, sehe ich nach der Uhr. Es ist zwölf Uhr mittags. Braucht man dann halb angezogen auf dem Sofa zu liegen und Herein zu rufen? Weil ich aber doch einmal im Schwanenweg war, bin ich ihn ganz entlang gegangen. Es ist eine etwas holprige Gasse, die sich am Berg entlang zieht. Ob hier jemals Schwäne gehaust haben, erscheint mir mehr als zweifelhaft. Es gingen aber ganz viele Menschen auf der Straße, und dann sah ich ein Haus vor mir, das ein Schild »Privatklinik« trug und darunter den Namen F. Roland,Dr. med.
Unwillkürlich blieb ich stehn und sah in die verhängten Fenster. Wird er hier sein Glück finden? Da faßte mich eine kleine Hand am Kleid.
Willst du jetzt zu Papa? Er hat eine Operation und ist nicht zu sprechen.
Ein kleines, häßliches, schlechtgekleidetes Mädchen stand vor mir. Sie hatte strubblige Haare, und Wasser und Seife schienen bei ihr zu fehlen. Wer bist du? erkundigte ich mich, obgleich ich mir die Antwort denken konnte.
Ich bin Minchen Roland, und ich warte auf Linchen und Stinchen. Wir haben zwei Groschen geschenkt bekommen und wollen uns was dafür kaufen!
Wer schenkt dir denn zwei Groschen? wollte ich fragen. Da aber kamen zwei kleinere, ebenso häßliche und ebenso verwahrlost gekleidete Mädels über die Straße gelaufen.
Nun wollen wir gehn! kommandierte Minchen. Linchen, du hältst meine linke, und Stinchen kann meine rechte Hand halten!
Eilig wollte die kleine Gesellschaft davonziehen; aber ich ging mit ihnen.
Wohin wollt ihr denn?
Zum Krämer an der Ecke, der gibt am meisten.
Und dann, wohin gehst du dann?
Wir wissen noch nicht; zu Hause wird operiert. Mama hat uns doch die zwei Groschen gegeben, damit wir aus der Luft sind. Sie kann nicht auf uns achten, und Frau Päpke muß alles kochen. Für uns ist niemand da.
Das war wieder Minchen, die die Unterhaltung machte. Sie hat verständige Augen und eine etwas altkluge Sprache.
Ich sah mir die drei kleinen Dinger an; und dann gedachte ich der Zeiten, wo auch ich allein fremde Straßen wanderte. Da war es eine Frau Roland, die mich gütig aufnahm, die Großmutter dieser Kinder. Also brachte ich mir diese drei Mädelchens mit nach Hause.
Die Weihnachtszeit kommt sehr nahe, und die kleinen Rolands beginnen ihre Weihnachtslieder zu singen. Es ist natürlich Minchen, die den Befehl des Singens ausgegeben hat, und sie gehorchen ihr alle. Auch mein großer Junge, der sich schon lange darein gefunden hat, daß drei kleine Mädchen jeden Tag mit seinen Spielsachen hantieren und ihm auch schon manches verdorben haben, obgleich Minchen sehr sorgsam ist, und wenn eine Operation notwendig sein sollte, sie ohne Zagen und sachgemäß ausführt. Sie ist ein echtes Doktorkind. Alles möchte sie heilen und sticken, und sie macht ihre Sachen wirklich nicht schlecht. Die drei Rolands verkehren schon mehrere Wochen in unserm Hause, wie unsre eignen Kinder, sie kommen zu allen Mahlzeiten, wenn es ihnen einfällt, sie bringen mir ihre zerrißnen Kleider und verlangen meinen Rat in den delikatesten Fragen; und noch niemals ist es ihrer Mutter eingefallen, mir ein Wort darüber zu sagen. Ich habe ihr einen Gegenbesuch gemacht, bin aber nicht angenommen worden, und auch Fred ist noch mit keinem Schritt in unserm Hause gewesen. Ihn entschuldige ich; er hat sehr viel zu tun, von allen Seiten laufen ihm die Kranken zu; er soll eine unfehlbar sichre Diagnose haben und mit geringen Mitteln viel ausrichten. Dazu hat er mit mancherlei Anfechtungen zu kämpfen. Zuerst haben ihn die hiesigen Mediziner ganz freundlich aufgenommen; aber wie sie nun merken, daß nicht allein die einfachen Leute vom Lande zu ihm kommen, sondern auch vornehme Herrschaften (der Fürst von Monreal ist nur seinetwegen auf sein kleines Raubschloß in unsre Nähe gezogen), seit der Zeit werden unsre vornehmen Professoren sehr kühl gegen Roland. Sie nennen ihn den Doktor Eisenbart und lachen bald laut, bald leise über ihn.
Walter hats mir erzählt. Auf den Wandelgängen des Universitätsgebäudes wird gelegentlich auch über andre Dinge geredet als über die hehre Wissenschaft, und Walter könnte mir sicherlich noch viel mehr berichten, wenn er nur besser aufmerken wollte; aber er denkt nur noch an seine Vorträge. Einen hat er schon in den fünf süddeutschen Städten gehalten und sehr viel Anerkennung gefunden. Er kam begeistert zurück, aber auch recht müde. Er lacht zwar, wenn ich es sage, aber ich kenne ihn doch besser als er sich selbst. Deshalb habe ich auch eine weitere Aufführung bei Rektors, wo ich wieder spielen sollte, dankend abgelehnt. Ich weiß, daß Walter mir diese kleinen Freuden von Herzen gönnt; mir gefällt aber im ganzen doch besser, wenn ich bei mir zu Hause bleiben kann bei meinem Jungen und bei meinem Manne, der für mich nur liebevolle Worte hat. Harald hat sich etwas im Arbeiten gebessert. Herr Külpe ist wahrhaftig bald nach meinem Besuche bei mir erschienen: ein noch sehr junger Mensch mit sehr verlegnen Manieren. Harald denkt an zu viel andres, sagt er, an Vögel und Hunde und an andre Spielereien statt an Latein.
Ist es unrecht, an Vögel und Hunde zu denken? fragte ich. Ich habe immer viel lieber an derartige Dinge gedacht als ans Lernen!
Herr Külpe lächelte und wurde rot.
Vielleicht haben Sie dann auch schlecht gelernt, gnädige Frau! stotterte er.
Ich mußte seufzen. Ja, mein Lernen war niemals berühmt. Als ich klein war, quälte mich der Gedanke, Gouvernante werden zu sollen. Es war Bernd Falkenberg, der mir als freundlicher Vetter diese Laufbahn in Aussicht stellte. Es ist nie soweit gekommen, und ich muß alle Kinder glücklich preisen, die nicht von mir unterrichtet sind. Dennoch mag ich Herrn Külpes Antwort nicht besonders gern hören. Aber er sieht mich dabei so treuherzig und so grenzenlos verlegen an, daß ich ihm nicht böse sein kann.
Gelegentlich ist Harald nicht mehr so sehr zerstreut. Er arbeitet vernünftig, und seine Zensuren werden besser. Kommt es daher, weil Minchen Roland neben ihm beim Lernen sitzt und sich seine Aufgaben vorsprechen läßt? Sie kann noch nicht ordentlich lesen, aber sie behält alles, was man ihr vorspricht, und es macht Harald Spaß, sie das, was er ihr sagt, wie ein Papagei abschnurren zu hören.
Es sind wunderliche Kinder, diese kleinen Rolands. Meist kommen sie gegen vier Uhr nachmittags zu uns. Zur Kaffeestunde, wenn Harald seinen Becher Milch trinkt, mit einem Schuß Braunes darin; dann werden noch weitere drei Becher mit demselben Inhalt, ausgeteilt, einige Brote mit Honig bestrichen, und dann wird unser kleines Eßzimmer sehr behaglich. Der grüne Kachelofen strahlt eine milde Wärme aus, die Lampe brennt, und die Kinder erzählen sich Geschichten. Minchen weiß natürlich die besten. Sie ist den ganzen Tag in der Klinik, hat die Augen, weit offen und sieht mehr als andre Sterbliche.
Gestern ist einer bei uns totgeblieben, berichtet sie mit ihrer sehr schrillen Stimme. Er kam viel zu spät; dann kann auch mein Papa nicht mehr helfen.
War es ein Mann oder eine Frau? erkundigte sich Harald.
Eine Frau. Nachher kamen zwei Jungen und weinten ganz schrecklich. Sie sagten, ihre Mutter sollte wieder lebendig werden. Aber das geht nicht. Was tot ist, das ist tot.
Mich überlief ein kleiner Schauder bei diesen kalten Worten; aber Harald nickte verständnisvoll.
Was tot ist, das ist tot.
Beide Kinder sprachen dann von andern Dingen, und Linchen und Stinchen, die Trabanten ihrer ältern Schwester, tranken behaglich ihre Milch dazu. Sie dürfen eigentlich niemals etwas sagen, und sie verlangen es auch nicht. Sie sind zufrieden, daß sie zuhören, daß sie Milch und Honigbrot haben dürfen. Wer doch auch so sein könnte. Es ist mir so, als wäre ich niemals mit Milch und Honigbrot zufrieden gewesen.
Nun also steht Weihnachten vor der Tür, und die Kinder singen ihre Lieder. Harald hat hundert Wünsche, und auch Minchen weiß genau, was sie haben möchte. Aber ich werde es niemals kriegen, sagte sie in einem Ton der Ergebung, der für ein so junges Kind etwas Rührendes hat. Auf meine Frage: Was ist es denn? lautete die Antwort: Ein kleines Operationsbesteck.
Ich bin sehr erstaunt, Harald lacht, und Minchen verteidigt sich.
So ein kleines Ding ist gar nicht so furchtbar teuer, und dann könnte ich doch Papa helfen. Er sagt so oft: Wieder kein Mensch, der mir helfen kann! Ach über die vielen Frauenzimmer! Hätte ich doch einen einzigen Jungen! Frau Päpke sagt, daß ich niemals mehr ein Junge werden kann, aber ich möchte ihm doch helfen.
Und die Kleine sieht mit ihren etwas hervortretenden Augen sehnsüchtig in das Lampenlicht. Zum Glück hat sie nicht lange diese Anwandlung: bald läßt sie sich von Harald aufziehn, oder bittet mich um ein Märchen, aber um ein wahres, und unser Beisammensein verläuft harmonisch wie immer. Aber Harald ist doch zu groß, um nicht seine eignen Gedanken zu haben, und er spricht sie mir in der stillen Stunde aus, wo ich vor seinem Bette sitze und auf sein Abendgebet warte.
Minchen und die andern Gören sind ja ganz nett, Mutterlieb, aber findest du es nicht komisch, wie ihre Mutter mit ihnen ist? Sie bringt sie nie zu Bett oder betet mit ihnen, und sie läßt sie immer laufen, wenn sie wollen. Sie ist schon immer etwas merkwürdig gewesen, aber hier ist es viel schlimmer geworden.
Frau Roland wird hier wohl recht viel zu tun haben, erwidere ich, und mein Junge nickt. Na natürlich, der Doktor hat ja sehr viel zu tun, und seine Frau muß alles anschreiben; aber etwas Zeit dürfte sie doch auch für ihre Kinder haben. Sie können doch nichts dafür, daß sie alle drei Mädchen sind. Du solltest nur einmal mit Frau Doktor sprechen. Du verstehst so etwas sehr gut.
Diese Anerkennung meines Sohnes quittiere ich mit einem Kuß, aber erkläre, daß ich mich auf nichts einlassen kann.
Walter tun die kleinen Mädchen auch leid. Er sagt ihnen immer ein freundliches Wort, wenn er ihnen begegnet; im übrigen ist er ganz wie ich gesonnen: wir wollen die Kleinen wohl bei uns aufnehmen und gut zu ihnen sein, aber um ihre innern Angelegenheiten dürfen wir uns nicht bekümmern. Doktor Roland macht sonst gerade um diese Zeit viel von sich reden. Auf der Universitätsklinik haben sie kürzlich einen armen Kranken als gänzlich unheil- und unoperierbar weggeschickt. Seine Frau brachte ihn zu Doktor Roland, und dieser hat ihn in kurzer Zeit ohne Operation geheilt. Die Sache hat viel Aufsehn erregt. Die Zeitungen haben sich ihrer bemächtigt, und man sagt, daß hier auf dem Bahnhof täglich Kranke ankommen, die nach Doktor Roland fragen. Jedenfalls hat er ein Nebenhaus gemietet, das hart an das seine stößt, und soll dort auch schon Kranke aufnehmen. Kürzlich besuchte mich der kleine Privatdozent, mit dem ich Theater spielen mußte, und dieser berichtete mir, daß der Geheime Medizinalrat, unser Rektor, recht böse wäre. Zwei Amerikaner sollen auch bereits zur Kur bei dem neuen Eisenbart eingetroffen sein.
Der Geheimrat ist doch so überlastet, meinte ich, da wird ihm eine kleine Ablenkung von seiner Klinik sehr angenehm sein.
Aber mein Besucher schüttelte den Kopf.
Doktor Roland wird nicht wieder eingeladen, sagte er mit einer so gewichtigen Miene, daß ich Mühe hatte, ernst zu bleiben.
Mir ist sonst nicht so sehr nach Lachen zumute. Erstens macht Walter mir Sorge, der trübe aus den Augen sieht und gelegentlich reizbar wird, und dann wills mit Harald nicht vorwärts mit dem Latein. Alles andre ginge schon, aber beim Latein kann Minchen ihm nicht helfen. Es wird also Weihnacht ein mangelhaftes Zeugnis geben, und wenn dies mir auch nicht so wichtig ist, so wird es dem armen Walter die Freude verderben.
Nun, ich muß die Sorgen zu vergessen suchen und daran denken, was ich meiner Frau Bäckermeisterin schenken will. Harald und ich haben uns den Kopf zerbrochen, bis ich in einer Kunsthandlung einen schönen Buntdruck von der Sixtinischen Madonna gefunden habe. Der ist denn jetzt nach Birneburg zu der gütigen Frau gewandert, an die ich mit soviel Liebe denke, und ich hoffe, sie wird sich freuen.
Ich wenigstens würde es tun, sagte Harald. Besonders da das Geschenk von dir kommt, du bist doch eine so reizende Frau.
Wir gingen zusammen auf der Straße, und ich blieb stehn, um meinen Jungen betroffen anzublicken.
Woher hast du solchen Unsinn?
Es ist kein Unsinn, erwiderte Harald trotzig. Die Jungen in der Klasse sagen alle, daß du reizend bist, und der Lohndiener, der damals bei Rektors aufwartete, als du dort Theater spieltest, hat es auch gemeint.
Ich lache ein wenig, aber nicht sehr viel, und ich halte meinem Sohne eine Vorlesung darüber, daß es nicht notwendig ist, von seiner Mutter in der Schule und mit Lohndienern zu sprechen. Aber der Sohn des Lohndieners besucht mit Harald dieselbe Klasse, und daher erfahre ich dies günstige Urteil.
Der Junge spricht auch bald von der Bäckermeisterin. Wie sie das Bild aufnehmen und wohin sie es hängen will. Und wann wir selbst wieder nach Birneburg fahren werden.
Dort hats mir gefallen! sagt er mit einem Seufzer. Weißt du, Mutterlieb, Wenns mir ganz schlecht ergeht, dann will ich mich in Birneburg zur Ruhe setzen.
Ich muß über sein ernstes Gesicht lächeln, und dann sprechen wir von Weihnachten.
Nun ist das Fest schon wieder vorübergerauscht, und ich freue mich darüber, wie ich mich jedesmal so sehr freue, wenn es kommen soll. Aber die Vorfreuden im Leben sind immer die besten, und wenn man mitten in der Freude stehn sollte, dann kommt allemal ein bittrer Nachgeschmack. Diesesmal ist er eigentlich ausgeblieben, obgleich es mir hart war, daß der Junge kein gutes Zeugnis hatte, und daß mein armer Walter so traurige Augen machte. Aber mein Mann wollte mir nicht die Festfreude verderben, und ich tat, als wäre sie mir nicht verdorben. Und gerade als unser Baum mit seinen vielen Lichtern brannte, da öffnete sich die Tür, und die drei Rolands traten ein. Ohne Feiertagsgewand, und ohne alle Umstände. Bei ihnen sollte erst morgen gefeiert werden, da konnten sie also heute zu uns kommen. Sie wanderten um den Lichterbaum, betrachteten ihn mit kritischen Blicken und falteten ihre Hände, als Harald sein Weihnachtslied deklamierte. Und dann sagte Minchen etwas ganz ähnliches her; wer es sie gelehrt hatte, wußte sie nicht mehr, aber sie konnte es. Und dann kam die Reihe an mich, und ich mußte, auf allgemeines Verlangen, etwas aus meinem Leben erzählen. Kein Märchen, sondern etwas Wahres, wie mir geboten wurde, und mein Sohn Harald schlug vor, daß ich berichten solle, wie ich ins Wasser gefallen, aber wieder herausgezogen worden wäre.
Da erzählte ich also, und die kleine Schar setzte sich schweigend um mich herum.