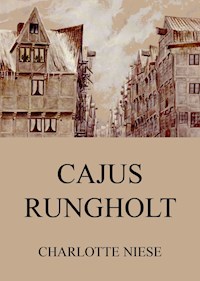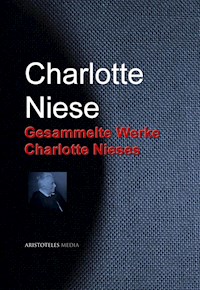13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es duftet nach Tannen, Zimt und Glühwein - die Vorfreude auf das Weihnachtsfest steigt in uns auf. Wir schmücken die Stube, backen Plätzchen, besorgen Geschenke, hören stimmungsvolle Musik und halten stille Einkehr. Weihnachtsgeschichten lenken unseren Blick auf das Wesentliche dieser Zeit und lassen uns den Zauber, der das Fest umgibt, erst richtig genießen. Geschichten von Peter Rosegger, Adalbert Stifter, Ludwig Thoma und anderen bekannten Autoren, aber auch unbekannte Schätze der Literatur und Volkskunst lassen uns von einer Heiligen Nacht am Kamin träumen, wenn sich draußen die Schneeflocken ans Fenster setzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Der Verlag dankt dem Otto Müller Verlag, Salzburg, für die freundliche Genehmigung zum Abdruck der nachstehend genannten Texte von Karl-Heinrich Waggerl:
»Das ist die stillste Zeit im Jahr«, Auszug aus: Karl-Heinrich Waggerl: Das ist die stillste Zeit im Jahr, © Otto Müller Verlag, 1. Auflage, Salzburg 2004
»Das Weihnachtsbrot«, © Otto Müller Verlag, Salzburg
LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2008
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim www.rosenheimer.com
Titelfoto: Bernd Römmelt, München
eISBN 978-3-475-54560-3 (epub)
Worum geht es im Buch?
Heilige Nacht in den Bergen
Es duftet nach Tannen, Zimt und Glühwein – die Vorfreude auf das Weihnachtsfest steigt in uns auf. Wir schmücken die Stube, backen Plätzchen, besorgen Geschenke, hören stimmungsvolle Musik und halten stille Einkehr. Weihnachtsgeschichten lenken unseren Blick auf das Wesentliche dieser Zeit und lassen uns den Zauber, der das Fest umgibt, erst richtig genießen.
Geschichten von Peter Rosegger, Adalbert Stifter, Ludwig Thoma, Helmut Zöpfl und anderen bekannten Autoren, aber auch unbekannte Schätze der Literatur und Volkskunst lassen uns von einer Heiligen Nacht träumen, wenn sich draußen die Schneeflocken ans Fenster setzen.
Inhalt
Der Orgelpeter
Charlotte Niese
Ein Dreikönigsspiel
Unbekannt
Der Weihnachtstag
Ida Bindschedler
Der allererste Weihnachtsbaum
Hermann Löns
Das sind Weihnachten
Adalbert Stifter
Die frohe Botschaft
Aus dem Lukasevangelium
Die heil’gen Drei Könige
Heinrich Heine
Der Christabend
Ludwig Thoma
Ein Weihnachtsmärchen
Heinrich Seidel
Weihnachten
Max Dauhtendey
Zwei Weihnachtsgeschichten
Sophie Reinheimer
Ein Weihnachtsabend
Ottilie Wildermuth
Das Märchen von den Sternschnuppen
Unbekannt
Das Weihnachtsbrot
Karl-Heinrich Waggerl
Weihnacht
Theodor Storm
Die Heilige und Ihr Narr
Agnes Günther
Das Fest
Johann Wolfgang von Goethe
Der Schneemann
Hans Christian Andersen
Gegen Sitte und Brauch
Ludwig Thoma
Die Puppe
Unbekannt
Aus Bärbels Weihnachten
Ottilie Wildermuth
Advent
Angelus Silesius
Einer Weihnacht Lust und Gefahr
Peter Rosegger
Der Weihnachtsbaum
Christoph von Schmid
Weihnachten in der Speisekammer
Paula Dehmel
Der Weihnachtsbaum
Heinrich Hoffmann von Fallersleben
Weihnachtsmärchen
Franz von Pocci
Aus der Weihnachtszeit
Isabella Braun
Weihnacht in Winkelsteg
Peter Rosegger
Das Christbäumchen
Wilhelm Curtmann
Das ist die stillste Zeit im Jahr
Karl-Heinrich Waggerl
Es gibt so wunderweiße Nächte
Rainer Maria Rilke
Kinderweihnacht
Monika Hunnius
Die Nüsse
Georg Ebers
Wunderliche Weihnacht
Unbekannt
Wenn es Winter wird
Christian Morgenstern
Der riesengroße Schneemann
Unbekannt
Bald kommt das Christkind
Ida Bindschedler
Das Weihnachtsland
Heinrich Seidel
Weihnachtszeit
Heinrich Hoffmann von Fallersleben
Das Leben des heilige Bischofs Nicolai
Martin von Cochem
Der glückliche kleine Vogel
Unbekannt
Das Weihnachtsfest
Carl Hauptmann
Der Tannenbaum
Hans Christian Andersen
Der Orgelpeter
Die meisten können keine Drehorgeln vertragen. Dem einen belästigen sie die Nerven, den anderen machen sie melancholisch, und der dritte ärgert sich über den Orgelspieler selbst. Deshalb hatte auch der Orgelpeter eine schwierige Stellung in der kleinen Eifelstadt. Seine Drehorgel besaß nämlich den denkbar schrecklichsten Ton. Eigentlich war es schon kein Ton mehr, sondern nur ein gurgelndes Gequieke, das geradezu nervig und ohrenbetäubend wirkte und mit einer Melodie keine Ähnlichkeit mehr besaß. Spötter behaupteten, die Orgel spiele überhaupt nicht mehr, es seien nur die Hunderte von Mäusen, welche in ihr hausten, deren Stimmen man vernehme. Jedenfalls war die Stellung des Orgelpeters eine schwierige, denn alles lief fort, sobald er mit seinem elenden Instrument erschien, und nur die kleinen Jungs beachteten ihn so weit, dass sie ihn mit Steinen bewarfen. Spott und Steinwürfe konnte er schon ertragen, an beides war er gewöhnt; aber niemand gab ihm mehr einen Pfennig, und der Hunger tat weh. Früher war es der alten Drehorgel doch gelungen, diesen bösen Feind von Peter fortzuhalten. Viele Jahre hindurch hatte sie mit ihrem Herrn jeden Markt in der Vordereifel besucht, und manch blanker Taler war durch sie verdient worden, nun aber konnte sie nicht mehr, so viel Mühe sie sich auch gab, und Peter musste einsehen, dass es mit ihr nicht mehr ging. Was sollte er aber ohne seine Drehorgel anfangen? Er war alt, lahm, und, wie die Leute sagten, sehr dumm. Da ist es schwer, sich auf eine neue Hantierung zu besinnen.
Als er nun eines Tages wieder die Orgel draußen vor der Stadt gespielt und Spott und Hohn geerntet hatte, setzte er sich gar trübselig auf die Schwelle eines Heiligenhäuschens und blickte durch das Gitter nach der lebensgroßen Figur des heiligen Petrus, welcher, den Schlüssel in der Hand, ernsthaft und aufgerichtet in einer Mauernische stand. Vor ihm brannten einige Kerzen und warfen einen flackernden Schein in das hölzerne Gesicht des Heiligen, ihm einen absonderlichen Ausdruck gebend. Der Orgelpeter war zwar ein guter katholischer Christ und beichtete jedes Ostern seine Sünden so gut, wie er’s verstand, aber über die lieben Heiligen im Himmel hatte er selten nachgedacht. Jetzt fiel ihm plötzlich ein, dass Sankt Petrus sein Schutzpatron sei und ihm gewiss helfen würde, wenn er ihn nur bäte, deshalb zog er schnell seine Mütze vom Kopf, faltete die steifen, gichtigen Hände und kniete vor dem Gitter nieder.
„Heiliger Petrus!“, sagte er, „bitt für mich, und hilf mir in meiner Not! Darfst es nicht übel vermerken, dass ich dich so lange gar nicht angesprochen hab’, aber ich mag die Leute nicht mehr inkommodieren als nötig. Weißt ja auch, dass ich Peter heiß’ nach dir, und ich mein’, dass du mir daher schon was zu Gefallen tust! Schau her – es ist armselig um mich bestellt, hab’ kein Brot und kein Geld, und die Leute spotten mich aus mit meinem Orgelchen. Sie ist noch gar nicht so übel und für mich lange gut – meine Mutter selig hat schon an ihr gedreht – aber heutzutage soll alles fein sein! Heiliger Petrus, zwei Kerzen will ich dir anzünden, wenn du mir hilfst, und die Kappe will ich jedes Mal ziehen, sobald ich hier vorübergehe, und wenn ich’s auch oft vergessen hab, so war’s nicht bös gemeint!“
Peter hatte sehr eifrig und eindringlich gesprochen, ohne die Augen zu erheben – jetzt sah er scheu in das unbewegliche Gesicht des Heiligen, als würde er eine Antwort erwarten. Aber diese blieb aus. Die brennenden Kerzen flackerten unruhig im Winde, und einige Schatten huschten über das Bildwerk – das war alles. Peter aber stand erleichtert auf. Ein so langes Gebet hatte er noch niemals gesprochen, und er fand, dass er seine Worte gut gewählt hatte. Er ging zufrieden in sein dunkles, feuchtes Kämmerlein und würde sich gar nicht gewundert haben, wenn in demselben Augenblick der heilige Petrus ihm dort mit einer neuen Drehorgel auf dem Arm entgegengetreten wäre. Aber es blieb alles beim Alten: seine Orgel ward nicht besser, der Verdienst immer elender, und der Orgelpeter fühlte sich täglich unglücklicher. Zuerst ging er alle Tage an dem Heiligenhäuschen vorüber und nickte dem Sankt Petrus vertraut zu, als wenn er ihn an seine Bitte erinnern wollte. Mehrmals sogar setzte er sich mit seiner Orgel auf die Stufen der kleinen Kapelle und spielte ganz gotteserbärmlich, bis die Polizei ihn fortjagte. Aber der Heilige schien taub für Gebet und Musik. Peter hörte endlich mit beidem auf und nahm es eigentlich übel, dass Petrus ihn so schlecht behandelte. Eines Tages ging er sogar zum Kaplan und verklagte seinen eigenen Schutzheiligen.
„Ich weiß gar nicht, was ich dem Herrn Petrus getan hab’!“, sagte er. „Da geh’ ich und bitt’ und bitt’, und er ist ganz taub geworben. Und ich hab’ ihn sonst nie um etwas gebeten – ich meine doch, er könnt’ mir mal einen Gefallen tun. Nun will ich einen andern Herrn bitten, mir ein’ neue Drehorgel zu geben, und Ihr sollt mir sagen, wer’s am ersten tut!“
Der Herr Kaplan suchte den armen, lahmen Peter zu trösten. So leicht, sagte er, ginge es niemals mit der Erfüllung von Wünschen und Gebeten, denn die Heiligen hätten viel zu tun und könnten sich nicht immer um die einzelnen Menschen kümmern. Der junge Geistliche sprach sanft und freundlich mit dem Alten, aber dieser machte ein verdrießliches Gesicht.
„Wenn Ihr mir nicht einen andern heiligen Mann sagen könnt, der mir meine Bitten erfüllt, dann geh’ ich zum Herrn Dechanten. Der ist neulich an mir vorübergegangen und hat mir einen Groschen geschenkt!“
Da lächelte der Kaplan unwillkürlich, holte ein Zwanzigpfennigstück aus seiner Tasche und reichte es dem Orgelpeter. Dann blickte er sich in seinem bescheiden eingerichteten Zimmerchen um, nahm ein Bild von der Wand und reichte es Peter.
„Dies ist das Bild des Aloysius“, sagte er; „du weißt doch, Peter, dass der heilige Aloysius der Schutzpatron aller ehrsamen Junggesellen ist? Er ist auch eines schrecklichen Todes gestorben, weil er sich nicht verheiraten wollte. Ich will dir das Bild schenken, Peter, vielleicht hilft dir der heilige Aloysius.“
Der Orgelpeter nickte zufrieden, brummte nur einen unverständlichen Dank, nahm das eingerahmte Bild unter den Arm, steckte das Zwanzigpfennigstück in die Tasche und ging nach Hause. Dort schlug er in seinem armseligen Zimmerchen einen Nagel in die Wand, über dem Platze, wo die alte Drehorgel stand, und hing den heiligen Aloysius daran auf. Er war sehr stolz auf seinen neuen Heiligen, und sein Freund Fridolin musste gleich kommen und den neuen Zimmerschmuck bewundern. Fridolin war ein kleiner achtjähriger Junge, der mit seiner Mutter in demselben Häuschen wie Peter wohnte. Er hatte noch niemals über Peter gelacht, oder über die arme Orgel gespottet, und deshalb empfand der alte Mann soviel Zuneigung zu dem Knaben, wie überhaupt Platz in seinem alten, vertrockneten Herzen war. Fridolin betrachtete also ehrfürchtig das Bild des guten Heiligen, aber er war in Hunger und Kummer groß geworden und daher für sein Alter altklug und misstrauisch.
„Der Aloysius hat viel zu tun in der Welt!“, meinte er, nachdem er sich eine Zeitlang besonnen hatte. „Ich hab schon von ihm gehört, aber die Mutter sagt, das Heiraten kommt aus der Mode, denn alle Männer wollen Junggesellen bleiben! Pass nur auf, Peterchen, dass du deine Worte schön stellst, sonst hört dich der Aloysius nicht!“
Aber Peter war überzeugt, dass der Heilige nur auf eine Gelegenheit wartete, um ihm einen Gefallen zu tun, und dass er in den nächsten Tagen eine neue Drehorgel erhalten werde. Daher brummte er nur in den Bart, dass der Fridolin ein dummer Bub sei und von dem heiligen Aloysius durchaus nichts wissen könne. In demselben Augenblick rief die Mutter des Knaben von unten her, und Fridolin, welcher nicht allein zur Schule ging, sondern auch Lumpen und Knochen sammelte, verließ den alten Peter, um seinem Gewerbe nachzugehen. In den Straßen der kleinen Stadt spielten täglich viele Kinder, so dass man unwillkürlich denkt, alle Knaben und Mädchen hätten nichts anderes zu tun, als zu kreiseln, Versteck zu spielen, oder mit Steinen das Obst von den Bäumen herabzuwerfen. Aber Fridolin spielte niemals. Er musste seiner Mutter bei allen häuslichen Hantierungen helfen, und wenn sie ausging, um Lumpen und Knochen zu verkaufen, dann hütete er sein jüngstes Schwesterchen. Manchmal leistete der Orgelpeter ihm dabei Gesellschaft, aber seitdem er das Bild des heiligen Aloysius bekommen hatte, bekümmerte er sich nicht mehr um Fridolin und erwartete täglich seine neue Orgel.
Aber der Heilige musste wirklich viel zu tun haben, denn obgleich Peter ihn seit dem Frühjahr inständig um die Gewährung seines Wunsches bat, so verging doch der ganze Sommer, ohne dass er sich auch nur das Geringste merken ließ. Es wurde Herbst, und an den Bergabhängen brannten schon die Feuer vom Kartoffelkraut, aber Peter wartete noch immer auf seine neue Orgel. Er wurde recht ungeduldig und mürrisch, und als er eines Tages wieder vor dem Heiligenhäuschen am Tor saß und bitterlich weinte, da sammelte sich eine ganze Menschenschar um ihn und hörte, halb mitleidig, halb lachend, seine traurige Geschichte. Das Bild des heiligen Aloysius war von der Wand auf seine Drehorgel gefallen, Rahmen und Glas waren zersplittert, und auch das Angesicht des Heiligen hatte Schaden genommen. Nun war es klar: die Heiligen im Himmel bekümmerten sich nicht um den Orgelpeter und wollten von seiner Bitte nichts wissen. Der Alte schluchzte laut, als er an diesen Satz kam, und man merkte es ihm an, wie sehr ihm die Sache zu Herzen ging. Er wollte sich auch nicht trösten lassen, als ihm eine oder die andere mitleidige Seele ein kleines Geldstück in die Hand drückte. Stundenlang saß er an derselben Stelle, immer wieder sein Leid erzählend. Zuletzt war er ganz allein, denn die meisten Leute haben nicht viel Zeit, auf die Klagen anderer zu hören. Peter wunderte sich auch nicht darüber, er war schließlich gewohnt, schlecht behandelt und vergessen zu werden, und fuhr erschreckt zusammen, als lange nachdem die Dunkelheit hereingebrochen, eine kleine Hand sich auf seine Schulter legte.
„Peterchen, komm heim!“, sagte Fridolins atemlose Stimme. „Wir haben Kartoffeln zu Abend gegessen, und in meiner Tasche sind noch vier Stück! Komm, nimm sie, ich bin ganz satt!“
Der Orgelpeter nahm die dargebotene Gabe schweigend und ohne Dank, aber er fühlte sich doch etwas getröstet.
„Was soll ich heimkommen?“, fragte er klagend. „Deiner Mutter bin ich die Miete für acht Wochen schuldig, und bald wird sie mich auf die Straße werfen, denn vor meiner Orgel laufen die Leute fort! Ach, du heiliger Aloysius, was hab ich dir doch getan, dass du mich so verachtest!“
Der Alte war aufgestanden und humpelte stöhnend die steinige Straße hinauf. Fridolin aber ging nachdenklich neben ihm her.
„Weißt du, Peterchen“, sagte er, „ich hab noch von einem gehört, den man bitten kann – es ist aber kein Heiliger!“
Peter schüttelte den grauen Kopf. „Lass mich in Ruh’!“, sagte er mürrisch. „Ich will niemand mehr bitten, denn so dumm bin ich auch nicht, dass ich nicht merke, wie die hohen Herren mit mir nix im Sinn haben! Mein bissel Brot will ich mir zusammenbetteln, und mein’ alte Orgel kann ich im Ofen verbrennen. Dann leg’ ich mich hin und sterbe – so ist alles aus!“
„Es ist aber gar kein hoher Herr, den du bitten sollst!“, rief Fridolin eifrig. „Es ist ja das Christkind, was ich mein’! Es hat in einer Krippe gelegen, aber um Weihnacht kommt’s immer wieder auf die Erde, und wer es recht von Herzen um was bittet, der bekommt es gleich. – Ich will das Christkind um eine neue Hose bitten!“, setzte Fridolin triumphierend hinzu.
Mittlerweile waren beide vor ihrer Hütte angelangt, und kopfschüttelnd sagte er: „Das Christkind ist nix für mich! Das ist noch niemals zu mir gekommen. Ich bin alt und lahm und verdrießlich, da mag sich niemand um mich bekümmern!“
Fridolin antwortete nicht. Er sah nur mit glänzenden Augen in den dunkeln Sternenhimmel über ihm. Er glaubte ans Christkind, obgleich es ihm noch niemals etwas gebracht hatte. Der Orgelpeter aber ging in sein dunkles, kaltes Zimmer, warf sich auf seinen Strohsack und versuchte einzuschlafen. Es gelang ihm aber nicht – er musste unwillkürlich an das Christkind und dann an Fridolin denken. Der Junge hatte ihm von seinen Kartoffeln abgegeben und war doch sicherlich noch hungrig gewesen. Ja, der Fridolin besaß ein gutes Herz, und wenn es noch Gerechtigkeit gab, dann musste das Christkind auch etwas für den Kleinen tun. Aber es gab ja einmal keine Gerechtigkeit, und mit diesem traurigen Gedanken schlief Peter ein.
In den darauf folgenden Wochen ward der Orgelpeter immer wortkarger und stiller, und oft ging er aus ohne seine Orgel. Manchmal schlich er in der Stadt von Haus zu Haus; öfters aber humpelte er auf die umliegenden Dörfer und kam erst spät heim. Fridolin wunderte sich im Stillen, aber er hatte nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, denn er musste für die Schule lernen und für seine Mutter arbeiten. Oft dachte er an das Christkind, denn die Weihnachtszeit rückte näher, und der Lehrer in der Schule erzählte immer neue und immer schönere Geschichten.
So war es Dezember geworden, und die Sonne schien hell auf die runden Kuppen der Eifelberge. Auf dem Hochsimmer lag etwas Schnee und glitzerte wie lauter Diamanten. Der Orgelpeter, wie er noch immer genannt ward, obgleich er seine Orgel nicht mehr spielte, saß am Rande des Weges und betrachtete aufmerksam ein Spielzeug, das er in seinen krummen Fingern hielt. Es war ein großer Kreisel, dem aber die Spitze fehlte. Er murmelte allerhand verdrießliche Worte in sich hinein und merkte gar nicht, dass jemand vor ihm stand, bis er angeredet ward. Da fuhr er erschreckt auf und riss seine Kappe vom Kopfe, denn es war der Herr Landrat, welcher ihn eben gegrüßt hatte.
„Nun, Peter, wie geht es dir?“, fragte er. Der Angeredete sank auf seinen Sitz zurück und stöhnte: „Wie soll’s gehen? Schlecht geht’s, Herr Landrat. Ich geh’ oft hungrig zu Bett, denn die Heiligen sind mir bös, ich weiß aber nicht warum!“
„Haben sie dir deine Orgel noch nicht gegeben?“, fragte der Landrat mit leichtem Lächeln, und Peter antwortete: „Die krieg’ ich auch nimmer, Herr Landrat. Das weiß ich schon, und ich muss mich drein finden. Aber weil der Fridolin sich so närrisch aufs Christkind freut, wollt’ ich was für ihn betteln, denn der Junge ist gut zu mir. Ich krieg’ auch allerhand Gerümpel, aber die Hose, Herr Landrat, die Hose! Das ist eine üble Sache, denn kein Mensch hat mir noch eine geschenkt!“
Peter war ganz eifrig geworden, man merkte ihm an, dass die Sache ihm Sorge machte, und der Landrat sah ihn wieder lächelnd an. „Nun, quäle dich nicht allzu sehr“, meinte er, „wer weiß, was das Christkindchen tut!“ Er ging, und Peter sah ihm kopfschüttelnd nach.
„Der tut auch so, als ob das Christkind alles könnte!“, murmelte er, und dann humpelte er der Stadt zu.
So kam das Weihnachtsfest heran. In vielen Häusern wurden Kuchen gebacken, und Peter empfand die Mildtätigkeit der Menschen, denn er bekam mancherlei Nützliches für Fridolin geschenkt. Eine Hose aber war nicht darunter, und daher haderte Peter ziemlich unverhohlen mit dem Christkinde, als er ein ganzes Paket voller Sachen zu Fridolins Mutter brachte.
„Du hättest gern an die Orgel denken können!“, murmelte er, als er die dunkle Treppe hinabstieg. „Aber ich weiß schon: mir tut kein Mensch im Himmel einen Gefallen – bin wohl zu elend und zu lahm! Na, es muss sich alles helfen!“
Dieser letzte Satz war Peters Trostspruch geworden. Er brauchte ihn bei allen Gelegenheiten und wollte ihn auch Fridolins Mutter sagen. Diese aber ließ ihn gar nicht zu Worte kommen, denn sie war so überrascht über die Kreisel, Peitschen, Bilderbücher und Holzpferdchen, welche Peter bei sich aufgespeichert hatte, dass sie in Tränen ausbrach und seine Entschuldigung über die fehlende Hose gar nicht hörte. Peter aber wurde ganz verdrießlich und ging brummend auf die Straße.
In der Kirche läuteten die Glocken, denn es war Christabend. Der Schnee knarrte unter den groben Stiefeln des Orgelpeters, der langsam zu der evangelischen Kapelle schlich. Fridolin hatte ihm gesagt, dass dort ein Weihnachtsbaum brenne, und den wollte er doch gern einmal sehen. So war es denn auch: aus den schmalen Kirchenfenstern leuchteten viele Lichter in die Dunkelheit hinaus, und die Orgel spielte eine volle, kräftige Melodie. Da war es dem Peter ganz andächtig zumute, und er vergaß, dass er eben noch mit dem Christkinde unzufrieden gewesen war.
Fridolin hatte schon früher vor der Kirche gestanden, jetzt stellte er sich neben Peter und sprach: „Siehst du, Peterchen, jetzt kommt das Christkind vom Himmel!“
Peter sah starr in den Lichtschein. „Warum kommt es aber zuerst zu den Evangelischen?“, fragte er misstrauisch, doch Fridolin lachte.
„Das Christkind kommt überall auf einmal hin, zu allen Menschen. Es kommt auch zu dir. Peterchen!“
Aber Peter schüttelte den Kopf. „Zu mir ist’s noch nimmer gekommen, Bub, noch nimmer. Weiß wohl nicht, wo ich wohn’!“ Und er seufzte unwillkürlich.
So saßen denn die beiden eine Zeit lang zusammen auf einem Eckstein und sahen in die Lichter des Christbaumes. Nach einer Weile jedoch erloschen sie, auch die Musik verklang, und alles ward still und dunkel. Da lief Fridolin davon. Er hatte seiner Mutter heute Morgen ein Weißbrot kaufen müssen, und er sehnte sich, es zu probieren. Peter folgte ihm langsam und leise stöhnend. Der Wind blies kalt um die Straßenecken und prickelte seine lahmen Glieder wie mit tausend Nadelstichen.
Als er bei den vielen erleuchteten Fenstern vorüberkam, seufzte er kummervoll: „Christkindchen, Christkindchen, warum bist du doch kein einziges Mal zu mir gekommen? Schau her, ich bin zwar alt und tauge nicht viel, aber einmal hättest du doch kommen können, bloß einmal, Christkindchen!“
Aber es schien, als ob das Christkind taub geworden war; es antwortete zumindest nicht auf Peters Anrede, und dieser kroch langsam die Stufen zu seiner Kammer hinauf. – Von unten her hörte er Fridolin lachen und jubeln. Der schien mit dem Christkind zufrieden, obgleich sein Herzenswunsch, die neue Hose, nicht erfüllt war. Oben vor Peters Tür war es ganz dunkel; langsam öffnete er die Kammertür. Plötzlich blieb er wie erstarrt stehen. Ein großes Wachslicht brannte in seinem Stübchen, und mitten darin stand eine neue, große Drehorgel. Sie war blank poliert und hatte blanke Griffe, ein Gestell und eine große Kurbel. Obenauf lag ein Brief, aber Peter hatte nie lesen gelernt, und es war ihm auch einerlei, was in demselben stand. Langsam, mit aufgehaltenem Atem schlich er näher, seine Augen wurden immer größer, als er nach der Kurbel griff und versuchte, diese vorsichtig zu drehen. Aber als der erste kräftige Ton eines Volksliedes durch sein Kämmerlein drang, da fiel er auf die Knie und schluchzte laut.
„Ach, du liebes Christkindchen, bist du doch zu mir altem Mann gekommen! Nimmer, nimmer kann ich dir genug danken!“
Er weinte noch, als Fridolin plötzlich vor ihm stand. Des Knaben Wangen waren hoch gerötet vor Aufregung.
„Peterchen!“, rief er. „Siehst du wohl, dass das Christkind zu dir gekommen ist! Und mir hat’s so viel, so viel gebracht! Heute Abend hat’s der Mutter noch einen neuen Anzug für mich geschickt, und kein Mensch weiß, wer ihn abgegeben hat! Peterchen, Peterchen, bist du aber nicht froh?“
Peter aber war noch immer wortlos. Er ließ sich zwar später von Fridolin vorlesen, dass viele gute Menschen gesammelt hätten, um ihm eine neue Orgel zu kaufen, aber er hörte nur halb hin. Noch spät in der Nacht, als alles zur Ruhe gegangen war, stand er an seinem kleinen Fensterchen und sah in den schwarzblauen Himmel, an dem viele tausend Sterne funkelten.
„Christkindchen!“, sagte er endlich wieder, „sei mir nicht bös, wenn ich früher nicht so recht an dich glaubte. Jetzt weiß ich, dass du besser bist als alle Heiligen! Ich aber will nimmermehr an dir zweifeln!“
So hatte der Peter eine neue Orgel, und wenn er es auch nicht verstand, den Leuten, welche sie ihm gekauft hatten, so recht von Herzen zu danken – er meinte nämlich, es sei genug, dem Christkinde dankbar zu sein – so freuten sich doch alle über seine große Glückseligkeit. Jeder wollte gern die neue Orgel hören, und der Orgelpeter verdiente manchen Groschen, so dass er sich bald einen neuen, warmen Kittel kaufen konnte und auch nicht mehr hungrig zu Bett ging. So kam er denn allmählich in eine ganz friedliche, fröhliche Stimmung, war niemals mehr verdrießlich und ließ sich vieles von Fridolin erzählen, der sehr fleißig zur Schule ging und dabei doch noch Zeit fand, dem Peter Gesellschaft zu leisten.
So verging der Winter, und der Sommer kam wieder. Der tat dem Orgelpeter gut, denn obgleich die Orgel ihn ausreichend ernährte, so wurden seine alten Beine immer schwächer, und er konnte oft nicht warm werden, selbst im warmen Sonnenschein. Aber er klagte niemals mehr. Oft saß er ganz still vor seiner neuen, schönen Orgel und streichelte sie leise, oder er hatte die Hände gefaltet und sah in den blauen Himmel. So kam der Herbst und mit ihm die Novemberstürme, und Fridolin hatte den Kopf wieder voll von Wünschen fürs Christkind. Er war eigentlich unbescheiden geworden und wünschte sich jetzt ganz unverfroren einen neuen Anzug. Peter sagte nichts dazu, er war immer einsilbiger geworden, und es schien, als wenn seine Gedanken nicht bei dem weilten, was der Kleine sprach. Aber als Fridolin ihn dringend fragte, ob er sich dieses Jahr denn gar nichts vom Christkinde wünschte, lächelte der alte Mann geheimnisvoll.
„Doch, Bub!“, sagte er, die vor Gicht krummen Finger reibend. „Ich wünsch mir schon was, und es ist ganz was Besonderes, aber ich sag’s keinem Menschen – auch dir nicht!“
Und so musste Fridolin zu seinem Entsetzen und Erstaunen bemerken, dass der Orgelpeter vor ihm ein Geheimnis hatte. Er quälte sich erst förmlich darum, denn er fand das Benehmen Peters unbegreiflich, dann aber vergaß er es über der Vorfreude auf Weihnachten.
Peter war dieses Jahr geschäftig. Er kaufte für seinen kleinen Freund Schiefertafel und Griffelkasten, ein Bilderbuch und eine warme Pelzmütze; aber er selbst ward immer wortkarger. Wenn er in der Stadt seine Orgel spielte, vergaß er sogar manchmal, hinterher sein Geld einzusammeln, und es schien ihm oft ganz einerlei zu sein, ob er einige Groschen mehr oder weniger einnahm. In den letzten acht Tagen vor Weihnachten ging er gar nicht mehr aus, spielte die Orgel für sich ganz allein auf seinem Stübchen, und oft schlief er dabei ein.
Fridolin hatte in dieser Zeit wenig Gedanken für den Orgelpeter, denn er freute sich so unendlich auf das Christkind, dass er alles andere darüber vergaß. Als aber der Christabend kam, bestürmte er Peter mit Bitten, er möge doch wieder mit ihm den Christbaum in der evangelischen Kirche sehen und das Läuten der Glocken hören. Aber Peter schüttelte den Kopf.
„Diesmal nicht, Bub!“, sagte er. „Ich muss hierbleiben in meinem Kämmerlein, ich darf nicht ausgehen!“
„Weshalb nicht?“, fragte Fridolin, und der alte Mann sah ihn wieder mit einem geheimnisvollen Lächeln an. „Ich muss sehen, ob das Christkindchen mir mein großes Bitten erfüllt.“
„Was hast du es denn gebeten, Peter? Sag es doch!“, rief der Knabe fast ungeduldig.
Der Orgelpeter lächelte wieder, setzte sich auf die Holzbank und lehnte den Kopf an seine Orgel. „Weißt“, sagte er leise, „ich wollt’s dir eigentlich erst hinterher sagen, aber vielleicht schadet’s auch nix, wenn ich vorher davon sprech’: Ich hab das Christkindchen gebeten, einmal zu mir in mein Kämmerlein zu kommen. Ich wollt’s so gern mal genau anschauen“, setzte er in einem halb entschuldigenden Tone hinzu, „und ich mein’, es tut mir schon den Gefallen. Ist ja so gut im vorigen Jahr zu mir gewesen, es wird auch diesmal mir seine Gnad nicht versagen!“ Er hielt inne und sah Fridolin an. Dieser aber vermochte vor Erstaunen nichts zu sagen.
Dann fuhr Peter bewegt fort: „Ich hab ihm so viel zu sagen. Denn ich bin früher ein böser Kerl gewesen und hab mir nicht viel aus der Kirche und den Heiligen gemacht. Da wollt ich denn das Christkind bitten, ein gutes Wort für mich einzulegen …“
Peter schwieg still. Er hatte mehr gesprochen, als seit langer Zeit – jetzt schien er müde zu sein, denn er schloss die Augen. Fridolin aber ging auf den Zehenspitzen aus der Stube und die Treppe hinunter, und erst als er auf der Straße war, dachte er an den Weihnachtsbaum und das Glockengeläut. Dann, als er wieder wie im vorigen Jahr auf einem Prellstein stand und in den Lichterbaum sah, blickte er halb ängstlich um sich, als wenn das Christkind dicht hinter ihm stände. Aber es war alles wie sonst, und als er endlich halb erstarrt nach Hause kam, fand er die Gaben des himmlischen Kindes in so reichem Maße vor, dass er alles vergaß, auch seinen Freund, den Orgelpeter, obgleich dieser ihm doch das meiste gegeben hatte.
Endlich lief er nach oben, mit lauter Stimme nach Peter rufend. Dieser aber antwortete gar nicht, und in seinem Stübchen war alles dunkel. Erst als die Mutter mit Licht kam, sahen sie den alten Mann ruhig und mit gefalteten Händen vor seiner Orgel sitzen. Er hatte ein friedliches Lächeln auf den Lippen und sah so glükklich aus, als sei ihm etwas ganz besonders Schönes passiert. Aber er konnte niemals erzählen, was es gewesen war, denn er war ganz leise und sanft gestorben.
Als Fridolin denselben Abend sich auf sein kleines Lager legte, bedachte er sich erst einen Augenblick und faltete dann die Hände. „Liebes Christkind“, sagte er, „ich danke dir vielmals, dass du den Peter besucht und gleich mitgenommen hast. Ich meinte auch, dass ich was Goldiges durch die Luft fliegen sah, als ich nach Hause kam – das bist du natürlich gewesen. Ich danke dir auch, dass du die Orgel hier gelassen hast, denn ich will gern auf ihr spielen, aber bitte, mach, dass die Engel dem Peter einmal ihre Orgel leihen, damit er doch auch noch Musik machen kann. Und dann wollte ich dich bitten …“ Aber hier fielen dem Fridolin die Augen zu, und er schlief sanft und tief ein. – In der Ferne aber läuteten die Weihnachtsglocken.
Charlotte Niese
Ein Dreikönigsspiel
Der Erste: Wir sind die drei Könige aus dem Morgenland; wir sind gegangen Hand in Hand. Wir brachten Weihrauch und Myrrhen. Ein Sternlein tat uns schön führen.
Die drei: Eia, Christkindlein!
Der Zweite: Und als wir traten in Bethlehems Stall, wir fanden Joseph und die Hirten all, dazu Maria, die Reine, mit einem Heiligenscheine.
Die drei: Eia, Christkindlein!
Der Dritte: Maria wiegte ihr Jesuskind zur Ruh’, und alle Hirtenbuben, die sangen dazu. Sie sangen so selig, sie sangen so süße wie Englein im Paradiese.
Die drei: Eia, Christkindlein!
Wir waren allesamt in den Tod verloren. Hosianna! Heut ist uns der Heiland geboren!
Der Erste: So lieblich ging ihre Weise.
Der Zweite: Maria, die weinte leise.
Der Dritte: Eia, Christkindlein!
Die drei: Nun wollen wir wieder nach Hause geh’n, denn wir haben den heiligen Christ geseh’n. Und wollen verkünden das liebe Kind den Menschen, die noch im Finstern sind; dass sie ihre Sorgen und Sünden all zum Opfer bringen in Bethlehems Stall.
Der Weihnachtstag
Endlich, endlich war der Weihnachtsmorgen da. Marianne leuchtete, und Lotti wischte den letzten Strich aus, den allerletzten! Kaum waren die beiden imstande, sich anzuziehen vor Freude. Und es gab doch noch so viel zu tun. Im Wohnzimmer brannte die Lampe, ringsum auf Tischen und Stühlen war eine prächtige Unordnung von Schuhen, Spielzeug und Kleidern, von Körben mit Äpfeln, Kuchen und allerlei anderen Esswaren. Mama richtete Pakete für verschiedene Leute, die sie beschenken wollte. So bekam Theodor Hahn ein paar neue Stiefel, ein Märchenbuch und eine große Tüte voll Backwerk. Für Mischa Zritschek, der immer noch alles Schuhwerk der Familie Turnach sohlte und flickte, hatte Mama Taschentücher und Schreibzeug, für seine Mutter Wollenstoff und Kaffee bereit.
„Guten Morgen, Mama! Mama, es ist Weihnachten!“, kamen die Kinder hereingesprungen und machten sich eilig auch an ihre Pakete. Das war die letzte schöne Arbeit! Marianne hatte für ihre Geschenke weißes Seidenpapier mit rosa Bändchen, Lottis Sachen wurden in Blau gewickelt mit silberner Schnur. Hans aber brachte hellgrüne Bogen und steckte auf alle seine Päckchen kleine Stechpalmenzweige voll roter Beeren, die er von Balbines Bruder, dem Gärtner, erhalten hatte.
Jedes der Kinder war in einer Ecke beschäftigt und schrie laut auf, wenn ein anderes in die Nähe kam. Lotti legte sich immer mit der ganzen Länge auf ihre Herrlichkeiten, um sie zu verbergen.
Der kleine Werner erschien nun ebenfalls und lief mit seinen dicken grauen Springerlein von einem zum andern, dass man ihm auch schöne Pakete daraus mache, was die gute Marianne dann tat.
Gegen Mittag wurde es immer geheimnisvoller im Hause. Mama schloss die Wohnstube ab, und ins Schlafzimmer durfte man auch nicht mehr. Man aß droben in der blauen Stube, doch niemand hatte Zeit, lange am Tisch zu sitzen. Die Kinder wurden hinaufgeschickt auf den Boden, wo sie oft nach dem Essen spielten, aber heute hielten sie es nicht aus dort droben.
„Geht hinunter zu Papa“, sagte Mama, „und fragt, ob er Zeit hat, mit euch spazieren zu gehen!“
„Ja, Mama, ja! Und wenn wir heimkommen, ist Weihnacht da!“
Jedes Jahr machte Papa mit den Kindern vor der Bescherung einen weiten Spaziergang hinauf durch den Wald und dann hinunter in die Seeweid zu Frau Völklein. Es mochte noch so kalt sein, dieser Spaziergang wurde gemacht, und die Kinder sagten, er sei der allerschönste im ganzen Jahr.
Als die vier Kinder – Werner war diesmal auch dabei – mit Papa das Haus verließen, kam Theodor Hahn mit glücklichem Gesicht über den Kornplatz, um sein Paket bei Frau Turnach zu holen.
„Aber noch nicht aufmachen, gelt?“, mahnte ihn Marianne.
„Nein, erst am Abend!“, versicherte Theodor. „Ich bekomme ein Christbäumchen!“
Unter der Türe der Apotheke standen Rudolf und Sylvia.
„Freut ihr euch auch so schrecklich?“, rief ihnen Hans zu.
„Ja, furchtbar!“, antwortete Sylvia, die mit dem ganzen Gesicht lachte. „Bei uns kommt das Christkind schon um fünf Uhr!“
Auf der Brücke liefen die Leute rasch und geschäftig aneinander vorbei, Frauen mit Körben, Männer und Knaben mit grünen Christbäumen auf den Schultern, neu lackierten Puppenwagen oder Schlitten. Jedes Mal wenn Lotti so etwas Ahnungsvolles erblickte, stampfte sie vor Vergnügen mit beiden Füßen.
„Die friert auch“, sagte ein Bäcker an der Kramgasse, der mit einem Blech voll frisch gebackener Stollen aus dem Laden trat.
„Nein, ich freu mich bloß so!“, rief Lotti.
Als man aus der Stadt heraus auf die Höhe kam, wurde es stiller. In dem tiefen Schnee sah man nur einzelne Fußstapfen. Es war das prächtigste Weihnachtswetter. Am Himmel zogen leichte weiße Wolken daher, aus denen der Schnee in feinen Flocken oder einzelnen Sternchen herunterschwebte. Dazwischen war wieder der blaue Himmel sichtbar, und die Sonne schien auf die beschneiten Abhänge. Die ganze Luft war wie Silber.
Am Waldeingang standen hohe Tannen, deren Äste sich unter der Last des Schnees senkten.
„Papa“, sagte Marianne, „wie das schön ist, durch den prächtigen Wald zu gehen und dabei an das andere Schöne zu denken, das am Abend kommt!“
Lotti war ein Stück voraus und sagte mit lauter Stimme ihr Weihnachtslied in die glitzernde Luft hinaus.
In den Tannen piepten die Meisen. Auf einem Ast saß ein Eichhörnchen und guckte neugierig zu den Kindern herunter. Werner, der so ein Schwanztier, wie er es nannte, noch nie gesehen hatte, hatte seine helle Freude.
„Komm! Komm! Ich schenk dir etwas!“, rief er und streckte ein Anisspringerlein zu der Tanne hinauf.
Papa aber zog seine Uhr. „Vorwärts, Kinder! In drei Stunden brennt schon der Christbaum!“
Da ließen die Kinder Meisen und Eichhörnchen und fingen auf einmal an so zu eilen, dass Papa kaum nachkam und Werner Trab laufen musste.
Die Seeweid lag einsam und verschneit. Aber als Frau Völklein die Turnachkinder die Treppe heraufstampfen hörte, kam sie aus ihrer Türe.
„Grüß Gott, grüß Gott, Kinderlein! So kalt und in dem tiefen Schnee! Ja, und das Wernermännchen auch! Mit ganz rotem Näschen! Gewiss habt ihr nasse Füße bekommen! Grit soll euch die warmen Schuhe bringen!“
Die Kinder zogen bereitwillig ihre Schnürstiefel aus. Sie wussten das vom vergangenen Jahr. Es war sehr lustig, in den viel zu weiten Hausschuhen herumzufahren wie in Kähnen. Dann aber setzte man sich an den Tisch zu einem warmen Tee und Bretzeln, und es schmeckte gar prächtig nach dem langen Spaziergang. Der Tee bei Frau Völklein gehörte durchaus zu den Weihnachtsfreuden der Turnachkinder. Fritz war nicht da, aber er wurde eingeladen, sich an einem der Feiertage die Bescherung anzusehen. Die Bescherung! Die Kinder standen vom Tisch auf. Sie konnten heute nirgends lang ruhig bleiben, sie schifften in ihren Hausschuhen auf den Gang hinaus zum Fenster.
Unter weißer Decke lag der Garten, die Seemauer und der Landungssteg, das Schiff war aufs Ufer gezogen unter ein Bretterdach. Alles sah aus, als ob es schlafe in dem tiefen Schnee. In der Küche saß Jakob bei seinem Abendbrot.
„Jakob, heut ist Weihnacht!“, riefen die Kinder.
„Ja“, sagte er und steckte das letzte Stück Brot in den Mund.
„Hast du dich auch so schrecklich gefreut, als du ein Bub warst?“
„Ja, ja, schon. Christbäume waren jedoch bei uns im Dorf nicht Brauch.“
„Aber du hast doch etwas bekommen? Was hast du bekommen?“
Jakob besann sich. „Eine kleine Stadt hat’s einmal gegeben zum Aufstellen. Und dann jedes Jahr ein paar Winterstrümpfe und einen großen Birnenkuchen.“ Er klappte sein Taschenmesser zusammen.
„Du, Jakob“, fing Lotti die Unterhaltung wieder an, „ich finde es schrecklich traurig, eine Kuh zu sein.“
„Lotti, wie kommst du denn darauf!“, riefen Hans und Marianne.
„Ja, ich meine es im Ernst. Jetzt stehen die Kühe im Stall und wissen gar nichts von Weihnacht. Und heut Abend bekommen sie bloß Heu, wie wenn es ein gewöhnlicher Tag wäre.“
„Das ist auch am besten für sie“, versetzte Jakob. „Und außerdem – etwas haben die Kühe vielleicht doch. Sie hatten vor acht Tagen die Thomasnacht.“
„Die Thomasnacht?“, fragten die Kinder. „Was ist in der Thomasnacht?“
Jakob zögerte ein wenig. „Bei uns daheim sagen manche Leute, in der Thomasnacht können die Tiere sprechen.“
„Jakob“, rief Hans. „Das glaubst du aber doch nicht!“
„Nein, natürlich – eigentlich nicht. Aber für die Thomasnacht richt’ ich den Stall doch immer besonders schön her – man weiß ja nicht – und ich möcht’s den Kühen gönnen, wenn sie auch einmal im Jahr das Maul auftun dürften!“
„Ja, das wäre nett für sie“, rief Lotti. „Und es könnte doch wahr sein! Jakob, geh in der Thomasnacht einmal in den Stall und hör zu!“
„Nein, das darf man nicht! Der Großvater hat immer gesagt, er glaube, der heilige Thomas gehe dann durch die Ställe und höre, was die Tiere zu erzählen haben, und wenn sie klagen, dass man schlecht mit ihnen umgehe, so sage der heilige Thomas es nachher dem lieben Herrgott.“
„Und dann?“, fragte Lotti.
Aber nun brachte Grit die Stiefel, die sie mit heißem Sand getrocknet hatte. Eilig und freudig schlüpften die Kinder hinein.
Als man unter den kahlen beschneiten Birnbäumen den Weg hinaufging, fing es an zu dunkeln. Droben an der Straße brannten schon die Laternen.
Werner marschierte tapfer neben Papa her und hüpfte von Zeit zu Zeit an ihm auf: „Papa, ich schenk dir auch etwas!“
„Ja, wenn ich doch wüsste, was das ist!“, sagte Papa.
„Tu raten, Papa!“
Also fing der gute Papa an zu raten: „Einen Schlafrock? Einen Zylinderhut? Eine Kutsche? – Aha, jetzt weiß ich: Einen Luftballon?“
Und der kleine Bursche lachte jedes Mal laut auf: „Nein, Papa! Nein!“ Auf diese Weise kam er vorwärts, ohne etwas Müdigkeit und Kälte zu fühlen.
Die drei Großen gingen hinterdrein.
„Was ist denn?“, rief Papa zurück, als er einen lauten Schrei hörte.
„Nichts, Papa!“, antwortete Marianne. „Wir mussten bloß ein bisschen schreien, weil wir es fast nicht mehr aushalten!“
Zu Hause saß Großmama schon in der blauen Stube. Onkel Alfred war auch da und ging auf und ab.
„Gelt, Onkel, man kann es fast nicht erwarten“, sagte Lotti. „Um sechs Uhr läutet’s. Wie lang dauert das noch?“
„49 Minuten 37 und eine halbe Sekunde“, sagte der Onkel auf die Uhr schauend. Dann aber setzte er sich ans Klavier und spielte schöne Akkorde. Es klang, als ob Weihnachtsglocken läuteten.
Endlich kam auch Mama mit dem Schwesterlein auf dem Arm und Papa.
Nun sollte Marianne mit ihrem Lied beginnen. Sie drückte die Hände einen Augenblick ineinander und spürte ihr Herz klopfen. Es war so feierlich, wie alle da still im Kreis saßen. Aber dann fing sie an: „Du lieber, heil’ger, frommer Christ …“ Sie sprach die Verse gut und ohne Stocken.
Lotti auch. Nur einmal mahnte Mama leise: „Nicht so schnell, Lotti!“
Als Hans das schöne Weihnachtsevangelium von den Hirten und dem Lobgesang der Engel aufgesagt hatte, stimmte Onkel Alfred am Klavier das liebe alte Lied an:
„Oh du fröhliche, oh du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit …“
Alle sangen mit. Papas und Onkel Alfreds Stimmen klangen wie Orgeltöne.
Dann aber vernahm man plötzlich einen andern Ton: Das helle Weihnachtsglöcklein läutete unten, so stark es vermochte.
„Mama, jetzt – jetzt!“
Mama nickte lächelnd. „Ja, jetzt!“
Die Kinder stürzten hinaus und die Treppe hinunter. Die Türe des Weihnachtszimmers war weit offen. Einen Augenblick blieben alle vier wie geblendet stehen. Strahlend stand der hohe Christbaum da mit seinen Lichtern, seinen farbigen Kugeln, goldenen Nüssen und dem funkelnden Flitter, der über den Ästen hing. So vertraut und doch so zauberhaft, so unbegreiflich schön!
Dann aber machte sich Werner von Mariannes Hand los. „Oh, oh, Kühe!“, rief er in höchstem Jubel und lief in die Ecke, wo man auf einem niedrigen Tischchen seine Sachen aufgebaut hatte.
Und nun war der Bann gebrochen. Hans erblickte seinen Platz rechts vom Christbaum. „Oh, oh!“, rief auch er und zog einen Schlitten heraus, einen festen Schlitten aus schönem glattem Holz, genau wie er sich ihn gewünscht hatte! „Marianne, sieh, wie lang! Da können wir zu dritt sitzen!“
Doch Marianne hörte nicht; sie hatte schon ihre Schlittschuhe in der Hand, ein Paar prächtige Schlittschuhe, ganz wie die von ihrer Freundin Lily! Marianne wollte sich gleich hinsetzen, um sie an ihrem Fuß zu messen, aber ihre Augen überflogen den Tisch und erblickten neben allerlei Paketen einen Muff und Pelzkragen, und dahinter stand die Puppenstube neu hergerichtet, mit weißen Vorhängen und grünem Tischteppich, drei neuen Puppenkindern und einem Papa in brauner Hausjoppe mit einer Zeitung, und am Fenster war ein Blumentisch. Nein, diese Seligkeit!
„Lotti, sieh doch!“ Lotti kniete indessen in lautem Entzücken vor einer Wiege, in der ein Wickelkind schlief, mit blonden Härchen und weißem Kittelchen.
„Es macht die Augen auf und zu! Oh, du Schatz!“, rief sie und küsste die Puppe und sah dann hinten über der Wiege den Kramladen! Frisch gestrichen und lockend stand er da mit Quittenwürstchen und Schokoladenschinken, mit Glasbüchsen voll Zuckererbsen, mit kleinen Brotlaiben und einer Menge weißer Tüten. Das Wickelkind im Arm, machte sich Lotti jauchzend an den Laden.
Am lautesten aber ging es in Werners Ecke her. Er kreischte geradezu vor Freude über seine Kühe und riss an Onkel Alfred, bis dieser sich zu ihm auf den Boden setzte, um die Tiere anzusehen.
„Die heißt – Dachs!“, schrie Werner. „Und die ist die böse, die heißt Bär! Und das ist der Bless!“
Dann lief er hinter den Ofen und erklärte dort dem Pferd, dass es Platz machen müsse, weil jetzt Kühe kommen. Es war auch ein Heubündel da. Werner hatte so zu tun, dass er die Schachtel mit dem Dorf und das Bilderbuch noch gar nicht betrachten konnte.
Hans wusste ebenfalls nicht, wohin sich wenden. Da war ein Buch, das hieß „Das Wunderland der Pyramiden“ und hatte eine Menge Bilder von Kriegern, Denkmälern, seltsamen Göttern und Felsengräbern. Das andere Buch trug den Titel „Sigismund Rüstig“.
„Marianne, das ist ja die prächtige Geschichte, aus der Papa uns schon erzählt hat!“
Aber im selben Augenblick rief Marianne: „Hans, Lotti! Seht doch den Christbaum wieder an, wie schön er ist!“
Ja, wenn man nur alles zugleich hätte bewundern können! Das Schwesterlein nahm sich am meisten Zeit für den Christbaum. Auf Mamas Arm guckte es mit weit offenen Augen unverwandt in die Lichter und fuhr mit den kleinen Fäusten auf und ab vor Erstaunen und Freude.
Balbine, Sophie und Ulrich waren auch hinzugetreten, und da sah man erst, dass Ulrich etwas in der Hand hielt, ein Geschenk für die Kinder, ein Schiff, das er an den Abenden und Sonntagen aus Holz geschnitzt hatte.
„Nein, so etwas Feines, Ulrich!“, jubelten die Kinder.
Es war weiß, blau und rot gestrichen und hatte ein Segel und ein bewegliches Steuerruder. Das Ganze war so kunstvoll und sauber gemacht, dass auch die Großen es bewunderten.
„Ulrich, Sie sind ja ein Schiffbauer erster Güte“, sagte Onkel Alfred. „Sie gehören auf eine Werft und nicht in die Garnkammer!“
Ulrich lachte verlegen. Er hatte auch einen Gabentisch und freute sich besonders über Lottis Pulswärmer. Aber vergnügt sah er immer wieder hinüber zu Hans, der das schöne Schiff auf seinen Tisch stellte, mitten unter die Herrlichkeiten, die noch gar nicht alle entdeckt waren. Da gab es ein Taschenmesser, warme Winterhandschuhe, ein Reißzeug, mit dunkelblauem Samt ausgeschlagen, einen Rucksack mit allerlei nützlichen Nebentaschen. Es war fast zu viel. Hans zog Marianne mit Gewalt herüber, dass sie ihm bewundern helfe.
„Ja, Hans, prachtvoll! Reizend!“, stimmte Marianne ein. „Aber komm, sieh meinen Malkasten an! Bitte, nur den! Es sind fünfzehn Farben und vier Pinsel!“
Hans besichtigte den Malkasten. Als er aber gleich wieder zu seiner Bescherung hinüberlief, holte sich Marianne Balbine, damit sie helfe, das Kommödchen von Großmama zu betrachten und die hübsche Schürze, die Zopfbänder, die Gamaschen und das Buch, das „Roland und Elisabeth“ hieß und gewiss wunderschön zu lesen war.
Lotti hatte sich Ulrichs bemächtigt. Er musste das Wickelkind besehen, die gefüllte Federschachtel, den kleinen Pumpbrunnen, den Baukasten und den Regenschirm mit einer Troddel wie der von Mama!
Der fröhliche Lärm wurde immer größer, da nun Papa und Mama, Großmama und Onkel Alfred auch an ihre Tische getreten waren und mit Ausrufen der Freude und Überraschung ihre Geschenke entgegennahmen. Die Kinder liefen von einem zum andern und standen gespannt dabei, wenn ihre kleinen Pakete aufgemacht wurden.
„Alles Blaue mit Silberschnur ist also von mir!“, verkündete Lotti.
Mama wickelte das Rumpelstilzchen aus. Großmama war entzückt über Hansens rosa Pappschachtel, in der Mariannes Blumenkarten lagen. Papa aber entdekkte Werners großartiges Geschenk.
„Gelt, Papa, das hast du nicht erraten können!“, triumphierte der Kleine, und ruhte nicht, bis der arme Papa ein Stück von dem dicken grauen Springerlein versuchte. Dann machte Onkel Alfred mit vielen Umständen Mariannes und Lottis Päckchen auf und hob behutsam den Tintenwischer heraus.
„Toll!“
„Für die Tinte!“, sagte Lotti und sah den Onkel stolz an.
„Tinte –“, wehrte dieser. „Nein, dafür ist dieses Kunstwerk zu kostbar! Höchstens meine Tränen wische ich damit ab.“
„Ach, Onkel, du weinst ja nie!“, riefen Marianne und Lotti belustigt.
„Nie! Wo ihr mir grade jetzt Tränen der Freude und Rührung entlockt!“
Und Onkel Alfred fuhr sich mit dem Tintenwischer über die Augen, dann aber befestigte er ihn an seinem Knopfloch und erklärte, er werde ihn als Verdienstorden tragen.
In dem Getümmel schoss auch noch Schnauzel hin und her, aufgeregt durch die Lichter, den Lärm und die Wurst, die er geschenkt bekommen hatte. Papa hatte ihm die Hälfte davon gegeben und die andere in die Höhe gehalten.
„Du begreifst, Schnauzel“, hatte er gesagt, „wenn du sie jetzt frisst, so hast du morgen nichts mehr.“
„Wau!“, bellte Schnauzel und wedelte heftig mit dem kurzen Schwanze, was jedenfalls heißen sollte:
Ja, ich begreife, aber ich will sie trotzdem gern heut noch! Worauf Papa ihm das zweite Stück aushändigte, damit auch er an diesem Abend seine ganze Freude habe.
Die gute Mama und Sophie machten es möglich, dass man im Weihnachtszimmer zu Nacht essen konnte. Man ließ sich’s gut schmecken, aber das Beste war doch, dass man hinter sich alle die wunderschönen Sachen wusste. Ja, man durfte, was sonst verboten war, mitten vom Essen weglaufen, zur Puppenstube, zum Schlitten und Schiff, zum Wickelkind, zu den Kühen und zu den Körbchen mit Backwerk, die auf den Gabentischen standen und aus denen man sich ein paar recht feine Stücke zum Nachtisch aussuchte.
Schrecklich aber war es, als Mama anfing, vom Schlafengehen zu sprechen.
„Mama, wenn man doch die Betten da heraus zum Christbaum stellen könnte!“, rief Lotti.
Zum Glück hielt das Gutnachtsagen und das Danken die Kinder noch ein Weilchen im Zimmer zurück. Man hatte für soviel zu danken!
Werner lief auf Papa zu. „Papa, hast du dem Christkind gesagt, dass es mir die Kühe schenken soll?“
„Ja, Wernermann.“
„Dann geb’ ich dir für jede einen Kuss!“
Und der Kleine rannte eifrig hin und her zwischen Papa und seinen Kühen, damit es nur ja richtig werde mit den Küssen.
Er wäre nie fertig geworden, wenn Sophie ihn nicht endlich gepackt hätte. Glücklich erwischte er aber noch den „Dachs“ und behielt ihn fest im Arm bis in den Schlaf hinein. Lotti stellte ihr „Schatzkind“ mit der Wiege neben ihr Bett. Hans legte sein „Land der Pyramiden“ und den „Sigismund Rüstig“ unter das Kopfkissen, damit er auch im Schlaf die beiden Bücher spüre, und Marianne hängte ihre Schlittschuhe an den Bettpfosten, wo man sie bei jeder Bewegung klirren hören konnte.
Nach der Spannung und der Freude des Tages schlummerten die Kinder bald ein. Aber in der Nacht, als es im Hause ganz still geworden war, erwachte Marianne, und es überkam sie eine unbezwingliche Lust nach dem Weihnachtszimmer.
„Lotti“, flüsterte sie, „Lotti, ich muss hinübergehen und den Christbaum ansehen!“
„Ich auch“, sagte Lotti, und beide stiegen aus ihren Betten und schlüpften hinaus ins Wohnzimmer.
Es war nicht ganz dunkel. Das Laternenlicht vom Kornplatz fiel auf den Christbaum, von dem ein feiner Tannenduft ausströmte. Zwischen den Zweigen leuchteten die vergoldeten Nüsse und die kleinen weißen Zuckerherzen. Die feinen Silberfäden, die über den Ästen hingen, zitterten leise. Hoch oben an der Spitze des Christbaums aber glänzte der große Stern.
Marianne und Lotti hielten sich an der Hand.
„Marianne“, flüsterte Lotti. „Es ist ganz sicher, dass es ein Christkind gibt. Wer könnte sonst so etwas Wundervolles wie einen Christbaum ausdenken!“
„Kinder, Kinder!“, rief jetzt auf einmal Mama aus ihrem Zimmer. „Meint ihr, ich hätte euch nicht gehört? Seid vernünftig und geht nun schnell in euere warmen Betten!“
Mamas Stimme tönte aber sehr freundlich und fröhlich. Gewiss war Mama einst als Kind auch hinausgehuscht ins Weihnachtszimmer, um zu sehen, wie schön und geheimnisvoll der Christbaum bei Nacht war.
Ida Bindschedler
Der allererste Weihnachtsbaum
Der Weihnachtsmann ging durch den Wald. Er war ärgerlich. Sein weißer Spitz, der sonst immer lustig bellend vor ihm herlief, merkte das und schlich hinter seinem Herrn mit eingezogener Rute her. Er hatte nämlich nicht mehr die rechte Freude an seiner Tätigkeit.
Es war alle Jahre dasselbe. Es war kein Schwung in der Sache. Spielzeug und Esswaren, das war auf die Dauer nichts. Die Kinder freuten sich wohl darüber, aber quieken sollten sie und jubeln und singen, so wollte er es, das taten sie aber nur selten.
Den ganzen Dezembermonat hatte der Weihnachtsmann schon darüber nachgegrübelt, was er wohl Neues erfinden könne, um einmal wieder eine rechte Weihnachtsfreude in die Kinderwelt zu bringen, eine Weihnachtsfreude, an der auch die Großen teilnehmen würden. Kostbarkeiten durften es auch nicht sein, denn er hatte nur so und so viel auszugeben und mehr nicht.
So stapfte er denn auch durch den verschneiten Wald, bis er auf dem Kreuzweg war. Dort wollte er das Christkindchen treffen. Mit dem beriet er sich nämlich immer über die Verteilung der Gaben.
Schon von weitem sah er, dass das Christkindchen da war, denn ein heller Schein war dort. Das Christkindchen hatte ein langes weißes Pelzkleidchen an und lachte über das ganze Gesicht. Rundherum lagen große Bündel Kleeheu, Bohnenstiegen, Espen- und Weidenzweige, und daran taten sich die hungrigen Hirsche und Rehe und Hasen gütlich. Sogar für die Sauen gab es etwas: Kastanien, Eicheln und Rüben.
Der Weihnachtsmann nahm seinen Wolkenschieber ab und bot dem Christkindchen die Tageszeit.
„Na, Alterchen, wie geht’s?“, fragte das Christkind. „Hast wohl schlechte Laune?“ Dabei hakte es den Alten unter und ging mit ihm. Hinter ihnen trabte der kleine Spitz, aber er sah gar nicht mehr betrübt aus und hielt seinen Schwanz kühn in die Luft.
„Ja“, sagte der Weihnachtsmann, „die ganze Sache macht mir so recht keinen Spaß mehr. Liegt es am Alter oder an sonst was, ich weiß nicht. Das mit den Pfefferkuchen und den Äpfeln und Nüssen, das ist nichts mehr. Das essen sie auf, und dann ist das Fest vorbei. Man müsste etwas Neues erfinden, etwas, das nicht zum Essen und nicht zum Spielen ist, aber wobei alt und jung singt und lacht und fröhlich wird.“
Das Christkindchen nickte und machte ein nachdenkliches Gesicht, dann sagte es: „Da hast du Recht, Alter, mir ist das auch schon aufgefallen. Ich habe daran auch schon gedacht, aber das ist nicht so leicht.“
„Das ist es ja gerade“, knurrte der Weihnachtsmann, „ich bin zu alt und zu dumm dazu. Ich habe schon richtiges Kopfweh vom vielen Nachdenken, und es fällt mir nichts Vernünftiges ein. Wenn es so weitergeht, schläft allmählich die ganze Sache ein, und es wird ein Fest wie alle anderen, von dem die Menschen dann weiter nichts haben als Faulenzen, Essen und Trinken.“
Nachdenklich gingen beide durch den weißen Winterwald, der Weihnachtsmann mit brummigem, das Christkindchen mit nachdenklichem Gesicht. Es war so still im Wald, kein Zweig rührte sich, nur wenn die Eule sich auf einen Ast setzte, fiel ein Stück Schneebehang mit halblautem Ton herab. So kamen die beiden, den Spitz hinter sich, aus dem hohen Holz auf einen alten Kahlschlag, auf dem große und kleine Tannen standen. Das sah wunderschön aus. Der Mond schien hell und klar, alle Sterne leuchteten, der Schnee sah aus wie Silber, und die Tannen standen darin, schwarz und weiß, dass es eine Pracht war. Eine fünf Fuß hohe Tanne, die allein im Vordergrund stand, sah besonders reizend aus. Sie war regelmäßig gewachsen, hatte auf jedem Zweig einen Schneestreifen, an den Zweigspitzen kleine Eiszapfen, und glitzerte und flimmerte nur so im Mondenschein.
Das Christkindchen ließ den Arm des Weihnachtsmannes los, stieß den Alten an, zeigte auf die Tanne und sagte: „Ist das nicht wunderhübsch?“
„Ja“, sagte der Alte, „aber was hilft mir das?“
„Gib ein paar Äpfel her“, sagte das Christkindchen, „ich habe einen Gedanken.“
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?
Weitere E-Books rund um Weihnachten
Pleiten, Pech und Tannen
eISBN 978-3-475-54359-3 (epub)
Die besinnliche Jahreszeit mit Wolfgang Schierlitz – garantiert ein lustiges Ereignis! Mit viel Witz und Humor erzählt er im ersten Band seiner Weihnachtsgeschichten von abenteuerlichen Christbaumkäufen, spektakulären Krippenspielen und digitalen Wunschzetteln.
Das Buch stimmt auf Weihnachten ein und erheitert auch das gestresste Gemüt. Für alle, die Weihnachten lieben, und jene, die dieser Zeit auch mit einem Augenzwinkern entgegensehen.
O Pannenbaum!
eISBN 978-3-475-54513-9 (epub)
Der Nachfolger von »Pleiten, Pech und Tannen«: Wolfgang Schierlitz zeigt uns, wie es rund um Weihnachten so zugehen kann! Katastrophen und Pannen, urkomische Missgeschicke und amüsante Zwischenfälle säumen den Weg zum Fest. In seinem unverwechselbaren Stil erzählt er von etwas sonderbaren Feuerwehreinsätzen, völlig verrücktem Christbaumschmuck und der obligatorischen Beziehungskrise während der Feiertage.
Mit einem gehörigen Augenzwinkern stimmt er uns erneut auf die schönste Zeit des Jahres ein und stellt fest, dass niemand perfekt ist.
Christmond
eISBN 978-3-475-54380-7 (epub)
Christmond wurde einst der Dezember genannt. Alfred Landmesser entdeckt diesen besonderen Namen für eine besondere Zeit neu. In vielen Kurzgeschichten entführt er uns auf eine Reise durch die Weihnachtszeit und erzählt, was rund um das Weihnachtsfest alles passieren kann.
Zarte Liebesbande werden geschmiedet, das Jesuskind verschwindet aus der Krippe und der geliebte Hund Felix kehrt zu seinem Frauchen zurück. Alfred Landmesser blickt auch in die Vergangenheit und wendet sich ernsten Themen zu. So gelingt ihm eine einstimmende Sammlung besinnlicher, aber auch humorvoller Geschichten über diesen wunderbaren Monat, den Christmond.
Weihnachtsstern
eISBN 978-3-475-54379-1 (epub)
Hans-Peter Schneider entdeckt die unterschiedlichen Facetten des Weihnachtsfestes neu und bringt sie in besinnlichen, heiteren und nachdenklichen Geschichten und Gedichten zum Ausdruck. Er erzählt von der kleinen Marie, die davon überzeugt ist, dass ihr Opa nur mit Sauerkraut und Bratwurst ein schönes Weihnachten haben kann – selbst wenn er schon im Himmel ist. Von einem Vater, der die Weihnachtsgans beim Metzger vergessen hat und es trotzdem schafft, seiner Familie ein ganz besonderes Fest zu bereiten. Dass nicht jeder in Wohlstand lebt, zeigt der Autor in der Geschichte des kleinen Florian, der stehlen muss, um seinem Vater ein Geschenk machen zu können. Lustig, berührend und einstimmend – dieses Buch bringt uns den Wert von Weihnachten nahe.
Zöpfls Weihnachtsbuch
eISBN 978-3-475-54550-4 (epub)
Jetzt, wenn die Glöckerln und d’Markln klingerln, de staadn Weisn vom Lautsprecher dringerln, Reklamechöre weihnachtlich singerln, de silbernen Kugerln und glanzerlten Ringerln, de rauschgoldgwanderten, lieblichen Engerln inmitten der duftenden Wurstwaren hängerln, se d’Leut in d’volle U-Bahn neizwängerln, konns sei, dass mia oft nimmer vor Geschenkerln and Geschenk von jener Heil’gen Nacht denkerln.
Mein großes Weihnachtsbuch
eISBN 978-3-475-54551-1 (epub)
Weihnachten – das ist das Fest der Geburt des Erlösers und ein Anlass, uns wieder auf unser Verhältnis zu Gott, zum Nächsten und zu uns selbst zu besinnen. Aber stimmt das heute wirklich noch, ist es nicht längst zu einem Fest von Konsum, Lärm und Hektik verkommen?
Der vielseitige bayerische Schriftsteller Helmut Zöpfl hat sich in seinen zahlreichen Prosa- und Gedichtbeiträgen, unterhaltsamen Geschichten und Szenen zum Thema Gedanken gemacht. Er findet viele nachdenkliche und viele ermutigende, aber auch kritische Worte, die doch mit ihrem augenzwinkernden Humor immer versöhnlich bleiben.
Ein ausgezeichnetes Lesefutter für lange Winterabende!
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com