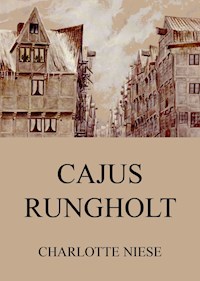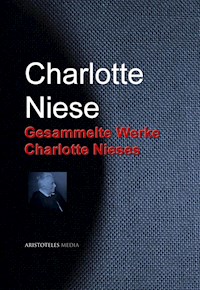Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Noch einmal erzähle mir vom grimmen Waldstein, vom Schwedenkönig Gustav Adolf und von der Schlacht, in der du mitgekämpft!« rief eine junge bittende Stimme, und eine sonnverbrannte kräftige Knabenhand legte sich schmeichelnd einem ältlichen Manne auf die Schulter. Der Angeredete, der auf einem rohbehauenen Steinbänkchen saß und mit der Ausbesserung einer alten Wolljacke beschäftigt war, schüttelte den kurzgeschorenen Kopf. »Geht nicht, Junkerlein!« sagte er kurz; »wißt Ihr doch selbst, daß die edle Frau mir bereits zweimal zehn Peitschenhiebe hat verabreichen lassen, weil ich mit Euch gar zu umständlich gesprochen und an den Schweden mancherlei ausgesetzt habe, was Eure Mutter in Harnisch brachte. Denn ob sie schon aus mecklenburgischem Hause ist, liebt sie doch die schwedischen Völker, als wären es ihre Brüder.« »Weshalb tut sie das, Hinnerk?« »Weiß ich's, junger Herr? Die edle Freifrau gönnt mir nur das Wort, wenn sie mich schilt. Aber geht, Junker Kai! Sie möchte Euch hier in meiner Nähe erblicken, und dann muß mein alter Rücken für Eure Neugier büßen.« Der Junker ballte zornig die Hand. »Bei meiner Seele, Hinnerk, wenn Holleby erst mein ist, werde ich dich niemals schlagen lassen!« Der Knecht pfiff leise vor sich hin, und über seine wetterharten Züge flog ein gutmütiges Lächeln. »Ihr habt ein gutes Herz, Junker Kai, aber wenn Ihr Herr über Holleby sein werdet, dann seid Ihr stolz und herrisch ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Junker Kai
von
Charlotte Niese
idb
ISBN 9783962243593
I.
»Noch einmal erzähle mir vom grimmen Waldstein, vom Schwedenkönig Gustav Adolf und von der Schlacht, in der du mitgekämpft!« rief eine junge bittende Stimme, und eine sonnverbrannte kräftige Knabenhand legte sich schmeichelnd einem ältlichen Manne auf die Schulter. Der Angeredete, der auf einem rohbehauenen Steinbänkchen saß und mit der Ausbesserung einer alten Wolljacke beschäftigt war, schüttelte den kurzgeschorenen Kopf.
»Geht nicht, Junkerlein!« sagte er kurz; »wißt Ihr doch selbst, daß die edle Frau mir bereits zweimal zehn Peitschenhiebe hat verabreichen lassen, weil ich mit Euch gar zu umständlich gesprochen und an den Schweden mancherlei ausgesetzt habe, was Eure Mutter in Harnisch brachte. Denn ob sie schon aus mecklenburgischem Hause ist, liebt sie doch die schwedischen Völker, als wären es ihre Brüder.«
»Weshalb tut sie das, Hinnerk?«
»Weiß ich's, junger Herr? Die edle Freifrau gönnt mir nur das Wort, wenn sie mich schilt. Aber geht, Junker Kai! Sie möchte Euch hier in meiner Nähe erblicken, und dann muß mein alter Rücken für Eure Neugier büßen.«
Der Junker ballte zornig die Hand.
»Bei meiner Seele, Hinnerk, wenn Holleby erst mein ist, werde ich dich niemals schlagen lassen!«
Der Knecht pfiff leise vor sich hin, und über seine wetterharten Züge flog ein gutmütiges Lächeln.
»Ihr habt ein gutes Herz, Junker Kai, aber wenn Ihr Herr über Holleby sein werdet, dann seid Ihr stolz und herrisch wie die andern Edelleute. Das liegt euch Großen im Blute: ihr müßt schlagen, und das Volk muß den Nacken beugen. Mir will freilich das Bücken nicht schmecken; wir von Fehmarn sind freigeboren und kennen keine Edelleute über uns. Daher werde ich wohl bald in meine Heimat reisen und euch allen Valet sagen!«
Kai faßte den Arm des Knechtes mit festem Griff.
»Das darfst du nicht!« rief er fast angstvoll. »Bedenke, was der Vater sagen wird, wenn er kommt und dich nicht hier findet! Was willst du auf Fehmarn? Hast du mir nicht selbst gesagt, daß dies Inselein flach und häßlich ist? Kein Baum wächst dort, seit König Erich den Wald abgebrannt hat. Bleib doch auf unserm schönen Seeland, bei unseren Buchenwäldern! Du wirst ja Heimweh nach unserem Lande bekommen!«
»Glaubt Ihr?« fragte Hinnerk halb spöttisch. »Was gehen mich die Buchenwälder an, wenn ich sie nicht durchschreiten kann, ohne stolzen Herren zu begegnen, die mich mit der Reitpeitsche schlagen, sobald ich ihnen nicht weit genug ausbiege, und die mich in den Turm werfen lassen, wenn ich mir ein armseliges Stück Wild in dem herrlichen Walde fange? Nein, junger Herr, für euch Junker mag die Insel Seeland ein gelobtes Land sein – für freie Bauern gibt's bessere Plätze, und daher sage ich Euch noch einmal, Junker, wundert Euch nicht, wenn ich auf mein kahles Eiland gehe. Aber kommt Ihr einmal nach Holstein, so segelt über den Sund und besucht mich. Vielleicht findet Ihr auch Gefallen an meiner Heimat. Nun geht aber, Junker. Vorhin sah ich ein dunkles Gewand hinter der Dornenhecke; es war wohl die Frau Rungholt, die stets ein scharfes Auge über uns offen hält. Da ist sie wieder! Duckt Euch hinter den Steinwall! O weh, es ist zu spät!«
»Ja, es ist zu spät, alter Sünder!« sagte eine scharfe Stimme, und eine hagere Frauengestalt stand vor dem Knecht, der sich erhoben hatte und demütig seine Kappe vom Kopfe riß. »Ich habe deine gottlosen Reden angehört, und ich werde dir zeigen, daß du noch nicht auf deinem elenden Eilande bist, wo du nach Belieben Rehe stehlen und andere Schandtaten verüben kannst. Doch vorläufig kannst du im Turm über deine törichten Worte nachdenken.«
Hinnerk hob seine kleinen grauen Augen langsam zu der Sprecherin empor und sah sie starr an. Es mochte etwas in dem Blick liegen, was der Freifrau von Rungholt nicht gefiel; sie wandte sich kurz um und schritt dem Herrenhause zu, mit herrischem Wink ihren Stiefsohn Kajus an ihre Seite befehlend.
Die edle Frau von Rungholt mochte einst eine stattliche Erscheinung gewesen sein; jetzt war sie ältlich und verblüht. Ihr Gesicht zeigte noch feine Züge, doch farblose, runzelige Haut bedeckte dieselben, und ihre graublauen, mit spärlichen Wimpern umrandeten Augen sahen mürrisch vor sich hin. Ihr Anzug war dunkel und einfach; nur ein großes rotes Rubinkreuz, das sie über dem glatten Leinenkragen trug, und der feingearbeitete silberne Schlüsselhaken an ihrer Seite zeugten von Wohlstand, wenn nicht von Reichtum.
Jetzt wandte sie sich plötzlich gegen Kajus, der einige Schritte hinter ihr herging.
»Habe ich dir nicht oft verboten, mit Hinnerk, diesem unzufriedenen Burschen, zu reden? Auch dich werde ich strafen, und zwar wirst du heute abend ohne Nachtessen schlafen gehen. Solltest du noch einmal mein Gebot übertreten, so lasse ich deinen Ungehorsam dem Herrn Prädikanten vermelden, damit dieser an dir die Rute nicht spare!«
Das scharfgeschnittene Gesicht des Knaben rötete sich bei diesen keifend gesprochenen Worten, und seine dunklen Augen blitzten zornig, aber er bezwang sich und sagte ruhig:
»Das Nachtessen werde ich schon verschmerzen, Frau Mutter, was aber den Herrn Prädikanten betrifft, so ist er ein guter Mann und wird mich nicht schlagen. Und wer mir sonst mit einer Rute naht, dem zerbreche ich sie auf seinem eigenen Rücken!«
Frau Rungholt wandte sich ihrem Stiefsohne zu und faßte nach dem Schlüsselbunde, als wenn sie dasselbe gegen ihn gebrauchen wolle, aber ein Blick auf Kais kräftige junge Gestalt ließ sie sich eines andern besinnen. Noch einmal drohte sie ihm; dann verschwand sie ebenso rasch, wie sie gekommen war, und der Knabe sah ihr kopfschüttelnd nach.
»Die Frau Mutter wird alle Tage wunderlicher,« sagte er halblaut vor sich hin; »ob sie wohl eine Hexe ist, wie Hinnerk sagt? Gestern abend lief eine große schwarze Katze mir nach, die mich böse ansah; sie hatte viel Ähnlichkeit mit der Frau Mutter; doch denke ich mir kaum, daß der Prädikant zu uns kommen würde, wenn eine Hexe im Hause wäre!«
Langsam war Kai auf den Garten zugeschritten, welcher sich hinter dem Herrenhause hinzog. Es war kein Ziergarten, in den er jetzt durch eine Holztür eintrat, sondern ein großes Stück Gemüseland mit abgeernteten Beeten. Nur einige Herbstblumen fristeten hier und da ein kümmerliches Dasein, und dicht am Hause stand eine große, mit Flieder und Jasmin bewachsene Laube; sonst war nichts vorhanden, was den Namen Garten gerechtfertigt hätte, weder Gebüsch noch Rasen oder Zierpflanzen. Aber der Junker Kajus Rungholt schien dieses Stück Erde nicht reizlos zu finden. Er warf einen raschen Blick um sich, und als er weder im Garten noch hinter den kleinen Fensterscheiben des Herrenhauses einen Menschen sah, eilte er an ein großes Beet und zog mit vieler Geschicklichkeit eine Menge von gelben Wurzeln aus, von denen er den größten Teil in sein stark verschlissenes Tuchwams steckte, während er den Rest flüchtig von der Erde befreite, um sie dann flugs hinter seinen weißen Zähnen verschwinden zu lassen.
»Sie sind nicht mehr so schön wie im Sommer,« meinte er dann, »aber zum Abendbrot noch immer gut genug!«
»Kai! Kai!« rief eine helle Kinderstimme, und ein etwa zehnjähriger Knabe kam eilig über die Beete gelaufen. Lange goldene Locken flogen um sein rosiges Gesicht, und große blaue Augen mit dunklen Wimpern sahen mit einem merkwürdig beobachtenden Blick zu dem älteren Bruder empor, der mit möglichster Geschwindigkeit den Rest der Wurzeln hinuntergeschluckt hatte.
»Was willst du, Klemens?« fragte er dann nicht unfreundlich. »Ich habe noch zu tun und kann nicht mit dir spielen.«
»Du sollst mir Bogen schnitzen, Kai!« sagte der andere im Tone des verwöhnten Kindes. »Ich will morgen nach der Scheibe schießen, und du sollst mir immer den Bogen spannen!«
»Bolzen werde ich dir vielleicht schnitzen, wenn du artig bist, aber zum Bogenspannen mußt du dir einen Hofjungen nehmen.«
»Keiner von den Hofjungen ist so stark wie du!« rief der Kleine weinerlich. »Auch sind sie alle dumm und lachen, wenn ich ihnen etwas befehle.«
Ein gutmütiges Lächeln ging über das Gesicht des Älteren, und er strich liebkosend über das weiche Haar des Bruders.
»Wenn ich dir einen Jungen zum Bogenspannen bringe, dann befehle ich ihm auch, dir zu gehorchen,« sagte er tröstend. »Jetzt aber geh ins Haus, die Frau Mutter wird nach dir verlangen, und ich habe noch im Hofe zu tun!«
Er wandte sich kurz um und trat, nachdem er den Garten durchschritten hatte, aus einer am Hause befestigten Tür auf den Hofplatz.
Der Edelhof Holleby gehörte dem deutschen Freiherrn von Rungholt, der seit einer Reihe von Jahren dem dänischen König Christian dem Vierten diente. Er lag im Nordosten der großen Insel Seeland und war eine der schönsten Besitzungen der Gegend. Große Buchenwaldungen, herrlicher Weizenboden, üppige Wiesen erstreckten sich viele Morgen weit um den Edelhof, und schon mancher dänische Ritter hatte dem Freiherrn große Summen Geldes für den Besitz geboten. Doch der deutsche Edelmann, obgleich er wohl wußte, daß seine dänischen Standesgenossen ihn seines Gutes wegen scheel ansahen, hatte bis jetzt alle Anerbietungen abgelehnt und erklärt, daß er den Edelhof seinem ältesten Sohne bestimmt habe. Der Freiherr selbst konnte nicht oft die Freuden des ländlichen Lebens genießen. Er war dem Könige lieb geworden und durfte ihn daher selten verlassen, oder er wurde von ihm in seine Provinzen gesandt, um bald als Staatsmann, bald als Krieger seinem Herrn zu nützen. So kam es, daß Monate, ja sogar Jahre verstrichen, ehe der Freiherr in Holleby seine Familie besuchen konnte. Es gab am dänischen Hofe böse Zungen, die behaupteten, daß der König dem Freiherrn oft Urlaub angeboten, um heimzureiten, daß letzterer aber selten Lust verspüre, sein Ehegemahl, die Freifrau, aufzusuchen, und niemand wollte ihm sein Sträuben verdenken. Denn Frau Rungholt galt für eine herrschsüchtige und geizige Frau, die ihren Stiefsohn Kajus schlecht behandelte, wogegen sie ihren leiblichen Sohn Klemens abgöttisch liebte.
Allerdings war auch bei Junker Kajus ein Häkchen, und mancher hochmütige dänische Edelmann schüttelte darüber bedenklich den Kopf. Seine Mutter war nämlich keines Adeligen, sondern eines Kaufmanns Tochter gewesen, und wenn man auch nicht wagte, offen seine Ritterbürtigkeit zu bezweifeln, – König Christian konnte über solchen Hochmut sehr böse werden, – so bedauerte man doch von Herzen den armen Junker, der außer dem Mißgeschick einer bösen Stiefmutter noch das einer zweifelhaften Geburt besaß und eigentlich nicht fähig war, einen dänischen Edelhof zum Eigentum zu haben.
Von allen diesen Dingen wußte Junker Kajus nichts. Er stand jetzt wohlgemut auf dem Hofplatz und sah den Kühen zu, die durch das Torhaus dem Stalle zugetrieben wurden, denn es war Ende September und des Nachts zu kalt für sie, um auf der Weide zu bleiben. Man sah es den Tieren an, daß sie sich auf den warmen Stall freuten; sie brüllten freudig und drängten sich hastig der geöffneten Tür zu. Nur einige Stücke Jungvieh schienen Lust zu verspüren, die goldene Freiheit noch zu genießen, und galoppierten schwerfällig auf dem weiten Hofplatz umher, verfolgt von einem großen weißen Schäferhunde, dem sie aber mutig die Hörner zeigten. Die untergehende Herbstsonne beleuchtete ein freundliches Bild: der stattliche Herrenhof mit seinen alten Bäumen, seinem gutgebauten, wenn auch niedrigen Herrenhause, den Scheuern auf beiden Seiten und dem Torhause mit dem Glockentürmchen darauf schien belebt und heiter, wozu das brüllende Vieh, die treibenden Knechte und die bellenden Hunde ihr Teil beitrugen.
Doch schien kein Mensch auf dem Hofe zu sein, dem dieser Anblick Freude machte; es war für alle etwas Alltägliches, Altgewohntes.
Nachdem die Kühe in den Stall getrieben, trat Kajus in ihn ein.
»Sind die Tiere schon gemolken?« fragte er eine mit schwerem Eimer bewaffnete Stallmagd. Diese knickste ehrerbietig.
»Nein, Junker; die Frau will immer, daß wir im Stall melken, obgleich es nicht gut für die Milch ist. Es ist wohl Mecklenburger Mode!« setzte sie in ihrem spitzigen Seeländer Dänisch hinzu, als sie merkte, daß Kai sich prüfend umsah. Dann zog er einen zinnernen Becher hervor. »Melk' mir diesen Becher voll!« befahl er. »Aber rasch, damit die Frau Mutter mich nicht hier ertappe. Und nimm die schwarze Kuh mit dem weißen Stern vor! Sie gefällt mir am besten!«
Das Mädchen gehorchte behend, und der Junker trank drei Becher von der schäumenden Milch der schwarzen Kuh, ehe die Stalltür sich öffnete, um die Freifrau einzulassen. Sie kam immer, um das Melken zu beaufsichtigen.
Kajus aber schlich leise aus der Hintertür und nickte zufrieden. »Mein Abendessen habe ich nun doch weg, Frau Mutter, und es schmeckte mir ebensogut, als wenn ich mit Euch Buchweizengrütze und Dünnbier gespeist hätte!«
Gemächlich schlenderte er dem Herrenhause zu und trat dann in die Tür desselben, die in einen großen Raum, Halle genannt, führte. Diese machte einen hohen, freundlichen Eindruck schon dadurch, daß die Wände mit dunklem Holzwerk bekleidet, während Decke und Estrich hell gestrichen waren. Das Licht fiel von zwei Seiten hinein, und die Fenster waren hoch und spitz wie Kirchenfenster, auch wie diese mit farbigen Malereien bedeckt. In der Mitte stand ein schwerer Eichentisch; einige geschnitzte Stühle, ein Kredenztisch mit Zinnkrügen und einige Bänke an der Wand bildeten die Ausstattung der Halle, an deren einer Seite ein mächtiger Kamin für den Winter gute Wärme versprach.
Die Sonne schien mit ihren letzten Strahlen goldig durch die bunten Fenster, als Kajus eintrat, und er hob unwillkürlich seine Augen zu der im vollen Farbenglanz strahlenden Malerei. Dann stellte er sich andächtig mit gefalteten Händen vor das Kunstwerk, das den triumphierenden David darstellte, der mit lächerlich kleinen Ärmchen Goliaths Schwert schwang, um dem unglücklichen Riesen das große Haupt abzuschlagen. Der Junker betrachtete die Malerei, bis die Farben der Bilder verblaßten und die Sonne eine andere Darstellung bestrahlte. Auf diese warf Kajus aber nur einen halb verächtlichen Blick. Der singende David, der dem Judenkönig Stückchen auf der Harfe vorspielte, war ihm unbegreiflich. Er haßte das fahrende Volk der Sänger, und es blieb ihm unverständlich, wie man erst einen Riesen töten und dann noch Harfe klimpern mochte.
Darauf streckte sich der Junker gemächlich auf eine der Holzbänke, die durch den großen, wie eine Hütte vorspringenden Kamin fast verdeckt wurden. Er wußte, daß seine Stiefmutter noch längere Zeit im Kuhstall zu tun hatte, und das gab ihm ein angenehmes Gefühl der Sicherheit, denn er liebte nicht, viel mit ihr zusammen zu sein.
Nachdenklich betrachtete er noch einmal die bunten Scheiben und blickte auf, als plötzlich die schwere Haustür sich öffnete und die Freifrau eintrat. Rasch drückte er sich dann an das dunkle Holzgetäfel der Wand; er hielt es nicht für nötig, daß sie ihn erblickte, besonders als er merkte, wie ein Fremder ihr folgte.
In der halbgeöffneten Tür erschien eine große, starke Gestalt, und mit einem scharfen Blick musterte Kajus die ganze Erscheinung. Ein ledernes, ziemlich vertragenes Koller, schwere Reiterstiefel und ein großer grauer Schlapphut mit Federn bildeten den Anzug des Fremden, der an der Seite noch einen großen Degen trug, den er klirrend auf den Fußboden fallen ließ, während er sich schwerfällig auf einen der am Tische stehenden Stühle setzte.
»Lasset nur nicht zu lange mit dem Labetrunk warten, Frau Cousine,« sagte er mit heiserer Stimme. »Der verwünschte Staub auf der Landstraße hat meine Kehle gedörrt wie ungegerbtes Leder, so daß ich mich nicht imstande fühle, ein längeres Wort mit Euch zu reden!«
Frau Rungholt nahm von der Kredenz einen der blanken Zinnkrüge und ging hinaus. Der Fremde knöpfte unterdessen sein Koller auf, streckte die Beine von sich und stöhnte zufrieden.
»Sie scheint mir hier recht gut zu sitzen!« sagte er dann halblaut und wendete sein Gesicht nach dem offen gebliebenen Eingang, so daß Kajus ein verschwommenes Gesicht mit strohgelbem Knebelbart und hervortretenden graublauen Augen erkennen konnte.
Jetzt trat die Freifrau wieder ein und schenkte schäumendes Bier in einen Steinkrug, den sie vor ihren Gast hinstellte.
Dieser murmelte einige Worte, von denen man das Wort Wein verstehen konnte; doch trank er in durstigen Zügen und wischte sich dann mit der Hand den Schnurrbart.
»Kein übler Trunk!« sagte er herablassend. »Bin freilich den Wein mehr gewohnt in Deutschland –«
»Dann hättet Ihr in Deutschland bleiben müssen!« unterbrach ihn spitzigen Tones seine Wirtin. »Hier in Dänemark gibt man den Gästen nicht mehr, als man hat!«
»Nun, nun,« begütigte der andere, »seid doch nicht gleich so hitzig, werte Frau Base! Man sollte meinen, Ihr wäret noch das schnippische Jungfräulein, das mit mir, dem Junker von Zoppelow, manch tollen Tanz am Hofe zu Güstrow aufführte. Damals konntet Ihr antworten! Es war eine Lust, Euch zu hören, und ich gedenke noch manchmal Eurer witzigen Rede, der ich so gern lauschte!«
Das mürrische Gesicht der Hausfrau legte sich in freundlichere Falten bei der Schmeichelei des Ritters, und sie füllte noch einmal den Krug des Sprechers, was dieser mit listigem Lächeln bemerkte. Dann setzte sie sich ihm gegenüber.
»Ihr habt recht, Herr von Zoppelow,« sagte sie seufzend, »unsere Jugendzeit war eine herrliche, und ich gedenke ihrer mit Wehmut. Es ist mir bitter hart, daß der böse Krieg auch unser armes Mecklenburg so arg mitgenommen hat und daß unsere regierenden Herren in der Fremde einen Unterschlupf finden müssen. Ich wäre auch gern einmal in die Heimat gereist, um mir alles anzusehen; doch mein Eheherr ist ein strenger Gebieter, der es nicht duldet, wenn ich mich vom Hofe entferne!«
»Ist auch besser so!« rief der Landsmann rauh. »Weibsvolk tut besser, daheimzubleiben und Suppe zu kochen, als sich in Kriegsgefahr zu begeben. Ihr würdet Eure Heimat nicht wiedererkennen. Der Waldstein ist übel mit ihr verfahren, und manches Herrenschloß, in dem Ihr den Reigen lustig tanztet, liegt als Trümmerhaufen da.«
Die Freifrau hörte dem Sprecher aufmerksam zu.
»Wollte Gott, es gäbe weder Kaiserliche noch Schweden!« seufzte sie. »Ich halte von beiden Teilen gar nichts, seit Gustav Adolf bei Lützen gefallen ist, und mich bedünkt, daß die Krieger, die jetzt unter seinen Fahnen kämpfen, ebenso grausam und beutegierig sind, wie die katholischen Heere!«
Herr von Zoppelow räusperte sich.
»Ihr seid falsch berichtet, werte Cousine,« sagte er dann mit Nachdruck. »Die Schweden sind freilich auch nicht säuberlich gegen ihre Feinde losgezogen, aber ihre Sache war gerecht, und sie durften sich etwas gegen die Papisten und gegen alle, die es mit diesen halten, erlauben. Glaubt mir,« fuhr er lebhafter fort, als die Freifrau den Kopf schüttelte, »ich verstehe es zu beurteilen. Bin ich doch selbst schwedischer Rittmeister und habe mein Reiterfähnlein bei Lützen gut geführt.«
Diese Mitteilung machte auf die Hausherrin keinen großen Eindruck.
»So, so!« sagte sie kurz, und warf einen mißtrauischen Blick auf den Mecklenburger, der beide Arme auf den Tisch gelegt hatte und sie erwartungsvoll anblickte.
»Was wollt Ihr denn auf Seeland?« fragte sie nach einer Weile.
Herr von Zoppelow zwirbelte den gelben Schnurrbart zwischen den Fingern und setzte sich fester hin.
»Seht, Frau Cousine,« rief er mit seiner krächzenden Stimme, »ich will Euch mein Kommen offen erklären. Wenn ich auch der schwedischen Fahne treu diene, so hat sie mir bislang blutwenig Glück gebracht, dagegen mancherlei Blessuren, am Arm, am Bein, am Halse, der Teufel weiß, wo sonst noch. Weil aber in Deutschland kein sicher Leben ist, habe ich an meine liebwerteste Frau Cousine gedacht, die einen armen Vettersmann sicherlich gut aufnehmen und verpflegen wird. Ist es nicht so, Frau Mathilde?«
Die Züge der Freifrau waren bei seinen Worten immer härter und strenger geworden; jetzt stand sie auf und bemerkte kurz:
»Es wird mir eine Ehre sein, dem Herrn von Zoppelow ein Nachtquartier zu geben, wenn ich ihn auch nicht zum langen Bleiben einladen kann. Denn eine einzelne Frau muß wohl auf ihren Ruf achten und kann nicht wochenlang einen Ritter bei sich aufnehmen, der kaum mit ihrer Großmutter und noch viel weniger mit ihr selbst blutsverwandt ist.«
Die Rede der Freifrau schien dem Gaste nicht sonderlich zu gefallen; er versuchte mehrfach ein begütigendes Wort einzuschieben; aber als sie geendet hatte, blieb er ruhig sitzen und überhörte auch die Aufforderung seiner Wirtin, sich auf das Gastzimmer geleiten zu lassen.
»Wo ist Euer Gemahl?« fragte er.
»In Kopenhagen, in Kronenburg, in Norwegen und Jütland; überall, wohin ihn der Wille Christians ruft.«
»Kommt er bald wieder hierher?«
»Erst kürzlich war er auf Holleby, und da es ihm hier niemals sonderlich gefallen will und er sich stets nach des Königs Hof und seinem bunten Treiben sehnt, so wird er wohl vor dem nächsten Jahre nicht wiederkommen!« rief die Freifrau, ungeduldig mit den Schlüsseln klirrend.
»Hattet Ihr nicht einen Stiefsohn, werte Frau?« fragte Zoppelow unbekümmert weiter.
»Gott sei's geklagt, ja!« versetzte die Gefragte geärgert. »Der Bursch wird alle Tage größer und ißt wie ein Landsknecht!«
»Laßt ihn doch einen werden!« rief Zoppelow, und Kajus, der bis jetzt teilnahmlos auf der Bank gelegen, richtete sich aufmerksam auf. Es war im Hintergrunde der Halle ganz dunkel geworden, und der Rest des Tageslichtes beschien nur den dicken Mecklenburger und seine Wirtin.
»Schickt ihn fort!« riet Zoppelow noch einmal. »Ich weiß einen Hauptmann, der ihn gern nehmen würde, und dann –« er lachte spöttisch, »mancher kommt nicht wieder, der in den Krieg gezogen!«
Frau Rungholt setzte sich wieder.
»Der Gedanke ließe sich hören,« sagte sie dann halblaut; »indessen muß dazu noch mancherlei überlegt werden. Wenn Ihr ihn und meinen Klemens erblickt, so werdet Ihr sehen, was für ein Unterschied zwischen beiden ist! Der eine ein Herrenkind, der andere ein häßlicher Bube, dem jedermann das bürgerliche Blut ansieht!«
»Also seine Mutter war eine Bürgerliche?« rief Zoppelow überrascht, während er langsam aufstand. »Nun, liebe Frau, dann ist's nicht zu verwundern, wenn er anders ist denn Euer Kind. Art läßt nicht von Art. Doch darüber wollen wir morgen weitersprechen. Führet mich gefälligst in mein Gemach und sendet mir etwas Nachtessen hinein; morgen früh wird mein stets waches Gehirn für Euch und Euer Söhnchen einen guten Plan geschmiedet haben, der Eurer Seele wohltun wird!«
Frau Rungholt öffnete ohne ein Wort der Erwiderung die Tür, die nach dem Innern des Hauses führte, und ging hinaus, gefolgt von dem schweren Schritt des Gastes.
Als beide verschwunden waren, richtete Junker Kai sich langsam empor.
»Was wollte der Mann?« fragte er sich nachdenklich. »Er scheint mir übel gesinnt zu sein, obgleich ich ihm nichts tat. Zum Landsknecht lasse ich mich aber nicht machen. Ich will ein Reitersmann werden!«
Geräuschlos schlüpfte er aus der Halle.
II.
Neben dem Herrenhause stand unter dem Schatten knorriger Ulmen ein verfallener, mit Efeu umrankter Turm, vielleicht der Überrest einer früheren Befestigung. Aus unbehauenen Felssteinen lose aufeinandergeschichtet, mit Backsteinen und Kalk ausgebessert, sah er aus, als könnte er täglich zusammenbrechen. Doch mancher Sturm war über das altersgraue Gemäuer dahingebraust, ohne seine Grundfeste zu erschüttern, und er stand auch nicht als Erinnerung an vergangene Tage. Hart über dem Erdboden war eine Tür aus dicken eichenen Bohlen, mit einem riesigen Hängeschloß versichert, und auf diese Tür warfen die Knechte von Holleby oft ängstliche Blicke. Es war nicht angenehm, hinter derselben im feuchtkalten Turm zu sitzen, und jedermann wußte, daß die Freifrau öfters ihre Leute einsperrte, wenn sie Anlaß zur Unzufriedenheit gaben. Selten nur war das Gefängnis unbewohnt und auch jetzt wieder besetzt durch den fehmarnschen Knecht Hinnerk, dessen Äußerung, er möchte nicht auf Holleby sein, durch Frau Rungholt auf frischer Tat bestraft wurde.
Der Aufenthalt in den alten Mauern war für einen älteren Mann wie Hinnerk, der dazu von der Gicht geplagt wurde, nicht angenehm, und der Knecht saß gekrümmt und leise stöhnend auf einem Haufen halbvermoderter Blätter. Aber er war nicht allein: vor ihm stand der Junker Kai. Das Gesicht des Knaben trug einen finsteren Ausdruck, während seine Blicke an den nassen, grünlich schimmernden Wänden hingen, und er lauschte nur mit halbem Ohre den Worten des Gefangenen.
»Eine Hexe ist sie!« stöhnte dieser grimmig. »Darauf möchte ich meinen Kopf verpfänden! Wie könnte sie sonst so unbemerkt an uns herangekommen sein? Aber ich sah, als ich mit Euch sprach, ein Eichkätzchen an dem weißen Birkenstamme sitzen, das mich schon an jemand erinnerte, und ich Narr gedachte nicht der Freifrau. Nun habe ich dafür meine Strafe!«
»Wenn sie eine Hexe wäre, würde der Prädikant doch nicht zu uns kommen!« wandte Kajus ein.
Hinnerk schüttelte den Kopf.
»Meint Ihr, daß die Frau den geistlichen Herrn nicht betören kann? Pah! Ich weiß von einer Hexe, die war des Bischofs Schwester. Sie wohnte bei ihm vier Jahre im Hause und würde noch länger ihr Wesen getrieben haben, aber eines Tages lag sie mit abgehauener Hand im Bette. Ein Ritter, dem sie als weiße Katze auf den Nacken gesprungen war, hatte ihr eine Pfote abgehauen!«
»Du hast mir diese Geschichte schon oft erzählt,« sagte der Junker ungeduldig. »Es mag wohl sein, daß die Frau Mutter hexen kann, und ich werde darüber mit dem Herrn Vater sprechen, wenn er einmal wieder heimkommt. Vielleicht geht sie dann in sich und tut Buße, ehe es zu spät ist. Aber wundern muß ich mich dann, daß sie sich den Herrn von Zoppelow nicht vom Halse schafft. Sie scheint ihn nicht gern hier zu sehen.«
»Wen?« fragte Hinnerk in einem so scharfen Tone, daß Kai befremdet aufsah.
»Ich meine den Herrn, der gestern abend bei uns eintraf, auch mit Bier bewirtet ward, obgleich es der Frau Mutter sauer abging. Er wollte lange hier bleiben, doch glaube ich kaum, daß die Mutter dies gestatten wird.«
Hinnerk war aufgestanden und ging langsam hin und her. Er schien in Aufregung zu sein, denn er murmelte unverständliche Worte und schüttelte drohend die Faust.
»Kennst du Herrn von Zoppelow?« fragte Kai, erstaunt über die Erregung des sonst so phlegmatischen Knechtes.
»Ob ich ihn kenne?« schrie Hinnerk. »Habe noch eine Rechnung mit ihm abzuschließen und schon oft zu Gott gebetet, er möge mir Gelegenheit geben zum Bezahlen!«
»Sprich nicht so laut!« rief Kai ängstlich. »Bedenke, daß man dich hören könnte, denn die Turmmauer hat viele Spalten!«
Hinnerk setzte sich mit einem Seufzer wieder auf seinen Platz.
»Ihr habt recht, Junker,« sagte er leiser, aber mit grimmigem Blick, »das laute Schelten nützt zu nichts. Dann kommen die großen Herren und hängen einen, ehe man's sich versieht. Aber wenn Ihr etwas für mich zu essen hättet, edler Junker,« setzte er mit veränderter Stimme hinzu, »so würde Gott es Euch lohnen. Ich habe seit gestern mittag nichts in den Magen gekriegt, und die Frau wird mich sicherlich noch ein Weilchen versäumen.«
Kajus zog aus seinem Wams einige Wurzeln und ein großes Stück Brot hervor.
»Verzeih,« sagte er freundlich, »daß ich vergaß, weshalb ich kam. Brot und Wurzeln müssen dir genügen, aber ich hoffe, dir am Abend Milch zu bringen. Hilf mir aber aus dem Turm, ehe du anfängst zu essen!«
Hinnerk erhob sich, und während er einige Dankesworte murmelte, stellte er sich gegen die Mauer und krümmte seinen Rücken, damit der Junker diesen als Stütze brauchen konnte. Kajus kletterte einige Fuß an der Innenseite des Turmes hinauf und zwängte seinen schlanken Körper durch einen Mauerspalt ins Freie. Hier stand eine Ulme, deren knorriger Ast fast in den Turm wuchs. Diesen ergriff Kajus, und nach wenigen Augenblicken saß er in dem Blätterwerk des Baumes, das trotz des Herbstes noch immer dicht genug war, um ihn vollständig zu verdecken. Er wollte an dem Stamm niedergleiten, als er Stimmen hörte, die sich diesem Platze näherten. Hastig drückte er sich in die Blätter zurück und warf einen scharfen Blick nach unten. Hier näherten sich langsam und in eifrigster Unterhaltung die Freifrau und ihr Gast aus Mecklenburg.
Es war ein sonniger, milder Herbsttag, und Frau Rungholt hatte dem schönen Wetter, vielleicht auch ihrem Besuch zu Ehren ein hellgraues, mit kirschrotem Tuch besetztes Gewand angelegt, das ihrem ältlichen Gesicht gut stand. Ein schöner Kragen aus gelblichen Spitzen verdeckte dabei ihre Magerkeit. Ein Häubchen aus grauem Tuch bedeckte ihren Scheitel, und breite Bänder von derselben Farbe rahmten das Gesicht ein. Kajus, dessen Falkenaugen nichts entging, mußte sich sagen, daß er seine Stiefmutter noch niemals so hübsch gesehen hatte, und er schämte sich, unfreundlich über sie gesprochen zu haben. Herr von Zoppelow sah heute nicht anders aus wie gestern. Der Staub war von seiner Kleidung verschwunden, aber sie erschien im hellen Sonnenlicht noch abgeschabter als gestern abend. Die schweren Stiefel waren schiefgetreten, der Koller vielfach ausgebessert und die Federn des Hutes kahl und verregnet. Trotzdem drehte sich der Mecklenburger mit siegesgewisser Miene den langen Schnurrbart und blickte um sich, als wäre er Besitzer des schönen Holleby.
Jetzt waren beide dicht am Turme angekommen, und während Frau Rungholt ein auf die Erde gefallenes Stück Kalk wieder zwischen zwei Steine einzufügen versuchte, lehnte Zoppelow sich behaglich an den Ulmenstamm, in dessen Krone Kajus saß.
»Ich merke schon, werte Cousine,« sagte er mit leicht gedämpfter Stimme, »Ihr seid der Sache nicht ordentlich zu Leibe gegangen, sonst müßte alles anders sein. Aber es ist wahr, Ihr seid ein Weib und habt keine männliche Stütze gehabt, ohne die Ihr nichts ausrichten könnt. Euer Gemahl begeht einen Übergriff, wenn er sich verleiten lassen sollte, seinen ältesten, unebenbürtigen Sohn zum Erben seines Besitzes einzusetzen. Der Freiherr mag ein stattlicher Kriegsheld sein, aber wer einmal ein bürgerlich Weib nahm, der verliert für viele Dinge das Verständnis. Laßt mich nur machen, werte Frau Cousine, und Ihr werdet den Tag segnen, da Albrecht Zoppelow den Fuß auf die Schwelle Eures Hauses setzte!«
Die Freifrau schüttelte ungläubig den Kopf.
»Ihr habt gut reden!« sagte sie dann. »Mein Herr ist ein Querkopf, der tut, was ihm wohlgefällt. Auch habe ich von Beispielen gehört, wo König Christian Knaben, die eine bürgerliche Mutter hatten, durch öffentliches Schreiben für ritterbürtig erklärte und in großen Zorn geriet, wenn man an seinem Wort hat zweifeln wollen. Nein, es wird schwer halten, meinem geliebten Sohne den Hof zu verschaffen, und manche schlaflose Nacht verbrachte ich in Kummer und Gram über das Schicksal des süßen Kindes!«
Zoppelow räusperte sich.
»Es gibt doch noch mancherlei Wege, zum Ziele zu kommen!« meinte er, sich vorsichtig umschauend.
»So haltet damit nicht hinter dem Berge!« rief Frau Mathilde ärgerlich. Bis jetzt flößte der Vetter ihr noch nicht viel Respekt ein.
Dieser warf ihr einen schlauen Blick zu.
»Wenn Seeland schwedisch würde!« sagte er bedeutungsvoll.
»Seeland schwedisch? Lieber Gott, was redet Ihr da!« rief die Freifrau unmutig. »Wollen denn die Schweden das ganze Erdreich besitzen?«
»So weit ist's noch nicht!« lächelte Zoppelow überlegen. »Ich weiß wohl, daß man mit Frauen eigentlich keine Politik treiben soll, weil sie doch nichts davon verstehen und meistens Verwirrung anrichten, aber erzählen muß ich Euch doch, daß man in Stockholm schon lange wünscht, Schonen, Bleckingen und Seeland einzuverleiben. Ihr müßt das auch begreiflich finden, da Schonen und Bleckingen in Südschweden liegen und Seeland nur durch den schmalen Sund von diesen Ländern getrennt ist. Es ist offenbar Gottes Wille, daß dies einst alles schwedisch wird, und die Dänen müssen sich darein finden. Behalten sie doch noch die übrigen Inseln: Norwegen, Jütland, Schleswig und Holstein, wahrlich ein weites Reich, wie sie es besser nicht verlangen können!«
»Hat Euch dieses Herr Oxenstirn alles selbst gesagt?« fragte die Freifrau, als Zoppelow schwieg und mit einem zerlumpten Tüchlein sich die Stirn trocknete. Der kühle Ton ihrer Frage behagte ihm nicht, und er warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu.
»Wäre ich ein Diplomatikus und in Oxenstirns Vertrauen, dann stünde ich wohl nicht hier,« erwiderte er unwirsch. »Aber ich weiß, was man in Stockholm redet, und daß es ein gut Stück Geld zu verdienen geben wird, wenn man dem Kanzler Nachricht über Seelands Armierung und Befestigung bringt. Auch habe ich erfahren, daß es hier mancherlei Leute gibt, die lieber unter der blaugelben Fahne als unter dem Danebrog leben möchten!«
»Ich verstehe aber nicht, was meine Angelegenheit mit diesen Sachen zu tun hat,« bemerkte Frau Rungholt, prüfend in das aufgedunsene Gesicht Zoppelows sehend.
»Nun, das ist doch ganz einfach!« rief dieser laut und ärgerlich. »Dann würden die schwedischen Gesetze mit aller Strenge hier eingeführt werden, und nimmer würde es dem Junker Kajus verstattet sein, einen Edelhof sein eigen zu nennen!«
»Wißt Ihr das gewiß?« fragte die Freifrau schnell.
»So gewiß, wie ich hier stehe!« beteuerte Zoppelow.
»Nun, wir können noch einmal über die Angelegenheit reden,« meinte die Dame, ihr Kleid aufraffend, um weiterzuschreiten. »Wenn Ihr auch nicht unrecht haben möget, daß Frauen wenig von der Politik verstehen, so weiß ich doch, daß mir die Schweden lieber sind als die Dänen. Erstere habe ich sogar zu einer Zeit sehr geliebt, ehe sie so grausam in Deutschland wüteten; aber die Dänen sind falsch und hochmütig, so daß schlecht mit ihnen zu leben ist. Doch laßt uns weitergehen, – an unserem Gefängnis ist für Euch nicht viel zu sehen!«
»Dies ist Euer Gefängnis?« Zoppelow wandte sich noch einmal um und klopfte mit dem Finger an die Mauer. »Nun, ein alter Bau; aber so morsch, daß er bald zusammenbrechen wird!«
»Er sieht wohl so aus,« versetzte seine Begleiterin, »aber ich kann Euch versichern, daß er noch viele Jahre seine Dienste tun wird!«
»Benutzt Ihr ihn fleißig?«
»Gewiß!« seufzte die Gefragte. »Das Volk ist widerspenstig und aufsässig, so daß fast immer einer hier drin sitzt. Jetzt sitzt hier ein Knecht, der mir davonzulaufen drohte. Er mag fein nachdenken über seine rebellischen Gedanken.«
»Solche Leute darf man nicht erst einsperren!« rief Zoppelow rauh. »Man muß sie auf frischer Tat aufhängen lassen – dann hat man nicht mehr nötig, sie zu füttern, und die andern mögen sich ein Beispiel daran nehmen!«
Er lachte roh auf und eilte der davonschreitenden Freifrau nach, während Kai mit schmerzenden Gliedern noch immer auf seinem Aste saß und nachdenklich vor sich hinblickte. Was wollte dieser fremde Mann hier, und weshalb sprach er so viel und so unfreundlich von ihm? Kai hatte ihm doch nie etwas zuleide getan; weshalb wollte der Fremde ihn seines Erbteiles berauben? Ein Gefühl des Unbehagens, wie er es noch niemals gekannt, bemächtigte sich des Knaben; langsam glitt er vom Baum herunter und ging schweren Schrittes zum Hofplatz. Er hätte am liebsten laut weinen mögen, und nur der Gedanke, daß dies nicht mehr für ihn schicklich sei, hielt ihn zurück.
Junker Kai war von der eben gehörten Unterhaltung so hingenommen gewesen, daß er auf nichts anderes geachtet hatte. So war es ihm entgangen, daß ein Lauscher den Kopf aus der Maueröffnung gestreckt und gleichfalls kein Wort Zoppelows verloren hatte. Jetzt noch sah er heraus, und seine kleinen Augen funkelten vor Wut.
»Also hängen wolltest du mich, du Landesverräter? Nun, lieber Gott im Himmel! Sie sagen ja immer, daß du auch ein Gott für die Armen und für die Knechte bist; dann zeige mir einmal deine Gnade und laß mich ihn aufhängen, wenn seine Stunde geschlagen hat!«
Junker Kajus hatte nicht viel Zeit, seinem Kummer nachzuhängen; auf dem Hofplatz kam ihm Klemens entgegen, der einen Papierdrachen steigen ließ und die Hilfe des Bruders beanspruchte. Dann waren auch noch Bolzen für den Kleinen zu schnitzen – kurz, Kai vergaß bald, weshalb er hätte weinen mögen, und dachte nur daran, wo der schönste Wind für den Drachen sei. Er beschloß, hinter den Garten auf eine kleine Wiese zu gehen, und Klemens, die Schnur des Drachens haltend, während ein Hofjunge das papierne Ungetüm trug, folgte ihm jubelnd.
Nicht lange dauerte es, und der Drachen erhob sich langsam, von Kajus sorgsam in die richtige Windrichtung gebracht. Beide Knaben standen dann still und schauten aufmerksam in die Höhe, während die Schnur, an der ihr Spielzeug befestigt war, sich immer schneller abwickelte. Endlich gab es einen kleinen Ruck – der Bindfaden hatte sein Ende erreicht, und der Drachen stand unbeweglich über ihnen.
»Er will weiter fort!« rief Kajus. »Sieh nur, wie er an der Schnur reißt! Ach, wäre sie doch doppelt so lang!«
»Gib mir das Band, damit ich den Drachen lenken kann!« bat Klemens, die Hand nach dem Stückchen Holz ausstreckend, um das das Ende des Bindfadens gebunden war und das Kajus in der Hand hielt.
Der ältere Bruder schüttelte den Kopf.
»Nein, mein Kleiner,« sagte er freundlich. »Du würdest den Burschen niemals halten können. Sieh, wie er sich bäumt und wie er vorwärtsdrängt! Er will weit weg fliegen, und er tut es sogleich, wenn er deine schwache Hand fühlt!«
Aber der Kleine hatte sich in den Kopf gesetzt, den Drachen selbst zu halten, und seine rosigen Lippen baten so inständig um diese Vergünstigung, daß Kai einige Schritte fortlief, um dem Drängen des Bruders zu entgehen. Als aber dieser, nach Art eines verwöhnten Kindes, zu weinen begann, ging er auf ihn zu und legte ihm gutmütig die Handhabe des Drachens in die Hände. Er selbst steckte die Hände in die Taschen und verfolgte die Bewegungen des Bruders mit Spannung.
Mit zufriedenem Lächeln übernahm Klemens die Leitung des Drachens, und er biß kräftig die Zähne zusammen, als der scharf angespannte Bindfaden die Haut seiner Finger rieb, aber lange hatte er nicht die Kraft, dem Zerren des ungebärdigen Spielzeuges zu widerstehen. Plötzlich fuhr ein schärferer Windstoß daher, der Drachen tat einen Ruck, und mit einem Aufschrei ließ Klemens das Stück Holz fahren, das sofort in die Luft gerissen ward. Der befreite Drachen fuhr mit stürmischer Eile vor dem Winde davon; langsam sinkend verschwand er hinter dem entfernten Walde.
Beide Brüder standen schweigend und sahen in die Höhe, bis der Drachen gänzlich ihren Blicken entschwunden war; dann sagte Kajus:
»Siehst du wohl, daß du ihn nicht halten konntest?«
»Mein Drachen, mein Bindfaden, mein Papier, mein Stück Holz!« schluchzte Klemens, dessen Tränen ungehindert flossen.
»Ja, alles ist verloren!« bestätigte Kajus. »Der Drachen fliegt vielleicht nach Schweden und bekommt ein großes Stück von der Welt zu sehen!«
Diese Bemerkung schien für Klemens nichts Tröstliches zu haben; er weinte noch stärker.
»Du bist an allem schuld!« schrie er Kajus an. »Ich wollte auf dem Hofplatze spielen, und dann hätte ich meinen Drachen noch! Du bringst mich um alles, um den Drachen und um meinen Edelhof!«
Kai, der tröstend seinen Arm um den Bruder legen wollte, trat einen Schritt zurück.
»Was sagst du da?« fragte er scharf, während dasselbe Gefühl des Unbehagens, das er soeben abzuschütteln versuchte, sich seiner wieder bemächtigte.
»Herr von Zoppelow sagt es!« schrie Klemens triumphierend, den Eindruck seiner Worte gewahrend. »Er sagt, daß du mir den Edelhof nehmen willst, obgleich er mir gebührt, denn du bist kein rechter Edelmann.«
Da fiel die Hand des älteren Junkers schwer auf den Rücken seines Bruders, und während dieser ein gellendes Jammergeschrei ausstieß, rief der andere, vor Zorn bebend: »Ich will dich lehren, deinem Bruder so unnützes Zeug zu sagen! Ich bin der erstgeborene Junker Rungholt und werde es bleiben, solange ich lebe!«
Kai hatte kaum die Worte ausgesprochen, als er einen schweren Schlag auf den Nacken erhielt. Mit einem kurzen Schmerzenslaut sich umwendend, erblickte er vor sich den mecklenburgischen Herrn und seine Stiefmutter. Herr von Zoppelow hob den wuchtigen Knotenstock, den er in der Hand hielt, bereits zum zweiten Male.
»Ihr scheint ein sauberes Früchtchen zu sein, Kajus Rungholt,« sagte er mit seiner heiseren Stimme, »und ich will Euch zeigen, –« ehe er den Satz vollendet, taumelte er mit einem Fluch zurück; Kai war mit einem wilden Sprunge gegen ihn vorgestürzt und hatte den überraschten Edelmann so heftig auf den Oberarm geschlagen, daß diesem der Stock entfiel.
Junker Rungholt griff rasch darnach und drohte zornig damit.
»Ihr wagt es, mich zu schlagen?« fragte er, seine blitzenden Augen auf den erschreckten Mecklenburger richtend. »Wahrlich, wäret Ihr nicht der Gast der Frau Mutter, Ihr müßtet bitter für Eure Verwegenheit büßen! Die Rungholts lassen sich nicht schlagen wie Knechte!«
»Ihr schluget auch den Kleinen!« brummte Zoppelow, scheu einige Schritte zurücktretend und seinen Arm reibend.
»Wenn ich meinen jüngeren Bruder für seine ungebührlichen Reden züchtige, so ist das mein Recht, und Euch geht das nichts an!« rief Kajus, den der Zorn wider seine Gewohnheit redselig machte.
»Laßt uns gehen!« rief jetzt die Freifrau scharf, die bis dahin schweigend gestanden und Klemens zärtlich gestreichelt hatte. »Ihr seht, werter Herr, daß ich Euch recht berichtete. Kajus ist ein böser Bube, mit dem nichts anzufangen ist, und dem es besser wäre, er käme in scharfe Zucht, als daß er sich einbildet, den adeligen Herrn hier spielen zu wollen. Im nächsten Brief an meinen Gebieter werde ich von ihm melden, und dann wird er, will's Gott, seiner Strafe nicht entgehen!«
Sie ging davon, noch einen giftigen Blick auf Kai werfend, und Zoppelow folgte ihr eiligst. Er brummte allerhand Drohworte in den Bart, hütete sich jedoch, sie laut werden zu lassen. Kajus, der unbeweglich mit dem Stock in der Hand stand, sah nicht aus, als wenn er viel Federlesens mit dem Herrn machen würde. Nur Klemens blieb bei dem Bruder. Er hatte niemals Furcht vor ihm empfunden und war jetzt zufrieden, da der fremde Herr für ihn Partei ergriffen hatte.
»Du mußt mir Bolzen schneiden!« rief er, den andern am Arme fassend, denn seine Strafe hatte er bereits vergessen.
Aber zum ersten Male in seinem Leben schlug Kai ihm diese Bitte ab.
»Geh und lauf zu deiner Mutter und zu dem Herrn mit der knarrigen Stimme!« rief er, sich ungeduldig abwendend. »Ich bin nicht dein Diener und habe nicht Lust, für dich etwas zu tun!«
Er ging eilig davon, während Klemens wieder in lautes Geheul ausbrach und dann wütend nach dem Hofjungen schlug, der ein stummer Zeuge des ganzen Vorganges gewesen war und sich jetzt herausnahm, über den kleinen Junker zu lachen.
III.
Im Schlosse zu Kopenhagen saßen in einem kleinen, prächtig eingerichteten Gemach zwei Männer beim Schachspiel. Die goldige Herbstsonne fiel durch buntgemalte Fenster und wob einen strahlenden Schein um das Gesicht des einen, der sich nachlässig in seinem reichgeschnitzten Stuhle zurücklehnte und mit prüfendem Blick auf das Brett vor sich sah. Er war ein älterer Mann, dessen scharfgeschnittenes Gesicht den Ausdruck großer Willenskraft und Entschlossenheit trug. Dichtes, leicht ergrauendes Haar bedeckte den starken Kopf und legte sich auf der einen Seite, zum Zopf geflochten, um das linke Ohr; ein starker Knebelbart verdeckte den etwas aufgeworfenen Mund, über den sich eine scharfgebogene Nase streckte. Die dunkelbraunen Augen hatten einen stolz gebietenden Ausdruck; man konnte es ihnen ansehen, daß ihr Besitzer nicht gewohnt war, Widerspruch zu ertragen. Sein Mitspieler war gleichfalls ein stattlicher dunkler Herr mit ausgeprägten Gesichtszügen und ernsthaftem Ausdruck.
König Christian der Vierte, denn er war es, richtete seine stattliche Figur auf und setzte mit rascher Bewegung einen Turm vor seinen König.
»Ihr bringt mir meinen König arg ins Gedränge, lieber Freiherr,« sagte er dann in fließendem Deutsch. »Wißt Ihr denn nicht, daß derartiges Benehmen für einen Hofmann unvorsichtig ist?«
»Und doch müssen in dieser Zeit selbst die Könige vor ihren Feinden fliehen!« versetzte der Angeredete und rückte seinen Springer so geschickt, daß der feindliche König mattgestellt ward.
König Christian schob das Schachbrett von sich.
»Ihr habt recht,« sagte er dann finster, »mit Königen und Prinzen geht man heutzutage übel um, und der Respekt mangelt vor den Gesalbten des Herrn. Doch tut Ihr nicht gut, Herr Freiherr, mich an meine Sorgen zu gemahnen, wenn ich im Spiel derselben vergessen will!«
Der Freiherr neigte das Haupt.
»Eure Majestät müssen mir in Gnaden meine Äußerung verzeihen, wußte ich doch nicht, daß Dieselben der Trübsal, die an die Pforten des Reiches klopft, vergessen wollten!«
Christian runzelte die Stirn.
»Wäret Ihr nicht ein so treuer Mann, Freiherr Rungholt, ich könnte Euch zürnen! Meint Ihr, daß mir nicht die Ohren vollgesprochen werden von der Politik aller Reiche? Wenn mein dänischer Kanzler Friis mich verläßt, kommt Reventlow, der Deutsche, und mit den Uhlfelds rede ich gleichfalls dasselbe: Politik und Politik – es ist das einzige, worüber meine Reichsräte sprechen können, und doch gibt es der Arbeit genug in meinem eigenen schönen Lande, daß ich die Händel der andern mit Freuden vergessen möchte!«
»Eure Majestät verstehen es ja, beides, die Wohlfahrt des dänischen Reiches und das Interesse an dem Auslande, miteinander zu vereinigen,« erwiderte Rungholt.
Der König blickte freundlicher.
»Ei, ei, mein lieber Freiherr,« sagte er mit gutmütigem Spott, »daß Ihr in so wohlgesetzten Worten schmeicheln könntet, habe ich nicht erwartet!«
Der Freiherr lächelte, wodurch sein ernstes Gesicht sich angenehm verschönte.
»Ich bin gestern abend bei der holdseligen Gräfin Eleonore in die Schule gegangen, und das liebliche Fräulein hat mir erzählt, daß ich ein deutscher Bär sei, der noch Anstand lernen müßte!«
Über Christians Züge flog ein behaglich freundlicher Ausdruck.
»Eleonore Christiane ist eine Zauberin und vom Höchsten mit herrlichen Gaben ausgestattet!« meinte er dann. »Korfiz wird ihr ein guter Eheherr sein!«