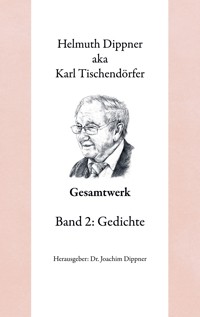Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Titel ist der erste Band der Gesamtwerkausgabe von Helmuth Dippner alias Karl Tischendörfer und enthält Erzählungen
Das E-Book Gesamtwerk 1 wird angeboten von BoD - Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
vielfältige Erzählungen,innere Konflikte,Menschliche Abgründe,Nachkriegsgeschichten,Aussteiger
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Anmerkungen des Herausgebers
Statt eines Vorwortes
Erzählungen
Der andere Gast
Greindl geht durchs Moor
Franz Holper, der Traummann
Pontecorvo
Ein eigenmächtiges Auto
Frau Duckstein überrascht ihre Familie
Gesellschaftstag beim Unterwirt in Haselbach
Franzka - auf der Suche nach sich selbst
Herr Nehls ändert sein Leben
Nachrichten aus der Kleinstadt
Konrad Leitgeb und der Seelenhändler
Gespräch mit einem Doppelgänger
Immer kam etwas dazwischen
Der Gast von Zimmer 14
Ein rätselhafter Hausgenosse
Die rätselhafte Dame Anastasia
Denkmal für einen Unbekannten
Leben mit Wolodja
Die Geschichte eines unordentlichen Lebens
Zurück zu den Wurzeln
Bekenntnisse eines Landstreichers
Es war alles an seinem Platz
Der Schlotter
Frühstück bei Claudia
Sie war wohl sehr einsam
Die Frau mit dem sechsten Sinn
Ein Wiedersehen unter alten Freunden
Leni und Aisha
Herr Binswanger nimmt Abschied
Eine unergiebige Zeugin
Vaters gutes Beispiel
Eine lebensrettende Schachpartie
Schnee auf den Inseln
Eva schlägt über die Stränge
Ein Kavalier der alten Schule
Konrad Padbergs glücklicher Sommer
Das Kernetauschen
Die Erfindung der Psychonomie
Eines Tages nannten sie ihn Moltke
Das glückliche Einhorn
Frank wollte nur nachdenken
Die beiden Leben des Herbert Stieglitz
Ein Abstecher in die Vergangenheit
Marek, Martin und Marcel
Ein Wiedersehen mit Arie van Vliet
Alle nannten ihn Alfred
Bellarmin oder Die Erfindung der Psychonomie
Ein hoch geachteter Ehrenbürger
Die Leute aus der Wilhelmstraße
Lothar Schirdewan, der Außenseiter
Sebastian Immer blickt aufs Meer
Der Onkel Jonathan
ERSATZ (Szenen aus der Nachkriegszeit)
Lebenslauf
Weitere Werke
Anmerkungen des Herausgebers
Am 27. März 2018, seinem 93. Geburtstag, nahm mich mein Vater auf die Seite. „Junge“, sagte er, „ich habe in meinem Leben so viel geschrieben, ich habe beschlossen aufzuhören. Ich fühle mich leer und habe nichts mehr zu sagen. Außerdem habe ich in meinem Alter keine Lust mehr, mich mit den jungen Schnöseln von Lektoren herum zuärgern. Denen geht es nur ums Geld und nicht um Sprache. Wenn du willst, kannst du alles von mir haben und dich selbst mit dieser Mischpoke rumärgern.“ Ich war so unvorsichtig, ja zu sagen, denn ich wusste nicht, was mich erwartete. Es war ein Schrank voll mit Manuskripten von Kurzgeschichten, Theaterstücken und sehr vielen Gedichten, gefühlt eine halbe Tonne Papier. Seinen 94. Geburtstag wollte er nicht feiern. „94 ist kein Grund zu feiern, nächstes Jahr, wenn ich 95 werde, feiern wir wieder mal im großen Stil“, waren seine Worte. Diesen Geburtstag sollte er nicht mehr erleben. Am 10. Januar 2020 verstarb mein Vater, Helmuth Dippner.
Ich stand vor einem Berg Papier und vor einem Problem: Mein Vater hatte nie in seinem Berufsleben einen Computer oder ein Textverarbeitungssystem benutzt. Alles was er geschrieben hatte, schrieb er auf seiner Schreibmaschine. Um diese Texte in einen prozessierbaren Zustand zu versetzen, habe ich während der Jahre 2018–2024, der Coronazeit und der heißen Sommer, alles gescannt, formatiert, editiert etc. Während des Korrekturlesens kam ich den Texten näher und je mehr ich las, desto mehr kam ich zu der festen Überzeugung, dass ich eigentlich sehr wenig über meinen Vater wusste. Ich hatte mir immer das Gegenteil eingebildet. Aus diesem Grund fühlte ich mich auch ziemlich befangen, ein Vorwort mit einer Würdigung zu schreiben. Deshalb habe ich einen Freund der Familie, Pfarrer Markus Geißendörfer, der auch meinen Vater beerdigt hat, gebeten, mir die Trauerrede als Vorwort zur Verfügung zu stellen. Dafür danke ich Markus.
Ein Schlüssel zu seinem Werk war ein kleines fragmentarisches Tagebuch, das ich zufällig auf der Suche nach dem Familienstammbuch fand. Es war ein Geschenk seiner Mutter zur Konfirmation am 2.4.1939. Der erste Eintrag ist vom 4.4.1939 und der letzte vom 17.9.1946. Dieses Tagebuch deckt sowohl die Zeit seiner Pubertät als auch die Zeit des zweiten Weltkrieges ab.
Die erste Erkenntnis aus diesem fragmentarischen Tagebuch war, dass er schon im Alter von 14 Jahren wusste, dass er Schriftsteller werden wollte. Der zweite bemerkenswerte Aspekt war seine beeindruckende, unverdrossene Hartnäckigkeit. Zwischen 1939 und 1944 reichte er 14 Theaterstücke und Erzählungen ein, deren Veröffentlichung alle abgelehnt wurde. Dies entmutigte ihn nicht, sondern spornte ihn an, weiter zu machen. Die Themen, die er behandelte, lassen sich anhand der kurzen Darstellungen einteilen in Fernweh und Heimweh, Liebe und Treue sowie Pflichtbewusstsein oder nordisches Heldentum. Personen, mit denen er sich beschäftigte, waren Vercingetorix, die Staufer oder Graf Götzen. Von diesen sehr frühen Werken ist nichts erhalten.
Der dritte und interessanteste Punkt war zu lernen, was er dachte und fühlte und was ihn im jugendlichen Alter prägte. Es sind dies drei Dinge, das Christentum, dem er in diesem Alter besonders kritisch gegenüber stand, die NS Propaganda eines Hans Friedrich Blunck, der in der Zeit des Nationalsozialismus verschiedene kulturpolitische Positionen unter anderem die des ersten Präsidenten der Reichsschrifttumskammer inne hatte, und vor allem aber die Romantik des 19. Jahrhunderts wie z.B. die Rheinsagen von Wilhelm Ruland.
Nach Sichtung des gesamten Materials war es nahe liegend, das Gesamtwerk in die drei Bände Erzählungen, Gedichte und Theaterstücke zu unterteilen. Der Band Erzählungen ist historisch nicht sortiert, da mein Vater sehr selten Angaben zur Datierung gemacht hat. Die Geschichte „Ersatz“, die 1945 im Zeitfenster zwischen Kapitulation und Jahresende spielt, ist sein letztes Werk und seine längste Erzählung.
Nach dem Notabitur 1944 wurde er sofort zur Wehrmacht einberufen und war in den Niederlanden und in Italien bei der Artillerie an der Front. Trotz öfteren Nachbohrens war er nicht bereit, über den Krieg und seine Erfahrungen zu erzählen. Die Erzählung „Pontecorvo“ lässt ansatzweise vermuten, welche traumatischen Erlebnisse dazu führten, nicht über den Krieg sprechen zu wollen.
In einigen Erzählungen und Theaterstücken kommt die Figur eines Landstreichers oder Hausierers vor. Für ihn waren Landstreicher aus einer verklärten Romantik heraus der Inbegriff von absoluter Freiheit. Er begegnete zeitlebens diesen Menschen mit höchstem Respekt.
Beim Band „Gedichte“ war eine grobe zeitliche Zuordnung etwas einfacher, da aufgrund des Pseudonyms Karl Tischendörfer eine Dreiteilung möglich war. Deshalb ist dieser Band unterteilt in die Kapitel „Der frühe Helmuth Dippner“, „Das Werk Karl Tischendörfers“ und „Der späte Helmuth Dippner“. Er legte sich das Pseudonym zu, als er als Journalist den Arbeitgeber wechselte und vom „Main Echo“ zur „Frankfurter Rundschau“ ging. Auf meine Frage, „Warum das Pseudonym?“ war seine Antwort, er möchte den Journalisten der Frankfurter Rundschau vom Literaten trennen.
Aus dieser Zeit stammt auch ein Briefwechsel mit Karl Krolow aus Darmstadt, der ihn ermutigte, weiter zu schreiben. Eine weitere zeitliche Zuordnung war im frühen Helmuth Dippner möglich aufgrund des benutzten Papiers, das in der Nachkriegszeit rar war. Mein Vater schrieb deshalb auf alles, was ihm in die Finger kam. Ein handschriftliches Gedicht war auf der Rückseite eines DIN A5 Formblattes des Sozialgerichts Landshut geschrieben.
Der Umzug von Landshut nach Aschaffenburg änderte auch seine Landschaftsbeschreibungen, ein weiteres Hilfsmittel der zeitlichen Zuordnung. Ich lernte beim Lesen das mir bis dahin unbekannte Versmaß der Terzinen kennen und war beeindruckt, zu sehen, dass er auch in jungen Jahren Sonette schrieb, bis er schließlich seine ihm eigene Bildsprache entwickelte, zu der vermutlich auch der enge Kontakt mit der Künstlerszene in Aschaffenburg und die Freundschaften mit Siegfried Rischar und Joachim Schmidt beigetragen haben.
Mein Vater liebte die Kunst, egal ob Musik, Literatur, Malerei oder Theater. Er war ein großer Freund des Boulevardtheaters, in das er gern mit der Familie ging, soweit es seine Zeit erlaubte. Seine Theaterstücke lassen sich ebenfalls kaum zeitlich zuordnen. Das älteste Stück „Der vierte Mann am Tisch“ ließ sich anhand der Papierqualität zuordnen. Vom Stück „Zur letzten Station“ gibt es drei verschiedene Schlussszenen. Hier ist dank einer zufälligen Datierung die letzte Version abgedruckt.
Ich wünsche allen Lesern viel Freude am Werk eines der letzten Romantiker.
Rostock 2025
Dr. Joachim Dippner
Statt eines Vorwortes
Liebe Trauergesellschaft,
liebe Inge, lieber Joachim,
ich erinnere mich noch gut, als er sich mir vor 27 Jahren vorstellte, damals war er gerade drei Jahre im Ruhestand und er nannte mir gleich die gesamte Biographie: Sein Kommen aus dem Rheinland, seine erste Stelle in Landshut bei der „Isar Post“, dann „Main Echo“ mit dem mühsamen Umzug hier her nach Aschaffenburg und nächtlichen Ankunft, wie es damals noch war, in der zerstörten Stadt der Kleiderfabrikanten, dann die Chance bei der Frankfurter Rundschau, verantwortlich für die Seiten 1 und 2. Als Abschluss seiner Laufbahn sei bei der kassenärztlichen Vereinigung gewesen und, weil er nie die Chance hatte zu studieren, macht er eben jetzt Geschichte im ich weiß nicht wievielten Semester. Dann kannte er alle Künstler Aschaffenburgs und Ihre Geschichten, seine Frankreichfahrten, konnte innerhalb seiner Reiseerzählungen immer gleich die Literatur nennen, die genau diese Landschaft beschrieben hatte und die regionalen Färbungen der entsprechenden Fremdsprache präsentieren. Er überfuhr einen mit seinem Wissen, mit seinem Auftreten, mit seiner Sprachgewalt und seinem Humor. Die Show war perfekt.
Aber auch anstrengend. Nie langweilig und er wiederholte sich dabei nicht. Ihre Mutter stand oft daneben und man hatte oft den Eindruck, dass sie ihn einbremsen musste in seinem überschäumenden Wesen und Wissen, das er nie vernachlässigte und immer und immer anreicherte.
Ob es Medizin war und man lernte von ihm Fachbegriffe. Seine Diagnosen waren so berichtet, dass eine längere Übersetzungsarbeit notwendig wurde. Seine Referieren über Reformationsgeschichte ließen jeden Theologen alt aussehen. Dann wieder Rilke und Brecht und dann seine eigenen schriftstellerischen Arbeiten, vor allem kleinere Gedichtbände.
Helmuth Dippner war ein Vulkan von Worten. Ich fand das immer sehr amüsant und dabei sehr bereichernd. So werde ich ihn auch in Erinnerung behalten.
Er stellte seine Sprache anderen zur Verfügung: Künstlern, dem Diakonischen Werk, dem Bildungswerk. Er war ehrenamtliches viel unterwegs und die Solidarität mit der Christuskirchengemeinde begleitete ihn, für die er viele Jahre ein streitbarer und kompetenter Kirchenvorsteher war. Er war immer ein überzeugter Protestant. Die Betonung lag auf Protestant. Und die Sprache war seine Art, sich zu zeigen, so ordnen und Dinge voranzutreiben und zu korrigieren. Seine Art, knapp Worte zu setzten, sie zu konzentrieren, vom allgemeinen Plauderton bis in die lyrische Verknappung. Helmuth Dippner war ein Mensch der Sprache, er verschieb sich ihr. Und: Er hatte einen wunderbaren sarkastischen und etwas arroganten Witz. Das war manchmal sehr wohltuend.
Sprache ist bekanntlich ein Mittel der Kommunikation. Was steckte hinter seiner Freude und Lust an der Sprache?
Sicher, das Wissen, dass er das konnte. Er konnte vier Fremdsprachen. Seine Ausdrucksweise war sicher in den Sätzen, in den Begriffen und wusste, wie man auf den Punkt kam. Man musste ihm nicht immer Recht geben, weiß Gott nicht, aber man wusste immer, was er sagen wollte.
Sicher war es die Suche nach Anerkennung. Er litt immer darunter, dass er nicht studieren konnte. Seine Mutter wollte nach dem Krieg die Kosten nicht aufbringen. Deshalb war er sehr stolz und vielleicht auch mit sich innerlich versöhnt, als er im Ruhestand einen Magister machen konnte. Damit erfüllte er sich einen großen Wunsch. Vielleicht stand hinter diesem Verlangen die Angst, doch nicht mit wirklichem Wissen aufwarten zu können. Das war natürlich überflüssig.
Sicher aber verbarg sich dahinter eine intensive Suche nach Wahrheit und ganz gewiss suchte er nach Nähe. Vielleicht war die Tragik seines Lebens, dass man das nicht gleichzeitig haben kann oder nicht gleichzeitig von jedem, so ließ sein Wesen immer eine Einsamkeit spüren, aus der man ihn auch nicht herausholen konnte. Zu sehr schlugen dieses beiden Herzen in seiner Brust, die Absicht, bewundert zu werden und die Suche nach Vertrautheit. Letztlich ist es die Idee, asymmetrische Beziehungen und partnerschaftliche gleichzeitig zu haben. Er konnte nicht von einen oder anderen Abschied nehmen um seine innere Einsamkeit zu überwinden.
Vieles seines Lebens ist aus der Nachkriegsgeneration verständlich. Man brauchte unbelastete Menschen, die sehr schnell Verantwortung übernehmen mussten. Umgekehrt muss man auch sagen, hat er in seinem Leben Positionen erreicht, die heute mit dieser Voraussetzung überhaupt nicht mehr denkbar wären. Er hatte wache Ohren und Augen und wusste dann, wann sich die Gelegenheit ergab, etwas Neues zu erreichen. Deshalb hat der Beruf des Journalisten sehr zu seinem Wesen gepasst.
Und: Er wollte leben. Ja, das ist vielleicht sein Motto gewesen. Er heiratete, Ilse Walschus, die aus Schlesien kam und in Landshut neu anfangen musste und mit Helmuth Dippner ihr Schicksal, in der Fremde zu sein, teilte. Beide gründeten eine Familie. Joachim und Inge wurden noch in Landshut geboren. Die Großmutter wohnte in der Wohnung dabei. Helmuth Dippner brauchte eine gewisse Geschwindigkeit und war immer unterwegs. Auch das gehörte zu ihm. Viele Reisen wurden unternommen und unzählige Bekanntschaften und Freundschaften geknüpft, das Ehepaar war bekannt in der Stadt.
Und noch etwas anderes dürfen wir nicht vergessen. Er war sehr gläubig. Sicher auf seine Art, sicher mit allen Fragen eines aufgeklärten Menschen und mit der dazu gehörenden Neugierde, und deshalb liegt es nahe gerade einen Satz aus dem Kolosserbrief seiner Beerdigungspredigt zu Grunde zu legen:
Der Briefschreiber wendet sich an die Gemeinde in der heutigen Türkei:
„Ich wollte euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um Euch führe und um die in Laodizea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchen verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.“
Wahrscheinlich ein Schüler des Paulus und Helfer schreibt diesen Brief um die Herzen der Menschen in Kolosä zu stärken und die Liebe, damit sie das Geheimnis Gottes erkennen. Es ist Christus, in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. So der Brief, der in einer (für uns nicht mehr so tröstlichen) geschwisterlich, betulichen Sprache verfasst ist. Jetzt kann man fragen: „Was ist Christus“, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind? Und an der Stelle halte ich jetzt inne, denn ich frage mich, ob Helmuth Dippner diese Frage gestellt hätte oder er aus Respekt vor einer religiösen Erfahrung davor zurückgeschreckt hätte. An der Stelle hatte er einen sehr weichen gläubigen Kern, und ein hohes Maß an zerbrechlicher Sensibilität. Aber er hat immer die Überzeugung ausgestrahlt, dass er eine tiefe Gottesbeziehung gelebt hat. Diese ist mit dem Symbol „Christus“ ausgedrückt, und dazu gehört für auch, dass die Geheimnisse auch im Leiden zu finden sind.
Im Leiden wurde bei ihm das nachgängige Entsetzen über die Herrschaft der NS ausgedrückt und diese Geschichte war ein Zugang zur Religion. Leiden und Gottesnähe gehörten zusammen, das konnte man an den vielen Gesprächen mit ihm heraushören. Umgekehrt macht ein sol ches Empfinden wiederum anderes verständlich, wie seine Verletzlichkeit, seine Spontaneität, seine künstlerischen Ambitionen und seine Unberechenbarkeit und seine soziale Ader. Immer wieder bekamen wir den Eindruck, dass er Menschen suchte, denen er helfen konnte. Aber er war öfters von Ideen geleitet war, die in die Irre führten und die eigentlichen Aufgaben aus dem Blick verlor.
In den letzten Jahren verabschiedete er sich zusehend von seinen Mitmenschen, man erlebte wache und verdunkelte Stunden mit ihm. Er ist sehr alt geworden, sehr alt und eigentlich hätte er, bei seiner gesundheitlichen Vorgeschichte und (wir erinnern uns alle, an den Unfall mit dem Linienbus) Malaisen, die ihm widerfuhren, nicht so alt werden dürfen. Aber der, der uns das Leben begreifen lässt, hat ihn viel erleben lassen und hat ihm seinen Willen zum Leben reichlich bedient.
Wir müssen uns verabschieden, ihn hergeben, uns um das kümmern, was er hinterlassen hat, und darum kümmern, was er in ihnen und in uns hinterlassen hat. Zum Abschiednehmen gehört auch immer das Verzeihen, sonst können wir nicht loslassen. Er war anregend und belebend, er zog manchmal Gedanken und Bahnen, die wir nicht so wirklich verstanden. Wir haben ihm viel zu verdanken. Er wollte leben, er hat andere leben lassen und er hat gelebt. Wir sollten seinem Motto folgen. Amen
Aschaffenburg 20.1.2020
Pfarrer Markus Geißendörfer
Erzählungen
Der andere Gast
An einem warmen Frühlingstag des Jahres 1946 ging ein grauhaariger Mann durch die Strassen von Straubing. Er schritt nur langsam aus, ohne indessen an einem der spärlich dekorierten Schaufenster länger zu verweilen. Er trug keinen Hut; seine strähnigen Haare waren lange nicht geschnitten und reichten weit in den Nacken. Er war mit einem abgetragenen, grünen Lodenmantel bekleidet, an einem Trageband hing ein wenig gefüllter Brotbeutel, Die Beine steckten in engen grauen Hosen, die unten aufgescheuert waren. Die klobigen Stiefel waren staubbedeckt und nur der rechte Absatz trug ein Eisen, das bei jedem Schritt hell aufklang, während der Schritt des linken Fußes stumm blieb.
In einer entlegenen Gasse betrat er eine kleine Wirtschaft. Es war um die Mittagszeit und er bestellte ein billiges Essen. Die dicke Wirtin, die, in eine fleckige Schürze eingehüllt, bislang strickend hinter der Theke gesessen hatte, stellte einen grauen Teller mit einem Gemisch aus Steckrüben und harten Kartoffeln vor ihn. Das Gericht nannte sich "Goldrübchen" und verbarg hinter seinem märchenhaften Namen die magere Wirklichkeit. Der Mann aß das stark nach einer Gewürz-Essenz duftende Gemisch gedankenlos und unaufmerksam. Die Wirtin beobachtete ihn heimlich. Sie hatte in den Jahren ihrer Arbeit in fremden und eigenen Gasthäusern viele Menschen kommen und gehen sehen und wusste bei ihren Gästen bald, wen sie vor sich hatte. Dieser Mann sah wohl verwahrlost aus, aber er war gewiss kein Strolch. Wie mochte er auf die Strasse gekommen sein? In dieser Zeit, in der alles aus den Fugen ging, erlebte man so viel und hörte von so manchem schweren Schicksal, dachte sie melancholisch. Ein Stammgast betrat mit vertraulichem Gruß die Gaststube und setzte sich zu dem Fremden an den Tisch. Als sie ihm das Essen brachte, gab es sich nahezu von selbst, dass sie bei den Männern Platz nahm und ein Gespräch begann. So hörte sie dann von dem Fremden, der in kurzen Sätzen sprach und so tat, als ob er manches Mal lange nach dem passenden Wort suchen müsse, dass er aus Winterberg im Böhmerwald stamme und aus der Gefangenschaft entflohen sei. Er habe weder Verwandte noch Bekannte und schlafe meist in den Übernachtungsheimen der wohltätigen Verbände oder in den Heuschobern der Bauern. Sie betrachtete den Mann aus der Nähe. Sein Gesicht war mager, faltig und hart, in den Augen saß die Trauer wie an dunklen Seen; in den Mundwinkeln nistete der Verzicht. Die braunen Hände, die gefaltet auf der Tischplatte lagen, sprachen von schwerer Arbeit, diese harten, zerschundenen Hände. Er hatte wohl gemerkt, dass sie seine Hände betrachtete, denn er versteckte sie plötzlich in den Jackentaschen.
Da fiel ihr Frau Biberger ein, ja natürlich, dass sie daran nicht schon eher gedacht hatte. Frau Biberger suchte einen Zimmerherrn, einen anständigen, gediegenen Mann. Sie war viel zu früh Witwe geworden und auch noch nicht zu alt. Vielleicht ging da etwas zusammen.
Sie stand eilig auf und ging so schnell es ihre arthritischen Knie erlaubten in die Küche, um das Küchenmädchen zu Frau Biberger zu schicken. Sie schenkte noch ein Glas Bier ein und stellte es dem Fremden mit freundlichem Blinzeln hin. Er möge nur trinken, es gehe auf ihre Rechnung.
Als Frau Biberger überrascht und fragend die Gaststube betrat, wurde sie von der Wirtin beiseite genommen. Sie redeten eifrig und leise miteinander; bisweilen schauten sie beide zu den Männern hinüber, prüfend und überlegend die eine, lobend und zuredend die andere. Endlich schienen sie sich einig zu sein. Stolzgebläht wie eine Viermast-Fregatte vor dem Winde segelte die Wirtin auf ihren Gast zu. Frau Biberger folgte bescheiden im Kielwasser. "Ich hab’ schon was für Sie", sagte sie und neigte sich vertraut zu ihm herab. "Frau Biberger" - sie schob ihre Nachbarin in den Vordergrund - "Frau Biberger" hier hat gerade ein möbliertes Zimmer frei. Sie können als Zimmerherr einziehen, wenn Sie wollen. - Ist das nicht ei n Glück?
So ein Zufall, nicht wahr, das sagen Sie auch?" wandte sie sich Lob heischend an den Stammgast. Der Fremde sah bei dieser überraschenden Mitteilung eher erschrocken als erfreut aus. "Ja, geht denn das so ohne weiteres? - Ich weiß nicht, ob ich das annehmen kann. Sie kennen mich doch gar nicht." "Man lernt seine Untermieter immer erst später richtig kennen", sagte Frau Biberger lachend und der warme Ton in ihrer Stimme hüllte ihn wie ein Mantel ein. Er würde später immer an diese erste Begegnung denken, wenn der abgestandene Geruch von Bier und kaltem Tabaksqualm und der saure Dunst schlechten Essens sich mischten. Er sträubte sich nicht mehr lange, schon um dem Bannkreis von Selbstgefälligkeit zu entfliehen, den die feiste Wirtin ausstrahlte.
Das Zimmer war lang und schmal und machte den gleichen sauberen Eindruck wie die ganze Wohnung der Frau Biberger - Veronika Biberger hatte er auf dem Namensschild an der Tür gelesen. Er fand es an der Zeit, sich nun vorzustellen und nannte sich Georg Maurer. "Legen Sie nur ab", sagte Frau Biberger. "Ich bringe gleich Wasser. Sie werden sich sicher waschen wollen."
Er blickte sich in dem Zimmer um: ein weißes Metallbett, von einer aus dicker Wolle gehäkelten Decke überzogen, ein dunkler massiver Schrank, ein runder, brauner Tisch und ein Stuhl von gleicher Farbe, in dessen Beinen der Holzwurm nagte, ein Waschtisch mit halberblindetem Spiegel, Wasserkanne und Schüssel, die ein lila und blassgrün ausgemaltes Blumenmuster zierte. Über dem Bett hing der stockfleckige Druck eines billigen Bildes aus der nachromantischen Zeit. Sein Titel "Frühlings Erwachen" stand mit verschnörkelten, blassen Buchstaben darunter. Das Zimmer war, obwohl sicher seit langem nicht mehr benutzt, sauber und ordentlich aufgeräumt.
Im Laufe des Nachmittages hatte Maurer bei Frau Biberger das gleiche neugierige Verhör zu bestehen wie vorher in der Wirtschaft. Es ergab sich dabei, dass er sich anmelden müsse, aber keine Ausweispapiere bei sich trage. Nach seiner Flucht aus der Gefangenschaft schien das völlig verständlich. Eine Arbeit brauche er wohl auch, meinte Frau Biberger und fragte, was er von Beruf sei. Er erzählte bereitwillig, dass er Möbelschreiner gelernt habe, sich aber schon seit langer Zeit mit dem Bau von Geigen beschäftigt und eine eigens dafür eingerichtete Werkstatt besessen habe.
Frau Biberger ihrerseits erzählte von ihrem Mann, der in den ersten Monaten des Krieges als Bahnbeamter bei einem Zugunglück ums Leben gekommen sei. Sie zog aus einer Schublade einen Stoß alter Fotografien, die sie vor Maurer ausbreitete. Das Hochzeitsbild, Familienaufnahmen, Bilder von Ausflügen und im Badeanzug, Fotos von Geburtstagen und Feiern, auf denen steif sitzende Damen würdevoll auszusehen versuchten, wobei sie ihre Knie, die wegen der kurzen Kleider jener Jahre zumeist unbedeckt blieben, krampfhaft zusammenpressten, das Bild eines Kindes schob sich dazwischen ("Er ist mit einem Jahr gestorben"), Herr Biberger tauchte unter dem Brustbild einer hässlichen Nichte auf: Ein stattlicher Mann mit Seehundsbart in Eisenbahner-Uniform. Zwischendurch flocht seine Witwe ein, dass die karge Pension natürlich nicht zum Leben ausreiche und dass sie deshalb ihr früheres Gästezimmer ermiete. Sie wolle sich aber, wenn möglich, ihre Zimmerherren selbst aussuchen und nicht jeden nehmen, der ihr zugewiesen werden.
Nun wussten der fremde, schweigsame Mann und die einsame Frau schon manches voneinander. Ihre Hände hatten sich zufällig beruht und der Atem des einen hatte beim Betrachten der Bilder das Gesicht des anderen gestreift. Ganz beiläufig wurden sie sich über den Preis für das Zimmer einig. Maurer musste sich noch anmelden, damit er für die Behörden überhaupt eine lebende Person sei und er brauchte eine Arbeit. Frau Biberger kannte eine Schreinerei, deren Meister in Kriegsgefangenschaft war und in der ein tüchtiger Mann gebraucht werde. Sie ebnete ihm alle Wege, wies ihn zu den richtigen Amtsstellen und fand sogar noch zwei Anzüge ihres Mannes, die leidlich passten. Das war in zwei Tagen geschehen und am Montagmorgen um sieben Uhr begann Maurer in der Schreinerei Kurz zu arbeiten.
"Ich bin Ihnen sehr viel Dank schuldig", sagte er an jenem Montagabend nach dem Essen. "Sie haben für mich gesorgt, wie eine Frau für ihren heimgekehrten Mann sorgen würde. Ich weiß nicht, womit ich mir das verdient habe und ob ich es Ihnen jemals entgelten kann." "Irgendjemand musste Ihnen helfen. So konnte es mit Ihnen nicht weitergehen." "Mir kann niemand helfen". Er sagte es leise und wie zu sich selbst. "Das sollen Sie nicht sagen. Es ist undankbar." Maurer erschrak und als ob er zuviel gesagt habe, beeilte er sich, ihr beizupflichten und sich zu entschuldigen. Frau Biberger aber blieb bei ihrem Thema und sprach von Christenpflicht und Kirchenbesuch. Maurer hörte indessen nur mit halbem Ohr zu und warf belanglose Redewendungen wie "ja, ja", "Natürlich", "Sie haben ganz recht" und was dieser Ausweichworte mehr sind, wie kleine Steine in den Fluss ihrer Rede, Spielzeug der eifrig dahinplätschernden Wellen.
Einige Tage später brachte ein Mann einen alten Schrank, ein ehrwürdiges Möbelstück aus dem Hausrat seiner Eltern, in die Schreinerei und bat, die unmodernen Schnörkel, die Rosenleisten und die erhabenen Kanten wegzunehmen, um dem Schrank ein Gesicht zu geben, das zu seinen übrigen Möbeln passe. Maurer erschrak: Er hatte zu Hause einen Schrank mit diesem Muster besessen und er sah Lina daran hantieren, wie sie die Wasche hineinschichtete und seine Anzüge zum Ausbürsten herausnahm. Er starrte den Schränk an und vergaß ganz des Kunden, der Maurer verwundert betrachtete und dann fragte, wann er den Schrank abholen könne. Maurer erwachte und gab irgendeinen Zeitpunkt an. Später musste er den Lehrling fragen, bis wann er dem Mann versprochen habe, mit der Arbeit fertig zu sein. Maurer werkte mit einem solchen Eifer an den Schrank hin, dass er schon am nächsten Mittag zu dem Kunden schicken konnte: Der Schrank sei fertig. Er wollte das Möbelstück, das ihn so jäh an die Vergangenheit erinnert hatte, aus seinen Augen fortschaffen.
In der nächsten Nacht träumte er zum ersten Mal seit vielen Monaten: Er stand vor dem Schrank und öffnete ihn, da stand Lina darin, aufrecht und ein wenig starr. Sie hatte die Augen ganz geöffnet, die blicklos ins Weite schauten. Die Augen traten ein wenig aus den Höhlen hervor; dunkle Sterne in einem milchweißen Himmel. Wie eine Spielzeugpuppe, die aufgezogen wird, öffnete sie mechanisch den Mund und sagte mit fremder Stimme: "Du lügst". Dann flog die Schranktür, von einem Windstoß bewegt, den er körperlich, kühl spürte, wieder zu. Er schrie auf. -
Beim Morgenkaffee schaute Frau Biberger ihn verschüchtert an. Er war blass und um die Augen lagen wie Handschellen dunkle Ringe. "Sie haben heute Nacht wohl schwer geträumt", fragte sie leise.
"Ja" sagte er verlegen und schaute in die Kaffeetasse.
Die Angstträume kamen wieder. Es schien, als ob eine Mauer in seiner Seele niedergerissen worden sei, hinter der bislang allerlei widerliches und gemeines Gedanken- und Erinnerungsgeschmeiß eingekerkert war, das nun ungehindert über den Spiegel seiner Seele laufen konnte, wo es seine Spuren als hässliche Träume hinterließ.
Einmal sah er Lina auf einem steilen, unzugänglichen Gipfel stehen, von einem grauen Schleier wie von Nebelfetzen umwölkt. Er versuchte, mühselig über Geröll und Felsbrocken zu ihr empor zuklettern. Immer wenn er noch eine Handbreit unter dem Gipfel war, trat Herr Wende hinter ihr hervor und schlug ihn mit einem schweren Hammer auf den Kopf, dass er wieder bis ins Tal hinunterstürzte. Dazu lachte Wende sein meckerndes Lachen, das sich in einem Echo siebenmal brach.
Sein Schlaf glich einer Folterkammer. Tagsüber arbeitete er wie eine Maschine, um abends abgerackert zu sein und so die Träume von seinem Lager zu bannen. Es half nichts. Vor Tag kroch das Gewürm über seine Bettdecke und überfiel ihn. Er sah müde und krank aus. Die Backenknochen, über denen sich die trockene, gelbe Haut spannte, traten deutlich hervor, um den Mund bildeten sich harte Falten. Frau Biberger betrachtete ihn mit Besorgnis und das Mitleid brach sich in ihrem mütterlichen Herzen Bahn.
Nach einem schweigend eingenommenen Abendessen aus saurem, schwarzem Brot und krümeligem Quark sagte sie: "Sie verbergen etwas vor mit" und legte ihre Hände auf seine Oberarme. Er zog sie ungestüm an sich. Sie, seit Jahren jeglicher liebenden Zuneigung entwöhnt, schrie leise auf, doch dann legte sie sich in seine Arme und duldete, dass seine zitternden Hände ihr über Haar und Schultern streichelten.
An den Sommersonntagen machten Maurer und Frau Biberger jetzt Spaziergänge. Sie folgten lange gewundenen Waldpfaden und kehrten in Dorfwirtschaften ein. Auf einem dieser Spaziergänge fand Maurer während einer Rast im warmen Gras eines versteckten Waldwinkels eine leblose Raupe. Sie zerbrach unter seinen Händen und es zeigte sich, dass ihr Inneres ausgehöhlt war. Nur die harte Schale war geblieben. Er erklärte Frau Biberger, dass es eine Wespenart gebe, die eine Raupe durch einen Stich lähme und dann ihre Eier in den Leib der Raupe versenke. Die ausschlüpfenden Maden fräßen die Raupe von innen heraus und durchbohrten nach der Wandlung zur Wespe die Schale, die als entleertes, hartes Gehäuse zurückbleibe, Frau Biberger schauderte vor soviel Grausamkeit. Maurer aber setzte, für sie unverständlich hinzu: "Es gibt Menschen, die von den Maden der Lüge so leer gefressen sind wie diese Raupe."
Über den Wochen der Lust, die das Leuchten in Maurers Augen zurückgetragen hatten, kam der Herbst, der große Wandler. Das Äußerliche fiel ab. Aus der lodernden Glut des Anfanges war das Eintönige der Gewohnheit geworden. Mit den ersten Nebeln wehten Maurers Träume grau und feucht wieder in seine Nächte hinein.
Eines Morgens erwachte er nach einem Traum, in dem ein Mann, der sich zwischen Baumstämmen verbarg, ihn mit dem Namen Gregor Mittenzwey angerufen hatte. Es war vier Uhr früh und der Schlaf war für den kargen Rest der Nacht geflohen. So blieb er liegen und trachtete, die Gegenstände im Zimmer zu erkennen. Er machte den Schrank aus und den Waschtisch, dann starrte er bewegungslos zur Decke und in einem Schwebezustand zwischen Traum und Wachen erlebte er noch einmal die Zeit mit Lina Grau. Er war weiß Gott kein Bettler, der Geigenbauer Gregor Mittenzwey. Er besaß am Rande von Passau ein Haus und die Tannen dahinter und den Mond überm Dach. Sein Geschäft ernährte ihn auch in den Jahren nach dem Krieg. Da wehte der böhmische Wind, der über den Arber und den Lusen pfeift, ihm eines Tages eine hübsche, junge Frau ins Haus: Lina Grau. Die fegte den Staub und die graue Trübsal der einschichtigen Jahre aus den Stuben, riss die Fenster auf und ließ die kräftige Luft vom Walde, den Sonnenschein und das Lachen ein. Er war 42 und sie etwa 3o Jahre alt und sie gewannen sich lieb. Einige sonnenüberglänzte Gipfel ragten aus der nebligen Niederung der Vergangenheit heraus: Mit Lina auf der Festung Oberhaus stehen, die Stadt auf dem Rücken zwischen Donau und Inn vor sich, das helldunkle Gewirr und Gewinkel von Türmen und Dächern, aus denen der sanfte Rauch aufsteigt, an der höchsten Stelle der große Dom, vorne am Strom das fremdländische Rathaus; dann eine Stunde auf der Saldenburg, das dunkel wogende Auf und Ab der Waldberge, die schmalen, von Tannennadeln glatten Wege nach Fürstenstein und zur Engelburg, das schwarz glänzende Auge eines verschwiegenen Weihers, und plötzlich der zeternde Huf eines Eichelhähers, vor dem sie so erschrak; dann ein Wintertag in Hacklberg, mit dem Schlitten in kühner, sausender Fahrt zu Tal, ihr Schrei hinter ihm, in dem sich Furcht und Freude mischten, der Weg den Bang hinauf, oben stehen im eisigen Wind, der den Himmel leergefegt hat und in dem die Kälte wie mit Glasscherben klirrt.
Später kam jener Mann ins Haus, der Franz Wende hieß und mit allem handelte, das gut und teuer war. Er brachte zunächst Kaffee mit und Süßigkeiten, später Büchsen mit Hammelfleisch und Bohnen, schließlich Strümpfe und Seife. Sie gingen zu dritt ins Kino oder ins Theater, sie unterhielten sich manchen Abend zusammen. Wenn er zu arbeiten hatte, kam es auch vor, dass Lina nur mit Wende ausging. Er fand nichts dabei, nur die Geschenke gefielen ihm nicht. Er erinnerte sich, dass er vor Jahren einmal eine schlichte Geigenmelodie geschrieben hatte. Er kramte die Noten heraus, feilte, übte und dann hatte er die Melodie soweit aufpoliert, dass er sie Lina schenken konnte. Sie kam mit Wende heim, der sich im Hausflur verabschiedete. Sie standen reichlich lange zusammen, fast zu lange für einen Mann, der mit einer Geige in der Hand wartet. Dann endlich huschte sie herein. Er begann zu spielen und schaute sie an. Sie warf ihre Mütze in den Schrank, den Mantel über den Stuhl, lief ein-, zweimal durchs Zimmer, blieb vor ihm stehen und entriss ihm die Geige, warf sie auf den Boden, trampelte wie irrsinnig darauf herum und schrie dazu: "Ich hab’s satt, Schluss mit der Spielerei, Schluss, Schluss, Schluss mit allem. Ich hab's satt, die ewigen Belehrungen, der sanfte Hundeblick, das leibhaftige schlechte Gewissen". Sie trampelte weiter auf der Geige herum und unter ihren Füßen zerbrachen die Töne schrill und schmerzlich. "Ich hab das alles satt, endgültig ..." Weiter kam sie nicht. Seine Hände hatten die Kraft eines Schraubstockes. Seit jenem Abend war Gregor Mittenzwey ein Landfahrender, der Taglöhnerarbeit tat und in Scheunen oder auch im Straßengraben übernachtete. Irgendein Geräusch riss ihn aus dem Dämmern. Er sah wieder den Schrank und den Waschtisch, hörte ein Geräusch von nebenan und wusste, wer dort schlief. Sie wärmte sich vielleicht an der Hoffnung, die Harmonie werde noch lange so rein und ungetrübt bleiben. Sie vermutete, dass die Erinnerungen an seine angebliche Haft ihn hier und da bedrückten und sie hatte, aus Mitleid oder Liebe, gleichviel, versucht, ihn durch ihre Hingabe abzulenken, seinen Geist zu fesseln, vor die kahle Gefängnismauer einen Rosenstrauch zu pflanzen. Er durfte sie nicht merken lassen, dass für diese Rosen der Herbst ebenso galt wie für die in den Gärten, dass - um bei ihrer Vermutung zu bleiben - das bedrohliche Grau der Mauer wieder durch die sich allmählich entlaubenden Äste des Rosenstrauches hindurch drang. Sie durfte nicht merken, dass ein unsichtbarer Gast mit ihnen am Tisch saß, ein hartnäckiger Gast, der durchs Schlüsselloch wieder hereinschlüpfte, wenn man ihn durch die Tür hinausgeworfen hatte, der einem nachlief, wenn man, seiner Nähe überdrüssig, das Haus verließ, der nachts zu Häupten des Bettes saß und an unsichtbaren Fäden die Träume lenkte. Er wusste selbst nicht zu sagen, wie lange er die vorwurfsvolle Gegenwart dieses ewigen Gegenübers noch ertragen konnte.
Er wusste nur, dass der Tag nicht mehr fern war, an dem er der Raupe glich, die von den Maden der Schlupfwespe ausgehöhlt, in irgendwelchen Händen zerbrach. Als er mit seinen Gedanken diesen Punkt erreicht hatte, sprang er aus dem Bett, schlüpfte in Herrn Bibergers Hausschuhe und begann im Zimmer auf und ab zu gehen. Die alten Dielen knarrten laut und störend. Sollte er nun so weiterleben, in der nagenden Angst vor sich selbst, weiter den leidgeprüften Mann Georg Maurer spielen, dessen sich eine mitleidige Frau angenommen hatte, die er dann eines Tages, aus Mitleid oder Verpflichtung oder um dem Gerede der Nachbarschaft ein Ende zu machen heiratete? Oder sollte er diesem Leben aus der Lüge ein mutiges Ende setzen? Konnte er Veronika alles erklären oder war es vielleicht besser, so plötzlich, wie er in ihr Leben getreten war, sich wieder daraus fortzustehlen? Vom Knarren der Dielen geweckt, war Frau Biberger aufgestanden und zu seinem Zimmer hinüber gegangen. Er musste das Klopfen überhört haben denn sie stand plötzlich unter der Tür. "Was machst du denn nur?" Er fuhr herum und ging mit zwei, drei großen Schritten auf sie zu. Sie hatte eine schlecht brennende Taschenlampe in der Hand, die er ihr abnahm und löschte.
"Ich habe an dich gedacht", sagte er. Dann hob er sie vom Boden hoch und trug sie in ihr Zimmer zurück.
Am nächsten Morgen ging der Mann, der sich seit einigen Monaten Georg Maurer nannte wie an jedem Tage aus dem Hause der Frau Biberger fort. Er trug noch immer den alten, grünen Lodenmantel und sein Haar war noch um einiges heller geworden. Die grauen, engen Hosen waren geflickt und die schweren Schuhe geputzt. Auch fehlte das Eisen am linken Schuh nicht mehr. Den Brotbeutel allerdings hatte er zu Hause gelassen. Er ging nicht zur Arbeit in der Schreinerei Kurz, sondern bog an der nächsten Straßenecke ein und wandte sich dem Ludwigplatz zu.
Der Polizist in der Wachstube riss eben das Kalenderblatt ab. Man schrieb den 12. November und der Mann lächelte überrascht. Auf die Frage des Beamten nach seinem Begehren sagte er: "Ich bin der Geigenbauer Gregor Mittenzwey aus Passau. Ich habe heute vor einem Jahr in meiner Werkstatt die Witwe Lina Grau aus Eifersucht erwürgt und die Leiche in einem Luftschacht des Hauses versteckt!" Und dann, straff aufgerichtet und mit Würde: "Ich stelle mich freiwillig".
Greindl geht durchs Moor
Eine Rauhnacht-Erzählung
Der Schnee war in jenem Winter so selten wie ein Kalb mit fünf Beinen, Das Jahr schien sich in einem immerwährenden Novembernebel leise fortstehlen zu wollen. Wie unförmige Schiffe, die ihren Hafen verloren haben, zogen die Nebel langsam und ziellos übers Moor. Das alte Jahr stand noch auf zwei Tagen. An solchen Abenden saßen nur wenige Gäste beim Ochsenwirt in der Stube. Einsilbig hockten sie hinter den Gläsern und der als erster ging, war der Greindl. Er schlüpfte in seinen schwarzen Überrock, strich mit der rauen Hand über das struppige Haar und stülpte den Hut auf den Kopf. Er knurrte ein paar Abschiedsworte, denen der Wirt seine Wünsche für ein gutes Neues Jahr anschloss. Dann humpelte der Greindl zur Tür, auf seinen Stock gestützt, so wie man ihn seit etwa 30 Jahren kannte, seit ihm im Krieg das rechte Knie zerschossen worden war. Draußen verschlang ihn der Nebel. Er ging in ihn hinein wie in einen grauen Sack.
Man musste die Gegend sehr gut kennen, wenn man sich an einem solchen Abend durch das Moor zu gehen traute. Aber wenn einer das Moor kannte, dann war es der Greindl. Seit über 20 Jahren, seit er die Lechner Wally geheiratet hatte, wohnte er auf der Einöde Voglau mitten im Moor und er war in der ganzen Gegend bekannt und beliebt als Viehhändler.
Er stapfte durch den Nebel und berechnete die Kosten für einige Reparaturen, die im neuen Jahr nötig waren. Dabei achtete er nicht auf den Weg, denn er vertraute ihm blind und um diese Zeit war hier niemand mehr um die Wege. In den Rauhnächten soll zwar allerlei Gelichter sein Unwesen treiben, aber Greindl glaubte nicht an die grauen Märchen, die in den abendlichen Mägdestuben flüsternd erzählt wurden.
Da stand einer am Weg, ein Mannsbild, dunkel und ungeschlacht. Greindl blieb stehen und fasste den Stock fester. Er kniff die Augen zusammen, um den Fremden besser zu sehen. Er erkannte ihn aber nicht; er hörte nur plötzlich sein Herz in den Ohren hämmern.
Da fühlte er sich angesprochen. Er nannte seinen Namen: "Greindl, Quirin, 62 Jahre alt, Viehhändler von Voglau. I bin der Greindl. Kennst mi net?" Der Andere schien ihn zu kennen. Greindl wollte näher herangehen, aber er konnte die Füße nicht bewegen. Jetzt wollte der andere wissen, ob sich Greindl noch an die Weihnachtspredigt in der Kirche erinnern könne. Greindl erzählte etwas vom Frieden auf Erden, aber das wollte der Andere nicht wissen, sondern jene Sätze, in denen der Pfarrer davon gesprochen hatte, jeden Streit, jeden Zwist und allen Hass im alten Jahr zu beseitigen und zu begraben. Ob er, Greindl, keinen Streit mehr auszutragen habe? "Nein" sagte er. "Ich bin bekannt und beliebt. Ich hab keinen Feind im ganzen Land."
Dann wusste der Greindl, wer sein Gegenüber war. Der Brandmeier Jackl, der vor genau 28 Jahren im Moor ertrunken war. Der Brandmeier Jackl, der auch die Lechner Wally heiraten wollte und der mit ihm zusammen eine Zeit lang beim Ochsenwirt gesessen hatte, damals im Herbst vor 28 Jahren, als der Nebel fast so dicht über dem Moor lag wie heute. Der Brandmeier Jackl, der nicht mehr nach Hause gefunden hatte und von dem alle annahmen, er habe sich bei dem starken Nebel im Moor verirrt. Dass der Jackl nicht allein durchs Moor gegangen war, wusste heute nur mehr der Greindl.
Die Umrisse Brandmeiers verschwammen ein wenig hinter einem Nebelschwaden, traten dann wieder genauer hervor und schienen näher zu kommen. Greindl nahm den Knotenstock hoch. Ballte die Linke zur Faust. Stand zum Schlag bereit. Der Brandmeier war wieder unbewegt, schwarz und kaum zu erkennen. Aber die Toten können doch gar nicht wieder kommen, wollte es in Greindl aufbegehren. Der andere musste es gehört haben. In den Rauhnächten sind wir wieder um die Wege, hörte der Greindl ihn sagen. Immer auf den alten Wegen, die wir zuletzt gegangen sind. Ruhelos und wartend. Jahrelang. Wir, Toten haben. Zeit bis zum jüngsten Tag. Einmal begegnen wir dem auf den wir warten.
. Die Angst ließ den Greindl eine andere Sprache anschlagen: "Warum wartest Du gerade auf mich, Jackl? fragte er vertraut und freundlich. Er vermeinte darauf ein polterndes Lachen zu vernehmen, das ihn frösteln machte. Warum; wohl, fragte, der andere und kam näher. Weißt Du nicht mehr, wer den Brandmeier Jackl niedergeschlagen und in einem schwarzen Moorloch versenkt hat? Weißt Du es nicht mehr? Wieder kam, er, einen Schritt auf ihn zu. Lass den Stock unten, hörte der Greindl. Du kannst mich nicht noch einmal erschlagen. Du musst laufen, Quirin, sagte es ganz leise. Um Dein Leben laufen. Der Jackl schob sich, heran und schien zwei plumpe Arme zu heben.
Da rannte der Greindl davon, so gut es sein zerschossenes Bein zuließ. Blindlings, ins Moor hinein. Er wandte sich nicht mehr um und hörte auch zunächst nicht das Wasser unter seinen hastenden Schritten platschen.
Die Greindl Wally fuhr in dieser Nacht von ihrer einsamen Bettstatt auf, weil sie im Traum einen Hilferuf gehört und das verwitterte Gesicht des Brandmeier Jackl an Fenster gesehen hatte. Sie tappte nach dem leeren Kissen neben sich und legte sich wieder seufzend nieder.
Franz Holper, der Traummann
"Kann einer von Euch etwas mit dem Namen Holper anfangen?" fragte Rita. "Ich habe heute Nacht im Traum diesen Namen gehört". Jutta und Jan schüttelten die Köpfe, aber Frank, Ritas Mann, sagte, er kenne einen Menschen dieses Namens. "Er hat vor gar nicht langer Zeit ein paar Wochen bei uns gearbeitet und ist dann plötzlich verschwunden". "Jetzt weiß ich es wieder", ergänzte Rita ihre Traumgeschichte. "Ich habe keine Person gesehen, sondern nur den Namen gehört und zwar hast Du, Jutta, einen Verehrer dieses Namens gehabt".
"Zu viel der Ehre, aber keinen Bedarf", sagte Jutta und schaute lächelnd zu Jan hinüber.
Die beiden Paare, die sich in die Wohnungen eines kleinen Hauses teilten und den großen Garten gemeinsam bewirtschafteten, saßen abends in Ritas Küche beim Wein zusammen.
"Holper", erzählte Frank weiter, "hatte etwas Unstetes. Er redete gern und gab geradezu damit an, in 26 verschiedenen Berufen gearbeitet zu haben."
"Oh", machte Jutta. "Vielleicht doch ein interessanter Typ."
"Na ja", sagte Frank gedehnt, "ich weiß nicht, wie Frauen einen solchen Mann beurteilen",
"So ein unstetes Wesen wäre nichts für mich, glaub' ich", warf Rita rasch ein,
"Er wohnt in der Südstadt"; erinnerte sich Frank. "Soll ich mal versuchen, ihn zu finden?"
"Aber" wehrte Rita ab, doch Jutta, von einer teils spöttischen teils abenteuerlustigen Neugier gepackt, beiahte begeistert. "Du kannst es ja versuchen", meinte der bedächtige Jan.
Frank versuchte es mit Erfolg. Eines Abends schleppte er den etwa 60jährigen Franz Holper an, einen schmächtigen Mann mit knochigem Gesicht, grauem Haarschopf und Seehundsbart.
Holper war weder scheu noch schüchtern. "Ihr wolltet mich kennen lernen. Jetzt kennt Ihr mich. Genügt das?" fragte er mit aggressivem Unterton in der Stimme und schaute die drei am Tisch mit einem ruhigen, prüfenden Blick nach einander an.
"Nun setz’ Dich erst mal hin, trink ein Glas mit uns", Frank schob ihm ein Weinglas hin und goss ein, "Warum bist Du neulich eigentlich aus der Firma verschwunden? Hast Du etwas Besseres gefunden?".
"So fragt man Leute aus", knurre Holper, hob aber sein Glas und prostete den dreien zu. "Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Ich habe in so vielen Berufen gearbeitet".
"In welchen beispielsweise", fragte Jutta rasch dazwischen.
"Auf dem Bau", begann Holper aufzuzählen. "In der Metallbranche, immer als Hilfsarbeiter oder Produktionshelfer, wie man heute verschönernd sagt. Aber auch auf Binnenschiffen, als Filmvorführer, als Werksbote, als Kurfotograf, mit dem Zirkus bin ich auch gereist. Erst das Zelt aufbauen, dann in schicker Uniform Programme verkaufen. Gärtnerei war eine schöne Arbeit. Zeitschriftenwerber der mieseste Job. Nach einer Woche bin ich da wieder auf und davon."
"Warum hast Du es eigentlich nirgendwo länger ausgehalten", fragte Frank.
"Ich bin ein unsteter Mensch. Nach kurzer Zeit langweilt mich alles und ich will etwas Anderes tun. Ich will die Welt sehen, Ich will Menschen kennen lernen, ihr Verhalten beobachten, mich darauf einzustellen lernen. Ich habe deshalb ja auch nicht geheiratet."
"Wie schön", sagte Jutta ohne zu wissen warum.
"Aber es muss doch einen Grund geben für diese Ruhelosigkeit. Wie siehst Du das selber", fragte Rita.
"Darf ich rauchen"? fragte Holper.
"Bitte, ja" sagte Rita und schob ihm Zigaretten über den Tisch. "Danke, ich rauche Pfeife", sagte Holper lächelnd und holte Pfeife und Tabaksbeutel aus der Tasche. "Ungewöhnlich", meinte Jutta. "Von Pfeifenrauchern sagt man, sie seien ruhige, nachdenkliche Leute und nicht so ein Flederwisch wie Du".
Holper stopfte langsam und bedächtig die Pfeife, entzündete sie sorgfältig und schaute Jutta mit seinen ruhigen, prüfenden Augen an. "Ich bin also Dein Traummann"?
Jutta lachte ein wenig nervös und deutete auf Rita. "Das musst Du sie fragen",
"Also, begann Holper, "Ich will das mal so erklären. Ein wenig ironisch zu Beginn. Ich bin ein loyaler und strebsamer Wirtschaftsbürger. Das seht Ihr doch auch so, oder?" Die Vier lachten ihn ausgiebig aus. "Von einem solchen erwartet man", fuhr Holper unbeirrt fort, "Mobilität und Flexibilität. Na schön, sagte ich mir. Das kommt meiner Veranlagung entgegen. Mobil von Ort zu Ort und flexibel von Beruf zu Beruf. Aber ganz ernsthaft. Ich sagte ja schon, ich halt' es nirgendwo lange aus, will Neues erleben, anderes sehen. Im Alter hat das auch seine Schattenseiten. Ich bin arbeitslos und es gibt wohl nichts mehr für mich. Da muss ich lernen, bescheiden zu sein. Ortsansässig, wie man sagt. Ich kenne genug Leute, die immer wieder eine Nebenbeschäftigung für mich haben. Zur Zeit fahre ich Brot aus für eine Bäckerei. Ein Beruf fehlt mir übrigens noch. Ich möchte ein Buch schreiben über dieses Leben."
"Da müsstest Du Dich aber lange auf den Hosenboden setzen" griff Jan zum ersten Mal in das Gespräch ein.
"Ich könnte aber viel erzählen."
"Was war denn das spannendste, verrückteste, ungewöhnlichste Erlebnis", fragte Jutta spürbar interessiert.
"Also, das war so", begann Holper aufs Neue, "Ich hatte einen schicken Anzug geschenkt bekommen und konnte mich als Herr verkleiden. Das sollte ich ausnützen, sagte ich mir und zog in ein sagen wir Mittelklasse-Hotel und ging auf Damenbekanntschaft aus. Den Bart trug ich damals noch nicht und die Frisur war auch bürgerlicher als heute. Der Dame, die spürbar viel Geld hatte und allein reiste, erzählte ich also etwas von einer Epoche machenden Erfindung im Computerbereich, Sie würde nichts davon verstehen, vermutete ich zu Recht. Ich sei nur im Augenblick etwas klamm, erwartete aber eine Erbschaft. Ich stellte mich übrigens als Alexander Freiherr von Brandis vor, alter liechtensteinischer Adel, Adel zieht immer, sagte ich mir und ich hatte Recht, Die Dame machte ein paar große Scheine locker und ich verschwand, heuerte für ein paar Monate als Hilfsmatrose auf einem Binnenschiff an".
Die vier Freunde waren jeder auf seine Weise überrascht, empört, amüsiert, sie redeten durcheinander bis Jutta sich Gehör verschaffte: "Also mein Verehrer, mein Traummann wärst Du nicht geworden, wenn ich mir auch vorstellen kann, dass Du mancher Frau Eindruck, nachhaltigen Eindruck gemacht hast."
"Ach, weißt Du" sagte Holper, "der Kavalier genießt manchmal auch nicht und schweigt doch." In das herzliche Lachen der Freunde hinein sagte er noch: "Das Geld habe ich der Dame anonym wiedergegeben, als ich etwas im Lotto gewonnen hatte". Holper trank sein Glas aus, verstaute Pfeife und Tabaksbeutel und verabschiedete sich rasch. Die Freunde forderten ihn herzlich und drängend auf. wiederzukommen.
"Ein verrückter Kerl", sagte Frank.
"Was es doch für merkwürdige Träume gibt", sagte Jutta nachdenklich und schaute Holper aus dem Küchenfenster nach.
Pontecorvo
Das ist jetzt fast dreißig Jahre her; der Krieg war noch nicht so vergessen wie heute, sagte Wesslinger. In den Städten sah man noch Trümmer und Ruinen: Häuser, Fabriken, Kirchen, Menschen. Ich war ein junger Mann damals, kaum 26 Jahre alt, und arbeitete als Kellner in einem Bahnhofs Restaurant. Das ist besser als in einer normalen Kneipe mit ihren Stammgästen und interessanter. Nach ein paar Wochen kennst du jeden, weißt, wer sich ärgert, weil seine Tochter zu ihrem Freund gezogen ist, weißt, wer von seinem Chef geduckt wird, wer einen Blechschaden am Wagen hatte. Da gibt es Typen, glaub mir, da kannst du wetten, was sie im nächsten Satz sagen werden.
Nein, in einem Bahnhofs-Restaurant ist das anders. Jeder Tag bringt neue Gesichter. Junge, hübsche, optimistische, von Leuten, die zu ihren Freunden fahren. Müde, blutleere, erschlaffte, von Geschäftsreisenden. Besorgte Gesichter von Müttern. Stumpfe, verschlagene Visagen von diesen bestimmten Typen, du weißt schon. Alte Menschen haben entweder leere Fassaden oder solche mit viel verstecktem Wissen in den Hautfalten.
Ich habe mir manchmal, wenn das Geschäft ruhig lief, Geschichten für die Gesichter ausgedacht, Lebensläufe erfunden, Erlebnisse zusammengebastelt, Schicksal gespielt. Meine Lehrer haben sich schon über meine lebhafte Phantasie gewundert. Heute sah ich einen Mann aus dieser Zeit wieder und die Erinnerung war blitzartig vor meinen Augen. Scharf wie ein gutes Dia. Ich wusste sofort, wie er hieß; denn was ich mit ihm erlebt habe, war einmalig.
Wie gesagt, es war in den fünfziger Jahren. Es ging uns allen noch nicht so gut. Man sah wenig Autos und wenig Eleganz auf den Straßen Die Männer fuhren früher zur Arbeit als heute und auf den Wiesen standen noch Kühe und keine Supermärkte. Es war im April. Der Wind blies kalt. Zwischendurch regnete es manchmal. Bahnhöfe sehen bei solchem Wetter besonders scheußlich aus. Grau und zugig. Das Regenwasser tropft auf die Bahnsteige. In den Dächern klafften hier und da noch Löcher von Bombensplittern und der Regen fiel hindurch wie eine Dusche.
Ich stand missmutig am Fenster. Es gab nichts zu tun. Die Arbeiterzüge waren raus. Bis zum Münchner Eilzug war noch lange Zeit. Da kam der Mann herein, von dem ich spreche. Er hatte dünnes Haar, das ihm nass in die Stirn hing, weil er weder Hut noch Mütze trug. Er war wohl nur ein paar Jahre älter als ich. Sein merkwürdig runder Kopf und die starken Augenbrauen fielen mir an ihm besonders auf. Daran habe ich ihn heute auch wieder erkannt. Damals war er sehr mager, was ich sah, als er seinen fleckigen Trenchcoat auszog. Der alte, an mehreren Stellen ungeschickt geflickte Anzug war ihm viel zu weit.
Ich wartete, bis er sich gesetzt hatte. Er platzierte sich so, dass er die Tür beobachten konnte. Ich ging auf ihn zu, aber noch ehe ich mein Sprüchlein loswerden konnte - "Guten Morgen, der Herr. Was darf’s sein?" - fragte er schon, ob nach ihm gefragt worden sei.
Ich sagte nein.
Er wunderte sich. Ich wisse noch nicht einmal seinen Namen. Wie ich da schon nein sagen könne. Ich sagte, niemand habe nach irgendjemandem gefragt.
Er stellte sich vor: Gregor Mittenzwey. Mit Ypsilon am Ende. Und er warte auf Hermann. Er bestellte ein Kännchen Kaffee und während ich Tasse, Untertasse und Reklame-Manschette der Kaffee-Firma zusammenstellte, erzählte er weiter. Er wolle mit Hermann nach Pontecorvo fahren. Er sagte es halblaut und geheimnisvoll. Weil keine Gäste zu bedienen waren und weil ich mich, wie gesagt, für die Geschichten meiner Gäste interessiere, versuchte ich, ihn ein wenig auszufragen.
Pontecorvo, wo liegt denn das?
In Italien, sagte Mittenzwey. Am Nordrand der Ebene von Cassino. Sie haben sicherlich vom Kloster Montecassino gehört. Ich nickte. Als ich ihm den Kaffee gebracht hatte, erzählte er weiter. Der Ort liegt am Liri. Über den Fluss führte eine Brücke, daher der Name. Ponte heißt Brücke. Seine Stimme wurde lebhafter. Ich habe da etwas zu richten, in Ordnung zu bringen.
Und woher kennen Sie das Nest?
Aus dem Krieg. Ich war da unten. Im Mai 1944.
Und seither nicht mehr?
Er schüttelte den Kopf und trank einen Schluck Kaffee. Und da wollen Sie jetzt etwas in Ordnung bringen, wie Sie sagen, jetzt, nach so vielen Jahren?
Dazu ist es nie zu spät, sagte er, hob leicht den Kopf und schaute mich an. Wenn man etwas versaut hat, muss man es in Ordnung bringen. Auf jeden Fall.
Da kam der andere herein. Eigentlich müsste ich sagen: Er schob sich herein. Wesslinger führte es vor: Schritt für Schritt schlürfend, den Rücken und die Handflächen stützend an der Wand. Er blickte rasch, ruckartig den einzigen Gast und mich an, erinnerte sich Wesslinger, machte einen großen Schritt zum nächsten Tisch und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Er trug einen ausgebleichten Drillichanzug, der vielleicht einmal khakifarben gewesen war, und das weiße Käppi der französischen Fremdenlegion. Mittenzwey war wie versteinert. Er starrte den hageren, krank und verwirrt aussehenden Legionär an, der verkrampft auf dem Stuhl saß, die Hände zusammenpresste und die Einrichtung der Gaststube musterte. Die alten Zigarettenreklamen, die Flaschen, die Regale.
Ich kenne die Typen. Die machen auf verrückt, sitzen zwei Stunden bei einem kleinen Bier und bringen es noch fertig, die Zeche zu prellen, wenn du nicht aufpasst. Er bestellte denn auch ein kleines Bier und ich ließ ihn gleich zahlen. Minuten vergingen. Mittenzweys Gesicht sah fiebrig gerötet aus. Er suchte nach Worten. Endlich kommt es halblaut: Da bist du ja. Du hast Wort gehalten. Ich wusste es. Der Legionär schaute Mittenzwey an, sagte rasch und obenhin jaja, trank von seinem Bier und verkrampfte die Hände wieder ineinander.
Jetzt steht Mittenzwey auf, schwerfällig, setzt sich in Bewegung, stakt wie mit steifen Knien zum Tisch des Legionärs, hält dem verstörten Mann die Hand hin. Hermann, mein Kamerad, schön, dass du da bist. Der Legionär schaut Mittenzwey mit schief gehaltenem Kopf aus den Augenwinkeln furchtsam an. Rasch legt er seine Hand in die Mittenzweys und zieht sie wieder zurück. Mittenzwey setzt sich. Wie siehst du nur aus, sagt er. Wie immer, sagt der Legionär, seit Dien Bien Phu. Dann überkreuzt er plötzlich die Arme über der Brust, versteckt die Hände in den Achselhöhlen, beginnt in einer fremden Sprache zu reden, vermutlich in Vietnamesisch. Er spricht immer schneller und immer lauter, dann schreit er nur noch, das Schreien geht in ein Brüllen über, er steckt alle zehn Finger in den Mund und sinkt auf die Tischplatte. Das Bierglas fällt um, das weiße Käppi rollt in die Bierlache, der Legionär beginnt zu schluchzen.
Hermann, sagt Mittenzwey fast tonlos. Mehr bringt er nicht heraus.
Ich muss sagen, ich habe so etwas auch vorher noch nicht erlebt. Mittenzwey ruft noch einmal den Vornamen. Der Legionär richtet sich langsam auf. Er ist nass verschwitzt. Hermann, was ist mit dir?
Weiß nicht, sagt der Legionär und betrachtet seine Fingernägel.
Sie haben etwas mit dir gemacht.
Sie haben etwas mit mir gemacht, wiederholt er.
Wer, fragt Mittenzwey.
Die Vietminh, Leutnant Tran.
Ich bitte Mittenzwey, ihn nicht länger zu quälen. Er sehe doch, was da passiert sei. Ich wische den Tisch ab, hole ein frisches Bier. Der Mann tat mir leid. Etwas Anderes konnte ich im Moment nicht für ihn tun.
Mittenzwey wartete, bis sich der Legionär beruhigt hatte, bis er wieder mit verkrampften Händen auf seinem Stuhl kauerte, das Käppi auf dem Kopf. Er hatte es aus der Stirn geschoben, was einen lächerlichen Kontrast ergab. Das stumpfe, zerstörte Gesicht und der forsche Sitz der Mütze. Wir sind, sagte er ohne Übergang, unter den Augen von General de Gaulle über die Champs Elysee marschiert und die Leute haben gesagt: Voila, le khepi blanc! Der Legionär richtete sich auf. In seine Augen kehrte für Sekunden ein Funke Leben zurück. Am 14. Juli, sagte er und nach langer Pause noch: Das ist lange her.
Mittenzwey wollte den Moment ausnutzen. Wie er denn in die Fremdenlegion gekommen sei. In Italien hätten sie sich doch verloren, beim Übergang über den Po. In der Gefangenschaft. Hungerlager Attichy. Da bringen sie dich so weit. Der Legionär hatte es monoton dahingesagt. Mittenzwey begann zu zweifeln. Aber du bist doch Hermann?
Jaja, machte der Legionär.
Und denkst du nicht mehr an Pontecorvo? An die Brücke?
Der Legionär nickte.
Dann erzähl mal, wie's gewesen ist.
Der Legionär schwieg. Denk mal nach, munterte Mittenzwey ihn auf. Wie war das mit der Brücke? Wer hat sie gesprengt? Mittenzwey wartete.