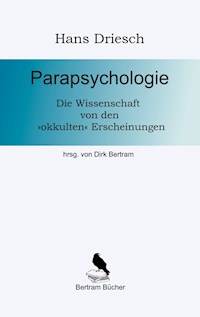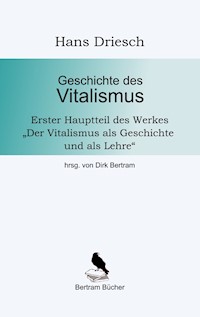
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die "Geschichte des Vitalismus" ist eine erweiterte Neuauflage des ersten Teils des 1905 erschienen Buches "Der Vitalismus als Geschichte und als Lehre". Ausgehend von der Zweckmäßigkeit der Lebensvorgänge, die Driesch in eine rein deskriptive sowie eine statische und eine dynamische Teleologie unterteilt, sieht er das eigentliche Problem in der Frage nach der Autonomie der Lebensvorgänge: "Nicht die Frage, ob Lebensvorgänge das Beiwort "zweckmäßig" verdienen, macht das Problem des Vitalismus aus, sondern diese Frage: ob das Zweckmäßige oder besser das Ganzheitsbezogene an ihnen einer besonderen Konstellation von Faktoren entspringe, welche aus den Wissenschaften vom Anorganischen bekannt sind, oder ob es Ausfluß ihrer Eigengesetzlichkeit sei." Während die statische Teleologie zu einer "Maschinentheorie der Organismen" führt, führt die dynamische Teleologie zum Vitalismus, d. h. in die Einsicht der "Autonomie der Lebensvorgänge". Die "Geschichte des Vitalismus" gibt einen Überblick, welche Auffassung von wem in früheren Zeiten bis in die Gegenwart Drieschs hinein vertreten wurde. Ohne die griechischen Zitate der Originalausgabe, insbes. von Aristoteles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Ausgabe basiert auf: Driesch, Hans, „Geschichte des Vitalismus“, Band III der „Natur- und kulturphilosophischen Bibliothek“, Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig, 1922 Ohne die griechischen Zitate der Originalausgabe, insbesondere von Aristoteles.
Vorwort zur ersten Auflage.
Als die Verlagsbuchhandlung mich zur Übernahme eines Bandes der „Natur- und kulturphilosophischen Bibliothek“ aufforderte, sah ich darin einen willkommenen Anlaß, ein lange gehegtes Vorhaben zur Ausführung zu bringen: Die ältere vitalistische Literatur gründlicher und nicht nur in Bruchstücken kennenzulernen, war seit längerem meine Absicht; hier bot sich ein realer Antrieb zu solchem Studium in der Gelegenheit, die Früchte desselben zugleich nutzbar zu machen für weitere Kreise. Auch war es mir lieb, einmal die Gesamtheit meiner Ansichten über das Leben in systematischer Form darstellen zu können für einen Leserkreis, welcher weiter als der eigentlich naturwissenschaftliche ist.
So ist denn diese „Geschichte“ und diese „Lehre“ des Vitalismus entstanden.
Durchaus anspruchslos treten die Ergebnisse meiner historischen Studien auf und wünschen auch so aufgenommen zu werden. Ich bin kein Historiker, und nichts liegt diesem Buche ferner als die Absicht sachlich-geschichtlicher Vollständigkeit. Meine wissenschaftlichen Freunde wundern sich vielleicht überhaupt, wie gerade ich, der ich über historische Elemente in den eigentlichen Naturwissenschaften stets sehr abweisend geurteilt habe − und noch urteile −, dazu komme, Geschichte zu schreiben.
Ich denke aber, es ist denn doch wohl eine andere Sache um phantastische „Stammbäume“ als um die Erkenntnis dessen, was große Männer der Vorzeit über die Fragen gedacht haben, die auch unser Leben ausfüllen, Hier, wie in vielen Gebieten der Menschheitsgeschichte überhaupt, bekommt Historie einen ganz unmittelbar persönlichen Wert.
Und im Sinne des mir persönlich Wertvollen sind denn auch diese geschichtlichen Skizzen geschrieben. Um durchaus unbefangen zu bleiben, habe ich kein einziges größeres Kompendium der Geschichte der Medizin1 bei meinen Studien benutzt. Nur der kleine historische Abriß in W. Preyers „Allgemeiner Physiologie“, welcher übrigens mit Vorsicht zu benutzen ist, und die vortrefflichen Aufsätze von W. His: „Die Theorien der geschlechtlichen Zeugung“ (Archiv für Anthropologie, Bd. IV 1870 S. 197 und 317 und Bd. V 1872 S. 69) dienten mir zur allgemeinen Orientierung. Von historischen Sonderstudien ist nur die im Text genannte ausgezeichnete Bonnet-Monographie Whitmans von mir benutzt worden.
Rudolf Burckhardt vor allem hat in jüngster Zeit das Interesse an Biologiegeschichte neu belebt; seine Arbeiten gehen aber das Klassifikatorische und im engeren Sinne Morphologische an, und die große Monographie seines Schülers Bloch behandelt eine Zeitepoche, die ich in meinen Studien bewußt ausschaltete.
Von Bedeutung ist es immer, wenn namhafte Forscher selbst, sei es auch nur skizzenhaft, sich über Geschichte ihrer Wissenschaft äußern: in diesem Sinne findet sich vieles Wertvolle bei Haller, BIumenbach und Burdach. Die historischen Exkurse in Claude Bernards „Leçons sur les phénomènes de la vie“ bieten eine gute Ergänzung zu meiner Arbeit, zumal im Hinblick auf den französischen Vitalismus des achtzehnten Jahrhunderts und sein Gegenstück.
So sind denn also vornehmlich, ja beinahe lediglich, die Originalia unserer Vorarbeiter meine Quellen gewesen. –
Soll ich zu dem besonderen Inhalt dieses Buches etwas Persönliches bemerken, so mag es nur dieses sein, daß die Auseinandersetzung mit Kants „Kritik der Urteilskraft“ mir mehr als alles andere am Herzen gelegen hat. Ich selbst kann nicht beurteilen, ob der Erfolg der Bemühung entspricht. –
Viel Geschichte treiben mag unproduktiv machen, aber keine Geschichte treiben bedeutet vieles sagen, was bereits, und wohl gar besser, gesagt war. Zwar kann Biologiegeschichte nie in dem Grade die Wissenschaft selbst sein, wie Geschichte der Mechanik das ist; aber ganz und gar vom Zufall hängt darum doch auch sie nicht ab: auch in ihr gibt es ein Sich-selbst-voIlenden der Grundgedanken. Es scheint mir in diesem Sinne von ganz besonderer Bedeutung zu sein, daß klar erkannt werde, wie im großen und ganzen der ältere Vitalismus dieselbe begriffliche Entwicklung nahm, welche unser neuer Vitalismus nehmen muß. Nur sind unsere kritischen Ansprüche gewachsen und ist das verarbeitete Detail jetzt ein anderes und dazu unermeßlich reicher: freilich gestattet gerade dieses Detail die Beweise des neuen Vitalismus.
Heidelberg, am 4. Januar 1905.
Hans Driesch.
1 Die Geschichte der Zoologie von V. Carus kam nicht in Frage, da sie nur auf die klassifikatorischen und deskriptivmorphologischen Bestrebungen Rücksicht nimmt.
Vorwort zur zweiten Auflage.
Die zweite Auflage meines Buches von 1905 mußte sich, wie die Dinge inzwischen gegangen waren, auf eine verbesserte, in manchem erweiterte und bis auf die Gegenwart fortgeführte Darstellung der Geschichte des Vitalismus beschränken, konnte also nur die Neuauflage des „Ersten Haupttei ls“ des ursprünglichen Werkes sein. Hätte ich auch den zweiten, den systematischen Hauptteil neu auflegen wollen, so hätte ich mich selbst abschreiben müssen; denn in meiner Schrift vom Jahre 1919 Der Begriff der organischen Form gab ich ein kurzes System des Vitalismus in einer Weise, wie sie meinen heutigen Anschauungen entspricht. Für diejenigen aber, welche sachlich tiefer dringen wollen, ist ja die, seit 1921 in teilweise umgearbeiteter zweiter Auflage vorliegende, Philosophie des Organischen vorhanden.
Ich habe die Geschichte des Vitalismus nach der philosophischen Seite hin erweitert. Abschnitte über Descartes, Leibniz, den deutschen Idealismus sind eingeschoben; kurze Abschnitte freilich, denn mein Buch will in erster Linie Wissenschaftsgeschichte bringen, nicht Philosophiegeschichte. Das Kapitel über Kant, schon früher das längste, wurde noch ausgebaut. Die Hauptaufgabe war die Fortführung der Geschichte bis auf die Gegenwart. Da war Auswahl und Klassifikation nicht immer ganz leicht; ich hoffe, daß mir beide geglückt sind. Vielleicht wird man sagen, ich hätte die ältere Geschichte des Vitalismus jetzt breiter fassen, hätte früher nicht genannte Vertreter heranziehen sollen. Aus zwei Gründen habe ich das nicht getan. Einmal wollte ich auch jetzt kein vollständiges Geschichtswerk, sondern nur eine historisch gegründete Typenlehre schreiben; und dann haben wir ja in E. RádIs ausgezeichneter „Geschichte der biologischen Theorien“ das Werk, welches allen Ansprüchen, die man an ein eigentliches biotheoretisches Geschichtswerk stellen kann, genügt.
Die erste Auflage dieses Buches ist ins Polnische, Italienische, Russische und Englische übersetzt worden. Nur die italienische und die englische Ausgabe kenne ich. In beiden ist der (jetzt für die deutsche Ausgabe, wie begründet wurde, fortgefallene) systematische Teil anders als im deutschen Original gestaltet worden, weil ja eben inzwischen die „Philosophie des Organischen“ erschienen war. Für die italienische Ausgabe hat der Übersetzer, Professor Stenta, vieles aus diesem Werke auszugsweise benutzt; für die englische Ausgabe schrieb ich den systematischen Teil selbst in gänzlich veränderter, von der Logik, nicht von der Empirie ausgehender Form neu nieder. Für den deutschen Leser konnte dieser Teil, wie gesagt, jetzt ganz fortbleiben; der Ausgang von der Logik findet sich nämlich auch in gewissen Teilen meiner eingangs erwähnten systematischen Werke.
Mein Dank gebührt dem Herrn Verleger für die große Bereitwilligkeit, mit der er sich zur Herausgabe dieser zweiten Auflage meines jetzt also rein historischen Werkes bereit fand.
Leipzig, am 15. Januar 1922.
Hans Driesch.
Inhalt.
Kritische Vorbemerkung: Die Arten des Zweckmäßigen
I. Der ältere Vitalismus.
A. Aristoteles
B. Die neue Wissenschaft und die neue Philosophie. Harvey.G. E. Stahl.
Harvey.
Georg Ernst Stahl
C. Vitalistische Lehren im Gefolge des Streites um „Evolution“ und „Epigenesis“.
Leibniz.
Button, Needham, Maupertuis.
Caspar Friedrich Wolff.
Bonnet, Haller.
Blumenbach.
D. Kants „Kritik der Urteilskraft“.
E. Vitalismus im Gefolge der Naturphilosophie.
Die „idealistische“ Philosophie.
Oken.
Reil (1759-1813).
Treviranus.
Der schulmäßige Vitalismus
Johannes Müller.
Liebig.
Schopenhauer.
Des älteren Vitalismus Ende.
II. Die Kritik und die materialistische Reaktion.
Lotze.
Bernard.
Die materialistisch-darwinistische Zeitströmung.
Ausblick auf Psychologisches.
III. Der neuere Vitalismus.
A. Die Tradition.
B. Die Stellung der Philosophie.
Eduard von Hartmann.
Andere Philosophen.
Psychologen.
Edmund Montgomery.
C. Antidarwinistische Dezendenztheoretiker
D. Die Stellung der Physiker.
IV. Der "Neovitalismus".
A. Grundlegungen.
B. Vitalistische Systeme.
a) Henri Bergson.
b) Mein eigenes System.
C. Gegner.
a) Philosophen.
b) Naturforscher.
D. Verschiedene Formen des Neovitalismus.
E. Der Ausbau des vitalistischen Systems.
a) Neue Tatsachen zur Grundlegung.
b) Logischer Ausbau.
c) J. v. Uexküll.
F. Die moderne Psychologie.
G. Ausblicke
Kritische Vorbemerkung:
Die Arten des Zweckmäßigen.
Nicht die Frage, ob Lebensvorgänge das Beiwort „zweckmäßig“ verdienen, macht das Problem des „Vitalismus“ aus, sondern diese Frage: ob das Zweckmäßige oder besser das Ganzheitsbezogene an ihnen einer besonderen Konstellation von Faktoren entspringe, welche aus den Wissenschaften vom Anorganischen bekannt sind, oder ob es Ausfluß ihrer Eigengesetzlichkeit sei.
Denn daß es vieles „Zweckmäßige“, vieles auf eine Ganzheit bezogene an Lebensgeschehnissen gibt, ist nichts anderes als eine Tatsache, die sich ohne weiteres aus der Definition jenes Begriffs und aus der Anwendung dieser Definition auf das Lebendige ergibt.
Im Sprachgebrauch des täglichen Lebens werden als zweckmäßig solche Handlungen bezeichnet, welche erfahrungsgemäß ein bestimmtes gewolltes Ziel mittelbar oder unmittelbar herbeiführen, oder von denen man das wenigstens annimmt. In letzterem Falle − dem Falle des „Probierens“ − kann in Strenge erst nach Erreichung des Zieles davon geredet werden, daß diese oder jene Handlung zweckmäßig gewesen sei, woraus sich dann allerdings für die Zukunft unter gleichen Umständen ein von Anfang an zweckmäßiges Handeln ergibt. Ich beurteile alle Zweckmäßigkeit von Handlungen von mir aus; das heißt: ich weiß für mich, wann meine Handlungen das Prädikat zweckmäßig verdienen, da ich meine Ziele kenne; davon gehe ich aus. Handlungen anderer Menschen benenne ich mit jenem Worte, wenn ich ihr Ziel „verstehe“, das heißt, wenn ich mir denken kann, daß es mein eigenes sein könne, und wenn ich sie mit Rücksicht auf dieses Ziel beurteile.
Nun beschränke ich aber die Anwendung des Wortes zweckmäßig nicht auf die Handlungen anderer Menschen, sondern dehne sie, schon im alltäglichen Leben, nach zwei Richtungen hin aus, und aus dieser Ausdehnung entspringt einmal die Anwendung des Wortes zweckmäßig auf Biologisches überhaupt, zum anderen entspringt aus ihr auch schon das biologische Grundproblem.
Ich nenne zweckmäßig sehr vieles an den Bewegungen der Tiere, und zwar nicht nur solche Bewegungen gewisser höherer Tiere, welche geradezu „Handlungen“ benannt werden, sondern auch solche Bewegungsgruppen, welche ihrer festeren Geschlossenheit wegen nicht als Handlungen, sondern als „Instinkte“, „Reflexe“ oder ähnlich bezeichnet zu werden pflegen. Von da bis zu den Bewegungen der Pflanzen, etwa gegen das Licht hin oder vom Licht ab, ist nur ein Schritt, und nur noch einen Schritt weiter bedeutet es, wenn „zweckmäßig“ auch die Wachstumsbewegungen genannt werden, welche in typischer Folge aus den Keimen die ausgewachsenen Organismen der Tiere und Pflanzen schaffen.
So sind denn also schließlich alle Geschehnisse an lebenden Wesen, welche nachweislich auf einen Punkt zulaufen, der in irgendeinem Sinne als „Ziel“, als zusammengesetztes Ganzes gedacht werden kann, dem rein deskriptiven Begriffe der „Zweckmäßigkeit“ unterstellt worden. Es ist nach allem Ausgeführten begreiflich, daß eine gewisse Willkür bei der Bezeichnung eines Geschehnisses als eines „Zweckmäßigen“ unvermeidbar ist: wird doch durchaus analogienhaft hier vorgegangen. Doch schadet diese Willkür nicht viel, da ja, um das noch einmal zu sagen, nur eine Art von orientierender Beschreibung mit jener Bezeichnung beabsichtigt ist, noch nichts weiter.
Ein Ziel oder, objektiver gesprochen, ein Endganzes müsse für den als zweckmäßig bezeichneten Vorgang gedacht werden können, so sagten wir: eben damit ist nun der Begriff des Zweckmäßigen zwar auf sehr viele Vorgänge der verschiedensten Art ausgedehnt, andererseits aber auch auf das Organische eingeschränkt worden, wenigstens soweit sogenannte Naturdinge in Betracht kommen: jene mehr oder weniger der Willkür preisgegebene Denkbarkeit eines Zieles gibt es eben nur bei Organismen. Es ist das u. a. wesentlich darin begründet, daß zum Begriffe der Beziehung eines Geschehnisses auf ein reales Ziel neben seinem Eingeordnetsein in ein tpisch-zusammengesetztes Ganze praktisch auch sein Auftreten in beliebig vielen Fällen oder Exemplaren, kurz seine Mehrmaligkeit in ideell unbegrenztem Maße gehört, und zwar seine typische Mehrmaligkeit, ein Postulat, das eben bei den organischen Naturdingen und nur bei ihnen erfüllt ist.
Sehr viele biologische Vorgänge können also analogienhaft als „zweckmäßige“ beschreibend gekennzeichnet werden.
Es werden nun aber als zweckmäßig beschreibend bezeichnet auch Vorgänge an gewissen nicht organischen Dingen, welche freilich keine Naturdinge engeren Sinnes sind − insofern nämlich hier überhaupt von einem Gegensatz zu „Natur“ in nicht gerade strenger, aber verständlicher Form geredet werden kann − nämlich Vorgänge an von Menschen gefertigten Artefakten, z. B. Maschinen. Hier liegt die zweite Erweiterung des Begriffs zweckmäßig, von der wir redeten, und hier liegt zugleich der Ausgang der Aufrollung des biologischen Grundproblems.
Ich halte es nicht für geraten, die „Maschinen“ als Dinge „zweckmäßig“ zu nennen: für Vorgänge muß diese deskriptive analogienhafte Bezeichnung aufgespart bleiben; aber jedes Einzelgeschehnis an einer Maschine ist „zweckmäßig“.
„Praktisch“ mag die Maschine als Ganzes heißen; sie ist das Ergebnis zweckmäßiger Tätigkeit, nämlich menschlicher Handlung; daß sie eben für Vorgänge da ist, das unterscheidet sie von anderen menschlichen Artefakten, z. B. von Kunstwerken.
Also auch anorganische Dinge, nämlich von Menschen gefertigte, können Vorgänge aufweisen, welche das Prädikat der Zweckmäßigkeit verdienen. Es ist klar, daß hier die Zweckmäßigkeit jedes einzelnen Vorganges auf der spezifischen Ordnung der spezifischen Teile der Maschine beruht, daß sie durch diese gegeben ist; anders gesagt: jeder einzelne Vorgang in der Maschine ist nur zweckmäßig, insofern er sich als Glied eines höheren spezifischen Ganzen abspielt, und er tut das vermöge der gegebenen Struktur oder Tektonik dieses Ganzen.
Unsere Betrachtungen haben uns jetzt zu dem Punkte geführt, an dem dasjenige Problem, welches wir das biologische Grundproblem genannt haben, in unseren Gesichtskreis tritt. Eine ganz prinzipielle Frage drängt sich uns auf: Sind etwa die als zweckmäßig bezeichneten Vorgänge an Organismen zweckmäßig nur vermöge einer gegebenen Struktur oder Tektonik, einer „Maschinerie“ also im weitesten Sinne, auf welcher als Basis sie sich abspielen, ebenso wie ja nur in diesem Sinne die Vorgänge an einer von Menschen gefertigten Maschine zweckmäßig sind; oder liegt eine andere besondere Art des Zweckmäßigen im Bereiche des organischen Lebens vor?
Man sieht: erst jetzt soll etwas über endgültige Gesetzlichkeit des Geschehens entschieden werden, bisher wurde nur in mehr äußerlicher Weise analogienhaft beschrieben.
Denn es kann gar nicht oft genug wiederholt werden, daß bloße Behauptung von Zweckmäßigkeit, bloße „Teleologie“ also, um nunmehr den üblichen Kunstausdruck einzuführen, nur beschreibt. Ausdrücklich als deskriptiv-teleologisch mag daher in diesem ganzen Buche jede bloß über das Dasein von Zweckmäßigkeiten aussagende Ansicht bezeichnet werden. Deskriptive Teleologie läßt das wichtigste noch offen, für das Lebendige insbesondere diese Frage: sind nur vermöge ihrer gegebenen Ordnung die Lebensvorgänge „teleologisch“ zu beurteilen, nur weil ihnen eine gegebene Maschine zugrunde liegt, während jeder einzelne von ihnen ein echter physikalischer oder chemischer Vorgang ist, oder sind Lebensvorgänge kraft einer unauflösbaren Eigengesetzlichkeit „zweckmäßig“.
Als statische und als dynamische Teleologie seien diese Gegensätze in Zukunft im Unterschiede von bloß deskriptiver Teleologie bezeichnet; wer will, mag auch von vorgebildeter und nichtvorgebildeter Zweckmäßigkeit bzw. Ganzheitsbezogenheit reden.
Die statische Teleologie führt zu einer „Maschinentheorie der Organismen“; Lebensgeschehen und seine Ordnung ist ihr nur ein besonderer Fall der auch sonst maßgebenden Geschehensgesetzlichkeiten und der allgemeinen Ordnung der Welt; die Konstellation aller einzelnen Weltelemente ist einmal so, daß auch die als „Leben“ zusammengefaßten Vorgänge dabei herauskommen. Das Leben ist dieser Auffassung nur als Kombination, nicht seiner Gesetzlichkeit nach etwas Besonderes. Die Frage, „woher“ die gegebene Ordnung komme, mit welcher statische Teleologie operiert, ist unlösbar; eben diese Umstandes wegen erscheint die Lebensmaschine denn doch als etwas anderes wie technische Maschinen, deren Herkunft man kennt, mag die Art der Zweckmäßigkeit des Geschehens, an beiden, nach Ansicht der teleologischen Statiker, die gleiche sein.
Die dynamische Teleologie führt zu dem, was meist „Vitalismus“ genannt wird; sie führt zur Einsicht in die „Autonomie der Lebensvorgänge“.
Welche beider Auffassungen vom Leben ist richtig, welche falsch?
Wie frühere Zeiten diese Frage entschieden haben, das darzustellen ist der Zweck dieses Buches, und auf solche Darstellung vorzubereiten, war der Zweck dieser Einleitung.
Wir haben nämlich mit dem Ergebnis dieser Einleitung, mit der Einsicht nämlich, daß es eine statische und eine dynamische Teleologie logisch geben könne, gleichsam ein Reagens in Händen, ein Mittel, mit welchem wir jeden historisch dargebotenen Ansichtenkomplex prüfen können daraufhin, was er denn eigentlich bedeute, und solches selbst dann, wenn einem Autor selbst, was nicht selten vorkommt, die Begriffe deskriptiv-, statisch und dynamisch-teleologisch nichts weniger als geklärt waren.
Zur Erleichterung der historischen Analyse und damit zur Erleichterung des Verständnisses überhaupt ist also diese logische Eingangsbetrachtung allem vorangestellt worden; sie soll durchaus etwas Vorläufiges, nicht etwa unsere letzte Ansicht über „Zweckmäßigkeit“, bedeuten.
Wenn wir uns nunmehr der Betrachtung der Entwicklung des älteren Vitalismus zuwenden, so darf wohl ein für allemal bemerkt sein, daß unserer Betrachtung weniger am Persönlichen als, wenn das Wort erlaubt ist, am Ansichtstypischen gelegen ist, daß sie daher auf Vollständigkeit im Sinne wahrhafter „Geschichte“ engeren Sinnes kein Gewicht, auf passende Auswahl des Gebotenen dagegen einen um so größeren Nachdruck legt.
Wenn, trotz unserer Absicht auf Typisches, ein nicht nur historischer, sondern gleichzeitig logisch fortentwickelnder Charakter, wie er in bekannten Geschichten der Mechanik oder der Wärmelehre geboten ward, unserer Darstellung unerreichbar bleibt, so wird solchen Mangel wohl nur tadeln können, wer die sachlichen Sonderheiten der in Frage kommenden Gebiete nicht kennt. Die Mechanik ist, wenigstens soweit ihre „Prinzipien“ in Frage kommen, eine zum großen Teil aprioristische, „selbstevidente“ Wissenschaft, und von wichtigen Teilen der Physik, der „Thermodynamik“ zumal, gilt das gleiche; hier ist Entdeckung gewissermaßen nur Selbstklärung, Zufälligkeiten spielen wenig, bei den grundlegenden Prinzipien fast gar nicht, in die geschichtliche Entwicklung der Einsichten hinein. Die Biologie andererseits ist in ihrem Fortschritt in hohem Grade von Zufälligkeiten, von „Entdeckungen“ engeren Sinnes abhängig, und wenn ihre Geschichte auch nicht nur aus solchen besteht, so sind dieselben doch geeignet, das eigentlich Logische an ihrem Fortschreiten zum mindestens zu verschleiern.
I. Der ältere Vitalismus.
A. Aristoteles
Einer auf das Typische gehenden Geschichtsdarstellung des Vitalismus kann Aristoteles als Vertreter des Altertums überhaupt gelten. Zugleich aber sind seine Ansichten über biologische Dinge die Grundlage alles Theoretisierens bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein, so daß er mit vollem Recht auch als Vertreter der mittelalterlichen und der frühmodernen Auffassungen des Lebendigen gelten kann. Darum ist die Analyse der aristotelischen Lebenstheorie einer der Grundpfeiler jeder Geschichtsschreibung über Biologie.
Für unsere Zwecke kommen neben einigen Abschnitten der „Metaphysik“ Teile der Schrift „Über die Entstehung der Tiere“ und die Schrift „Über die Seele“ in Betracht2.
Wir werden die in dem von der Entstehung der Tiere handelnden Werke niedergelegten theoretischen Ansichten zuerst analysieren, um uns dann, nachdem wir gesehen haben werden, wie Aristoteles hier alles auf Leistungen der „Seele“ zurückführt, den tiefer dringenden Darlegungen des zuletzt genannten Buches zuzuwenden.
Es ist von hohem Interesse, zu gewahren, wie schon der erste Vertreter eines wissenschaftlichen „Vitalismus“ seinen Ausgang von den Problemen der Formbildung, der Embryologie oder Ontogenie in moderner Sprechweise, nimmt. Schon hier ist Aristoteles typisch, und zwar ist er hier nicht nur ein typischer Vertreter des Altertums und des Mittelalters, sondern auch ein typischer Vorläufer jeder vitalistischen Theorie bis in die allerjüngste Zeit: neben den Phänomenen der tierischen koordinierten Bewegungen sind stets die Erscheinungen der Formbildung aus dem Keim der Urausgang alles Vitalismus gewesen. –
Männchen und Weibchen tragen beide, aber in verschiedener Weise, zur Zeugung bei, indem beide Samen ausscheiden. Aber die weibliche Ausscheidung, als welche Aristoteles den Monatsfluß deutet, liefert nur den Stoff zur Erzeugung, die männliche bedingt die Form und den Ursprung der Veränderung; man sieht: den beiden grundlegendsten Begriffen des Stagiriten begegnen wir, in besonderer Ausgestaltung, auch hier.
Vom ganzen Körper her, wie behauptet worden war, braucht der Same nicht zu kommen, denn „warum kann nicht der Same von Haus aus so beschaffen sein, daß aus ihm Blut und Fleisch werden kann, ohne daß er selbst Blut und Fleisch zu sein braucht?“ Die Mischung der männlichen und weiblichen Ausscheidung ergibt den Keim; die Sonderung der Keime in Eier und Würmer, je nachdem das Junge aus einem Teil oder aus dem Ganzen des Keimes entsteht, wobei denn im ersteren Fall der Rest als Nahrung diene, hat für uns hier kein tieferes Interesse.
Welche Rolle spielt nun im einzelnen der männliche Same bei der Entwicklung, jenes „Höhere und Göttlichere", das sich nicht irgendwie stofflich an ihr beteiligt?
Hier beginnt des Aristoteles Entwicklungstheorie. –
Eine klare Fragestellung leitet sie ein:
„Dieser Punkt nun fordert eine genauere Untersuchung, auf welche Art denn eine jede Pflanze oder jedes Tier aus dem Samen entsteht. Denn notwendig muß jedes Entstehende aus Etwas entstehen und durch Etwas und als Etwas“. Das, woraus es entsteht, ist der von der Mutter gelieferte Stoff. „Es handelt sich aber hier nicht sowohl darum aus was, sondern durch was die Teile entstehen.“
Daß nun dieser maßgebende Faktor, durch den die Teile entstehen, etwas außerhalb des Samens Befindliches sei, wird als widersinnig abgelehnt; also liegt er in ihm, und zwar nicht als etwas von ihm Gesondertes, sondern als ein wahrer Teil von ihm selbst, der auch in das Junge als Teil desselben übergeht.
Aristoteles weiß durch mannigfache Beobachtungen, daß die embryonalen Teile nicht alle zugleich da sind, sondern sichtbarlich nacheinander entstehen: er ist also, um modern zu reden, deskriptiver „Epigenetiker“. Wie entstehen diese Teile nun?: „bildet der eine den anderen, oder entstehen sie nur schlechthin nacheinander?“ Unser Forscher entscheidet diese etwas dunkle Frage kurzerhand dahin, daß nicht etwa das Herz, welches der erste sichtbare Teil des Embryos sei, die Leber mache, und diese wieder einen anderen Teil, „sondern der eine Teil wird nach dem anderen, wie nach dem Knaben der Mann kommt, aber nicht durch jenen entsteht“. Denn im anderen Falle müsse ja, ganz abgesehen davon, daß es an einem Grund für die Entstehung des Herzens fehlen würde, Art und Gestalt der Leber im Herzen sein: „In allem nämlich, was durch die Natur oder durch die Kunst hervorgebracht wird, entsteht ein der Möglichkeit nach Seiendes durch ein in Wirklichkeit Seiendes“.
Hier wird uns das zweite grundlegende Begriffspaar der aristotelischen Philosophie, werden uns die Begriffe Dynamis und Entelechie in embryologischem Rahmen vorgeführt. Wir sind also mit einem Male auf Grundprobleme, aber auch auf Grundschwierigkeiten der aristotelischen Philosophie überhaupt gekommen und müssen daher unsere fortschreitende biologische Darstellung kurz unterbrechen:
Es handelte sich früher um Stoff und Form und handelt sich jetzt um Möglichkeit und Wirklichkeit: Hyle und Eidos, Dynamis und Entelechie. Dynamis bedeutet nun bei Aristoteies nicht das, was in neuerer Sprache in Begriffen wie Potential oder potentielle Energie zum Ausdruck kommt, wenigstens nicht nur und jedenfalls hier, an der von uns herangezogenen Stelle, nicht. Der Begriff der Dynamis ist viel weiter: er umfaßt die Möglichkeit, etwas zu erleiden. Der „Dynamis“ nach ist auch im Marmorblock die Statue enthalten, ja gerade dieser Sinn des Wortes ist es, an den Aristoteles, wie sich noch zeigen wird, an unserer Stelle ausschließlich denkt. Entelechie aber ist das im höchsten Sinne „Seiende“ einschließlich des ihm innewohnenden Strebens nach realer Ausgestaltung: in diesem Sinne „ist“ die Statue vor ihrer Realisation im Geiste des Bildhauers. Man sieht, daß eher noch als der Begriff der Dynamis derjenige der Entelechie dem modernen Begriff des Potentiellen entspricht, obschon auch nicht völlig. Aristotelisch gesprochen, kann man die Entelechie am besten als dynamisch, als „sich äußernd“ oder doch „sich äußern könnend“ gedachte „Form“ bezeichnen.
Doch liegen tiefere logische Untersuchungen uns hier ja fern, und so fahren wir denn in der Darstellung fort:
Es liegt eine offenbare Schwierigkeit darin begründet, daß, wie erörtert, nicht ein Teil des werdenden Körpers die Entstehung des anderen bedingen soll, denn damit ist eigentlich gesagt, daß der Grund für die Differenzierung der Teile, um kurz zu sprechen, nicht im Samen gelegen sei; sollte ja doch der Samen als wahrer Teil des werdenden Körpers angesehen werden. Es war aber früher auch gesagt, daß dieser Grund nicht außerhalb des Samens liegen könne.
Wie löst sich dieser Knoten?
Er löst sich wohl dadurch, daß unter gewissen Umständen doch „Etwas durch ein außer ihm Seiendes“ entstehen kann.
Und nun bringt Aristoteles in viel allgemeinerer Form als früher jenes Geschehenschema wieder hervor, welches er für den besonderen Fall des Entstehens eines Organs aus dem anderen, also etwa der Leber aus dem Herzen, nicht als anwendbar erachtete: „es gibt etwas, was die Teile bildet, aber nicht in der Art, daß es ein individuelles Wesen wäre, oder als der erste vollendete Teil in ihm vorhanden wäre“3, vielmehr ist die Formbildung als Ganzes nach Art der Kunstschöpfungen zu beurteilen:
„Wie aber jeder Teil entsteht, muß man aus dem Grundsatze herleiten, daß alles, was von Natur oder durch Kunst wird, durch ein in Wirklichkeit Existierendes aus einem der Anlage nach ebenso Beschaffenen entsteht. Der Same nun ist ein solches Wesen, und hat ein solches Bewegungsprinzip, daß, wenn der Anstoß der Bewegung aufhört, ein jeder Teil, und zwar als beseelter wird."
Das also ist die Grundlehre der aristotelischen Entwicklungstheorie. Die Ansicht, daß und wie jeder organische Teil beseelt sei, daß also z. B. ein totes Auge nur noch uneigentlich so genannt werde, tritt zunächst zurück gegen die Hauptsache: Der Same bildet den Körper durch eine Art von Beseelung aus dem von der Mutter gelieferten Stoffe, und er tut das kraft eines besonderen „Form“-Prinzips; dieses Prinzip nun hat er von einem anderen, dem wahren „in Wirklichkeit Existierenden“ her; er spielt also eine Art Mittlerrolle. Das „in Wirklichkeit Seiende“, von dem alles ausgeht, aber ist der Erzeugende oder vielmehr dessen Seele.
Eine Lücke im Text schneidet hier die weitere Darlegung ab; das Wesentliche lag wohl schon vor.
Alle Entwicklung hat also die größte Ähnlichkeit mit der Produktion von Kunstwerken; Aristoteles kommt immer wieder auf dieses Gleichnis. Interessant ist zu bemerken, wie er dem Anteil der unbelebten Faktoren sowohl an Entwicklung wie an Kunstproduktion durchaus zutreffend gerecht wird: Härte, Weichheit und anderes könne wohl Wärme oder Kälte bewirken, aber nicht die „Wesenheit“ z. B. von Knochen, ebenso wie Wärme und Kälte zwar das Eisen hart und weich mache, aber noch kein Schwert schaffe.
Der Unterschied zwischen Kunst- und Naturwerk wird trotz allem nicht übersehen: „die Kunst ist Ursprung und Gestalt des Werdenden, aber in einem anderen, die Bewegung der Natur aber hat in dem Ding selbst statt, ausgehend von einem zweiten Wesen, welches diese Gestalt schon in Wirklichkeit hat.“ –
Es wird nicht verkannt werden können, daß des Aristoteles Entwicklungstheorie nicht von allen Dunkelheiten ganz frei ist; ja, ich glaube die Behauptung wagen zu dürfen, daß Dunkelheiten in der vorstehenden Erörterung sicherlich nicht nur meiner Darstellungsart zuzuschreiben sind, mag dieselbe noch so verbesserungsfähig sein. Was trotz allem in höchste Bewunderung für den großen Griechen versetzt, das ist das überall sichtbare Ringen nach Klarheit in dieser schwierigsten aller Naturfragen, dieses fortwährende Hin- und Herwenden und Vertiefen derselben Fragen, diese feinste logische Subtilität. Wie plump ist vieles Neuere dagegen! –
Wie der Same im einzelnen die Entwicklungsbeseelung leistet, das wird recht kurz von Aristoteles abgemacht: er setzt die Ausscheidung der Gebärmutter in dieselbe Bewegung, in der er selbst sich befindet. Solches geht an, weil ja das Weibchen gleichsam ein verstümmeltes Männchen ist und sein Monatsfluß Samen ist, dem eben das Prinzip der Seele fehlt.
Bedeutsamer für uns sind jene verschiedenen Stufen von „Seele“, welche gewissermaßen die verschiedenen Stufen des Organischen kennzeichnen: Die Pflanzen haben zeitlebens und die Tiere im Anfang nur die ErnährungsseeIe, welche zugleich Wachstumsseele und auch mit jener im Samen als Prinzip vorhandenen Zeugungsseele identisch ist. Später bekommen die Tiere dazu die Empfindungsseele verbunden mit der begehrenden; kraft dieser eben sind sie Tiere. Der Mensch allein besitzt als drittes Vernunft, sie· allein ist „von außen“ gekommen und ist „göttlich“.
Doch sind wir damit bereits in die eigentliche Seelentheorie des Aristoteles eingetreten, aus welcher wir an der Hand der drei Bücher „Über die Seele“, wenigstens einiges zur Vertiefung alles Gesagten hier beibringen müssen.
Der Besitz einer der genannten Seelenstufen genügt bereits, um einen Körper zu einem lebendigen zu machen, denn Leben ist im allgemeinsten Sinne „die Ernährung und das Wachsen und Abnehmen eines Dinges durch sich selbst“. Besitzt er mehrere Seelenstufen, so sind immer in der höchsten alle niederen mit enthalten, „wie im Viereck das Dreieck" mit enthalten ist, und zwar dient jede niedere Stufe der höheren als Werkzeug, wie denn schließlich die Körper nur Werkzeuge des Seelischen sind und „nur der Seele wegen da sind“.
Daß die Seele als „vollendete Wirklichkeit“, als „Entelechie“ den Körper organisiere, ward schon in der Entwicklungstheorie erläutert; auch jetzt, in noch höherem Sinne, nennt Aristoteles wieder die Seele „gleichsam den Anfang der lebenden Wesen“, um dann zu seiner berühmten Definition zu gelangen, daß in allgemeinstem Sinne die Seele die „erste vollendete Wirklichkeit eines dem Vermögen nach lebendigen Naturkörpers, und zwar eines solchen, der Organe hat“, sei.
Damit ist in der Tat, wenn man die Worte richtig wendet, alles gesagt, was der große Denker sagen will: die Seele ist zureichender Grund des Daseins und des Soseins und des Sichsoverhaltens des organischen Körpers in jeder Beziehung. Sie ist im höchsten Sinne „Wirklichkeit“, und zwar „wie die Wissenschaft, nicht wie das gegenwärtige Wissen“.
Die Frage, ob Seele und Körper Eins seien, hat so wenig Sinn wie in bezug auf das Wachs und seine Gestalt. Sie kann nicht ohne Körper sein, sie ist aber nicht der Körper, sondern etwas am Körper; „wäre das Auge ein lebendiges Wesen, so würde das Sehen seine Seele sein, da dieses das begriffliche Sein des Auges ist, und das Auge wäre dann der Stoff des Sehens“.
Der Vernunft des Menschen als höchster Seelenstufe dienen alle niederen Seelenstufen, wie schon gesagt, als Werkzeuge; die Leidenschaften gehören diesen niederen Stufen an: nicht die höchste Seele also „zürnt oder bemitleidet, sondern der Mensch mittels der (niederen) Seele“; auch kommt das Alter nicht davon, daß die höchste Seele etwas erlitten hat, sondern der Körper, worin sie ist; „das Denken und Überlegen wird im Alter nur schwach, weil ein anderes im Inneren verdirbt, es selbst ist leidlos“.
Nur die Vernunft, wie sie ja auch von außen gekommen und göttlich ist, ist unsterblich: „wenn dieses Wesen untergeht, so hört Erinnern und Leiden auf, denn es gehört nicht zur Vernunft, sondern nur zu dem Gemeinsamen, was untergegangen ist.“
Man beachte hier, was freilich des näheren in die allgemeine Metaphysik gehört, daß Aristoteles nicht, wie wir heute, den großen Einschnitt im Reiche des Lebendigen zwischen Gestaltungskräften und Seele setzt, sondern zwischen Gestaltungskräften + niederen Seelenvermögen und Vernunft. Auch ist nicht zu vergessen, daß Aristoteles zwar insofern „Dualist“ ist, als ihm der begriffliche Gegensatz zwischen Form und Stoff ein Urgegensatz ist, daß er aber realiter keinen „Stoff“ ohne „Form“ kennt. Er ist also, wenn man so will, auch „Vitalist“ für das Anorganische, so daß ihm schließlich der einzige große Einschnitt in der empirischen Wirklichkeit überhaupt zwischen dem Geist und allem anderen liegt. Nach der anorganischen Seite hin war das ein Mangel; er kennt Mechanik auch da nicht, wo sie zu Recht besteht.
Solches muß genügen, um uns über des Aristoteles Ansicht vom Leben im weitesten Sinne aufzuklären; auf feinere logische Untersuchungen über die Begriffe Dynamis, Entelechie und Energie einzugehen, kann hier nicht der Ort sein, ebenso wenig auf intimere Erörterungen über Stoff, Form und Wesen; für Hegel ist in dieser Hinsicht bekanntlich das aristotelische Denken maßgebend geworden. –
Des Aristoteles Lebenslehre ist ein reiner Vitalismus, und zwar möchte ich ihn ursprünglichen oder naiven Vitalismus nennen, da er aus ganz unbefangenem Betrachten der Lebensphänomene heraus erwachsen ist, nicht im Kampf gegen andere Doktrinen. Nur ganz gelegentlich, wie z. B. bei jener Bemerkung, daß doch Wärme und Kälte nicht ein Schwert mache, zeigt sich dem aufmerksamen Beobachter, daß Aristoteles bei seinem Theoretisieren überhaupt Gegner hatte4: wir wissen, daß die Materialisten der Schule Demokrits solche Gegner waren, wie deren in Epikurs Schule später viele erstanden. Vielleicht hielt Aristoteles, auf seiner biologischen Sachkenntnis gegenüber den luftigen Thesen der Demokritianer fußend, eine eingehende Widerlegung für überflüssig. Immerhin hätte er für die unbelebte Seite der Natur von ihnen lernen können. –
Gegen Ende seines Buches von der Tierentwicklung faßt Aristoteles einmal kurz zusammen, was seine Naturauffassung von derjenigen gegenerischer Philosophen unterscheidet, eine Stelle, welche hier folgen möge, da sie zugleich ein guter kurzer Ausdruck seines Vitalismus, seiner Lebensautonomielehre ist:
„Es ist in den geordneten und gesetzlichen Werken der Natur ein Jegliches nicht deswegen so beschaffen, weil es mit solchen Eigenschaften entsteht, sondern vielmehr, weil es ein so Beschaffenes ist, deshalb entsteht es mit solchem Eigenschaften: denn die Entstehung und Entwicklung richtet sich nach dem Wesen und ist um des Wesens willen, nicht aber dieses nach der Entstehung. Die alten Naturforscher hatten aber die entgegengesetzte Meinung, weil sie nicht erkannt hatten, daß es mehrere Ursachen gibt, sondern weil sie nur die stoffliche und die bewegende und auch diese nicht nach ihren Unterschieden kannten, die des Begriffs und des Zwecks aber außer acht ließen.5“
Wir Neueren werden uns aus des Demokrit Lehrsystem immerhin den Begriff der Naturnotwendigkeit zu eigen machen, welchen Aristoteles nicht in genügender Strenge hat, mögen uns schon die schematischen materialistischen Behauptungen nichts angehen. –
Die Bedeutung des biotheoretischen Systems des Aristoteles kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Obschon von Plato ausgehend, verdrängte er wegen seiner schärferen logischen Begriffsmittel gerade in bezug auf im engeren Sinne Naturwissenschaftliches dessen Einfluß völlig: er hat in seinem Begriff der „Entelechie“ das Band zwischen „Idee“ und Wirklichkeit geschaffen, welches bei Plato fehlt; und eben diese Schöpfung brauchte die theoretische Naturforschung.
Aristoteles ist auch in biologischen Dingen – wie in so vielen anderen – die Autorität bis ins siebzehnte, ja