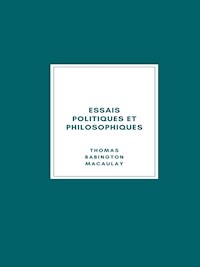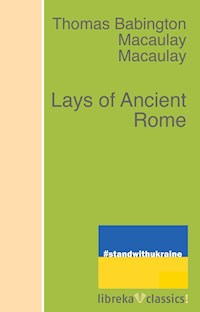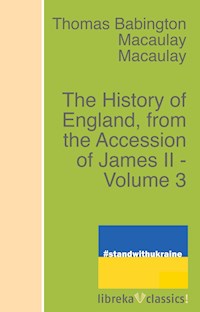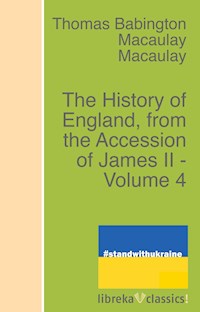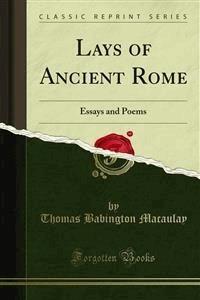Geschichte von England seit der Thronbesteigung Jakob's des Zweiten. Zehnter Band: enthaltend Kapitel 19 und 20. E-Book
Thomas Babington Macaulay, Macaulay, Baron
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Ähnliche
Thomas Babington Macaulay’s
Geschichte von England
seit der
Thronbesteigung Jakob’s des Zweiten.
Aus dem Englischen.
Vollständige und wohlfeilste
Stereotyp-Ausgabe.
Zehnter Band:
enthaltend Kapitel 19 und 20.
Leipzig, 1856.
G. H. Friedlein.
Neunzehntes Kapitel. Wilhelm und Marie.
Inhalt.
Wilhelm’s auswärtige Politik.
Während England einestheils durch die Besorgniß einer Invasion, andrentheils durch die Freude über seine durch die Tapferkeit seiner Seeleute erwirkte Befreiung bewegt wurde, fanden wichtige Ereignisse auf dem Continent statt. Am 6. März war der König im Haag angekommen und hatte seine Anstalten für den bevorstehenden Feldzug zu treffen begonnen.[1]
Die vor ihm liegende Aussicht war trübe. Die Coalition, deren Schöpfer und Oberhaupt er war, schwebte seit einigen Monaten in steter Gefahr, sich aufzulösen. Durch welche unermüdliche Anstrengungen, durch welche sinnreiche Mittel und Wege, durch welche Schmeicheleien, durch welche Lockungen es ihm gelang, seine Verbündeten abzuhalten, sich einer nach dem andren Frankreich zu Füßen zu werfen, läßt sich nur unvollkommen ermitteln. Die vollständigste und authentischeste Aufzählung der Mühen und Opfer, durch welche er acht Jahre lang eine Schaar kleinmüthiger und verrätherischer, das gemeinsame Interesse nichtachtender und auf einander eifersüchtiger Potentaten zusammenhielt, findet sich in seiner Correspondenz mit Heinsius. In dieser Correspondenz ist Wilhelm ganz er selbst. Er hatte im Laufe seines ereignißvollen Lebens einige wichtige Aufgaben zu lösen, für die er nicht besonders befähigt war, und diese Aufgaben löste er unvollkommen. Als Souverain von England zeigte er Talente und Tugenden, die ihm zu einer ehrenvollen Erwähnung in der Geschichte berechtigen; allein er hatte auch große Mängel. Er war bis zum letzten Augenblick ein Fremder unter uns, kalt, zurückhaltend, niemals heiter, niemals sich wohl fühlend. Sein Königreich war ein Verbannungsort, seine schönsten Paläste waren Gefängnisse. Er zählte stets die Tage, welche noch vergehen sollten, ehe er sein Geburtsland, die beschnittenen Bäume, die Flügel zahlloser Windmühlen, die Storchsnester auf den hohen Giebeln und die langen Reihen bunter Landhäuser, die sich in den ruhigen Kanälen spiegeln, wiedersehen sollte. Er bemühte sich gar nicht, die Vorliebe zu verbergen, die er für seinen heimathlichen Boden und für seine Jugendfreunde empfand, und daher herrschte er nicht in unseren Herzen, obwohl er unsrem Vaterlande große Dienste leistete. Auch als General im Felde bewies er einen seltenen Muth und eine seltene Tüchtigkeit; aber als Taktiker stand er manchen seiner Zeitgenossen nach, die ihm in allgemeiner geistiger Befähigung weit nachstanden. Das Geschäft, für das er sich ganz vorzüglich eignete, war die Diplomatie im höchsten Sinne des Worts. Es darf bezweifelt werden, ob er in der Kunst große Unterhandlungen zu leiten, von denen das Wohl der Völkerrepublik abhängt, je übertroffen worden ist. Seine Geschicklichkeit in diesem Zweige der Politik wurde niemals strenger erprobt und glänzender bewiesen als während des letzten Theils des Jahres 1691 und des ersten Theils des Jahres 1692.
Die nordischen Mächte.
Eine seiner Hauptschwierigkeiten wurde durch die finstre und drohende Haltung der nordischen Mächte hervorgerufen. Dänemark und Schweden hatten einmal geneigt geschienen, sich der Coalition anzuschließen, aber sie waren bald wieder kühl geworden und nahmen rasch eine immer feindseligere Haltung an. Von Frankreich glaubten sie wenig zu fürchten zu haben. Es war nicht sehr wahrscheinlich, daß seine Armeen über die Elbe gehen oder daß seine Flotten den Durchgang durch den Sund erzwingen würden. Aber die vereinte Seemacht England’s und Holland’s konnte wohl in Stockholm und Kopenhagen Besorgnisse erwecken. Bald entstanden unangenehme seerechtliche Fragen, Fragen, wie sie fast in jedem ausgedehnten Kriege der Neuzeit zwischen Kriegführenden und Neutralen aufgetaucht sind. Die skandinavischen Fürsten beschwerten sich darüber, daß der berechtigte Handel zwischen der Ostsee und Frankreich despotischerweise unterbrochen worden sei. Obwohl sie im allgemeinen nicht auf einem sehr freundschaftlichen Fuße miteinander gestanden, begannen sie doch jetzt sich eng an einander anzuschließen, intriguirten an jedem kleinen deutschen Hofe und versuchten das zu bilden was Wilhelm eine dritte Partei in Europa nannte. Der König von Schweden, der als Herzog von Pommern verpflichtet war, dreitausend Mann zur Vertheidigung des deutschen Reichs zu stellen, sandte anstatt ihrer den Rath, die Alliirten möchten unter den besten Bedingungen, die sie erlangen könnten, Frieden schließen.[2] Der König von Dänemark nahm eine große Anzahl holländischer Kauffahrteischiffe weg und zog in Holstein eine Armee zusammen, die seinen Nachbarn keine geringe Besorgniß einflößte. „Ich fürchte,” schrieb Wilhelm in einem Augenblicke tiefer Niedergeschlagenheit an Heinsius, „ich fürchte, daß der Zweck dieser dritten Partei ein Friede ist, der die Knechtung Europa’s im Gefolge haben wird. Die Zeit wird kommen, wo Schweden und seine Verbündeten zu spät erfahren werden, welchen großen Fehler sie begangen haben. Sie stehen der Gefahr allerdings ferner als wir, und deshalb sind sie so eifrig bestrebt, unsren und ihren eignen Untergang herbeizuführen. Daß Frankreich jetzt auf billige Bedingungen eingehen wird, ist nicht zu erwarten, und es wäre besser, mit dem Schwerte in der Hand zu fallen, als sich Allem zu unterwerfen was es dictiren würde.”[3]
Der Papst.
Während der König so durch die Haltung der nordischen Mächte beunruhigt wurde, begannen auf einer ganz andren Seite ominöse Anzeichen sichtbar zu werden. Es war von vornherein kein leichtes Ding gewesen, Souveraine, welche die protestantische Religion haßten und sie in ihren eigenen Landen verfolgten, zur Unterstützung der Revolution zu bewegen, welche diese Religion aus einer großen Gefahr errettet hatte. Glücklicherweise aber hatten das Beispiel und die Autorität des Vatikans ihre Bedenken gehoben. Innocenz XI. und Alexander VIII. hatten Wilhelm mit schlecht verhehlter Parteilichkeit betrachtet. Er war zwar nicht ihr Freund, aber er war ihres Feindes Feind, und Jakob war ihres Feindes Vasall und mußte es im Fall seiner Restauration wieder werden. Sie liehen daher dem ketzerischen Neffen ihren wirklichen Beistand, den rechtgläubigen Oheim aber speisten sie mit Complimenten und Segenswünschen ab. Doch Alexander VIII. hatte wenig über funfzehn Monate auf dem päpstlichen Throne gesessen. Sein Nachfolger Antonio Pignatelli, der den Namen Innocenz XII. annahm, verlangte ungeduldig danach sich mit Ludwig zu versöhnen. Ludwig sah jetzt ein, daß er einen großen Fehler begangen, indem er zu gleicher Zeit den Geist des Protestantismus und den Geist des Papismus gegen sich aufgeregt hatte. Er erlaubte den französischen Bischöfen, sich dem heiligen Stuhle zu unterwerfen. Der Streit, der einmal den Anschein gehabt hatte, als werde er mit einem großen gallikanischen Schisma enden, wurde beigelegt, und es war Grund zu der Annahme vorhanden, daß der Einfluß des Oberhauptes der Kirche dazu angewendet werden würde, die Bande zu lösen, welche so viele katholische Fürsten an den Calvinisten knüpften, der den britischen Thron usurpirt hatte.
Benehmen der Verbündeten.
Mittlerweile war die Coalition, welche die dritte Partei auf der einen und der Papst auf der andren Seite aufzulösen versuchten, in nicht geringer Gefahr, aus bloßer Fäulniß zu zerfallen. Zwei von den verbündeten Mächten, und nur zwei waren der gemeinsamen Sache herzlich zugethan: England, das die anderen britischen Königreiche mit sich fortzog, und Holland, das die anderen batavischen Republiken mit sich fortzog. England und Holland waren zwar durch innere Parteispaltungen zerrissen und durch gegenseitige Eifersüchteleien und Antipathieen von einander getrennt, aber beide waren fest entschlossen, sich der französischen Oberherrschaft nicht zu unterwerfen, und beide waren bereit, ihren Theil, ja noch mehr als ihren Theil von den Lasten des Kampfes zu tragen. Die meisten Mitglieder des Bundes waren nicht Nationen, sondern Personen: ein Kaiser, ein König, Kurfürsten und Herzöge, und unter diesen gab es kaum Einen, der mit ganzer Seele bei dem Kampfe gewesen wäre, kaum Einen, der sich nicht gesträubt, der nicht eine Entschuldigung für die Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gefunden, der nicht gehofft hätte, zur Vertheidigung seiner eigenen Rechte und Interessen gegen den gemeinsamen Feind gemiethet zu sein. Der Krieg aber war der Krieg des englischen Volks und des holländischen Volks. Wäre er dies nicht gewesen, so würde weder England noch Holland die Lasten, die er nöthig machte, nur ein einziges Jahr getragen haben. Als Wilhelm sagte, daß er lieber mit dem Schwerte in der Hand fallen als sich vor Frankreich demüthigen wolle, sprach er nicht nur seine eigene, sondern die Gesinnung zweier großer Staaten aus, deren erste Magistratsperson er war. Leider sympathisirten mit diesen beiden Staaten andere Staaten nur wenig. Sie wurden in der That von anderen Staaten so angesehen, wie reiche, ehrlichhandelnde, freigebige Tropfe von bedürftigen Gaunern angesehen werden. England und Holland waren reich und sie waren thätig. Ihr Reichthum erweckte die Habgier der ganzen Allianz und zu diesem Reichthum war ihre Thätigkeit der Schlüssel. Sie wurden mit schmutziger Zudringlichkeit von allen ihren Bundesgenossen verfolgt, vom Cäsar, der im stolzen Bewußtsein seiner einzigen Würde König Wilhelm nicht mit dem Titel Majestät beehren wollte, bis herab zu dem geringsten Markgrafen, der aus den zerbrochenen Fenstern des ärmlichen und verfallenen alten Hauses, das er seinen Palast nannte, sein ganzes Land übersehen konnte. Es war noch nicht genug, daß England und Holland viel mehr als ihre Contingente zum Landkriege stellten und die ganze Last des Seekriegs allein trugen. Sie waren auch noch von einem Schwarme vornehmer Bettler belagert, einige roh, andere demüthig, alle aber unermüdlich und unersättlich. Ein Fürst kam alljährlich mit einer kläglichen Darstellung seiner Noth zu ihnen betteln. Ein andrer trotzigerer Bettler drohte der dritten Partei beizutreten und einen Separatfrieden mit Frankreich zu schließen, wenn seine Forderungen nicht gewährt würden. Jeder Souverain hatte überdies seine Minister und Günstlinge, und diese Minister und Günstlinge gaben beständig zu verstehen, daß Frankreich bereit sei, sie zu bezahlen, wenn sie ihre Gebieter bewegen könnten, von der Coalition zurückzutreten, und daß England und Holland klug daran thun würden, Frankreich zu überbieten.
Die durch die Habgier der verbündeten Höfe verursachte Verlegenheit war jedoch kaum größer als die durch ihren Stolz und ihren Ehrgeiz herbeigeführte Verlegenheit. Der eine Fürst hatte sich auf eine kindische Auszeichnung, auf einen Titel oder einen Orden capricirt und wollte nicht eher etwas für die gemeinsame Sache thun als bis seine Wünsche erfüllt waren. Ein andrer geruhte sich einzubilden, daß er zurückgesetzt worden sei, und wollte sich nicht rühren, bis ihm Genugthuung verschafft worden. Der Herzog von Braunschweig-Lüneburg wollte kein Bataillon zur Vertheidigung Deutschland’s stellen, wenn er nicht zum Kurfürsten gemacht würde.[4] Der Kurfürst von Brandenburg erklärte, er sei noch eben so feindselig gegen Frankreich gesinnt als je; aber die spanische Regierung habe ihn übel behandelt und er werde daher seine Soldaten nicht zur Vertheidigung der spanischen Niederlande verwenden lassen. Er sei zwar bereit, am Kriege Theil zu nehmen, aber nur in der ihm convenirenden Weise; er müsse das Commando einer besonderen Armee haben und seine Stellung zwischen dem Rhein und der Maas bekommen.[5] Der Kurfürst von Sachsen beschwerte sich, daß seinen Truppen schlechte Winterquartiere angewiesen worden seien, und er rief sie daher gerade in dem Augenblicke zurück, wo sie hätten Anstalt treffen sollen, ins Feld zu rücken, erbot sich aber ganz kaltblütig sie wieder zu schicken, wenn England und Holland ihm vierhunderttausend Reichsthaler gäben.[6]
Der Kaiser.
Man hätte erwarten sollen, daß wenigstens die beiden Häupter des Hauses Oesterreich in diesem Augenblicke ihre ganze Kraft gegen das rivalisirende Haus Bourbon aufbieten würden. Leider waren sie nicht zu bewegen, auch nur für ihre eigne Erhaltung energische Anstrengungen zu machen. Sie hatten ein großes Interesse daran, die Franzosen von Italien abzuhalten. Gleichwohl konnten sie nur mit Mühe dazu vermocht werden, dem Herzoge von Savoyen den geringsten Beistand zu leihen. Sie schienen zu glauben, daß es England’s und Holland’s Sache sei, die Pässe der Alpen zu vertheidigen und die Armeen Ludwig’s zu verhindern, die Lombardei zu überschwemmen. In den Augen des Kaisers war der Krieg gegen Frankreich in der That eine untergeordnete Aufgabe. Seine Hauptaufgabe war der Krieg gegen die Türkei. Er war beschränkt und bigott. Es beunruhigte ihn, daß der Krieg gegen Frankreich in gewissem Sinne ein Krieg gegen die katholische Religion war, und der Krieg gegen die Türkei war ein Kreuzzug. Sein neuerlicher Feldzug an der Donau war glücklich gewesen. Er hätte leicht einen ehrenvollen Frieden mit der Pforte schließen und seine Waffen gegen Westen richten können. Aber die Hoffnung war in ihm erwacht, seine Erblande auf Kosten der Ungläubigen vergrößern zu können. Visionen von einem triumphirenden Einzuge in Konstantinopel und von einem Te Deum in der Sophia-Moschee waren in seinem Kopfe aufgestiegen. Er beschäftigte nicht nur im Osten eine Truppenmacht, die mehr als ausreichend gewesen sein würde, Piemont zu vertheidigen und Lothringen wiederzuerobern, sondern er schien auch zu glauben, daß England und Holland verpflichtet seien, ihn für die Vernachlässigung ihrer Interessen und für die Wahrnehmung seiner eigenen glänzend zu belohnen.[7]
Spanien.
Spanien war damals schon was es bis auf unsre Zeit geblieben ist. Von dem Spanien, das über Land und Meer, über die alte und neue Welt geherrscht, von dem Spanien, das in der kurzen Zeit von zwölf Jahren einen Papst und einen König von Frankreich, einen Souverain von Mexico und einen Souverain von Peru als Gefangene fortgeführt, von dem Spanien, das eine Armee unter die Mauern von Paris gesandt und eine gewaltige Flotte ausgerüstet hatte, um in England einzufallen, war nichts mehr übrig als eine Anmaßung, die einst Schrecken und Haß erweckt hatte, die aber jetzt nur noch ein geringschätzendes Lächeln hervorrufen konnte. An Umfang übertrafen zwar die Gebiete des katholischen Königs die Gebiete Rom’s, als Rom auf dem Gipfel der Macht stand. Aber die ungeheure Ländermasse lag erstarrt und hülflos da und konnte ungestraft beleidigt und beraubt werden. Die ganze Verwaltung, des Heeres und der Marine, der Finanzen und der Kolonien, war völlig desorganisirt. Karl war ein entsprechender Repräsentant seines Reichs, körperlich, geistig und moralisch impotent, in Unwissenheit, Sorglosigkeit und Aberglauben versunken, doch aber vom Gefühl seiner Würde aufgebläht und sehr bereit, sich Beleidigungen einzubilden und solche zu ahnden. Seine Erziehung war so erbärmlich gewesen, daß, als man ihm den Fall von Mons, der wichtigsten Festung seines großen Reichs mittheilte, er fragte, ob Mons in England liege.[8] Unter den Ministern, welche durch seine krankhafte Laune erhoben und gestürzt wurden, war keiner befähigt, ein Heilmittel gegen die Gebrechen des Staats anzuwenden. Die Nerven dieses gelähmten Körpers neu zu stählen, würde allerdings selbst für einen Ximenes eine schwere Aufgabe gewesen sein. Kein Diener der spanischen Krone bekleidete einen wichtigeren Posten und keiner war unfähiger zur Bekleidung eines wichtigen Postens als der Marquis von Gastanaga. Er war Gouverneur der Niederlande und es war wahrscheinlich, daß in den Niederlanden das Schicksal der Christenheit entschieden werden würde. Er hatte sein Amt verwaltet, wie damals jedes öffentliche Amt in jedem Theile dieser großen Monarchie verwaltet wurde, von der man hochtrabend sagte, daß die Sonne nie darin untergehe. So fruchtbar und reich das Land war, das er verwaltete, wälzte er doch auf England und Holland die ganze Last, es zu vertheidigen. Er erwartete daß Alles, Waffen, Munition, Wagen und Lebensmittel, von den Ketzern geliefert würde. Es war ihm nie eingefallen, daß es seine und nicht ihre Sache sei, Mons in den Stand zu setzen, eine Belagerung aushalten zu können. Die öffentliche Stimme beschuldigte ihn ganz laut, diese berühmte Festung an Frankreich verkauft zu haben. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß man ihm nichts Schlimmeres zur Last legen konnte als die seiner Nation eigene hochmüthige Apathie und Trägheit.
Es gelingt Wilhelm, der Auflösung der Coalition vorzubeugen.
In diesem Zustande befand sich die Coalition, deren Oberhaupt Wilhelm war. Es gab Momente, wo er sich überwältigt fühlte, wo ihm der Muth sank, wo seine Geduld erschöpft war und seine angeborne Reizbarkeit sich Luft machte. „Ich kann,” schrieb er, „keinen Vorschlag machen, ohne daß mir eine Subsidienforderung entgegengehalten wird.”[9] „Ich habe rund abgeschlagen,” schrieb er ein andermal, als er dringend um Geld angegangen worden war, „denn es ist unmöglich, daß die Generalstaaten und England die Lasten der Armee am Rhein, der Armee in Piemont und der ganzen Vertheidigung von Flandern tragen können, der ungeheuren Kosten des Seekriegs gar nicht zu gedenken. Wenn unsere Alliirten nichts für sich thun können, dann ist es am besten, die Allianz löst sich je eher je lieber auf.”[10] Aber nach jedem kurzen Anfall von Entmuthigung und Verstimmung raffte er wieder die ganze Energie seines Geistes zusammen und legte seinem Temperament einen starken Zügel an. So schwach, engherzig, falsch und selbstsüchtig nur zu viele seiner Verbündeten auch waren, nur unter ihrem Beistande konnte er durchführen, was er von Jugend auf als seine Mission betrachtet hatte. Wenn sie ihn verließen, so wurde Frankreich der unbestrittene Beherrscher Europa’s. Wie sehr sie auch bestraft zu werden verdienten, wollte er doch, um ihrer Bestrafung willen, nicht in die Unterjochung der ganzen civilisirten Welt willigen. Er nahm sich daher vor, einige Schwierigkeiten zu überwinden, und andere zu umgehen. Die skandinavischen Mächte gewann er, indem er, allerdings mit Widerstreben und nicht ohne schweren inneren Kampf, auf einige seiner Seerechte verzichtete.[11] In Rom hielt sein Einfluß, obwohl nur indirect ausgeübt, dem des Papstes selbst die Wage. Ludwig und Jakob überzeugten sich, daß sie außer Innocenz keinen Freund im Vatikan hatten, und Innocenz, der von sanftem und unschlüssigem Character war, scheute sich, einen den Gesinnungen seiner ganzen Umgebung direct zuwiderlaufenden Weg einzuschlagen. In Privatunterredungen mit jakobitischen Agenten erklärte er sich dem Interesse des Hauses Stuart zugethan; in seinen öffentlichen Handlungen aber beobachtete er eine strenge Neutralität. Er schickte zwanzigtausend Kronen nach Saint-Germains; aber er entschuldigte sich bei den Gegnern Frankreich’s, indem er versicherte, daß dies keine Subsidie zu irgend einem politischen Zwecke, sondern lediglich ein unter arme britische Katholiken zu vertheilendes Almosen sein solle. Er gestattete die Verlesung von Gebeten für die gute Sache im englischen Collegium zu Rom; aber er bestand darauf, daß diese Gebete in allgemeine Ausdrücke gefaßt sein müßten und daß kein Name darin genannt werden dürfe. Umsonst beschworen ihn die Gesandten der Häuser Stuart und Bourbon ein entschiedeneres Verfahren zu beobachten. „Gott weiß,” rief er einmal aus, „daß ich mit Freuden mein Blut für die Wiedereinsetzung des Königs von England vergießen würde. Aber was kann ich thun? Wenn ich mich rühre, sagt man mir, daß ich die Franzosen begünstige und ihnen zur Aufrichtung einer Universalmonarchie behülflich sei. Ich bin nicht wie die früheren Päpste. Die Könige wollen nicht auf mich hören, wie sie auf meine Vorgänger hörten. Es giebt jetzt keine Religion, sondern nichts als gottlose, weltliche Politik. Der Prinz von Oranien ist der Gebieter. Er beherrscht uns Alle. Er hat eine solche Gewalt über den Kaiser und den König von Spanien gewonnen, daß keiner von Beiden es wagt, sein Mißfallen zu erregen. Gott helfe uns! Er allein kann uns helfen!” So sprechend schlug der alte Mann in einer Regung ohnmächtigen Zornes und Unwillens mit der Hand auf den Tisch.[12]
Die deutschen Fürsten standhaft zu erhalten, war keine leichte Aufgabe; aber sie wurde durchgeführt. Es wurde Geld unter sie vertheilt, zwar viel weniger als sie verlangt hatten, aber doch viel mehr als sie anständigerweise beanspruchen konnten. Mit dem Kurfürsten von Sachsen wurde ein Abkommen getroffen. Er hatte neben einem starken Gelüste nach Subsidien großes Verlangen danach, Mitglied der auserlesensten und höchsten Ritterorden zu werden. Wie es scheint, begnügte er sich anstatt der verlangten vierhunderttausend Reichsthaler mit hunderttausend und dem Hosenbandorden.[13] Sein Premierminister Schöning, der habgierigste und treuloseste Mensch von der Welt, wurde durch eine Pension gewonnen.[14] Dem Herzoge von Braunschweig-Lüneburg verschaffte Wilhelm nicht ohne Mühe den lange ersehnten Titel eines Kurfürsten von Hannover. Durch solche Mittel wurden die Risse, welche die Coalition zerklüftet hatten, so geschickt ausgebessert, daß sie dem Feinde noch immer eine feste Stirn bot.
Neue Arrangements für die Verwaltung der spanischen Niederlande.
Wilhelm hatte sich bei der spanischen Regierung bitter über die Unfähigkeit und Trägheit Gastanaga’s beklagt, und die spanische Regierung konnte, so hülflos und schläfrig sie auch war, nicht ganz gleichgültig gegen die Gefahren sein, welche Flandern und Brabant drohten. Gastanaga wurde abberufen und Wilhelm ersucht, die Verwaltung der Niederlande mit Gewalten, welche denen eines Königs nicht nachstanden, selbst zu übernehmen. Philipp II. würde so leicht nicht geglaubt haben, daß innerhalb eines Jahrhunderts nach seinem Tode sein Urenkel den Urenkel Wilhelm’s des Schweigsamen bitten würde, in Brüssel die Autorität eines Souverains auszuüben.[15]
Der Antrag war in einer Hinsicht lockend; Wilhelm aber war zu klug, um ihn anzunehmen. Er wußte, daß die Bevölkerung der spanischen Niederlande der römischen Kirche fest anhing. Jede Maßregel eines protestantischen Regenten konnte sicher sein, von dem Klerus und der Bevölkerung dieses Landes mit Mißtrauen betrachtet zu werden. Gastanaga hatte bereits im Aerger über seine Entlassung den römischen Hof schriftlich benachrichtigt, daß man Veränderungen im Sinne habe, welche Gent und Antwerpen eben so ketzerisch machen würden wie Amsterdam und London.[16] Ohne Zweifel hatte Wilhelm auch erwogen, daß, wenn es ihm auch durch eine milde und gerechte Regierung und durch Bezeigung einer geziemenden Achtung für die Gebräuche und Diener der katholischen Religion gelingen sollte, sich das Vertrauen der Belgier zu erwerben, er unvermeidlich auf unsrer Insel einen Sturm von Vorwürfen gegen sich heraufbeschwören würde. Er wußte aus Erfahrung was es hieß, zwei Nationen zu regieren, welche fest an zwei verschiedenen Kirchen hielten. Eine zahlreiche Partei unter den Episkopalen England’s konnte es ihm nicht vergeben, daß er in die Einführung der presbyterianischen Kirchenverfassung in Schottland gewilligt hatte. Eine zahlreiche Partei unter den Presbyterianern Schottland’s tadelte ihn, daß er die episkopale Kirchenverfassung in England aufrecht erhielt. Wenn er jetzt Messen, Processionen, geschnitzte Bilder, Mönchsklöster, Nonnenklöster und, was das Schlimmste von Allem war, Jesuitenkanzeln, Jesuitenbeichtstühle und Jesuitencollegien unter seinen Schutz nahm, was konnte er dann Andres erwarten, als daß England und Schottland einen einstimmigen Tadelsschrei erheben würden? Er weigerte sich daher, die Verwaltung der Niederlande zu übernehmen und schlug vor, sie dem Kurfürsten von Baiern zu übertragen. Der Kurfürst von Baiern war nach dem Kaiser der mächtigste katholische Potentat Deutschland’s. Er war jung, tapfer und lüstern nach militärischer Auszeichnung. Der spanische Hof war geneigt, ihn zu ernennen und er sehnte sich danach, ernannt zu werden; aber eine alberne Schwierigkeit verursachte eine lange Verzögerung. Der Kurfürst hielt es unter seiner Würde, das zu verlangen, was er so sehr wünschte, und die Formalisten des Cabinets von Madrid hielten es unter der Würde des katholischen Königs, etwas zu geben, um was nicht nachgesucht worden war. Eine Vermittelung war nothwendig, und sie führte endlich zum Ziele. Aber es war viel Zeit verloren worden, und das Frühjahr war schon weit vorgerückt, als der neue Gouverneur der Niederlande seine Functionen antrat.[17]
Ludwig rückt ins Feld.
Wilhelm hatte die Coalition vor der Gefahr behütet, durch Uneinigkeit zu Grunde zu gehen. Aber durch keine Vorstellungen, durch keine Bitten, durch keine Bestechungen konnte er seine Verbündeten bewegen, bei Zeiten im Felde zu stehen. Sie hätten die harte Lection, die ihnen im vorhergehenden Jahre gegeben worden war, benutzen sollen. Doch abermals zauderte Jeder und wunderte sich warum die Anderen zauderten, und abermals erwies sich der Mann, der allein die ganze Macht Frankreich’s in seiner Hand hatte, wie seine stolze Devise sich dessen seit langer Zeit rühmte, einer Menge von Gegnern gewachsen.[18] Während seine Feinde noch immer nicht schlagfertig waren, erfuhren sie mit Schrecken, daß er persönlich an der Spitze seines Adels ins Feld gerückt war. Noch bei keiner Gelegenheit war dieser tapfere Adel mit größerem Glanze in seinem Gefolge erschienen. Ein einziger Umstand mag genügen, um einen Begriff von der Pracht und dem Luxus seines Lagers zu geben. Unter den Musketieren seiner Haustruppen ritt zum ersten Male ein siebzehnjähriger Jüngling, der bald nachher den Titel eines Herzogs von Saint-Simon erbte und dem wir die unschätzbaren Memoiren verdanken, welche zur Unterhaltung und Belehrung vieler Länder und vieler Geschlechter das lebensvolle Gemälde eines längst entschwundenen Frankreich erhalten haben. Obgleich sich die Familie des Knaben damals in arger Geldverlegenheit befand, reiste er doch mit fünfunddreißig Pferden und Saumthieren. Die Prinzessinnen von Geblüt, jede von einer Gruppe vornehmer und anmuthiger Damen umgeben, begleiteten den König, und das Lächeln so vieler reizender Frauen beseelte den Schwarm der eitlen und üppigen, aber hochsinnigen Cavaliere mit einem mehr als gewöhnlichen Muthe. In der glänzenden Schaar, welche den französischen Augustus umgab, sah man auch den französischen Virgil, den eleganten, zarten, melodischen Racine. Er war, in Einklang mit der herrschenden Mode, fromm geworden, hatte das Schriftstellern für die Bühne aufgegeben, und da er sich entschlossen, den Pflichten, die ihm als Historiographen Frankreich’s oblagen, energisch nachzukommen, hatte er sich persönlich eingefunden, um die großen Ereignisse mit anzusehen, welche der Nachwelt zu erzählen sein Amt war.[19] In der Nähe von Mons bereitete Ludwig den Damen das Schauspiel der prächtigsten Revue, die man im modernen Europa je gesehen hatte. Hundertzwanzigtausend Mann der schönsten Truppen der Welt waren in einer acht Meilen langen Linie aufgestellt. Es steht zu bezweifeln, ob eine solche Armee jemals unter den römischen Adlern vereinigt gewesen war. Das Schauspiel begann früh am Morgen und war noch nicht vorüber, als der lange Sommertag sich zu Ende neigte. Racine verließ den Platz erstaunt, betäubt, geblendet und todtmüde. In einem vertrauten Briefe wagte er es, einen liebenswürdigen Wunsch zu äußern, den er im Hofzirkel auszusprechen sich wahrscheinlich gehütet haben würde: „Wollte Gott, daß alle diese braven Burschen wieder in ihren Hütten, bei ihren Frauen und ihren Kleinen wären.”[20]
Belagerung von Namur.
Nach diesem prächtigen Schauspiele kündigte Ludwig seine Absicht an, Namur anzugreifen. In fünf Tagen war er an der Spitze von dreißigtausend Mann unter den Mauern dieser Stadt. Zwanzigtausend Landleute, die man in den von den Franzosen besetzten Theilen der Niederlande gepreßt hatte, mußten als Schanzgräber dienen. Luxemburg hatte mit achtzigtausend Mann eine feste Stellung auf der Straße zwischen Namur und Brüssel inne und war bereit, jeder Truppenmacht, die es versuchen sollte, die Belagerung aufzuheben, eine Schlacht zu liefern.[21] Diese Theilung der Aufgaben nahm Niemanden Wunder. Es war längst bekannt, daß der große Monarch ein Freund von Belagerungen, nicht aber von Schlachten war. Er sprach die Ansicht aus, daß eine Belagerung der wahre Prüfstein militärischer Tüchtigkeit sei. Der Ausgang eines Zusammenstoßes zwischen zwei Armeen im offenen Felde wurde seiner Meinung nach oft durch einen Zufall entschieden; aber Ravelins und Bastionen, welche die Wissenschaft erbaut, konnte nur die Wissenschaft bewältigen. Seine Verleumder nannten es spöttelnd ein Glück, daß der Zweig der Kriegskunst, den Se. Majestät für den edelsten halte, ein solcher sei, der ihn selten nöthigte, ein seinem Volke unschätzbares Leben ernster Gefahr auszusetzen.
Namur, am Zusammenflusse der Sambre und der Maas gelegen, war eine der großen Festungen Europa’s. Die Stadt lag in einer Ebene und besaß keine andre Stärke als die durch die Kunst hervorgerufene. Aber Kunst und Natur hatten sich vereinigt, um die berühmte Citadelle zu befestigen, die vom Scheitel eines hohen Felsens auf eine von zwei schönen Flüssen bewässerte unabsehbare Fläche von Kornfeldern, Waldungen und Wiesen herniedersieht. Die Bevölkerung der Stadt und Umgegend war stolz auf ihr uneinnehmbares Kastell. Sie bildete sich etwas darauf ein, daß in allen Kriegen, welche die Niederlande verwüstet, Geschicklichkeit oder Tapferkeit nie im Stande gewesen waren, durch diese Mauern zu dringen. Die benachbarten Festungen, in der ganzen Welt wegen ihrer Stärke berühmt, Antwerpen und Ostende, Ypern, Lille und Tournay, Mons und Valenciennes, Cambray und Charleroi, Limburg und Luxemburg, hatten ihre Thore den Siegern geöffnet, noch niemals aber war von den Zinnen Namur’s die Fahne herabgenommen worden. Damit nichts fehlte, um die Belagerung interessant zu machen, standen die beiden Großmeister der Befestigungskunst einander gegenüber. Vauban war viele Jahre hindurch als der erste Ingenieur betrachtet worden; aber ein gefährlicher Nebenbuhler war seit Kurzem aufgetaucht: Menno, Baron von Cohorn, der geschickteste Offizier im Dienste der Generalstaaten. Die Vertheidigungswerke von Namur waren unlängst unter Cohorn’s Oberleitung verstärkt und ausgebessert worden, und er befand sich jetzt innerhalb der Mauern. Vauban war im Lager Ludwig’s. Es ließ sich demnach erwarten, daß Angriff wie Vertheidigung mit ausgezeichneter Geschicklichkeit geleitet werden würden.
Die verbündeten Armeen hatten sich inzwischen versammelt, aber es war zu spät.[22] Wilhelm eilte nach Namur. Er bedrohte die französischen Werke zuerst von Westen, dann von Norden, dann von Osten. Aber zwischen ihm und den Circumvallationslinien stand die Armee Luxemburg’s, allen seinen Bewegungen folgend und stets in so starker Position, daß es die größte Unklugheit gewesen wäre, ihn anzugreifen. Mittlerweile machten die Belagerer unter Vauban’s geschickter Leitung und durch Ludwig’s Anwesenheit angefeuert rasche Fortschritte. Es waren allerdings viele Schwierigkeiten zu überwinden und große Beschwerden zu ertragen. Das Wetter war stürmisch, und am 8. Juni, dem Tage des heiligen Medardus, der im französischen Kalender die nämliche unheildrohende Stelle einnimmt, die in unsrem Kalender dem heiligen Swithin gebührt, regnete es in Strömen. Die Sambre stieg und überschwemmte viele mit reifenden Ernten bedeckte Quadratmeilen. Die Mehaigne führte ihre Brücken mit sich fort in die Maas. Alle Straßen wurden in Moräste verwandelt. In den Laufgräben standen Wasser und Schlamm so hoch, daß man drei Tage zu thun hatte, um eine Kanone von einer Batterie zur andren zu schaffen. Die sechstausend Wagen, welche die französische Armee begleitet hatten, waren nutzlos. Schießpulver, Kanonenkugeln, Korn und Heu mußten auf dem Rücken der Kriegsrosse von Ort zu Ort transportirt werden. Nur die Autorität Ludwig’s konnte unter solchen Umständen die Ordnung aufrecht erhalten und Freudigkeit erwecken. Seine Soldaten bezeigten ihm in der That eine größere Ehrerbietung als dem Heiligsten ihrer Religion. Sie verwünschten den heiligen Medardus aus dem Grunde des Herzens und zerschlugen oder verbrannten jedes Bild von ihm, dessen sie habhaft werden konnten. Aber es gab nichts, was sie nicht bereitwillig für ihren König gethan und ertragen haben würden. Trotz aller Hindernisse machten sie unaufhaltsame Fortschritte. Cohorn wurde schwer verwundet, während er mit verzweifelter Tapferkeit ein von ihm selbst erbautes Fort vertheidigte, auf das er stolz war. Seine Stelle war nicht zu ersetzen. Der Gouverneur war ein schwacher Mann, den Gastanaga ernannt und dessen Versetzung Wilhelm kürzlich dem Kurfürsten von Baiern angerathen hatte. Der Muth der Besatzung schwand, und die Stadt übergab sich am achten Tage der Belagerung, die Citadelle etwa drei Wochen später.[23]
Die Geschichte des Falles von Namur im Jahre 1692 ist der Geschichte des Falles von Mons im Jahre 1691 sehr ähnlich. Sowohl 1691 wie 1692 konnte Ludwig, der einzige und unumschränkte Gebieter über die Hülfsquellen des Landes, den Feldzug eröffnen, bevor Wilhelm, der Feldherr einer Coalition, seine zerstreuten Streitkräfte zusammengebracht hatte. In beiden Jahren entschied der Vortheil des ersten Zuges den Ausgang der Partie. Bei Namur sowohl wie bei Mons leitete Ludwig unter Vauban’s Beistand die Belagerung; Luxemburg deckte sie, Wilhelm versuchte vergebens sie aufzuheben und mußte zu seinem tiefen Schmerze dem Siege seines Gegners als Zuschauer beiwohnen.
In einer Hinsicht war jedoch das Schicksal der beiden Festungen ein ganz verschiedenes. Mons wurde von seinen eigenen Einwohnern übergeben. Namur hätte vielleicht gerettet werden können, wenn die Besatzung eben so begeistert und entschlossen gewesen wäre wie die Einwohnerschaft. Merkwürdigerweise herrschte in dieser so lange einer fremden Herrschaft unterworfenen Stadt ein Patriotismus ähnlich dem der kleinen griechischen Republiken. Man hat keinen Grund zu glauben, daß die Bürger sich um das Gleichgewicht der Macht kümmerten oder eine Vorliebe für Jakob oder für Wilhelm, für den Allerchristlichsten König oder für den Allerkatholischsten König hatten. Aber jeder Bürger glaubte seine eigene Ehre mit der Ehre der jungfräulichen Festung verknüpft. Die Franzosen mißbrauchten zwar ihren Sieg nicht. Es wurden keine Gewaltthätigkeiten verübt, die Privilegien der Municipalität wurden geachtet, die Behörden nicht gewechselt. Dennoch aber konnte das Volk einen Sieger nicht ohne Thränen der Wuth und Scham in das bis dahin unbezwungene Schloß einziehen sehen. Selbst die barfüßigen Carmeliter, die allen Genüssen, allem Eigenthum, allem geselligen Umgang, allen häuslichen Zuneigungen entsagt hatten, deren Tage lauter Fasttage waren, die einen Monat nach dem andren verlebten, ohne ein Wort zu sprechen, waren heftig ergriffen. Umsonst bemühte sich Ludwig, sie durch Beweise von Achtung und fürstlicher Freigebigkeit zu beschwichtigen. So oft sie einer französischen Uniform begegneten, wendeten sie sich mit einer Miene ab, welche bewies, daß ein Leben des Gebets, der Enthaltsamkeit und des Schweigens ein irdisches Gefühl in ihnen nicht zu ersticken vermocht hatte.[24]
Dies war vielleicht der Augenblick, wo Ludwig’s Arroganz den höchsten Grad erreichte. Er hatte die letzte und glänzendste Kriegsthat seines Lebens vollbracht. Seine verbündeten Feinde, Engländer und Deutsche, hatten gegen ihren Willen seinen Triumph erhöht und waren Zeugen des Ruhmes gewesen, der ihnen das Herz brach. Seine Freude war grenzenlos. Die Umschriften auf den Denkmünzen, die er zur Verewigung seines Sieges schlagen ließ, die Schreiben, durch welche er den Prälaten seines Königreichs befahl, das Te Deum zu singen, waren prahlerisch und sarkastisch. Sein Volk, ein Volk, zu dessen vielen edlen Eigenschaften Mäßigung im Glück nicht gerechnet werden kann, schien eine Zeit lang trunken von Stolz. Selbst Boileau, durch die herrschende Begeisterung mit fortgerissen, vergaß die Gelassenheit und den guten Geschmack, denen er seinen Ruf verdankte. Er bildete sich ein, ein lyrischer Dichter zu sein und machte seinen Gefühlen in hundertsechzig Strophen geistlosen Bombastes über Alcibiades, Mars, Bacchus und Ceres, die Leier des Orpheus, die tracischen Eichen und die permessianischen Nymphen, Luft. Er sagte, er möchte wohl wissen, ob Namur, wie Troja, von Apollo und Neptun erbaut worden sei. Er fragte, welche Macht eine Stadt bezwingen könne, welche stärker sei als die, vor der die Griechen zehn Jahre lagen, und er gab sich selbst die Antwort darauf, daß ein solches Wunder nur durch Jupiter oder durch Ludwig bewerkstelligt werden könne. Die Feder am Hute Ludwig’s war der Leitstern des Sieges. Vor Ludwig müsse sich Alles beugen, Fürsten, Nationen, Winde und Wasser. Zum Schluß wendete sich der Dichter an die verbündeten Feinde Frankreich’s und ersuchte sie höhnisch, die Nachricht mit nach Hause zu nehmen, daß Namur vor ihren Augen gefallen sei. Doch es waren noch nicht viele Monate verstrichen, als der prahlerische König und der prahlerische Dichter belehrt wurden, daß es eben so klug als anständig ist, in der Stunde des Sieges bescheiden zu sein.
Eine Kränkung hatte Ludwig selbst inmitten seines Glückes erfahren. Während er vor Namur lag, hörte er Töne des Jubels im fernen Lager der Alliirten. Ein dreifacher Donner aus hundertvierzig Geschützen wurde von drei Salven aus sechzigtausend Flinten beantwortet. Man erfuhr bald, daß diese Salven wegen der Schlacht von La Hogue abgefeuert wurden. Der König von Frankreich bemühte sich heiter zu erscheinen. „Sie machen einen entsetzlichen Lärm um das Verbrennen einiger Schiffe,” sagte er. In der That aber war er sehr besorgt, dies um so mehr, als die Nachricht nach den Niederlanden gelangt war, daß ein Seetreffen stattgefunden und daß seine Flotte geschlagen worden sei. Seine gute Laune wurde jedoch bald wieder hergestellt durch den glänzenden Erfolg der Operationen, die unter seiner unmittelbaren Leitung vor sich gingen.
Ludwig kehrt nach Versailles zurück.
Als die Belagerung vorüber war, übertrug er Luxemburg das Obercommando der Armee und kehrte nach Versailles zurück. Bald fand sich der unglückliche Tourville daselbst ein und wurde freundlich empfangen. Sobald er in dem Zirkel erschien, begrüßte ihn der König mit lauter Stimme. „Ich bin vollkommen zufrieden mit Ihnen und mit meinen Seeleuten. Wir sind zwar geschlagen worden, aber Ihre Ehre und die der Nation sind unbefleckt.”[25]
Obgleich Ludwig die Niederlande verlassen hatte, waren doch die Blicke von ganz Europa noch immer auf diese Gegend gerichtet. Die daselbst stehenden Armeen waren durch von verschiedenen Seiten herangezogene Verstärkungen vermehrt worden. Ueberall anderwärts waren die militärischen Operationen des Jahres unbedeutend und ohne Interesse. Der Großvezir und Ludwig von Baden thaten wenig mehr, als daß sie einander an der Donau beobachteten. Der Marschall Noailles und der Herzog von Medina Sidonia thaten wenig mehr, als daß sie einander in den Pyrenäen beobachteten. Am Oberrhein und längs der Grenze, welche Frankreich von Piemont scheidet, wurde ein unentschiedener Raubkrieg geführt, durch den die Soldaten wenig, die Landleute aber sehr viel litten. Jedermann aber blickte in gespannter Erwartung eines großen Ereignisses nach der Grenze von Brabant, wo Wilhelm und Luxemburg einander gegenüberstanden.
Luxemburg.
Luxemburg, der jetzt in seinem sechsundsechzigsten Jahre stand, war allmälig und durch den Tod mehrerer großer Männer zum ersten Platze unter den Generälen seiner Zeit emporgestiegen. Er stammte aus dem edlen Hause Montmorency, das viele mythische und viele historische Ansprüche auf Ruhm in sich vereinigte, das sich rühmte, dem ersten Franken, der im fünften Jahrhundert auf den Namen Christi getauft wurde, entsprossen zu sein, und das seit dem 11. Jahrhunderte Frankreich eine lange und glänzende Reihe von Connetables und Marschällen gegeben hatte. In Bezug auf Tapferkeit und Talente stand Luxemburg keinem seines erlauchten Geschlechts nach. Aber trotz vornehmer Herkunft und hoher Begabung hatte er nur mit Mühe die Hindernisse bewältigt, die sich ihm auf dem Ruhmeswege entgegenstellten. Wenn er der Freigebigkeit der Natur und der Glücksgöttin viel verdankte, so hatte er doch noch weit mehr unter ihrer Ungunst gelitten. Sein Gesicht war abschreckend häßlich, seine Gestalt klein, und ein hoher, spitzer Höcker erhob sich auf seinem Rücken. Seine Constitution war schwach und kränklich. Gegen seinen sittlichen Wandel waren schwere Beschuldigungen erhoben worden. Er war des Verkehrs mit Zauberern und Giftmischern beschuldigt worden, hatte lange in einem Kerker geschmachtet und hatte endlich seine Freiheit wiedererlangt, ohne seine Ehre völlig wiederzuerlangen.[26] Sowohl Louvois als Ludwig hatten ihn nie leiden können. Doch der Krieg gegen die europäische Coalition hatte noch nicht lange gedauert, als der Minister und der König einsahen, daß der Staat den ihnen persönlich verhaßten General nöthig brauchte. Condé und Turenne waren nicht mehr, und Luxemburg war ohne Widerrede der ausgezeichnetste Soldat, den Frankreich noch besaß. An Wachsamkeit, Fleiß und Beharrlichkeit fehlte es ihm. Er schien seine großen Eigenschaften für große Ereignisse aufzusparen. Auf dem offenen Schlachtfelde war er ganz er selbst. Er besaß einen raschen und sicheren Blick. Sein Urtheil war dann am klarsten und treffendsten, wenn die schwerste Verantwortlichkeit auf ihm lastete und wenn die Schwierigkeiten sich massenhaft um ihn her aufthürmten. Seiner Geschicklichkeit, Energie und Geistesgegenwart verdankte sein Vaterland einige ruhmvolle Tage. Aber obwohl in Schlachten außerordentlich glücklich, war er nicht besonders glücklich in Feldzügen. Er erwarb sich auf Wilhelm’s Unkosten einen glänzenden Ruf, und doch gaben die beiden Feldherren in Sachen des Kriegs einander wenig nach. Luxemburg war zu wiederholten Malen siegreich, aber er verstand die Kunst nicht, einen Sieg zu benutzen. Wilhelm wurde zu wiederholten Malen geschlagen; aber von allen Feldherren verstand er es am besten, eine Niederlage wieder gut zu machen.
Im Monat Juli befand sich Wilhelm’s Hauptquartier in Lambeque. Ungefähr sechs Meilen davon, bei Steenkerke, lag Luxemburg mit dem Gros seiner Armee, und noch etwa sechs Meilen weiter lag ein starkes Corps unter den Befehlen des Marquis von Boufflers, eines der besten Offiziere in Ludwig’s Diensten.
Die Gegend zwischen Lambeque und Steenkerke war von unzähligen Hecken und Gräben durchschnitten, und keine der beiden Armeen konnte sich der andren nähern, ohne mehrere lange und schmale Defilés zu passiren. Luxemburg hatte daher wenig Grund zu befürchten, daß er in seinen Verschanzungen angegriffen werden würde, und er war überzeugt, daß er in Zeiten erfahren würde, wenn ein Angriff im Werke war; denn es war ihm gelungen, einen Abenteurer, Namens Millevoix zu bestechen, welcher erster Musiker und Privatsekretär des Kurfürsten von Baiern war. Dieser Mann sandte regelmäßig authentische Nachrichten über die Pläne der Alliirten in das französische Hauptquartier.
Im festen Vertrauen auf die Stärke seiner Position und auf die Genauigkeit seiner Nachrichten, lebte der Marschall in seinem Zelte, wie er in seinem pariser Hotel zu leben gewohnt war. Er war zu gleicher Zeit ein Schwächling und ein Wüstling und in beiden Eigenschaften liebte er die Bequemlichkeit. Er bestieg fast nie sein Pferd. Leichte Conversation und Kartenspiel füllten den größten Theil seiner Zeit aus. Seine Tafel war luxuriös, und wenn er einmal bei Tische saß, war es gefährlich, ihn zu stören. Einige Spötter sagten, daß er sich bei seinen militärischen Dispositionen nicht ausschließlich durch militärische Gründe leiten lasse, daß er sich gewöhnlich an einem Orte verschanze, wo das Kalbfleisch und Geflügel besonders gut seien, und daß er stets darauf Bedacht nehme, sich diejenige Communication mit dem Meere frei zu halten, die ihm vom September bis zum April eine regelmäßige Zufuhr von Sandwich-Austern sicherte. Wenn es in der Nähe seines Lagers hübsche Frauen gab, so waren sie in der Regel bei seinen Gastmählern zu finden. Man kann leicht denken, daß unter einem solchen Befehlshaber die jungen Prinzen und Edelleute Frankreich’s in Glanz und Galanterie mit einander wetteiferten.[27]
Schlacht von Steenkerke.
Während er sich so auf seine gewohnte Art amüsirte, kamen die verbündeten Fürsten dahinter, daß ihre Beschlüsse verrathen wurden. Ein Landmann fand einen Brief, der verloren worden war, und brachte ihn dem Kurfürsten von Baiern. Dieser Brief enthielt klare Beweise von Millevoix’ Schuld. Wilhelm hegte die Hoffnung, daß es ihm gelingen werde, seine Feinde in der Schlinge zu fangen, die sie ihm gelegt hatten. Der treulose Sekretär wurde vor den König citirt und wegen seines Verbrechens zur Rede gesetzt. Man gab ihm eine Feder in die Hand, hielt ihm ein Pistol auf die Brust und befahl ihm bei Strafe des augenblicklichen Todes zu schreiben. Sein von Wilhelm dictirter Brief wurde sodann ins französische Lager gesandt. Luxemburg wurde darin benachrichtigt, daß die Alliirten am folgenden Tage ein starkes Fouragirungscorps zu entsenden gedächten. Um dieses Detachement vor Belästigung zu schützen, würden in der Nacht einige Bataillone Infanterie, von Artillerie begleitet, ausrücken, um die zwischen den beiden Armeen gelegenen Defilés zu besetzen. Der Marschall las, glaubte und begab sich zur Ruhe, während Wilhelm eifrig seine Vorkehrungen zu einem allgemeinen Angriff auf die französischen Linien betrieb.
Die ganze verbündete Armee stand unter Waffen, als es noch dunkel war. Mit dem Grauen des Morgens wurde Luxemburg durch Kundschafter geweckt, die ihm die Nachricht brachten, daß der Feind in bedeutender Stärke anrücke. Er nahm die Mittheilung anfangs sehr leicht. Sein Correspondent schien, wie gewöhnlich, umsichtig und exact gewesen zu sein. Der Prinz von Oranien hatte ein Detachement zum Schutze seiner Fourageurs entsendet, und der Schrecken hatte dieses Detachement zu einer gewaltigen Armee vergrößert. Doch eine beunruhigende Nachricht folgte der andren auf dem Fuße. Alle Pässe, hieß es, wimmelten von Massen von Infanterie, Cavallerie und Artillerie unter den Bannern England’s, Spanien’s, der Vereinigten Provinzen und des deutschen Reichs, und jede Colonne bewege sich gegen Steenkerke. Jetzt stand der Marschall endlich auf, stieg zu Pferde und ritt aus, um zu sehen was vorging.
Inzwischen war die Vorhut der Alliirten bis dicht an seine Vorposten herangekommen. Etwa eine halbe Meile von seiner Armee lagerte eine Brigade, welche den Namen der Provinz Bourbonnais führte. Diese Truppen hatten den ersten Anprall auszuhalten. Erstaunt und von panischem Schrecken ergriffen, wurden sie in einem Augenblicke geworfen und suchten ihr Heil in der Flucht, ihre Zelte und sieben Kanonen dem Feinde überlassend.
Soweit waren Wilhelm’s Pläne mit vollständigem Erfolge gekrönt worden; jetzt aber begann das Glück sich gegen ihn zu wenden. Er war über die Beschaffenheit des zwischen der Stellung der Brigade Bourbonnais und dem Hauptlager des Feindes liegenden Terrains falsch berichtet worden. Er hatte erwartet, daß er im Stande sein würde, ohne allen Aufenthalt vorwärts zu dringen, daß er die französische Armee in einem Zustande wilder Verwirrung finden und daß sein Sieg leicht und vollständig sein würde. Aber er wurde durch mehrere Hecken und Gräben in seinem Vorrücken gehemmt, es entstand ein kurzer Aufenthalt, und dieser kurze Aufenthalt reichte hin, sein Vorhaben zu vereiteln. Luxemburg war ganz der Mann für einen solchen Fall. Er hatte große Fehler begangen, er hatte sorglose Wacht gehalten, er hatte Nachrichten, die sich als falsch erwiesen, blind geglaubt, er hatte Nachrichten, die sich als wahr erwiesen, nicht beachtet, eine seiner Divisionen war in wilder Flucht begriffen, die anderen Divisionen waren nicht kampfbereit. Eine solche Krisis würde die Geisteskräfte eines gewöhnlichen Feldherrn gelähmt haben; die Geisteskräfte Luxemburg’s wurden dadurch nur gestählt und zu erhöhter Thätigkeit angeregt. Sein Geist, ja auch sein kränklicher und verwachsener Körper schienen aus Mißgeschick und Schrecken Gesundheit und Kraft zu schöpfen. In kurzer Zeit hatte er Alles angeordnet. Die französische Armee stand in Schlachtordnung. Unter dieser großen Armee zeichneten sich besonders die Haustruppen Ludwig’s, das berühmteste Corps streitbarer Männer in Europa aus, und an ihrer Spitze erschien, strahlend von eilig übergeworfenen Tressen und Stickereien, ein Schwarm junger Prinzen und Cavaliere, die eben erst durch die Trompeten von ihren Lagern oder ihren Banketten aufgeschreckt worden waren, und die sich beeilt hatten, dem Tode mit der heiteren und festlichen Unerschrockenheit ins Angesicht zu schauen, welche dem französischen Gentleman eigen ist. Am höchsten im Range unter diesen vornehmen Kriegern stand ein sechzehnjähriger Jüngling, Philipp, Herzog von Chartres, Sohn des Herzogs von Orleans und Neffe des Königs von Frankreich. Nur mit Mühe und durch dringendes Bitten hatte der tapfere Knabe Luxemburg die Erlaubniß entrissen, sich dahin begeben zu dürfen, wo das Feuer am heißesten war. Zwei andere Jünglinge von königlichem Geblüt, Ludwig, Herzog von Bourbon, und Armand, Prinz von Condé, bewiesen einen ihrer Ahnherren würdigen Muth. Neben ihnen kämpfte ein Abkömmling der Bastarde Heinrich’s IV., Ludwig, Herzog von Vendome, ein in Trägheit und in die niedrigsten Laster versunkener Mensch, der aber dennoch fähig war, bei einer großen Gelegenheit die Eigenschaften eines großen Soldaten zu entfalten. Auch Berwick war darunter, der sich einen ehrenvollen Namen in den Waffen zu erwerben begann, und an seiner Seite ritt Sarsfield, der sich durch seinen Muth und sein Talent an diesem Tage die Achtung der ganzen französischen Armee verdiente. Unterdessen hatte Luxemburg einen Eilboten abgesandt, um Boufflers herbeizurufen. Aber die Botschaft war überflüssig. Boufflers hatte das Feuer gehört, und als ein tapferer und intelligenter Heerführer eilte er bereits dem Punkte zu, von woher das Geräusch kam.
Obgleich die Angreifenden den ganzen Vortheil eines Ueberfalles verloren hatten, rückten sie doch beherzt heran. Im Vordertreffen marschirten die Briten unter den Befehlen des Grafen Solms. Mackay’s Division sollte vorangehen, und ihn sollte nach Wilhelm’s Plan ein starkes Corps Infanterie und Cavallerie unterstützen. Obwohl die meisten von Mackay’s Leuten noch nie im Feuer gestanden hatten, versprach ihr Benehmen doch an Blenheim und Ramilies zu erinnern. Sie stießen zuerst auf die Schweizer, welche in der französischen Armee eine ausgezeichnete Stelle einnahmen. Der Kampf war so dicht Mann gegen Mann und so verzweifelt, daß die Mündungen der Gewehre sich kreuzten. Die Schweizer wurden unter einem furchtbaren Blutbade zurückgeworfen. Mehr als achtzehnhundert Mann von ihnen wurden nach den französischen Listen getödtet oder verwundet. Luxemburg äußerte nachher, daß er nie in seinem Leben einen so wüthenden Kampf gesehen habe. Er holte eiligst die Ansichten der ihn umgebenden Generäle ein. Alle waren der Meinung, die Lage der Dinge sei eine solche, gegen die gewöhnliche Mittel nicht ausreichten. Die königlichen Haustruppen mußten die Engländer angreifen. Der Marschall gab die Parole, und die Haustruppen, geführt von den Prinzen von Geblüt, rückten mit geschultertem Gewehr heran. „Das Schwert zur Hand!” erscholl es durch alle Reihen dieser furchtbaren Brigade; „das Schwert zur Hand! kein Feuern! Schlagt sie mit dem kalten Stahl zu Boden!” Nach langer und verzweifelter Gegenwehr wurden die Engländer geworfen. Sie hörten nie auf zu wiederholen, daß, wenn Solms seine Schuldigkeit gegen sie gethan hätte, sie selbst die Haustruppen geschlagen haben würden. Aber Solms gewährte ihnen keine wirksame Unterstützung. Er ließ einige Cavallerie vorgehen, die aber in Folge der Bodenbeschaffenheit wenig oder nichts thun konnte. Seine Infanterie ließ er nicht von der Stelle. Sie könne nichts nützen, sagte er, und er habe nicht Lust, sie zur Schlachtbank zu schicken. Ormond wäre sehr gern zur Unterstützung seiner Landsleute herbeigeeilt, aber er durfte nicht. Mackay sandte einen Eilboten und ließ sagen, daß er und seine Leute dem sicheren Untergange preisgegeben seien; aber es war Alles vergebens. „Nun wohl, Gottes Wille geschehe,” sagte der tapfere Veteran. Er starb wie er gelebt hatte: als ein guter Christ und ein guter Soldat. Mit ihm fielen Douglas und Lanier, zwei unter den Besiegern Irland’s ausgezeichnete Generäle. Auch Mountjoy war unter den Gefallenen. Nachdem er drei Jahre in der Bastille geschmachtet, war er gegen Richard Hamilton ausgewechselt worden, und, durch erfahrene Unbilden, die mächtiger waren als alle Argumente Locke’s und Sidney’s, zum Whiggismus bekehrt, war er unverzüglich als Freiwilliger in Wilhelm’s Lager geeilt. Fünf schöne Regimenter wurden völlig zusammengehauen. Es würde vielleicht kein Mann von dieser opferfreudigen Schaar davongekommen sein ohne den Muth und das Benehmen Auverquerque’s, der im Augenblicke der höchsten Bedrängniß mit zwei frischen Bataillonen zur Hülfe herbeieilte. Noch lange erinnerte man sich an den britischen Wachfeuern mit dankbarer Bewunderung der Tapferkeit, mit der er die Ueberreste von Mackay’s Division befreite. Der Boden, auf dem der Kampf gewüthet, war mit Haufen von Leichen bedeckt, und Die, welche die Erschlagenen begruben, bemerkten, daß fast alle Wunden vom Säbel oder Bajonnet herrührten.
Man erzählte sich, Wilhelm habe seine gewohnte stoische Ruhe soweit vergessen, daß er eine heftige Aeußerung that über die Art und Weise der Hinopferung der englischen Regimenter. Bald jedoch erlangte er seinen Gleichmuth wieder und beschloß den Rückzug anzutreten. Es war hohe Zeit, denn die französische Armee verstärkte sich mit jedem Augenblicke, da die von Boufflers befehligten Regimenter in rascher Aufeinanderfolge herbeikamen. Die alliirte Armee zog sich in guter Ordnung und ohne verfolgt zu werden, auf Lambeque zurück.[28]
Die Franzosen gestanden ein, daß sie ungefähr siebentausend Todte und Verwundete hatten. Der Verlust der Alliirten war nur sehr wenig größer, wenn er überhaupt größer war. Die relative Stärke der beiden Armeen war die nämliche wie am vergangenen Tage, und sie blieben in ihren bisherigen Stellungen. Aber der moralische Eindruck der Schlacht war groß. Der Stern von Wilhelm’s Ruhm begann zu erbleichen. Selbst seine Bewunderer mußten zugeben, daß er im Felde Luxemburg nicht gewachsen sei. In Frankreich wurde die Nachricht mit maßlosem Jubel und Stolze aufgenommen. Der Hof, die Hauptstadt, selbst das Landvolk der entlegensten Provinzen freute sich über die ungestüme Tapferkeit, die so viele Jünglinge, die Erben berühmter Namen, an den Tag gelegt hatten. Man erzählte sich mit Freude und Rührung im ganzen Lande, daß der junge Herzog von Chartres durch keine Vorstellungen sich von der Gefahr habe zurückhalten lassen, daß eine Kugel seinen Mantel durchlöchert habe und daß er an der Schulter verwundet worden sei. Das Volk versammelte sich längs der Straßen, um die von Steenkerke zurückkehrenden Prinzen und Cavaliere zu sehen. Die Juweliere verfertigten Schnallen à la Steenkerke, die Parfümeriehändler verkauften Pulver à la Steenkerke. Besonders aber wurde der Name des Schlachtfeldes einer neuen Art Halsbinde gegeben. Die Modeherren trugen damals Spitzenhalstücher, die sie mit großer Sorgfalt zu knüpfen pflegten. In dem schreckensvollen Augenblicke aber als die Brigade Bourbonnais vor dem Angriffe der Alliirten floh, war keine Zeit, sich zu putzen, und die elegantesten Herren vom Hofe kamen mit ungeordneten Cravatten vor die Front der Schlachtlinie gesprengt. Es wurde daher bei der Pariser schönen Welt Mode, Tücher von den feinsten Spitzen in gesuchter Unordnung um den Hals zu tragen, und diese Tücher hießen Steenkerkes.[29]
Im Lager der Alliirten herrschte allgemeine Uneinigkeit und Unzufriedenheit. Nationale Eifersüchteleien und Animositäten wütheten rückhaltlos und unverhohlen. Die Entrüstung der Engländer äußerte sich laut. Solms war, obgleich Diejenigen, die ihn genau kannten, ihm einige schätzenswerthe Eigenschaften nicht absprachen, nicht der Mann, Soldaten für sich zu gewinnen, die gegen ihn als Ausländer eingenommen waren. Sein Benehmen war anmaßend, sein Character unbiegsam. Schon vor der unglücklichen Schlacht von Steenkerke verkehrten die englischen Offiziere nicht gern mit ihm, und die gemeinen Soldaten murrten über sein barsches Wesen. Nach der Schlacht aber wurde das Geschrei gegen ihn wüthend. Er wurde, vielleicht mit Unrecht, beschuldigt, während des verzweifelten Kampfes der englischen Regimenter gegen eine große Uebermacht mit gefühlloser Leichtfertigkeit geäußert zu haben, daß er neugierig sei, wie die Bulldoggen sich herausbeißen würden. Würde jetzt noch, fragte man, Jemand behaupten, daß er seiner hervorragenden Geschicklichkeit und Erfahrung wegen über so viele englische Offiziere gestellt worden sei? Es sei gebräuchlich zu sagen, daß diese Offiziere noch niemals Krieg in großem Maßstabe gesehen hätten. Aber sicherlich sei auch der unerfahrenste Neuling befähigt das zu thun was Solms gethan habe: Befehle falsch zu verstehen, Cavallerie zu Diensten zu verwenden, die nur Infanterie verrichten könne, und aus sicherer Entfernung zuzusehen, während tapfere Männer in Stücke gehauen würden. Es sei zuviel, zu gleicher Zeit beschimpft und aufgeopfert, von den Ehren des Kriegs ausgeschlossen und doch den ärgsten Gefahren desselben entgegengeworfen, als ungeschickte Rekruten verhöhnt und dann ohne Beistand dem Kampfe mit dem schönsten Corps Veteranen von der Welt überlassen zu werden. So lauteten die Klagen der englischen Armee, und sie fanden bei der englischen Nation Wiederhall.
Zum Glück wurde um diese Zeit eine Entdeckung gemacht, welche dem Lager von Lambeque wie den Kaffeehäusern London’s einen Unterhaltungsstoff lieferte, der den Jakobiten viel weniger angenehm war als die Niederlage von Steenkerke.
Verschwörung Grandval’s.
Seit einigen Monaten war im französischen Kriegsministerium ein Complot gegen das Leben Wilhelm’s geschmiedet worden. Wie es scheint, hatte Louvois ursprünglich den Plan entworfen und ihn, in rohen Umrissen, seinem Sohne und Nachfolger Barbesieux hinterlassen. Barbesieux brachte die Idee zur Reife. Die Ausführung wurde einem Offizier, Namens Grandval, übertragen. Grandval war ohne Widerrede tapfer und voll Begeisterung für sein Vaterland und seine Religion. Er war zwar ein Fanatiker und nicht ganz bei Verstande, aber deshalb nicht minder gefährlich. Ein fanatischer und halb verrückter Mensch ist in der That gerade dasjenige Werkzeug, das schlaue Politiker in der Regel vorziehen, wenn etwas besonders Gefährliches auszuführen ist. Kein vorsichtig berechnender Kopf würde sich für noch so hohen Lohn dem Schicksale eines Chatel, eines Ravaillac oder eines Gerarts ausgesetzt haben.[30]
Grandval hatte sich, wie er wenigstens glaubte, den Beistand zweier Abenteurer, Dumont’s, eines Wallonen, und Leefdale’s, eines Holländers, gesichert. Im April, kurz nach Wilhelm’s Ankunft in den Niederlanden, erhielten die Mörder Befehl, sich auf ihren Posten zu begeben. Dumont war damals in Westphalen, Grandval und Leefdale in Paris. Uden war als der Ort bestimmt, wo die Drei zusammentreffen und von wo sie sich in das Hauptquartier der Alliirten begeben sollten. Ehe Grandval Paris verließ, stattete er noch einen Besuch in Saint-Germains ab und wurde Jakob und Marien von Modena vorgestellt. „Ich bin von Ihrem Vorhaben unterrichtet,” sagte Jakob. „Wenn Sie und Ihre Begleiter mir diesen Dienst erzeigen, soll es Ihnen nie an etwas fehlen.”
Nach dieser Audienz trat Grandval seine Reise an. Er hatte nicht die leiseste Ahnung davon, daß er sowohl von dem Complicen, der ihn begleitete, als auch von dem Complicen, mit dem er noch zusammentreffen sollte, verrathen war. Dumont und Leefdale waren keine Fanatiker; die Restauration Jakob’s, die Größe Ludwig’s und das Uebergewicht der römischen Kirche waren ihnen sehr gleichgültig. Jeder Verständige mußte einsehen, daß, mochte der Plan gelingen oder nicht, der Lohn der Mörder wahrscheinlich darin bestehen werde, daß sie von den Höfen von Versailles und Saint-Germains mit erheucheltem Abscheu desavouirt, und mit glühenden Zangen gezwickt, mit geschmolzenem Blei begossen und von vier Pferden zerrissen wurden. Für gewöhnliche Menschen hatte die Aussicht auf ein solches Märtyrerthum nichts Anziehendes. Jene beiden Männer hatten daher fast zu gleicher Zeit, wenn auch wie es scheint ohne vorgängige Verabredung, Wilhelm auf verschiedenen Wegen die Warnung zukommen lassen, daß sein Leben in Gefahr sei. Dumont hatte Alles dem Herzog von Celle, einem der verbündeten Fürsten, mitgetheilt, und Leefdale hatte durch seine in Holland wohnenden Verwandten ausführliche Nachrichten gegeben. Mittlerweile hatte Morel, ein schweizerischer Protestant von großer Gelehrsamkeit, der sich damals in Frankreich aufhielt, Burnet schriftlich mitgetheilt, daß man den schwachen und überspannten Grandval prahlend von einem Ereignisse habe sprechen hören, welches die Welt in Erstaunen setzen werde, und daß er mit großer Zuversicht prophezeit habe, der Prinz von Oranien werde das Ende des nächsten Monats nicht erleben.
Diese warnenden Winke wurden nicht unbeachtet gelassen. Von dem Augenblicke an wo Grandval die Niederlande betrat, war er von Fallstricken umgeben. Alle seine Bewegungen und Reden wurden beobachtet; er wurde festgenommen, verhört, mit seinen Complicen confrontirt und in das Lager der Alliirten geschickt. Ungefähr acht Tage nach der Schlacht von Steenkerke wurde er vor ein Kriegsgericht gestellt. Ginkell, der für seine großen Dienste in Irland mit dem Titel eines Earl von Athlone belohnt worden war, führte den Vorsitz, und Talmash befand sich unter den Richtern. Mackay und Lanier waren ebenfalls zu Mitgliedern des Tribunals ernannt worden; aber sie waren nicht mehr, und ihre Plätze wurden daher durch jüngere Offiziere ausgefüllt.