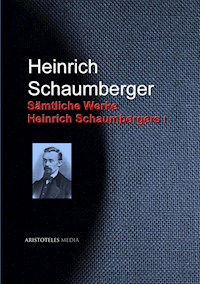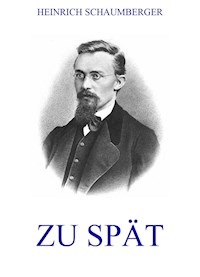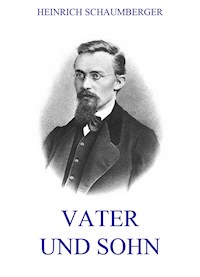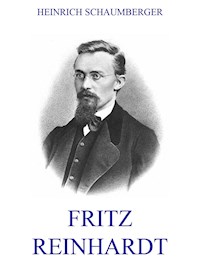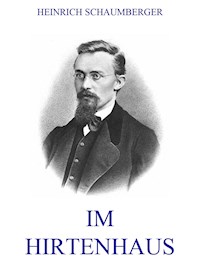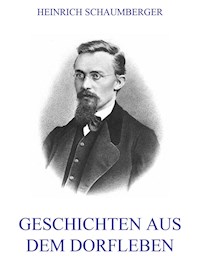
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heitere Bilder aus dem oberfränkischen Dorfleben. Das literarische Schaffen Schaumbergers war bestimmt von den Menschen und der Landschaft seiner oberfränkischen Heimat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichten aus dem Dorfleben
Heinrich Schaumberger
Inhalt:
Heinrich Schaumberger – Biografie und Bibliografie
Gesalzene Krapfen
Umsingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Der Dorfkrieg
Glückliches Unglück
Geschichten aus dem Dorfleben, Heinrich Schaumberger
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849634728
www.jazzybee-verlag.de
Heinrich Schaumberger – Biografie und Bibliografie
Deutscher Volksschriftsteller, geb. 15. Dez. 1843 in Neustadt a. d. Heide (Sachsen-Coburg), gest. 16. März 1874 in Davos, wirkte als Volksschullehrer an mehreren Orten, seit 1869 in Weißenbrunn bei Schalkau (S.-Meiningen). Schaumbergers Gebiet ist die Dorfgeschichte auf dem lokalen Boden seiner engeren Heimat. Edle Gesinnung und sichere Darstellung der Charaktere bei schlichter volkstümlicher Sprache zeichnen seine Erzählungen aus, unter denen wir »Vater und Sohn« (4. Aufl. 1899), »Zu spät« (4. Aufl. 1895) und »Im Hirtenhaus« (7. Aufl. 1899) besonders hervorheben. In dem Roman »Fritz Reinhardt« (3. Aufl. 1881, 3 Bde.) hat S. seinen eignen Entwickelungsgang geschildert. Seine Werke erschienen seit 1875 mehrfach gesammelt, zuletzt als Volksausgabe in 2 Bänden (Wolfenb. 1905); »Sämtliche Werke«, herausgegeben von H. Möbius (Leipz. 1905, 8 Bde.). Vgl. Möbius, Heinrich S., sein Leben und seine Werke (Wolfenb. 1883); den Vortrag von E. Schreck (Bielef. 1896); H. C. H. Meyer, Heinrich S. und Rud. Köselitz. Dichter und Illustrator (Wolfenb. 1901).
Gesalzene Krapfen
»Werd' vernünftig, 's ist Zeit!« rief die Eckenbäurin. »Du mußt nun auf eigenen Füßen stehen, bei uns kannst nimmer bleiben, das Gütle erträgt den Schwarm Kinder nicht. Mit der mühldorfer Rikelsbas hab' ich geredet, Du brauchst nur Ja zu sagen, so ist's fertig, und Du sitzest warm und sicher. Merk's: eine Gelegenheit wie die Ev findest Du Dein Lebtag nicht wieder! Aber mach' was Du willst, Du freist für Dich, nicht für mich. Nur das sag' ich Dir: bettst Du Dich gut, schläfst Du gut! – Steht Dir jedoch die Ev' durchaus nicht an – such' Dir einen Herrn und werd' Knecht. Aus dem Haus mußt Du auf alle Fälle, da beißt die Maus keinen Faden ab!«
»Nur nicht grrrrrand gethan!« entgegnete der Eckenpeter, halb verwundert, halb verdrießlich, nahm bedächtig seine Trompete sammt den Stimmbögen von der Wand, prüfte die Hosentasche, ob sie auch das Mundstück enthielt, und ging dann gemächlich seinen Kameraden nach, die vor dem untern Wirthshaus schon eine Weile auf ihn gewartet hatten.
»Heda, was ist Dir über die Leber gelaufen?« fragte der Schneidersheiner im Gehen. »Siehst ja aus, meiner 152 Seel', die Milch fährt zusammen bei Deinem Anblick. – Warst doch sonst immer ganz glückselig, ging's zur Kirmse! – Was ist's, hat's daheim wieder Lärm gegeben?«
»Die Weiber, die Weiber!« knurrte Peter, und schob seine Pelzmütze, die er auch im Sommer trug, vom rechten Ohr auf's linke. »Der Geier hol' sie mit'nander! Den Himmel hätt' man auf der Welt, gäb's keine Schürzen mehr und Unterröck'. – Jetzt laß mich in Frieden!«
Damit wendete er sich ab und folgte langsam seinen Kameraden, die scherzend und lachend Mühldorf zueilten. Gern hätte er einem oder dem andern seine Noth geklagt, um Trost und Rath gebeten: aber er kannte seine Schweden allzugut, es gelüstete ihn ganz und gar nicht nach ihrem Spott und Hohn, lieber plagte er sich allein mit seinen schweren Gedanken.
Ja, die Worte der Mutter machten ihm viel zu schaffen; noch nie war seine Mütze so oft von einem Ohr auf's andere gewandert, noch nie so oft seine Pfeife »ausgegangen«, als heute. Nicht ihr Vorwurf beschäftigte ihn. Daß er leichtfertig, gedankenlos in den Tag hineingelebt, mehr als gut und erlaubt den Vergnügungen nachgegangen war – ei, das wußte er selber schon lange. Zwar scheute er die Arbeit nicht, aber sie machte ihm auch keine Freude; kam es darauf an, dann schaffte er wohl für Drei, darnach konnte er aber auch ohne Gewissensbisse wochenlang faulenzen. An seine Zukunft dachte er nicht; hatte er Geld, ging es in den Wirthshäusern hoch her; war sein Beutel leer, nahm er ohne Murren mit der schmalen Kost daheim vorlieb; ging es gar nicht anders, hungerte er auch unverdrossen. Peter war nicht vergeblich ein Sonntagskind. Schätzt 153 man den Werth des Lebens allein nach Seelenruhe und Zufriedenheit, dann war Peter der glücklichste Mensch unter der Sonne. Vollständig wunschlos, begehrungslos, neidlos ging er durch die Welt, nichts nannte er sein als die Gegenwart, diese aber auch ganz und voll. Die Freude des Augenblicks ließ er sich weder durch größere Erwartungen, noch durch verfehlte Hoffnungen, noch durch Reue verbittern; das Ungemach des Lebens, das ihn oft genug derb heimsuchte, vergrößerte er nicht durch die Betrachtung, wie er es hätte vermeiden können, verbitterte es nicht durch Unmuth und Ungeduld – und so ging es vorüber und Peter spürte es eigentlich gar nicht. Am besten wäre er zu vergleichen mit dem dummen, guten Bruder Hans im Märchen. Denn neben seiner gutmüthigen Albernheit fehlte es ihm nicht an Mutterwitz und jener gesunden Lebensklugheit, die man nicht für Geld erwirbt. Nur vergrub er sein Pfund gar so tief, und die Zeiten sind leider für immer vorbei, da ein gutmüthiges Naturkind durch harmlose, spaßhafte Nichtsnutzigkeiten der fein berechnenden überklugen Welt ein Schnippchen schlägt, und wenn auch nicht das ganze Glück, doch wenigstens einen Zipfel seines Mantels vergnügt in Sicherheit bringt. Das mußte Peter jetzt bitter genug erfahren. »Aus dem Haus mußt Du auf alle Fälle, da beißt die Maus keinen Faden ab!« Das war das flammende Cherubschwert, das ihn aus seinem Paradies vertrieb und die Rückkehr versperrte. Ach, und da es nun für immer damit vorbei war, nun erkannte, nun verstand er erst die unbeschreiblichen Wonnen, die unsäglichen Seligkeiten seines bisherigen Schlaraffenlebens. Und vorbei – vorbei für immer! – Peter schob die Mütze in den Nacken 154 und brummte: »Nur nicht grand gethan!« Das hieß aber in die gewöhnliche Sprache übertragen: »O Mutter, wie könnt Ihr so grausam sein und mir mein Himmelreich zerstören? Wie vermögt Ihr es, mich so grausam hinauszustoßen in die böse, unbarmherzige Welt, wo mir nichts bleibt als die Wahl: ob ich mich nun in Nesseln oder in Disteln betten soll?« – Aber leider änderte dieser Seufzer nichts; hatte die Mutter einmal gesagt: »Da beißt die Maus keinen Faden ab!« – dann bissen auch alle Mäuse der Welt von ihrem Beschluß kein Zipfelchen ab und das ganze Herzogthum warf ihn nicht um. Unwillkürlich sang Peter in sich hinein:
Es kann ja nicht immer so bleiben Hier unter dem wechselnden Mond; Der Krieg muß den Frieden vertreiben, Im Kriege wird keiner verschont.
Ja ja, so war's! – Aber mit dieser geduldigen Unterwerfung in das Unabänderliche war seine Noth noch nicht gehoben. Wer die Wahl, hat die Qual! das gilt im Glück wie im Unglück. Ein Anderer hätte vielleicht ein anderes Gleichniß gebraucht, Peter nun blieb dabei: Knechtschaft und Ehestand sei im Grund Haux wie Maux, eine Wahl eben wie zwischen Disteln und Brennnesseln. – Ein gar zu schlimmes Entweder – Oder, vor das ihn seine Mutter gestellt! Im Anfang war er fast geneigt, einen Dienst zu suchen. Er mußte dann freilich arbeiten wie ein Gaul – allein das war für ihn eine Kleinigkeit; er war auch nicht mehr Herr seiner selbst und seiner Zeit – doch gab es zum Glück Sonn- und Feiertage; dann mußte er aber Ordnung einhalten und ein geregeltes Leben führen – das 155 war schlimm, gar nicht auszusagen, wie sehr schlimm. Sein Mützenschild saß gerade über dem linken Ohr und blickte ernsthaft zum Himmel, als wolle es um Erleuchtung flehen. – Hm, hm! – Das Mützenschild senkte sich vertraulich zum Ohr herab. Wofür war Petri, Walpurgi, Jakobi und Martini in der Welt? Ja, der Herrgott sorgt väterlich für all' seine Kreatur, auch für Knechte, denen Ordnung und ein geregelt Leben ein Greuel ist. Obgleich Protestant, war Peter den guten Heiligen von Herzen dankbar, daß sie den armen Knechten zu rechter Zeit ein Loch aufmachen, ward ihnen ein Dienst gar so langweilig. Also Knecht! – Aber war es erhört, daß jemals ein bergheimer Bauernsohn in Knechtschaft gegangen? Sollte er, der Eckenpeter, solche schlimme Neuerung aufbringen? Durfte er den Bauernstand also beschimpfen? Sein Vater war ja freilich nur ein armseliges Kühbäuerle, aber doch ein Bauer, dazu auch ein Viertel von einem EinundzwanzigerIn Bergheim besaßen einundzwanzig Berechtigte das Gemeindevermögen, waren allein Vollbürger, regierten das Dorf. Der Eckenbauer besaß den vierten Theil eines Gemeinderechts. – was sollte die Welt sagen, ward eines solchen Mannes ältester Sohn Knecht? Mußte er, Peter, als Mann nicht klüger sein als die Mutter, die in solchen Dingen nichts verstand? – Das Kappenschild saß sehr bedenklich ganz auf dem Hinterkopf. – Und jetzt fiel ihm noch ein: war er nicht der berühmteste Trompeter der Gegend? Einer der Hauptkerle des bergheimer Musikkorps? – Wie sollten die Musikanten bestehen ohne ihn? Durfte er es seinen Kameraden anthun und sie auf solche Weise verlassen? War es nicht 156 überhaupt sündlich, die Musik an den Nagel zu hängen, jetzt, da er es nach jahrelangen Mühen zu einer erfreulichen Fertigkeit gebracht, jetzt, wo sich endlich sein Fleiß, seine Ausdauer belohnen sollte? – Das Mützenschild saß tief im Nacken und verkroch sich verschämt unter den Jackenkragen. Nein! Knecht ward er nicht, das litt seine Reputation, sein Stand nicht. Der Mensch muß auch etwas für seine Ehre thun, punktum! Entschieden saß das Mützenschild über dem rechten Ohr, als wollte es sagen: Nur nicht grand gethan!
Also Heirathen! – –
Ja! – Das war nun auch eine schlimme Sache, an und für sich schon eine sehr, sehr schlimme Sache. Noch weniger als ein Knecht war der Ehemann Herr seiner selbst, noch mehr als von dem Knecht ward von ihm ein geordnetes, regelmäßiges Leben verlangt; ach, und in der Ehe brachten weder Sonntage noch Feiertage Erlösung, für den Ehemann gab es kein Petri oder Jakobi! Galt das im Allgemeinen von jeder Ehe, o Himmel, was stand dann ihm noch im Besonderen bevor! Kein Zweifel, wollte er der Knechtschaft entgehen, lud er sich die trostloseste Sklaverei auf den Nacken. Zu gut kannte er die ihm bestimmte Braut und ihre Eltern, um nicht genau zu wissen, was ihm bei ihnen bevorstand.
Schon in den Namen hatte der Volkswitz den Vetterleuten ein böses Denkmal gesetzt. Rikelsrik hieß die Base, Rikelssamel der Vetter, Rikelsev die Tochter. Daraus ging hervor, wer Herr im Haus war, in welch' elender »G'schlaferei« der arme Samel schmachtete. Was ward nun erst aus ihm, trat er in diese Familie: ein Rikelspeter oder Evenpeter? – Ach, das Mützenschild hing schon 157 lange trübselig auf dem rechten Ohr und Peter's Kopf auf der Brust. So viel wie heute hatte er sein Lebtag noch nicht nachgesonnen; noch vor einer Stunde hätte er keinem Menschen geglaubt, daß solch' eine Menge schwerer Gedanken in seinem Kopf Platz finden würde, ohne ihn zu zersprengen.
Daß die Vetterleute nicht in gutem Ruf standen, ja, daß ihrem Namen gar mancher Makel anklebte, das störte ihn nicht; ihr Wohlstand, ihr schönes Haus und Feldwesen deckte diesen Mangel zu. Bedenklicher schon war ihr Geiz, ihre unstillbare Habsucht. Du lieber Gott, wie vertrug sich sein leichter Sinn, seine Geringschätzung des Geldes mit solchen Neigungen? Der größte Haken war aber die Ev, seine Zukünftige, selber. Alles ließ sich am Ende noch übersehen, ertragen, aber die Ev – die Ev! Das lange, rasseldürre Mädchen konnte gut seine Mutter sein, ach, und wie war sie so häßlich, so unsauber, und nun gar ihre Zunge! – Tief seufzend setzte er seine Mütze zurecht; langsam – immer langsamer schlich er seinen Kameraden nach und haderte mit dem Schicksal. Wozu gab es Knechtschaft und Weiber in der Welt? Warum konnte er nicht als bergheimer Bauernsohn und Musikant fortleben wie bisher?
Was sollte geschehen? Das Wort der Mutter stand fest, daran war nicht zu rütteln – was nun thun? – »Nur nicht grand gethan!« brummte Peter tiefsinnig. »Schaden kann's nicht, guck' ich mir die Bescherung gründlich in der Nähe an – ich hab' ja immer noch meinen freien Willen! Nur nicht grand gethan!«
Unwillkürlich beschleunigten sich seine Schritte, er sah die mühldorfer Planbursche mit dem Biergießer den 158 Musikanten entgegen kommen – da durfte er natürlich nicht fehlen. Ein tiefer, endloser Zug aus dem Bierglas stellte seinen Gleichmuth wieder her und richtete ihn mächtig auf. Noch ist ja Polen nicht verloren! Ist nicht der Himmel blau und lacht nicht die Sonne? Duften die Blumen in den Sträußen der Planbursche, rauschen die Seidenbänder weniger lustig denn früher? Wer wird verzagen, so lange es noch Kirmsen gibt und Bier! – Keck saß die Mütze wieder auf einem Ohr, glückselig lächelnd leerte er ein Glas nach dem andern und beim Einzugsmarsch schmetterte seine Trompete, es war eine Lust.
Es war eigentlich natürlich, daß Peter erklärte, er quartiere sich bei seinen Vetterleuten ein, und doch rief sein Entschluß großes Gelächter hervor, die Musikanten wie die Planbursche sahen ihn mit eigenen, zweideutigen Blicken an. Peter stieg das Blut zu Kopf, er wußte selbst nicht, warum er so ärgerlich ward. Zornig knurrte er: »Nur nicht grrrand gethan!« und ging davon.
Von den Rikelsleuten, d. h. von der Rikelsrik und Ev (der Samel zählte nicht mit), ward Peter mit großer Herrlichkeit aufgenommen; ja die Ev ward gleich so handgreiflich zuthulich, daß er sie mit einem mürrischen: »Nur nicht grrrand gethan!« von sich schob und sich sehr verdrießlich hinter den Tisch pflanzte. Die Geschichte war gefährlicher als er gedacht, ein ängstlicher Zweifel stieg in ihm auf, ob er in diesem Haus während dreier Tage seine Freiheit wohl werde bewahren können. Die Ev dagegen war ganz glückselig; das alte Mädchen hätte den schmucken Burschen wohl am liebsten gleich in den Himmel gehoben, wäre es gegangen; dafür stellte sie ihm ihren Ehehimmel wenigstens in 159 desto gewissere Aussicht! Auch die Rik war wie umgewandelt, redete so aufrichtig, herzensfreundlich mit dem Vetter, wußte ihm so klug und geschickt um den Bart zu gehen – der einsame Samel ärgerte sich in seiner Ecke fast schwarz über dieses »ewige Geleck«!
Trotz seines Kummers ließ sich Peter die Kartoffelklöße und den Schweinebraten wacker schmecken, verschmähte auch das Bierglas nicht, und in merklich besserer Laune ließ er sich nach Tisch von den Weibsleuten in Haus, Hof und Garten herumführen. Allmälig kam er in bedrängte Lage. Das schöne Haus, das prächtige Feldwesen zogen ihn mächtig an; als er durch Stall und Scheune schritt, lachte ihm das Herz über den gediegenen Wohlstand, der ihm entgegenleuchtete und der so gewaltig gegen die Armuth daheim abstach. Fast wollte ihn bedünken, um diesen Preis könne man sich wohl Rikels- oder Evenpeter nennen lassen. Freilich, die »G'schlaferei«! Der arme Samel, es war doch zu schändlich, wie er mißachtet ward, wie er in seinem eigenen Haus auch nicht ein Wort reden durfte. Sollte es ihm ebenso ergehen? Und nun erst gar die Ev, die Ev! Dem langen Ding schlotterten die Kleider lüderlich um den hagern Leib; das gelbe, faltige, von verwilderten Haaren umstarrte Gesicht sah gerade aus, als seien ihm Wasser und Seife gänzlich unbekannte Dinge. Wenn sie verliebt mit ihren kleinen grünen Augen auf ihn blinzelte, den zahnlosen Mund fast bis an die Ohren auseinanderzog – dann überlief Peter ein Schauder, sie glich gar so genau der greulichen Schlange, die er auf den Vogelschießen gesehen. Dazu stand ihre spitze Nase keck und kühn im Gesicht wie ein Schnabel, aber eine Zierde war sie ihr auch nicht; wenn 160 sie sich im Eifer des Gespräches Peter zuneigte und ihm vertraulich zunickte, wich er unwillkürlich zurück; er ward die Angst nicht los, der Schnabel könne unversehens nach seinen Augen hacken. Selbst ihre Freundlichkeit hatte etwas katzenartig Lauerndes, Bösartiges, das gut zu dem falschen Wesen ihrer Mutter stimmte. Je länger Peter sie ansah, desto größer ward sein Grauen vor dem Mädchen, fast beschlich ihn ein Gefühl wie Furcht. Zwar war er daheim auch nicht an holländische Reinlichkeit gewöhnt, aber solcher Schmutz, solche Unordnung überall ekelte ihn doch an. Seine Noth ward groß. Was thun? – Da fielen ihm die Worte der Mutter ein: »Eine Gelegenheit wie die Ev findest Du Dein Lebtag nicht wieder – bettst Du Dich gut, schläfst Du gut!« Verdrießlich schob er sein Mützenschild rund um den Kopf und brummte: »Knechtschaft? – Nein, dazu bin ich doch zu gut, der Mensch muß auch was für seine Ehre thun! – Meinetwegen auch, ich mach's fertig, die Mutter zwingt mich ja dazu. Wie's ausfällt, das geht mich nichts an, das ist ihre Sach'! Geht's krumm – und es ist vorauszuseh'n, daß's krumm geht – nachher soll sie auch nicht grand thun! – Meintwegen, ich wag's! – Ach, du liebster Herrgott, wenn die Ev nur ein Linsele schöner wär' – und – – – – –« Weiter kam er vorläufig nicht.
Gleich nach seinem Eintritt hatte die Rik ihre Tochter bei Seite genommen und ihr eingeschärft, sie solle Peter nicht aus den Augen lassen und ihn scharf beobachten. Zeige er sich nur im Geringsten freundlicher, müsse sie sofort einen gewaltsamen Sturm wagen, um ihn womöglich durch Ueberraschung zu fangen. »Denn«, meinte der alte, geriebene Racker, »er möchte wohl, aber er möchte auch wieder 161 nicht. Lassen wir ihm erst Zeit, sich zu besinnen, bleibt uns gewiß das Nachsehen. Haben wir ihn aber einmal in der ›Klupp‹, dann sorg' ich, daß ihn kein Teufel wieder los macht. Also merk's: er darf nicht aus dem Haus, bis er unser ist!« Das leuchtete der Ev ein, sie war nicht vergeblich die Tochter der Rikelsrik. Als nun der Peter gar so tiefsinnig vor sich hinstarrte, seine Kappe immer heftiger auf dem Kopf umherwanderte, machte sich die Ev ganz sachte herbei; näher und näher rückte sie, streichelte seine Hand, nannte ihn ihren liebsten Vetter, fragte theilnehmend, was ihm fehle und dabei schlang sie sachte ihren Arm um seinen Hals. Peter achtete nicht groß auf diese plötzliche Vertraulichkeit; als sich jedoch ihr Arm um seinen Nacken eng zusammenzog, als sie ihn fest an sich drückte, schrie er erschrocken: »Herrgott von Bentheim, nur nicht grand gethan!« Zu spät! Der Arm war wie eine eiserne Klammer und so schloß denn Peter geduldig die Augen und dachte, während ihn die Ev liebkoste, an die schönen Aecker und Wiesen, an die runden Kühe und die fetten Schweine, welche ihm dieser Kuß zubrachte. Er verwunderte sich auch nicht im Geringsten, als die Rik plötzlich unter der Thür stand, die Hände zusammenschlug und rief: »Herr meines Lebens! Steht es so mit euch? – O ihr Kinnerle, ihr Kinnerle, was macht ihr mir für Streich'! Ist's denn wirklich euer Ernst? – Wahr, und wahrhaftig? – Nu, so geb' der Herrgott seinen Segen dazu, wenn ihr doch einmal nicht von einander lassen wollt!«
Wenn auch Peter heimlich den Kopf schüttelte, er war nun richtig Bräutigam und mußte gute Miene zum bösen Spiele machen. Gar so schwer ward es ihm auch nicht, 162 sich in seinen neuen Stand zu finden, empfand er es doch fast wie eine Erleichterung, daß sich seine Zukunft so rasch entschieden hatte. Groß war die Freude der Rikelsweiber, sie trugen Peter fast auf den Händen, nur der Samel, den Niemand beachtete, hockte mürrisch auf dem Hellstein und verachtete die ganze Welt. Sein einziger Trost war der, daß diese Herrlichkeit bald ein trauriges Ende nehmen werde.
»Will ich oder will ich nicht?« sann die Rikel in der Küche und blickte traurig bald auf den Mehlkasten, bald auf den Topf voll »geläuterter« Butter. »So will ich! 's ist freilich Verschwendung, aber bei 'ner Freierei darf man auch was nicht anseh'n. Und ich will's auch schon wieder beibringen; ist der Peter erst einmal im Haus – na, na! – In's Kukuks Namen mag's drum sein!« – Trotz dieser beruhigenden Rede war ihr doch nicht anders, als schnitte sie sich ein Stück von ihrem Herzen, so oft sie einen Löffel Butter aus dem Topf holte; mit Jammern und Seufzen ging sie daran, Krapfen zu backen.
Der Samel hörte auf seinem Hellstein das Prasseln des Feuers, das Zischen der Butter; ahnungsvoll schlich er in die Küche und mußte sich vor freudigem Schreck an die Wand lehnen. »Krapfen! – O du liebster Herrgott im hohen Himmel droben! Krapfen, meiner Seel', wahrhaftige, echte, rechte Krapfen!« seufzte er. Mit feuchten Augen gab er nachträglich dem Paar seine Einwilligung zur Freierei, dann aber litt es ihn nicht mehr länger in der Stube. Ach, Krapfen waren ja für ihn der Inbegriff der höchsten irdischen Glückseligkeit, der höchste Genuß – und er hatte 163 sie entbehren müssen seit seiner Hochzeit. Heimlich trug er seinen Kühen eine Handvoll des besten Klees zu und flüsterte ihnen schluchzend in die Ohren: »Ihr Küh', ihr Küh', denkt an: morgen gibt's Krapfen!«
Unterdeß ging wie ein Lauffeuer die Nachricht durch's Dorf: die Rikelsev hat sich mit dem bergheimer Eckenpeter versprochen. Maßloses Staunen folgte ihr, dann Spott und Gelächter. Manche bedauerten auch Peter und meinten, es sei schade um den Burschen; das waren doch nur vereinzelte Stimmen, das allgemeine Urtheil ging dahin: wer sich mit den Rikelsleuten einläßt, ist selbst nichts werth; geht's dem Peter schlecht, hat er's nicht besser verdient! Am meisten wunderten und ärgerten sich die Musikanten. Zuerst glaubten sie dem Gerücht gar nicht, schickten den Bergkasper und Schneidersheiner auf Kundschaft aus, der Sache auf den Grund zu kommen. Lange schlichen die Beiden um das Rikelshaus, vergeblich; Peter war klug und ließ sich nicht blicken. Dafür machten sie eine andere Entdeckung. Die mühldorfer Mannsleute wollten auf den Köpfen stehen vor Verwunderung, als Heiner und Kasper berichteten, die Rikelsev habe eine ganze Mulde Krapfen in's offene Kammerfenster gestellt. »Entweder ist die Rikel übergeschnappt oder sie stirbt bald!« riefen Alle wie aus einem Mund. Die Krapfen machten größeres Aufsehen als selbst die Freierei. Zuletzt meinte ein Planbursch: »Ich wollt', es käm' ne Katz' oder sonst was über die Krapfen, der Rikelsrik, dem Geizkragen, wär's zu gönnen. Hollahurreh, der Lärm! Ich glaube, sie stürmte ihr ganzes Haus!« Dieser Wunsch erregte allgemeinen Beifall und ward viel belacht.
164Wie sich Peter auch davor graute, es half nichts, er mußte endlich doch seine Trompete von der Wand nehmen und seine Kameraden aufsuchen, denn die Zeit zum »Zusammenblasen« der Plansmädle war nun da. Beim Eintritt in die Wirthsstube biß er die Zähne zusammen und ballte die Fäuste, um nicht loszubrechen; grün und gelb ward es ihm vor den Augen, sein Blut kochte – aber er hielt an sich. War der erste Sturm überstanden, dann war das Aergste vorbei, dann konnte er auch eher zu Wort kommen, rechnete Peter, und nicht falsch. Aber es war doch eine schwere Prüfung, die er zu überstehen hatte, der Spott und Hohn wollte gar kein Ende nehmen, all' seine: »Nur nicht grand gethan!« blieben ohne Wirkung. Dankbar drückte er dem Gänskasper die Hand, der war der Einzige, der sich seiner annahm.
Alles auf der Welt hat seine Zeit, die Planbursche und Musikanten mußten endlich von Peter ablassen und aufbrechen. Wie athmete Peter auf! Der Arme ahnte nicht, daß ihm das Schlimmste erst noch bevorstand.
Heute klang Peter's Trompete nicht so lustig wie sonst, wie er sich auch mühte, er brachte gar keinen rechten Ton hervor, auch das Bier schmeckte ihm nicht, und als auf dem Plan die Ev sich schmunzelnd an ihn drängte, ein Flüstern und heimliches Lachen durch die Planpaare und Zuschauer lief, da schoß ihm das Blut in das Gesicht, und eine tiefe, tiefe Scham, er wußte selbst nicht recht worüber, glühte in ihm auf. Und der Sonnenglanz, Blumenduft, die Farbenpracht und das Rauschen der Seidenbänder, es erfreute ihn nicht mehr; die fröhlichen Gesichter, das Jubeln und Jauchzen verdroß ihn. Von der lustigen Kirmsepredigt, die soeben 165 der Planvortänzer gehalten, vernahm er kein Wort, rein mechanisch stimmte er in den folgenden Tusch mit ein. Jetzt begann der zweite Planbursch seinen Spruch. Peter fuhr zusammen, denn er mußte hören:
Die Rikelsev und der Eckenpeter – Potz Dunnerschlag, das sagt ein Jeder! – Solch' Paar war noch nicht auf dem Platz, Die passen zusammen wie Hund und Katz'! O Peterlein, o Peterlein, Wie wird Dir's über's Jahr wohl sein? – Man möcht' sich gleich den Kopf zerreißen: Wie wird der Peter künftig heißen? Evenpeter ist nix – Rikelspeter ist nix – 's ist euch eine verdammte Wix! Doch halt! – da fällt mir noch was ein, Ich mein', das wird das Rechte sein!Rikelsevenpeter! – das wird einmal sein Nam', Da ist gleich sein ganzes Hauskreuz beisamm'! Der Rikelsevenpeter soll leben und seine Ev daneben! Vivat hoch!
»Der Rikelsevenpeter soll leben und seine Ev' auch daneben, vivat hoch!« lärmte und schrie die Versammlung, die Musikanten mußten so heftig lachen, daß sie fast den Tusch nicht blasen konnten. Heulend und schimpfend rannte die Rikelsev davon, Peter aber nahm sein Mundstück von der Trompete, preßte sie unter den linken Arm, ließ sein Kappenschild kreisen und schrie: »Nur nicht grrrrrrrand gethan! Alles hat sein Maß und Ziel, und wo der Schimpf anfängt, hört der Spaß auf!« Damit steuerte er auf den Planbursch los, der den Reim auf ihn gebracht hatte. Das Lachen verstummte, die Mädchen flohen scheu zur Seite, die Bursche traten in Haufen zusammen. Zu einer Prügelei kam es nicht; der Zimmerdick und der mühldorfer Schulz 166 vermittelten, und mit dem Versprechen, daß er forthin ungeneckt bleiben sollte, beruhigte sich Peter. Er hätte sich vielleicht nicht so leicht beschwichtigen lassen, wäre ihm nicht die Richtigkeit des Reimspruches selber so einleuchtend gewesen, daß er darüber in eine große Traurigkeit und in tiefe Gedanken versank. Mechanisch blies er mit, war aber so geistesabwesend, daß er während des ganzen Nachmittags nicht einmal an das Trinken dachte.
Zum Abendessen ging er nicht in's Rikelshaus, traurig blieb er auf dem Orchester sitzen und schüttelte auf alle Trostgründe seiner Freunde, deren Mitleid allmälig erwachte, trübsinnig den Kopf. Welche Veränderung war mit dem leichtsinnigen, gedankenlosen Burschen vorgegangen! Wie hatte er so rasch nachdenken und überlegen gelernt!
Mitleidige Mühldorfer schlichen herbei und erzählten ihm Geschichten von den Rikelsleuten, daß ihm vor Scham die lichten Flammen aus dem Gesicht schlugen; sie berichteten Einzelheiten aus dem Rikelshaushalt, besonders wie die Weiber mit dem Samel umgingen, daß ihm der helle Angstschweiß ausbrach. Und als er später die Ev in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit drunten im Tanzsaal sitzen sah, überlief es ihn heiß und kalt, vor Wehleid hätte er heulen können.
»Mach's jückgängig, Petej,« mahnte der Bergkasper gutmüthig, »mach's jückgängig, eh' Dich's jeut!«
Peter blickte verdrießlich von der Seite nach dem Rather. Gereut hatte ihn die Sache schon lange, aber mit dem Rückgängigmachen, das war's ja eben. Ach, der Rikelsrik und ihrer Ev entrann er nicht, die hielten ihn fester als die Katze die Maus.
167Und nun kam ihn ein großer Zorn an über seine Mutter, daß sie ihn so hartherzig in solch' großes Unglück gestürzt hatte. Aber wunderlich, dieser Unmuth hielt durchaus nicht Stand, immer schlug er um und wendete sich gegen ihn selber. Die Mutter hatte nur die Wahrheit gesagt und ihre Schuldigkeit gethan, sonst nichts. Traurig genug, daß sie so gegen ihn auftreten mußte. Und nun ging plötzlich unserem Peter ein Licht über sich selbst auf, so groß, so hell, so blendend, daß er im ersten Schrecken sich am liebsten vor sich selber verkrochen hätte. »Traurig genug, daß sie so gegen mich auftreten mußte!« Das war der Schlüssel, der ihm mit einem Schlag das Verständniß seines bisherigen Lebens erschloß. – Ja, schön war es freilich gewesen, lustig, sorgenlos. Aber was hatte er der Welt genützt? Wie hatte er seine Gaben und Kräfte gebraucht? Seinen Eltern machte er Sorge und Noth, den Nachbarn gab er Aergerniß, den Geschwistern ward er ein verderbliches Beispiel. Auch nicht eine vernünftige That zeigte ihm seine Vergangenheit, wie ein rechter Narr hatte er die schönste Zeit seines Lebens vertollt, nutzlos vergeudet. Zur Strafe dafür saß er im Unglück bis an den Hals und durfte nicht einmal klagen. Er hätte den Kopf an die Wand rennen mögen! Was hätte er jetzt um seine Freiheit gegeben, wie hätte er sie benützen wollen, wie gerne, ach so gerne wäre er Knecht geworden!
Solche Erwägungen hatten freilich vorläufig nur das Ergebniß, seinen Jammer zu vergrößern, denn je mehr er sich nach Freiheit sehnte, desto erschreckender trafen ihn die verliebten Blicke seiner verlobten Braut. Zuletzt ergab er sich seufzend in sein Geschick, und es ward ihm ein Weniges 168 leichter um das Herz, da er sich gelobte, wenigstens von jetzt an ein ordentlicher Mensch zu werden.
Um die Ev kümmerte er sich nicht das Mindeste. Die arme Braut mochte winken und bitten wie sie wollte, Peter saß wie angenagelt auf dem Orchester und rührte und regte sich nicht. Mit ihr tanzen! – Schon bei dem Gedanken daran überlief ihn eine Gänsehaut. Sie heimzugeleiten war er vollends durch nichts zu bewegen. »Die findet den Weg ohne mich,« entschuldigte er sich seufzend bei dem Gänskasper, »ich muß mich erst so nach und nach an ihren Anblick gewöhnen!«
Trübsinnig schlich er nach dem Feierabend durch die thaufrische Nacht dem Rikelshaus zu. Wie zufällig trafen ihn der Bergkasper und Schneidersheiner, hörten geduldig sein Lamento an und sprachen ihm Muth und Trost ein. Endlich machten sie ihm den Vorschlag, er solle zu guter Letzt noch einen richtigen Kirmesspaß mit ihnen ausführen. Peter wollte lange nichts davon hören; ihm sei's nicht wie spaßen! wehrte er ab. Zuletzt erwachte doch der alte Schalk in ihm und er sagte: »Meintwegen auch! Noch einmal will ich mitthun! Ist's weiter nichts, vergess' ich doch eine Weile mein Elend!«
Nun ward er kreuz und quer durch Höfe und Gäßchen, über Hecken und Dörner geführt; endlich erklärte der Schneidersheiner: da droben im offenen Kammerfenster stehe eine ganze Mulde Krapfen, er solle die bereitstehende Leiter hinaufklettern und sie heraushäkeln. Peter machte die Sache Spaß, er stieg zum obern Stock empor, fand Fenster und auch glücklich die Mulde mit den Krapfen, die er vorsichtig mit einem Hakenstöckchen herausangelte und seinen Gesellen 169 zuwarf. Unbemerkt kam er wieder herab, in einer Streuschuppe ward der Raub getheilt, dann ging es wieder lange kreuz und quer herum, bis endlich auf der Dorfstraße der Heiner und Kasper den Peter verließen. Ihr unmäßiges Lachen schrieb er auf Rechnung des gelungenen Streiches, mit schwerem Herzen, tief seufzend schlich er in's Rikelshaus und auf seine Kammer.
Peter warf sich noch lange schlaflos auf seinem Lager umher, finstere Gestalten tauchten aus dem nächtlichen Dunkel auf, umstanden sein Bett, beugten sich über ihn, blickten ihn mit feurigen Augen an, hauchten ihm mit glühendem Athem in's Gesicht. Und obgleich er sie zum ersten Mal sah, kannte er sie doch gar gut, und sein Herz erzitterte. Ja, wenn er sich seines vergangenen Lebens erinnerte, richtete sich wohl die Reue neben seinem Bett empor und erzählte ihm alte Geschichten, hielt ihm einen Spiegel vor, und Stunde auf Stunde seines Lebens, die er verschleudert, vertollt, zog vor seinen Augen vorüber. Dachte er an seine Zukunft, dann standen schon die Sorge und die Angst bereit, beugten sich über ihn und legten sich wie ein Alp auf seine Brust. Endlich, schon dämmerte der Morgen, fielen ihm doch die müden Augen zu.
Ein wilder Lärm, Heulen, Schreien, Fluchen und Schimpfen weckte ihn. Thüren wurden auf- und zugeworfen, treppauf treppab ging es im Haus, und jetzt vernahm er deutlich, wie der Samel in der Nebenkammer jammerte: »Ach du lieb's Herrgottle, die Krapfen, die Krapfen!«
Wie ein Donnerschlag trafen Peter diese Worte. »O Herrgott von Bentheim, die Krapfen!« murrte er, sprang aus dem Bett an das Fenster – richtig, draußen in den 170 Zweigen des Birnbaumes schwankten drei Krapfen lustig auf und ab. Zitternd fuhr er in seine Kleider; dort auf der Lade lag sein Raub! – was sollte er mit dem Unglückszeug, das ihn verrathen mußte, beginnen? Noch stand er rathlos, da stürmte die Rikelsrik heulend, mit aufgelösten Haaren, herein. Aber ihr Heulen verstummte, ihre Augen traten aus den Höhlen, wie versteint starrte sie auf den Bündel Krapfen, die sie sofort als die ihrigen erkannte. Peter kraute sich hinter den Ohren und war auf Alles gefaßt. Zu Gewaltthätigkeiten kam es jetzt noch nicht, fluchend eilte die Rik aus der Kammer, drunten aber erhob sich ein neuer Lärm, nur in anderer Tonart.
Da stand nun Peter wie ein begossener Pudel und konnte fast den Knoten an seinem Halstuch nicht binden, so zitterte seine Hand. Heimlich verfluchte er die Schelme, die ihn zu dem Streich verleitet. Was sollte er jetzt thun? Heimlich das Haus verlassen und abwarten, bis sich der Zorn seiner Schwiegermutter gelegt? Aber wann kam es dazu? Ihre Krapfen verschmerzte die Rik niemals! Und dann war es ihr gar wohl zuzutrauen, daß sie ihm in das Wirthshaus nachging und ihn vor allen Leuten beschimpfte. Ohnedieß hingen seine Stimmbögen, die er nicht entbehren konnte, in der Wohnstube. Seufzend entschloß er sich, gleich jetzt das Wetter über sich ergehen zu lassen und stieg ächzend die Treppe hinab.
Vater, Mutter und Tochter saßen heulend, jammernd und schimpfend in der Wohnstube zusammen. Jedes würgte an einem besonderen Aerger, einstimmig waren sie nur in ihrem Zorn auf den unglücklichen Peter. Die Ev konnte die gestrige Zurücksetzung nicht vergessen, Samel den Verlust 171 der Krapfen nicht verschmerzen, der Rik dagegen ging das Loch im Mehlkasten überall nach, und der leere Buttertopf höhnte: Das geschieht Dir recht, Rik, ganz recht geschieht Dir. Was bist Du auch so dumm, ach so arg dumm? Als nun Peter schüchtern eintrat, fuhren alle Drei schimpfend und scheltend auf ihn ein.
Peter war vollständig fassungslos, er stand da wie ein Gänserich, wenn's blitzt. Von dem Lärm hörte er nichts, voller Entsetzen starrte er auf die Ev. Ihre Nase hackte wie ein Geierschnabel, ihre Kinnladen klappten wie bei einem Krokodil; es war greulich, wie tief er in den weit aufgerissenen, zahnlosen Mund hinabsehen konnte. Und das sollte seine Frau werden? Ein Schauer überlies ihn. Unwillkürlich streckte er abwehrend die Hände vor und wich Schritt um Schritt zurück.
Dieses Zurückweichen machte seinen Gegnern Muth. Der Samel, der sich vorsichtig im Hintertreffen gehalten hatte, fuchtelte ihm mit den Fäusten gefährlich um die Nase; die Rikelsrik taxirte ihn verächtlich für einen Jammerlappen gleich ihrem Alten, bei dem man sich wohl was erlauben könne, und plötzlich schrie sie: »Was, solch ein Nichtsnutz, solch ein Umschlag will mein Mädle frei'n? Gott's Donner! Da hab' ich auch noch ein Wort drein zu reden! Nichts ist's, aus ist's! Und er kriegt die Ev nicht, und wenn er mir auf dem Fleck zu Füßen fällt. Aus ist's!«
Heraus war es – nun sah auch die Rik, was sie angerichtet, aber es war zu spät. Peter schien größer zu werden, ein eigenes Feuer glühte in seinen Augen auf. Mit der einen Hand warf er den Samel hinter den Ofen, mit der andern langte er seine Trompetenbögen von der 172 Wand. Darnach begann er mit Lachen: »Nur nicht grrrrrrrrand gethan! Herrgott von Bentheim, ihr habt mir's heiß gemacht. Mit den Krapfen war's ein Kirmesspaß, der Bergkasper und Schneidersheiner beluchsten mich dazu, ich wußt' nicht, daß's auf eure abgesehen war. Mein Theil liegt droben in der Kammer, wegen den übrigen haltet euch an den Kasper und Heiner. So – nur nicht grrrrrand gethan! Ihr habt mich gestern mit Listen gefangen – 's weiß der liebe Gott, was ich seit der Zeit euretwegen ausgestanden habe – euer Aerger wegen der Krapfen ist Spaß dagegen. Nun sagt Ihr, Rik, 's wär' aus – das vergelt' euch der Herrgott im Himmel! Ja, aus ist's, und vorbei ist's auf alle Zeit! – Mich fangt ihr nicht wieder!« Damit verließ er das Haus.
Ach – wie war der Himmel so blau, wie lachte das goldene Morgensonnenlicht auf Berg und Thal, Wiese, Wald und Dorf, wie dehnte sich seine Brust im erfrischenden, wasserduftigen Morgenwind, wie melodisch klang selbst das Klappern der Papiermühle – er war ja frei! Ein neues, schönes Leben lag vor ihm! Wie schlug sein Herz, wie klopften die Pulse! Wenn er auch nicht die Hände faltete, wenn er auch nicht die Augen zum Himmel aufschlug, sein ganzes Denken und Empfinden war ein feuriges Lob- und Dankgebet, und das Gelöbniß, das ihm gestern die Verzweiflung abzwang, er erneute es als freiwilligen Entschluß: ja, nun werd' ich ein anderer Mensch!
Und nun dachte er wieder an den Streich mit den Krapfen. Er war wohl zu seinem Glück ausgeschlagen, aber es hätte auch anders ausfallen können; ein schlechter Spaß blieb es immer – sollten die Beiden straflos ausgehen? 173 Peter versank in tiefes Sinnen, bald aber umspielte ein lustiges Lachen seine Lippen.
Eben saßen die Musikanten und Planbursche im Wirthshaus zusammen, belachten den gelungenen Streich und ließen sich die »eroberten« Krapfen schmecken. Eben meinte der Schneidersheiner: »Was nun die Rikelsrik vorgibt! – Donnerwetter, in Peter's Haut möcht' ich nicht stecken!« – als der Genannte eintrat, sich still in eine Ecke drückte und wie in tiefen Gedanken den Kopf auf die Hand stützte.
»De hat seinen Theil kjiegt!« meinte der Bergkasper, und der Schneidersheiner rief: »Holla, Peter, was für 'ne Laus ist Dir über die Leber gelaufen? – Hat Dich Deine Schwieger am End' recht gelobt, daß Du so gut einschlägst und gleich in der ersten Nacht einen Bündel in's Haus trägst?«
»Das Donner und Wetter soll euch regieren!« überschrie Peter das Lachen und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Braucht euch auch eurer Schlechtigkeit noch zu berühmen! Herrgott von Bentheim, ihr habt was Schönes angerichtet! Und seid nur still von der Sach', ich bitt' euch um Alles in der Welt, tretet sie nicht breit, macht sie nicht offenbar! Herrgott von Bentheim, wenn die Rik die Spitzbuben erwischte – an das Unglück mag ich gar nicht denken!«
Die Musikanten sahen sich erstaunt an, Heiner's und Kasper's Gesichter zogen sich sehr in die Länge – wenn die Rikel Peter's Thäterschaft nicht kannte, dann war ja der Hauptspaß verdorben. Eine Weile tuschelten sie 174 heimlich, dann verließen sie stille die Stube, und Peter lachte, als er sie dem Rikelshaus zueilen sah.
Dort war große Noth. Die Rik raste und tobte: die Krapfen zum Teufel, und nun auch noch den Schwiegersohn, der so schön gefangen war, verloren! verloren durch eigene Schuld! – Das war zuviel auf einmal. Dazu war Peter auch noch ohne Strafe davongekommen, wahrscheinlich lachte er sie aus – das brachte die Rik vollends um alle Besinnung. Dazu heulte und schrie die Ev, machte ihrer Mutter die bittersten, kränkendsten Vorwürfe, sagte ihr auf den Kopf: durch ihre Dummheit habe sie das ganze Unheil angerichtet. Der Samel gar ächzte und jammerte, daß es einen Stein hätte erbarmen können: »Ach, die Krapfen, die guten, guten, schönen Krapfen! – Nun krieg' ich mein Lebtag keine Krapfen mehr!« – Die Rik war nicht mehr Herr ihrer selbst, eben wollte sie am Samel ihren Zorn auslassen, als gar freundlich der Bergkasper und Schneidersheiner in die Stube traten.
»Sind euch keine Kjapfen gestohlen worden?« fragte der Bergkasper so unschuldig als möglich; und der Heiner: »Wißt ihr nicht, wer's gethan hat?«
Das war doch zu arg! Die Rikel riß es in die Höhe, die Augen der Ev funkelten grünlich, selbst Samel, der eigentlich im Herzen den Beiden dankbar war, daß sie den Sturm von seinem Haupte ablenkten, gerieth in Wuth, als er des Krapfendiebstahls gedachte. Einhellig stürmten die Rikelsleute auf die Musikanten ein, aller Zorn, alles Gift, alle Galle, Alles, Alles, was sich in ihren Herzen angesammelt, jetzt brach es los! Ueberrascht, bestürzt sahen die Ahnungslosen ein Wetter gegen sich heraufziehen; ehe sie sich 175 besinnen konnten, war es schon in voller Entladung. An Gegenwehr dachte Keiner, Hören und Sehen verging ihnen, sie wußten nicht wie ihnen geschehen war, als sie sich plötzlich auf der Rikelsmiste fanden. Erst nach und nach tauchte eine dunkle Erinnerung an funkelnde Augen, knirschende Zähne, geschwungene Fäuste, scharfe Fingernägel in ihnen auf. Am Dorfbrunnen wuschen sie sich die brennenden Gesichter, dann schlichen sie langsam in das Wirthshaus zurück.
Peter hatte unterdeß den wahren Sachverhalt berichtet; als nun der Bergkasper und Schneidersheiner übel zugerichtet in die Stube kamen, sagte er lachend: »Potz Donner, müßt ihr im Rikelshaus 'ne Freud' angerichtet haben! Die Rik hat euch ja traktirt, 's ist aus der Weis'! Seid ihr vielleicht gar in's Kaffeehäfele gefallen?«
»Herrgotts Donnerschlag!« schrie der Heiner wüthend.
»Nur nicht grrrand gethan! Hab' ich nicht gesagt, ihr solltet das Maul halten, wenn die Rik die Spitzbuben erwischte, wird's schlimm? – O ihr Duckmäuser! Habt gemeint, die Krapfen wären mir noch nicht genug versalzen gewesen, und seid darüber selbst in Pfeffer und Essig gerathen. Wohl bekomm's!«
Dießmal hatte Peter die Lacher auf seiner Seite, und als die Beiden erst den Stand der Dinge erfuhren, kratzten sie sich hinter den Ohren und Heiner meinte: »Da haben wir allein die Zeche bezahlen müssen!«
Die Rikelsleut' gaben sich viele Mühe, Peter wieder zu versöhnen, allein er lachte sie aus. Er hielt Wort, ward ein tüchtiger Knecht und später ein rechtschaffener Hausvater. Wenn er auf seine erste Freierei zu sprechen kam, 176 pflegte er zu sagen. »Ja, meine letzten dummen Streiche waren mein Glück. Besser wär's freilich gewesen, ich hätte nicht erst durch Dummheiten gescheit gemacht werden müssen.«
Die Rikelsev harrte lange vergebens auf einen neuen Freier. Endlich fand sich doch einer, aber das war ein Hagebüchener aus den Bergdörfern, der vergalt der Rik und der Ev reichlich, was sie am Samel gesündigt hatten.
Wurden der Schneidersheiner und der Bergkasper an diese mühldorfer Kirmse erinnert, dann machten sie verlegene Gesichter und knurrten: »Ja, das waren gesalzene Krapfen.«
Umsingen
An einem stürmischen Dezembernachmittag kurz vor Weihnachten saßen wir, eine Anzahl junger Lehrer, in der warmen Wirthsstube zu Ebenfelden so recht behaglich zusammen. Wie es unter Lehrern zu geschehen pflegt, lenkte sich unser Gespräch bald auf die Angelegenheiten unseres Standes; wir gedachten unserer Bestrebungen, Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft, auch die alten, leider immer neuen Klagen wurden laut. Bald fiel uns auf, daß unser lieber Freund, der alte Kantor von Ebenfelden, so schweigsam unter uns saß und, ganz in sich versunken, theilnahmlos in das Schneegestöber draußen starrte. Auf unsere Frage strich er langsam über Stirn und Augen, blies eine mächtige Rauchwolke hinaus und sagte: »Ihr habt Recht, ich war nicht bei der Sache. Das wilde Wetter und eure Gespräche brachten mich auf mancherlei Gedanken und erweckten Erinnerungen aus längst vergangenen Tagen. Du lieber Himmel! – welche Veränderungen habe ich mit erlebt, wie ist es so ganz anders geworden, seit ich Lehrer bin! Ich kenne mich kaum selbst mehr, solche Wandlungen mußte ich durchmachen, und – und – nun ja! – in der neuen Welt, die um mich entstanden ist, fühle ich mich nicht heimisch, 2 ich komme mir oft recht einsam und verlassen vor. – Ja, ja, schüttelt nur die Köpfe! – Es mag Thorheit sein, so fest am Alten zu hängen, aber ich kann's nicht ändern, bei mir ist es nun einmal so.« Der alte Herr stärkte sich durch einen tiefen Zug, reichte sein leeres Glas dem Wirth und fuhr dann fort: »Ihr dürft mich nicht falsch verstehen. – Ich bin kein Feind des Fortschritts, erkenne gern das Gute an, wie und wo ich es finde, erfreue mich der Hebung unseres Standes, wie wir sie erlebt und noch erstreben, bin demnach keineswegs blind gegen die Vorzüge der Neuzeit – aber mein Herz gehört einmal der Vergangenheit, und ihr werdet mich darum nicht schelten.«
»Es waren freilich jammervolle Zustände, da die jungen Leute gleich nach der Konfirmation, ohne jede Vorbildung, wie sie eben aus der Volksschule kamen, als ›Präzeptoren‹ – welcher Titel etwa unserem ›provisorischer Lehrer‹ entsprechen mochte – auf die Dörfer geschickt wurden. Unbeirrt von grauer Theorie, unbelästigt von des Wissens Dunst und Qualm traten sie unter ihre Kinder, selbst noch halb Kind mochten sie nun zusehen, wie sie zurecht kamen. Hatten sie sich nach vielen verfehlten Versuchen einige Erfahrung in der edlen Kunst des Schulhaltens erworben, waren sie lange genug von Dörfchen zu Dörfchen im Lande herumgeworfen worden, so mit achtundzwanzig bis dreißig Jahren fanden sie endlich, wenn sie nicht vorher auf Abwege geriethen und zu Grunde gingen oder die Lust am Schulhalten verloren, eine feste Anstellung und ernteten nun als ›wirkliche Schulmeister‹ die Früchte ihrer Beharrlichkeit. Besondere Glückskinder erstiegen auch wohl die höchste Staffel schulmeisterlicher Ehren, bekamen zu allen übrigen Aemtern 3 und Würden noch den Titel ›Kantor‹ – der ihnen freilich nichts eintrug als Neid und Zorn der weniger begünstigten Kollegen. Auf welcher Stufe dieser Himmelsleiter aber auch der Lehrer stehen mochte, es war gesorgt, daß er nicht üppig, nicht übermüthig wurde; Bedrückung und Noth sind böse Lebensgefährten, und der Schulmeister ward sie nie los. Ich selbst habe noch diesen Weg durchlaufen, habe als Präzeptor unter den Leiden des ›Wandeltisches‹ geseufzt, als wirklicher Schulmeister Bedrückung von oben, Quälerei, bösen Willen von unten erduldet, und als Kantor harte Kämpfe bestehen, schwere Sorgen tragen müssen. Aber davon erzähle ich euch vielleicht ein andermal, heute beschäftigten meinen Geist nicht solche trübe Erinnerungen. – Ach, es war in alter Zeit auch gar schön; bei allen Leiden, allem Hunger und Kummer war unser Leben reich an Freuden, im Ganzen waren wir vielleicht glücklicher als ihr.
»Ihr seht mich erstaunt an? – Ja, es ist mein Ernst, und die Erklärung auch einfach genug. Wir Lehrer waren ein frisches, lebensfrohes Völkchen; für unsere bescheidenen Bedürfnisse reichte zur Noth unser Gehalt aus, und ging es einmal knapp her, nun so ertrugen wir auch das, ein leichter Sinn, ein zufriedenes Gemüth half über Vieles hinweg. Dazu waren wir noch nicht durch eine verfeinerte, erweiterte Bildung vom Volke getrennt, seine Freuden waren auch die unseren, wir nahmen herzhaft Theil an den Vergnügungen der Bauern und erschraken nicht vor einem derben Wort oder Witz. Die Kirmse war für uns das höchste Fest des Jahres; Hochzeiten, Taufen, Leichenschmäuse, Schlachtfeste, bei denen der Lehrer nie fehlen durfte, unterbrachen erfreulich die einförmigen Tage. Besonders einige 4 althergeorachte Ordnungen und Gebräuche, die, aus dem Volksleben herausgewachsen, ein gut Theil Volksgemüth, seine unverwüstliche Laune, seinen Humor, seine übersprudelnde Fröhlichkeit, zum Ausdruck brachten, wurden ein Trost in engen Verhältnissen, richteten den bedrückten Geist auf, machten das Herz frisch und fröhlich.
»So hatte zum Beispiel jede größere Pfarrei ihren Kirchenmusikchor, der unter der Leitung des Lehrers stand und durch Aufführung von Kirchenmusiken den Gottesdiensten an hohen Festtagen eine besondere Weihe geben sollte. Diese Chöre – mit Vorliebe Choradstanten-Institute genannt – waren in gleicher Weise der Stolz der Lehrer wie der Gemeinden und wurden so zu einem trefflichen Bindeglied zwischen Beiden. Dem Lehrer, dessen Tüchtigkeit damals fast allein nach seinen musikalischen Leistungen bemessen wurde, bot der Kirchenchor erwünschte Gelegenheit, seine Ehre, sein Ansehen zu vermehren; die Gemeinden dankten ihm jede Bemühung, lauschten mit Wonne den Aufführungen, und es störte nicht, wenn sie auch noch so unkirchlich klangen. Die Musikanten dagegen standen mit dem Volk in vielfachen, nahen Beziehungen. Sie geleiteten – natürlich wenn es bezahlt wurde! – den Säugling bei der Taufe zur Kirche, schritten dem Brautpaar auf dem Weg zum Altar voran und trugen bei Leichenbegängnissen durch jammervolle Arien zur Vermehrung der Wehmuth bei – wie mir denn eine alte Bäuerin einst versicherte: ›Die Leichenmusik heut war aber zu schön, Herr Kantor! das Heulen ist dabei gleich viel leichtlicher gangen!‹ Das war aber noch nicht die Hauptsache; ohne die Musikanten gab es gar kein wahres volles Vergnügen, bei Taufen und 5 Hochzeiten durften sie auch in den Häusern nicht fehlen, ohne ihre lustigen Tanzweisen war vollends die Kirmse gar nicht denkbar. Sie standen aber auch in allgemeiner Gunst, und vielleicht war das eine Ursache mit, daß die tüchtigsten Männer es sich zur Ehre rechneten, den Choradstanten anzugehören. Aus Liebe zur Musik trat wenigstens selten Jemand in den Verein – war es doch auf große musikalische Leistungen durchaus nicht abgesehen, zu den nöthigen Proben fehlte Zeit und Lust, dagegen entwickelte sich in ihrem Kreise eine frische Geselligkeit; stets guter Laune, immer aufgelegt zu Scherz und Possen, ging von ihnen mancher kernige Kraftspruch, manch' treffender Witz aus. Wir Lehrer standen mit den Choradstanten selbstverständlich in engster Verbindung; als Präzeptoren waren wir ihre Kollegen; rückten wir dann zu wirklichen Schulmeistern und Chordirektoren auf, so that dieß dem herzlichen Verhältniß keinen Eintrag, nach wie vor blieben wir Freunde und verlebten zusammen glückliche Stunden.
»Habe ich euch nun von einer schönen Einrichtung der Vorzeit berichtet, so darf ich auch eines lieben, sinnigen Gebrauches nicht vergessen, der eng mit dem Lehrerleben und Musikantentreiben verwachsen war. Am Weihnachtsfest zogen wir Lehrer mit vollem Chor durch die Pfarrei und sangen – vielleicht zur Erinnerung an den Engelsgesang zu Bethlehem – vor jedem Haus ein frommes Lied. – Dieses ›Umsingen‹, wie wir es nannten, von Haus aus freilich ein religiöser Gebrauch, wurde allerdings nicht immer mit dem rechten Ernst und der gehörigen Andacht vollführt, es mischte sich viel weltliche Lust und Fröhlichkeit hinein, aber gerade deßwegen wuchs es uns – Lehrern, Musikanten, 6 dem Volke – so recht in's Herz hinein, war es doch gerade so ein echtes Stück Volksleben.
»Die Choradstanteninstitute sind aufgelöst, das Umsingen ist abgeschafft, kaum noch hie und da lebt in einigen Greisen die Erinnerung an diese schönen, volksthümlichen Einrichtungen fort – in kurzer Zeit wird auch das letzte Gedächtniß daran verschwunden sein. Ich aber kann weder das Eine noch das Andere verschmerzen, empfinde bitter: wir Lehrer sind ärmer geworden und auch das Volk hat sich beraubt. Wenn ich dann das hastige, gemüthlose Treiben um mich betrachte, kommen mir ernste Zweifel, ob das jetzige Geschlecht im Stande sein wird, durch neue Schöpfungen das Alte, das es so pietätlos bei Seite warf, zu ersetzen – bis heute habe ich wenigstens keinen Anfang bemerken können. – – Seht, darum bin ich in der Gegenwart nicht mehr recht heimisch, fühle mich oft einsam und verlassen; und wenn nun Weihnachten naht und der Nordsturm um's Haus heult, dann erwacht Erinnerung auf Erinnerung – ich hoffe, ihr werdet mir diese Schwäche zuguthalten.«
Unsere Neugierde war rege geworden. Da und dort hatten wir vom Umsingen reden hören, ohne doch etwas Rechtes zu erfahren. Auf unsere Bitten, mehr zu berichten, lächelte der alte Herr: »Zu berichten ist allerdings nicht viel, macht es euch jedoch Vergnügen, will ich euch erzählen, was ich selbst auf einem bergheimer Umsingen vor langen Jahren erlebte. Ich thue es gern, ihr werdet mich um so besser verstehen, und dann ist besagtes Umsingen für mein ganzes Leben gar verhängnißvoll geworden.«
»Richtig, Herr Kantor!« fiel der alte, weißköpfige 7 Schultheiß ein, der bisher aufmerksam zugehört hatte und jetzt mit freundlichem »Verlaubt!« seinen Stuhl an unseren Tisch zog. »Richtig, auf einem bergheimer Umsingen habt Ihr ja – –«
»Stille, Alter, nichts verrathen!« fiel ihm der alte Herr in's Wort. »Voraus bemerken will ich, daß es wohl manchmal ein wenig wild unter den Choradstanten zugegangen sein mag; es dürfte auch nicht Alles zu loben sein, was ihr hören werdet – vergeßt aber nicht, es ist eben ein Stück heiteres Volksleben, das ich euch vorführen will. Trotz aller Streiche waren die Choradstanten durchweg ehrenhafte Männer.«
Wir rückten enger zusammen, auch die Nachbarn kamen näher; nachdem sich der Kantor durch einen Schluck gestärkt und seine Pfeife in Brand gesetzt hatte, begann er seine Erzählung.
1.
»Da ist er ja!« rief mein Pathe und Pflegevater, der alte, dicke Kantor von Bergheim, wie ich am Weihnachtsheiligabend, gerade als das Fest eingeläutet ward, dickbeschneit in die Stube trat. »Sagt' ich's nicht, er kommt? Wußt' ich doch, der Junge hat seine Pflegemutter und den einzigen Bruder seines Vaters nicht vergessen! – Na, Gertrud, erdrücke ihn nur nicht, will auch noch was von ihm übrig behalten. – Sei herzlich willkommen in der Heimat, Karl! – Und nun mache Dir's bequem, Du bist ja zu Haus!«
Die Wahrheit zu gestehen, so hatte ich allerdings daran gedacht, die Weihnachtsfeiertage in Blumenroth, wo ich seit 8 drei Jahren als gestrenger Präzeptor über die Schuljugend herrschte, zu verleben. Ich erwartete täglich das Regierungsdekret mit meiner Ernennung zum wirklichen Schullehrer in Großgarnstett und wollte vor seinem Eintreffen meinen Wohnort nicht verlassen. Als nun aber ein Brief von meinem Pflegevater ankam, worin er mich gar so herzlich einlud, die Ferien im Elternhaus zuzubringen und ihm beim Umsingen beizustehen – da war mein Entschluß gefaßt. Das Dekret läuft mir nicht davon! dachte ich, schmierte meine Stiefeln, packte mein Seminaristenränzel, übergab meiner alten Nachbarin meine wenigen Blumenstöcke zu treuer Pflege, und am Weihnachtsheiligabend in der Frühe wanderte ich durch dichtes Schneegestöber Bergheim zu.
Freilich, die Liebe zu den Pathenleuten, die mich nach dem frühen Tod meiner armen Eltern zu sich genommen und gehalten hatten wie ein eigen Kind, war es, ich muß es gestehen, doch nicht allein, was mich so rasch umstimmte. Noch etwas Anderes zog mich nach Bergheim. Schon als Schulknabe war ich der stillen, sanften Wagnersmargareth gar herzlich zugethan gewesen, und sie erwiderte meine Freundschaft. Nach der Konfirmation kamen wir, wie das so zu geschehen pflegt, auseinander, und als mir auf dem Seminar neue Welten, ein neues Leben aufging, ja, da vergaß ich das stille Mädchen gänzlich. Die Base sprach wohl öfter von ihr, lobte ihr sittiges, sanftes Wesen, rühmte ihren Fleiß, ihr Geschick auch in feineren weiblichen Arbeiten, die sie bei ihr erlernte, ihre Häuslichkeit und Güte; ich achtete jedoch nicht darauf. Erst später als ich auf eigenen Füßen stand und an die Gründung eines Hausstandes denken durfte, ward ich aufmerksam und begann das Mädchen in der Stille zu 9 beobachten. Margareth war zur Jungfrau erblüht, ihre Schönheit erschreckte mich fast, ich begriff nun selber nicht, wie ich das bis heute hatte übersehen können. Aber nicht bloß äußere Vollkommenheiten entdeckte ich, das Lob der Base bestätigte sich in allen Stücken – genug, bald stand es in mir fest, Margareth, keine Andere, wird einmal meine Frau. Trotzdem fand eine Annäherung nicht statt; von der Base und meinem lieben Freund, dem Mühljohann, wußte ich, daß Margareth noch keinen Schatz hatte, dagegen war es gewiß, daß sie mich gerne leiden mochte: das war mir vorläufig genug. Da ich ohnedieß als Präzeptor nicht heirathen konnte, verschob ich ernstliche Bewerbung von einer Zeit zur andern. Nun schrieb mir aber der Mühljohann vor wenigen Wochen: der mühldorfer Präzeptor, Richard Schmidt hieß er, habe ganz unerwartet die gersdorfer wirkliche Lehrerstelle bekommen und nun gehe das Gerede, er wolle die Wagnersmargareth freien. Zwar sei er schon früher einmal von der Margareth und ihren Eltern abgewiesen worden – aber jetzt habe er eine gute Stelle, man könne darum nicht wissen, was geschehe. Begreiflich machte mir diese Nachricht viel Sorgen, aber die Reue über meine Zurückhaltung besserte nichts an der Sache. Als nun die Einladung vom Vetter kam, nahm ich das für einen Wink des Himmels, beschloß meinem Nebenbuhler womöglich zuvorzukommen und eben als Präzeptor mein Heil bei dem Mädchen zu versuchen.
Und so war ich jetzt wieder in der Heimat, bei den guten, kinderlosen Pathenleuten! Ei, wie wohl ward mir im trauten Stübchen, wo jedes Eckchen liebe Erinnerungen aus der goldenen Jugendzeit erweckte, jedes Geräthe, das die Base so festlich herausgeputzt hatte. Den blankgescheuerten 10 Fußboden deckte schneeweißer, knirschender Sand, an den Fenstern waren frische Vorhänge aufgesteckt, auf dem Tisch prangte die feine Wollendecke – der Stolz der Base! – und die Kissen des alten Kanapes blickten in ihren neuen, buntfarbigen Ueberzügen fast ein wenig hochmüthig drein. Dazu war es tief still, nur die alte schwarzwälder Uhr ging ihren gleichförmigen Gang, und unter dem Ofen schnurrte die Katze. Der Vetter saß im bequemen Schlafrock, das gestickte Hauskäppchen auf dem ehrwürdigen Haupt, im Sessel zur Seite des warmen Ofens; er lachte so herzlich über meine Schnurren, daß ihm fast die lange Pfeife erlosch, und die Base den Kopf zur Küchenthür hereinsteckte, zu fragen, was es gebe.
Aus der Küche drang ein köstlicher Duft in die Stube, der Tisch ward an den Ofen gerückt, in behaglichster Stimmung schlürften wir den Nachmittagskaffee. Nur die Base blickte besorgt hinaus in das Schneegestöber, und als der Wind immer wilder um das Haus heulte, sagte sie ängstlich: »Ach, du meine Güte, ist das ein Wetter! Keinen Hund jagt man vor die Thür – und morgen geht das Umsingen an! Gottlieb dießmal wirst Du Dir schon was holen, gib nur Acht! – Was gäb' ich darum, würde einmal das Umsingen abgeschafft!«
»Gertrud, Gertrud! Das laß mich nicht noch einmal hören!« drohte der Vetter, halb im Scherz, halb im Ernst. »Gott verhüte, daß es jemals abkäme, wenigstens will ich das nicht erleben. Mit dem Wetter ist es nicht so schlimm, als es aussieht; steckt man nur erst mitten drin, dann geht's schon. Wird es aber einmal gar zu bös, vertritt eben Karl meine Stelle!«
11»Nu, nu, Alterle, so arg schlimm war es nicht gemeint!« begütigte Gertrud. »Mir ist das Umsingen auch in's Herz gewachsen und ich würde es schwer genug vermissen!«
Damit war der Friede hergestellt. Eben trat der Mühljohann in die Stube; er hatte mich kommen sehen und konnte den Abend nicht erwarten, mich zu begrüßen. Die Base bot ihm ein Schälchen Kaffee, aber Johann »zierte« sich sehr und griff erst zu, als der Vetter sagte: »Genir' Dich nicht, Johann, Du sollst den Kaffee nicht umsonst haben, kannst nachher helfen, Noten schreiben.«
Als dann der Vetter seine Musikalien herbeibrachte, fand sich viel Arbeit. Da gab es Stimmen und Textzettel für die Feiertagsmusik zu schreiben, besonders in den Liederbüchern, die beim Umsingen gebraucht wurden, waren viele Lücken zu ergänzen. Der alte Herr ließ es sich gern gefallen, daß wir seinen Beistand ablehnten, mit der geliebten Pfeife machte er es sich im Lehnstuhl bequem und las in einem Buch.
Eine Zeitlang hörte man nichts als das Knirschen unserer Federn. Endlich stieß mich Johann an und sagte leise: »Gehst doch heut Abend auch in die Lichtstube? – 's gibt ein grausames Vergnügen!«
»Weiß nicht!« entgegnete ich gleichgültig.
»Du – die Wagnersmargareth kommt auch!« Als ich roth wurde lachte er: »Ja, meinst Du, ich merke nicht, wie's um Dich steht? – Drum hab' ich Dir's ja auch geschrieben, was der Schmidt vorhat. Warum bist Du nicht eher gekommen?«
»Ist es schon so weit?«
12»Ja, 's heißt, die Feiertage wolle er kommen und die Sache fest machen.«
Die Noten glichen plötzlich schwarzen Teufelchen, die voller Spott und Schadenfreude wild durcheinander tanzten. »Und Margareth?« fragte ich kleinlaut.
»Ja, die will ihn freilich nicht und der Wagnersjörgnickel war ihm auch nie grün – aber er ist doch nun einmal wirklicher Schulmeister und hat eine gute Stelle, das kann viel ändern.«
»Da fang' ich lieber gleich gar nicht an!« seufzte ich.
»Hätt's auch gedacht! Mach' nur jetzt keine dummen Geschichten! – Im Vertrauen: die Margareth gestand meiner Dorthee, sie hätte Dich lieber, wie jeden Andern. Wenn Du Dich freilich noch lange zurückhälst, und ihr nicht zeigst, wie Du gesonnen bist – dann kann's dennoch sein, daß sie zuletzt den Schmidt anhört. – Also: soll ich Dich abholen?«
Es war gut, daß unsere Arbeit zu Ende ging, denn auf dem Papier vor mir wimmelte es durcheinander wie in einem Ameisenhaufen. Die dumme Glut im Gesicht zu verbergen, begleitete ich Johann vor die Hausthür und ärgerte mich, daß er nochmals fragte, ob er mich abholen solle. »Ei freilich doch, braucht es da noch eine Frage?« rief ich und Johann ging lachend davon.
Nach dem Abendessen schmückten wir einen kleinen Christbaum; während die Lichter angezündet wurden, holte ich von meiner Kammer die Geschenke für die Pathenleute. Dem Vetter hatte ich eine seltene Kirchenmusik von Naumann, nach welcher er schon lange getrachtet, sauber abgeschrieben, die Base bekam ein Paar bunte Hausschuhe. War das eine 13 Freude! Mit leuchtenden Augen rief die Base: »Ich sage ja immer, der Karl ist ein treues Gemüth!« Nun kam aber das Staunen an mich. Unter den mir bestimmten Gaben stach mir zuerst in die Augen eine nagelneue, prächtige Tabakspfeife. Den fein bemalten Kopf zierte ein silbernes Beschläg und das Rohr war eine ächte Weichsel. Daneben – ich wußte kaum mehr, ob ich wache oder träume! – daneben lag wahrhaftig das Ziel meiner heimlichen Wünsche, ein herrlicher Mantel! Ich war sprachlos; dem Vetter fiel ich so stürmisch um den Hals, daß er brummte: »Nun, nun, erstick' mich nur nicht!«
Der Vetter setzte sich an das Klavier, nach kurzem Präludium leitete er in den Choral ein, und fröhlich sangen wir:
Vom Himmel hoch da komm' ich her, Ich bring' euch gute neue Mär. Der guten Mär bring' ich so viel, Davon ich sing'n und sagen will.
Euch ist ein Kindlein heut gebor'n Von einer Jungfrau auserkor'n. Ein Kindelein so zart und fein, Soll eure Freud und Wonne sein! — — — — — —
Das Nachspiel war verklungen; die Base hatte schon vorher zwei große Bündel für die Armen bereitet; als sie sich jetzt mit Annedorl, der alten, treuen Hausmagd, zum Ausgang rüstete, sagte der Vetter: »Grüße mir Deine kleinen Schützlinge und sage ihnen, wenn sie hübsch brav und fromm blieben, dann wollte ich nächstes Jahr wieder ein gutes Wort für sie beim heiligen Christ einlegen.« Darnach, als wir allein im Stübchen waren, meinte der Vetter: 14