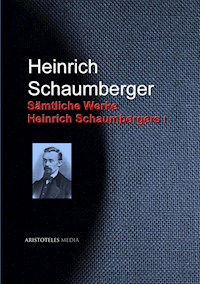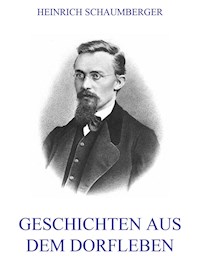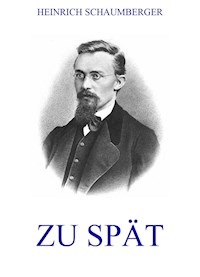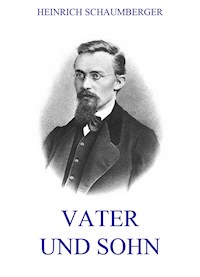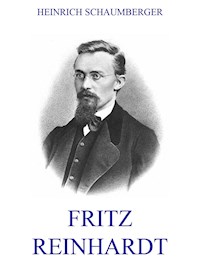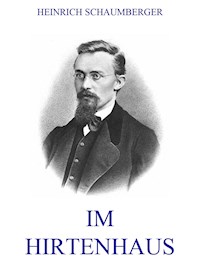
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman "Im Hirtenhaus" erzählt in beeindruckender Weise von den psychologischen Folgen der ländlichen Verarmung, die der Autor in seiner thüringischen Jugend selbst erleben musste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Hirtenhaus
Eine oberfränkische Dorfgeschichte
Heinrich Schaumberger
Inhalt:
Im Hirtenhaus.
Vorwort.
1. Ins Hirtenhaus.
2. Rückblicke.
3. Ein trüber Morgen.
4. Im Gemeinderath.
5. Das Hirtenhaus und seine Bewohner.
6. Hirtenhausleben und eine Dorfmajestät.
7. Ein Ein- und ein Auszug.
8. Neue Ordnung und erster Sturm.
9. Neuer Sturm und ein Kirchgang.
10. Ränke und ihre Folgen.
11. Ein Erwachen.
14. Eine Haussuchung.
13. Folgen.
14. Neue Störung, ein Gensdarm tritt auf.
15. Ein Dorfregiment; wie die Unruhen zum Ausbruch kamen.
16. Revolution.
17. Am Dorfteich.
18. Neue Zeit für Dorf und Hirtenhaus.
19. Der Eisenbahnschrecken.
20. Eisenbahnnoth und Eisenbahnsegen.
21. Neues Leben.
22. Neue Stürme und ein großer Entschluß.
23. In der Schlucht.
24. Finden und Scheiden.
25. Veränderungen.
26. Hoffen und Harren.
27. Aus dem Hirtenhaus.
28. Schluß.
Im Hirtenhaus, Heinrich Schaumberger
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849634698
www.jazzybee-verlag.de
Heinrich Schaumberger – Biografie und Bibliografie
Deutscher Volksschriftsteller, geb. 15. Dez. 1843 in Neustadt a. d. Heide (Sachsen-Coburg), gest. 16. März 1874 in Davos, wirkte als Volksschullehrer an mehreren Orten, seit 1869 in Weißenbrunn bei Schalkau (S.-Meiningen). Schaumbergers Gebiet ist die Dorfgeschichte auf dem lokalen Boden seiner engeren Heimat. Edle Gesinnung und sichere Darstellung der Charaktere bei schlichter volkstümlicher Sprache zeichnen seine Erzählungen aus, unter denen wir »Vater und Sohn« (4. Aufl. 1899), »Zu spät« (4. Aufl. 1895) und »Im Hirtenhaus« (7. Aufl. 1899) besonders hervorheben. In dem Roman »Fritz Reinhardt« (3. Aufl. 1881, 3 Bde.) hat S. seinen eignen Entwickelungsgang geschildert. Seine Werke erschienen seit 1875 mehrfach gesammelt, zuletzt als Volksausgabe in 2 Bänden (Wolfenb. 1905); »Sämtliche Werke«, herausgegeben von H. Möbius (Leipz. 1905, 8 Bde.). Vgl. Möbius, Heinrich S., sein Leben und seine Werke (Wolfenb. 1883); den Vortrag von E. Schreck (Bielef. 1896); H. C. H. Meyer, Heinrich S. und Rud. Köselitz. Dichter und Illustrator (Wolfenb. 1901).
Im Hirtenhaus.
Vorwort.
Im »Hirtenhaus« eines oberfränkischen Dorfes spielt die nachfolgende einfache Geschichte. Wer nun auch nicht weiß, daß in Oberfranken die Hirtenhäuser, seitdem durch Einführung der Stallfütterung der Hirte mit Hund, Horn, Peitsche und Mantel zu einer sagenhaften Erscheinung der Vorwelt geworden ist, die nur noch im Gedächtniß weniger Alten dunkel fortlebt, zum Armenhaus der Gemeinde umgewandelt worden, der kann im Voraus vermuthen, daß er von dem Erzähler nicht in vornehme, feine Gesellschaft eingeführt werden wird. Nicht einmal eine romantische Liebesgeschichte darf der Leser erwarten, denn seit das alte Hirtenhäuschen zum Armenhaus wurde, ist alle Poesie aus seinem Umkreis geschwunden. Die Noth, das Elend, Kummer und Sorge mit ihrem unheimlichen Gefolge haben da Wohnung genommen und herrschen unumschränkt in den freudlosen Räumen.
Wenn es nun trotzdem der Erzähler wagt, den Leser dort einzuführen, so dürfte es wohl nöthig sein, ein rechtfertigendes Wort vorauszuschicken.
Nur der Oberflächliche, Gedankenlose läßt sich am Duft, an der Farbenpracht der Blume allein genügen, sieht im Rosenstrauch eben nichts anderes als den Träger der Rose, die wiederum nur blüht, um eine kurze Weile seine Sinne zu erfreuen. Der Empfindende, sinnig Betrachtende wird dabei nicht stehen bleiben. Mit inniger Theilnahme geht er den verschiedenen, sich wechselsweise ergänzenden und bedingenden Daseinsstufen, den geheimnißvoll wirkenden, gestaltenden Kräften nach, deren lieblichste Erscheinungsform freilich die Rose, keineswegs jedoch deren höchster, letzter und einziger Zweck ist. Auch untergeordnete, unscheinbare Gestaltungen gewinnen für ihn Bedeutung, selbst Mißbildungen, Entstellungen der reinen Form werden ihm Gegenstand theilnehmender Betrachtung. Und je mehr er in den Verzerrungen dieselben Gesetze und Kräfte wirksam, dasselbe Streben nach höchster, vollkommenster Ausgestaltung, nur gehindert, vom graden Wege abgelenkt durch innere oder äußere Störungen, erkennt – desto mehr schwindet das anfängliche Mißbehagen, ja es verwandelt sich in die innigste Theilnahme, wenn sich ihm nun das Verständniß erschließt, wie der verwundete und erkrankte Organismus so machtvoll ringt und arbeitet, die Zerstörung zu überwinden, über alle Hemmnisse hinweg zur vollkommnen, reinen Form zurückzukehren. Nun erst vermag er sich mit reinster Lust der vollkommenen, vollendet schönen Bildung zu erfreuen.
Aehnlich verhält es sich mit der Betrachtung des Menschenlebens. Wer das Leben ganz fassen und verstehen will, darf sich nicht blos an seinen Lichtseiten, an vollendeten Bildungen erfreuen wollen, er muß auch das Herz haben, die Verkrüppelungen, Verzerrungen der ewig herrlichen Normalgestalt, das Laster und das Elend in seiner wahren Gestalt kennen zu lernen. Nur wer der Sünde, der Noth in das unverhüllte Antlitz blickt, theilnehmend in den entstellten Zügen nach dem ursprünglichen reinen Gottesgedanken forscht, liebevoll den Ursachen nachgeht, die zuerst die Entwickelung der Seele störten, vielleicht hemmten, die sie, da ja das Leben und die Weiterbildung nicht stillstehen kann, gewaltsam in Formen preßten, die der ursprünglichen Idee entgegengesetzt scheinen, nur wer sorgsam die inneren, geheimen Regungen solcher verkrüppelten Seelen belauscht, auf den geheimsten Pulsschlag solches entstellten, beraubten Lebens horcht und sich nicht in eigensüchtiger Selbstüberhebung den verwandten Tönen verschließt – nur der kann zu einer richtigen Schätzung des Werthes und der Würde des Menschen gelangen.
Darum wage ich getrost in den nachfolgenden Blättern den Schleier von einer Nachtseite unsres Volkslebens zu heben, ich wage den Leser an eine Stätte zu führen, wo die Sünde, das Laster und das Elend herrscht. Er wird Bekanntschaft mit gefallenen Menschen machen, sich ihre Gesellschaft gefallen lassen, ihre Art ertragen müssen. Für zarte Naturen, die nur durch einen verhüllenden Schleier die Welt zu betrachten wagen, für empfindsame Herzen, die verlangen, daß das Elend nur in Glacéhandschuhen in ihre Nähe komme, für fein besaitete Seelen, die vor einem kräftigen Wort, vor einer derben Natürlichkeit in Ohnmacht sinken – für solche ist das Büchlein nicht geschrieben, sie mögen es ungelesen aus der Hand legen. Wer aber ein Herz hat für die Armuth und ihre Leiden, wer auch noch in dem gesunkenen und gefallenen Menschen den Bruder liebt, wer aus der Dissonanz seines zerrissenen Innenlebens noch verwandte menschliche Töne hervorklingen hört, wer den geheimen Schmerz versteht über ein verlorenes Leben, den die wildesten Leidenschaften nicht gänzlich zu übertäuben vermögen, der so oft unerwartet, gewaltsam hervorbricht, wem vor allem das Ringen der Seele nach Freiheit, nach Licht, nach harmonischer Ausgestaltung auch im Verkommensten mit Theilnahme erfüllt – der wage getrost den kurzen Gang. Wohl ist der Erzähler der Wirklichkeit nicht ängstlich aus dem Wege gegangen, doch hofft er nirgends das Gefühl zu beleidigen, und auch an freundlichen Oasen in der Wüste des Elendes, wo er sich an murmelnder Quelle auf schwellendem duftigen Rasen, im Schatten rauschender Bäume freundlich ausruht, soll es nicht gänzlich fehlen.
Solche zerrüttete Dorfverhältnisse, wie die geschilderten, Schultheißen wie der Türkenhenner, Menschen wie der Kirchbauer mag es zum Glück selten geben, wer aber das Volksleben nur einigermaßen kennt, wird sich ähnlicher Gestalten gewiß erinnern, zugleich aber auch seufzend eingestehen, daß Männer wie der Bergbauer und der Schreinerslorenz bis heute auf dem Lande mit Laternen gesucht werden müssen. Aber kein Dorf im lieben deutschen Vaterland ist so klein und so gering – ein Armenhaus mit all seinem Jammer und Elend findet sich gewiß – und dürfte das Bild des Bergheimer Hirtenhauses vor seiner Instandsetzung auch heute noch leider, leider! nur auf allzu viele passen.
Darumward nachfolgende Erzählung geschrieben, und wenn sie nur in einer einzigen Gemeinde die Aufmerksamkeit auf das Armenwesen lenkte, würde sich der Erzähler reich belohnt sehen.
1. Ins Hirtenhaus.
Hirtenhaus! – Wie unschuldig, ja fast anheimelnd das Wörtchen klingt! Unwillkürlich denkt man dabei an ein malerisches, altes Häuschen, ein wenig verfallen und altersgrau zwar, aber doch nett, wohnlich, heimlich. Vor dem Häuschen umschließt eine lebendige Hecke von Hagebutten und Kreuzdorn ein sauberes Gärtchen; in der Gartenecke auf dem knorrigen, weißblühenden Hollunderbaum nistet die Grasmücke, unter dem weitvorspringenden Dach hat sich die Schwalbe angesiedelt und hält gute Nachbarschaft mit dem Rothschwänzchen, nur die Spatzen, die sich in den Löchern der baufälligen Giebelwand festgesetzt, stören dann und wann den Hausfrieden. Daneben streckt ein alter Nußbaum seine sparrigen Aeste hoch in die Luft und breitet sie über das Häuschen, als wollte er es beschützen vor Unbill des Wetters und Windes. Auf dem Bänkchen vor der Hausthür sonnt sich ein Alter, aus dessen runzelvollem Gesicht ein paar helle Augen klug und zutraulich in die Welt blicken; oft nickt er wohl auch dem Hund zu, der seinen Kopf auf des Herrn Knie legt, und streichelt ihm das 2 zottige Fell. Lugt dann noch ein blühendes Mädchengesicht verstohlen durch die halboffene Hausthür, dann ist das Bild ländlicher Stille, befriedeten Glückes vollendet.
Aber wie wenig entspricht dem die Wirklichkeit, wie verschwinden all die heiteren Bilder, sobald man weiß: Das Hirtenhaus ist das Armenhaus des Dorfes, der Sammelplatz alles Elendes, der Aufenthalt der Verkommenen, auch der Verworfenen. »Ins Hirtenhaus!« – begreifst Du nun die Bedeutung der kleinen Wörtchen? verstehst Du, was sie für den, dem sie gelten, besagen? – –
***
Der Kuckuck in der Schwarzwälderuhr rief eben die dritte Morgenstunde an.
Ein tiefer Seufzer in der dunkeln, kalten Kammer übertönte das Rasseln und Rauschen des Schlagwerks, und eine unterdrückte Männerstimme flüsterte: »Margelies! Margelies!« Eine Weile erfolgte keine Antwort, als aber der Name ängstlicher wiederholt ward, klagte eine Frau: »Laß mich, den Alp, der mich drückt, vertreibt kein Anruf. – – – Schon drei! – Großer Gott im Himmel, und heute noch in's Hirtenhaus!« Heftiges Weinen brach die Stimme.
In der andern Ecke ward es ebenfalls lebendig, ein Kinderstimmchen wisperte! »Marie, Mariele! – Hast den Kuckuck gehört?«
»Mehr wie Du!« war die wichtigthuende Entgegnung. »Schon um zehn, elf, zwölf, eins, zwei und jetzt wieder. 3 Siehst Du, ich hab ihn nun einen ganzen Tag vorausgehört. – Ach unser armer Kuckuck!«
»Warum geht er nicht mit?«
»Bist dumm! Weißt nicht? er wird ja verkauft?«
»Ach unser armer, armer Kuckuck!« jammerte das Kind. »Gelt, Mariele, das ist gar nicht wahr? gelt unser Kuckuck wird nicht verkauft?«
»So sei doch still!« suchte Marie zu beschwichtigen. »Ach Gott, wenn's mit dem Kuckuck allein abging! Sei still, heul' nicht, die Eltern haben so Kummer genug. Gieb Acht! – Wenn unser Kuckuck fortgetragen wird, passen wir auf, wo er hinkommt, nachher stellen wir uns vor's Haus, da hören wir ihn alle Tage.«
»Aachele – wir hören unsern Kuckuck alle Tag'!«
Die Mutter jammerte, der Vater schluchzte, und die erschrockenen Kinder stimmten laut in das Weinen ein. »Lorz, Lorz, so rede was!« klagte die Frau. »Du bist der Mann, hast Du keinen Trost?«
»Ja, ja, Margelies,« war die Antwort, gleich, gleich doch!«
Leise verließ der Vater das Bett, tastete sich zu den Kindern – auch ein drittes war erwacht – und redete ihnen freundlich zu: »Seid still, Kinderle, schlaft ruhig! Wird der alte Kuckuck verkauft, was thut's? Dafür schaff' ich euch einen neuen, viel, viel schönern!«
Die beiden Kleinen beruhigten sich, das Wasser stand ihnen noch in den Augen und schon patschten sie vor Freude in die Händchen, schliefen auch richtig bald ein. Nicht so Marie. Heftig schlang sie ihre Arme um den Hals des 4 Vaters und flüsterte ihm in's Ohr: »Wenn ich aus der Schule bin, dien' ich und verdiene viel, viel Geld. Und alles geb ich Euch – aber gelt, eines thut Ihr – Ihr kauft den alten, guten Kuckuck wieder? – Gelt, den alten?«
»Ja, ja, freilich!« flüsterte Lorenz, den diese Worte fast wieder außer Fassung gebracht hätten. »Du bist ein brav's Mädle! Aber schlaf! – Um acht geht die Schul' an, und Du weißt, jetzt mußt Du doppelt auf dem Zeug sein.«
Die Mutter saß noch aufrecht im Bett, hatte das Gesicht in die Hände gelegt und die Thränen tröpfelten ihr durch die Finger. Lorz versuchte vergeblich ihre Hände wegzuziehen, was er auch sagte, sie wollte sich nicht trösten lassen, blieb fest dabei: »Und wenn zehnmal unschuldig, darnach fragen die Leute nicht!«
»So brauchst Du Dich auch nichts um sie zu kümmern. Kommt keine Krankheit und Schwäche über mich, will ich sorgen, daß wir nicht lange im Hirtenhaus bleiben.«
»Drin waren wir doch,« rief Margelies und rang die Hände, »wenn auch nur einen Tag, eine Stunde; kein Mensch kann das wieder von uns weg bringen. Mir ist's nicht um mich, könnt' ich's allein auf mich nehmen, kein Wort käme über meine Lippen – mich jammern nur unsere Kinder! Auch die, und sie besonders sind verschimpft für's ganze Leben, werden verspottet, wo sie sich sehen lassen, verachtet, gemieden von Jedem. Dazu müssen sie sich hudeln und herumstoßen lassen, sollen ausfressen, was Andere einbrocken, da ist überhaupt nichts zu schlecht, nichts zu schändlich – ihnen wird's zugemuthet, sie sind ja aus dem 5 Hirtenhaus! Bis heut' war es meine Lust, die Kinder in Ehrbarkeit und Rechtschaffenheit großzuziehen, nun ist alle Mühe umsonst, im Hirtenhaus werden sie bald an Leib und Seel verderben. Ach und wenn die Kinder umschlügen! – eh' ich das erleb', eh' wollt ich, ich wär gestorben!«
Lorenz hatte seine Margelies gewähren lassen, was sollte er auch erwidern? Nur ihr letztes Wort war ihm zuviel. Er ließ ihre Hände los und sagte streng: »So, das ist deine ganze Weisheit? Meinst Du nun wirklich, damit sei etwas gebessert und besonders den Kindern geholfen? – Margelies, Du dauerst mich, daß Du im Jammer Alles vergißt und nur allein an Dich denkst. Von mir nicht zu reden, was soll aus den Kindern werden, ging dein Wort in Erfüllung?«
»So war das gar nicht gemeint!« weinte Margelies.
»Drum eben ist's doppelt Unrecht! Mir sind die Kinder so fest an's Herz gewachsen als Dir, ich weiß auch, was ihnen im Hirtenhaus droht – aber mit Klagen und jämmerlichen Reden ist da nichts geholfen. Nimm Dich zusammen Margelies, daß wir nicht gänzlich zu Schanden werden. Je mehr Schlechtes die Kinder im Hirtenhaus hören und sehen, desto eifriger müssen wir ihnen ein gutes Beispiel vor Augen führen, müssen die Kinder behüten wie Augäpfel. – Margelies, das ist ein Großes, aber wenn wir's zwingen, und mit Geduld und Standhaftigkeit müssen wir's zwingen, – auch im Hirtenhaus sollen die Kinder gedeihen – dann können wir einmal getrost die Augen zuthun. – Du glaubst mir nicht? – Ja den Kopf müssen wir freilich oben behalten, sonst geht das nicht. Merk Dir 6 doch: Ein unverschuldet Unglück ist kein rechtes Unglück, wenn wir's nicht dazu machen, und wer treu seine Schuldigkeit thut, kann nicht gänzlich zu Schanden werden!«
Margelies schluchzte, tastete aber doch nach ihres Mannes Hand und sagte: »Hab' Geduld mit mir Lorenz! Es war schlecht von mir, so zu reden – es soll nicht wieder geschehen. Ich will beten, Lorenz, daß mich der Herrgott gesund und bei Kräften erhält! – Es ist ja wahr, so lange wir frisch und gesund zusammen sind, dürfen wir nicht klagen!«
»So höre ich Dich gern – halt aber auch daran fest! Dein Herz wird Dir noch manchmal schwer, arg schwer werden – wein' Dich dann aus in der Nacht oder geh' abseits, am Tag zeig' ein fröhliches Gesicht, ich thu's auch, so sauer mir's ankommt. Merk's, damit verderben wir unsern Feinden die Freud', sie müssen erkennen, daß wir uns nicht niederwerfen lassen. Nimm Dich zusammen auch der Kinder willen! Das ewige Flennen macht sie verstört, die armen Würmer wissen nimmer, wem sie angehören.«
»Ich dank Dir, Lorenz! – Hilf mir nur zurecht, Du bist der Mann, und habe Geduld!«
»Ja, Geduld haben wir beide von Nöthen! Halte daran fest: Was zu ermachen ist, wird ermacht! Sollte es aber doch länger dauern, ehe wir aus dem Hirtenhaus herauskommen, laß keinen Verdruß zwischen uns aufkommen, sonst ist's gefehlt. Gieb mir die Hand; Bergheim soll erfahren: Hirtenhaus oder Bauernhof, Herrenschloß oder Bettlerhäusle macht in Wahrheit keinen Unterschied, auf die Leute kommt's an, die drin wohnen! – Jetzt sei still, die 7 Kinder regen sich wieder, wir selber brauchen Ruhe, es steht uns ein schwerer Tag bevor.«
Es war schon lange stille in der Kammer, als der Kuckuck vier Uhr ankündigte. Die jüngern Kinder verschliefen diesmal den Ruf, Marie saß jedoch aufrecht zwischen Bruder und Schwester und weinte. Kein Wort des Gesprächs war ihr entgangen, faßte sie auch nicht Alles, soviel hatte sie verstanden: Die Eltern sorgten und härmten sich auch ihretwillen. Im schmerzlichen Gefühl ihrer Hülflosigkeit und Schwachheit rang sie die kleinen Hände; da sie die Eltern nicht trösten konnte, gelobte sie mit heißen Thränen, Vater und Mutter zur Freude zu leben, das kindische Wesen abzuthun, der Mutter beizustehen. »Die Geschwister behalt' ich im Aug' und leide nicht, daß sie ausarten. Gras trag' ich bei für die Ziegen und im Winter spinn' und strick ich mit der Mutter um die Wette. Ach du lieber Gott, mach' mich recht geschickt und fleißig und brav, es ist ja wegen der Eltern!« Mit einem Gebet auf den Lippen schlief sie endlich ein.
Lorenz lag still und athmete ruhig, aber seine Augen standen weit offen, und unter der Decke rang er die Hände. Der langsame Pendelschlag der Uhr war ihm unerträglich, jedes Tick-Tack traf ihn wie ein Schlag auf den Kopf. Er war daran aufzustehen, die Uhr zu stellen – aber was hätte er Margelies antworten sollen? Mit Mühe hatte er ihr den Sturm in seiner Brust verborgen, um sie aufzurichten, sich stärker gestellt, als er war; jetzt kam die Angst doppelt über ihn. Er marterte sich ab, einen Ausweg zu finden, seine Gedanken verwirrten sich bei der Frage: mußte es so kommen? 8
2. Rückblicke.
An der Wiege war es ihm nicht gesungen worden, daß er einstmals der Barmherzigkeit der Bergheimer anheimfallen würde. In dem schmucken Häuschen links an der Lindengasse, an dessen Wand der Weinstock sich emporzog und mit seinen Ranken einen dichtgefüllten Bienenstand umschlang, vor dessen Fenstern die Zweige fruchtbarer Obstbäume im Winde schwankten und rauschten, erblickte er das Licht der Welt. Der Vater war ein wohlbehaltener Mann; nicht nur Haus und Garten, auch manchen wohlgelegenen Acker, manches fruchtbare Wiesengrundstück besaß er schuldenfrei, dazu verstand er sein Handwerk aus dem Fundament und war weitum berühmt als geschickter Schneider. Sonst wußten die Nachbarn wenig Löbliches von ihm zu berichten, ernste Männer schüttelten bedenklich die Köpfe, so oft sie am Schneiderhaus vorübergingen. Ueber der Hausthür streckte ein gemalter Ziegenbock die Hörner vor, daneben stand geschrieben:
Hier wohnt der SchneiderFriedericus Heider, Der sich nicht mit Kummer plagt, Die Sorgen all zum Teufel jagt! Seht an das edle Schneidersthier, Das guckt aus meiner Thür herfür, Das spricht wie ich: meck, meck, Ihr Sorgen geht mir weg! – Und kommt sie mir doch in's Haus, Reit' ich auf'm Bock zum Dach hinaus!
Wie zur Erklärung der letzten Zeilen knarrte auf dem First eine große Wetterfahne: ein springender Ziegenbock, 9 der einen Schneider mit riesiger Scheere trug. Spruch und Fahne kennzeichnen den »Gaisenschneider«, wie er allgemein genannt ward. Eine lustige Seele, immer zu Scherz und Possen aufgelegt, dabei ein offener Kopf, der sich nicht leicht hinter das Licht führen ließ, hätte er es gewiß zu was Rechtem bringen können; aber sein unruhiger Geist, der Mangel an »Sitzfleisch«, wie die Bauern sagten, waren sein Unglück. Es war freilich viel schöner, in der grünen Welt herumfahren, als in der dumpfigen Stube schwitzen; unterhaltender, im Wirthshaus lustigen Seelen Schnurren vormachen und Bären aufbinden, als sich daheim mit den langweiligen Kirchenröcken und Lederhosen plagen – aber dabei ging sein Handwerk zu Grund. Die Bauern murrten und zankten, wenn ihre Kleiderstoffe drei und mehr Wochen unberührt im Schneidershaus liegen blieben; als das nichts half, gingen sie zu andern Meistern. Der Gaisenschneider ließ sich das allerdings nicht anfechten. »Die Bauern meinen,« zankte er im Wirthshaus, »wir Handswerksleute müßten ihre Lastesel und Pudelhunde sein – pros't die Mahlzeit! Bei Anderen mag's gelten, auf den Gaisenschneider paßt das nicht! Ich pfeif' auf die Schneiderei, mit dem verdammten Sticheln und Fädeln verdient man das Salz in der Suppe nicht. Was brauch ich mich für Andere zu plagen? meine Feldgüter nähren allein ihren Mann!«
Uebertrieben war das wohl nicht, aber es war doch ein Fehler in seiner Rechnung, der ihm den Hals brach. Je weniger er arbeitete, desto länger saß er im Wirthshaus; je geringer sein Verdienst, um so größer waren seine Ausgaben. Bald kam ihm vor, der Ziegenbock sehe nicht mehr 10 so lustig drein; als gar die Kinder hinter ihm: »Gaisenreuter!« riefen, fuhr es ihm wie ein Stich ins Herz – das kam davon, er hatte Schulden machen müssen.
Um wieder Oberwasser zu bekommen, verfiel unser Friedericus auf Mancherlei. Zuerst richtete er mit seinen Kühen ein Botenfuhrwerk ein, das ihm nichts trug als Kosten und ein paar ruinirte Kühe. Darnach, als die Hauptstraße durch den Werthagrund gebaut ward, kaufte er einen lebensmüden Gaul, der sollte durch Steine und Erdenfuhren die verlorenen Kühe wie das verlorene Geld ersetzen helfen. Vielleicht wäre es gegangen, aber noch vor dem rechten Beginn der Arbeit stürzte der Gaul und stand nicht wieder auf. Die Bergheimer spotteten: »Der Gaisenschneider hat sich vom Bock auf den Gaul gesetzt, um ja recht bald gänzlich auf den Hund zu kommen!« Zuletzt errichtete er, wie alle heruntergekommenen Hauswirthe gern thun, einen Schnapsschank, damit schnürte er sich vollends die Kehle zu. Höhnend sagten die Nachbarn: »Darfst den Spruch vor der Thür auskratzen, denn gingst Du darnach, hättest Du lang zum Dach hinausreiten müssen!« Den Gefallen that ihnen jedoch der Alte nicht, legte sich vielmehr hin und starb. Am andern Tag war Spruch und Fahne verschwunden, auch der Schnapsschank geschlossen.
Sein Tod kam zu rechter Zeit, er bewahrte die Schneidersfamilie vor gänzlicher Verarmung. Freilich mußten die besten Grundstücke verkauft werden, und der Kirchbauer hatte noch ein bedeutendes Kapital auf dem Uebrigbleibenden stehen – aber die Schneiderin hoffte trotzdem vorwärts zu kommen. Im Anfang schien es auch wirklich, als sollten 11 für die schwergeprüfte Familie bessere Zeiten kommen, aber nicht lange und neue Wetterwolken zogen sich zusammen. Eben als der jüngste Sohn, unser Lorenz, zu einem Schottendorfer Schreiner in die Lehre kam – mit Mühe und Noth hatte die Schneiderin das Lehrgeld zusammengebracht – erkrankte ihre einzige Tochter. Die Schneidersmargareth, ein wundersam schönes Mädchen, hatte sich heimlich mit dem Pfarrfritz in einen Liebeshandel eingelassen. Schon sein Abgang zur Universität griff das zarte Mädchen hart an; als er darauf wegen »demagogischer Umtriebe,« wie das Urtheil lautete zu fünf Jahren Festung verurtheilt ward, brach sie zusammen. Die Krankheit war schwer und langwierig; kaum erholte sich Margareth, so begann die Schneiderin an den Augen zu leiden und die Aerzte befürchteten Erblindung. Um dem Drängen des Kirchbauern, der grade jetzt in dieser ärgsten Noth mit Kündigung seines Kapitals drohte, ein Ziel zu setzen, rief die Wittwe ihren ältesten Sohn Johann, der in der Hauptstadt bei einem Schneider in Arbeit stand, heim; er sollte Haus und Güter übernehmen, heirathen und die Mutter verpflegen. Johann war das wohl zufrieden; sein Schatz, das Unterweißbacher Ritzenbärble, nicht minder. Bald ward eine fröhliche Freierei gefeiert; Johann besonders war voller Zuversicht und berechnete, da die Mitgabe seiner Braut die Schuld des Kirchbauern fast deckte, in wie viel Jahren spätestens er die elterlichen Grundstücke wieder beisammen haben wolle.
Ganz Bergheim nahm aufrichtig Antheil am Glück der Schneidersleute, nur einer ging grimmig herum, der Kirchbauer. Zwischen ihm und dem Gaisenschneider bestand 12 eine alte Feindschaft, deren Grund Niemand kannte; als es mit dem Schneider abwärts ging, söhnte sich zu allgemeiner Ueberraschung der Kirchbauer mit seinem Gegner aus, ja er ward dessen vertrautester Freund. Die Bergheimer wunderten sich, der alte Herrenbauer aber sagte: »Nun ist's vollends um den Gaisenschneider geschehen; gebt Acht, sein neuer Spezial saugt ihm das Mark aus den Knochen!« Wie Recht er hatte, zeigte sich nach dem Tod des Schneiders. Mit dem damaligen Gewinn jedoch noch nicht zufrieden, war des Kirchbauern ganzes Dichten und Trachten darauf gerichtet, auch den letzten Rest der Schreinersgüter billig an sich zu bringen. Diesmal vielleicht weniger aus Haß und Habsucht, sondern weil er Geld brauchte, viel Geld! Noch galt er als dicker Bauer – und doch war er arm, ärmer vielleicht als sein Taglöhner. Bis jetzt hatte er die hohen Summen, die er im Färbeln verspielt, öffentlichen, ihm anvertrauten Kassen entnommen; wurden ihm die Kassen abgefordert, war er verloren. Darum sein Schrecken, als ihm die Freierei des Schneidersjohann die letzte Aussicht auf Rettung zu zerstören drohte. Aber noch gab er sein Spiel nicht auf, und die Schreinersleute sollten bald spüren, daß ein mächtiger Gegner an ihrem Untergang arbeitete.
Als Johann für seine Braut Aufnahme in Bergheim verlangte, lachte der Schulz höhnisch und sagte: »Oha, Johann, so geschwind geht das einmal nicht. Der Ausschuß hat über die Sach' Sitzung gehalten und ist einig worden: das Ritzenbärble kriegt ein für allemal keine Aufnahme. 13 Wir haben arme Leut genug im Dorf, die der Gemeinde zur Last fallen, wir wollen uns nicht auch noch fremde Brut in den Pelz setzen, denn das ist allemal die schlimmste. Muß es durchaus geheirathet sein, halte Dich an Deinesgleichen im Dorf, da wird Dir nichts in den Weg gelegt, eine Fremde kommt aber einmal für allemal nicht in's Dorf!«
Johann war ganz erstarrt, bat, begehrte auf, umsonst, der Türkenhenner lachte ihn nur aus; auch eine Klage half nicht, der Schulz und Gemeindeausschuß blieben im Recht. Freilich, hätte er auch die Aufnahme erzwungen, es war doch zu spät. Der Ritzenmathes war über den Schimpf, den ihm die Bergheimer Gemeinde angethan, so erbittert, daß er den Verspruch mit dem Schneidersjohann rückgängig machte und seine Tochter bald darauf nach Lengsfeld verheirathete.
Soweit im Vortheil säumte der Kirchbauer auch nicht, sein Werk zu vollenden. Schlag auf Schlag folgte Kündigung, gerichtliche Klage und Abpfändung; ehe die Schneidersleute nur recht zur Besinnung kamen, hatten sie die letzten Grundstücke, Haus und Hof verloren. Der Kirchbauer lachte in's Fäustchen, der Profit von den abgepfändeten Grundstücken reichte beinahe hin, die Löcher in den Kassen zu füllen, jetzt war er wieder ein großer Bauer, mochten ihn die Leute auch einen Seelenverkäufer und Blutsauger nennen, deswegen ließ er sich kein graues Haar wachsen. Beweisen konnten sie ja doch nichts, und sonst sollten sie ihm nur kommen.
Um diese Zeit ward der Pfarrfritz begnadigt, kehrte nach Bergheim zurück, verlobte sich mit der Schneidersmargareth und rüstete zur Reise nach Amerika. Johann 14 schloß sich seinem Schwager eng an; beide waren erbittert über die heimischen Zustände, beiden waren die liebsten Hoffnungen durch Bosheit und Niedertracht zertrümmert worden – Zorn und Haß auf das Vaterland war der Kitt ihrer Freundschaft. Der Jammer der alten, halbblinden Mutter rührte ihn nicht, trotzig rüstete auch er zur Abreise nach Amerika.
Zuletzt nach den Feldgütern ließ der Kirchbauer auch das Schneidershaus öffentlich versteigern; als es eine liederliche, blutarme Familie aus Uhlstedt um unbegreiflich hohen Preis erstanden, schlug Johann mit der Faust auf den Tisch und schrie: »O ihr verdammten Hallunken und Spitzbuben! Die eigene Brut tretet ihr mit Füßen und stoßt sie in's Elend, damit der fremden Brut Platz wird. Gottes Fluch über euch, Schulz und Kirchbauer! Ihr aber, ihr einundzwanzig Herren,In Bergheim besaßen das Gemeindevermögen einundzwanzig Berechtigte; die übrigen Bergheimer wurden Hintersitzer genannt. ihr Krautspöpel und Nickmännle, die ihr die ärgsten Schelme und Heimtücker über euch setzet, euch gönn ich's, daß ihr ausfressen müsset, was sie einbrocken. Denket an mich, der Kirchbauer hat euch mit den Uhlstedtern ein Ungeziefer in den Pelz gesetzt, das euch garstig beißen wird!«
Begehrten da der Schulz und Kirchbauer auf! – Aber nicht lange, denn diesmal hatte der Schneidersjohann nur das Eis gebrochen, den Widersachern des Schulzen und Kirchbauern unter den einundzwanzig Gemeindeberechtigten die Zunge gelöst. Die zwei Gewaltigen mußten 15 bittere Pillen verschlucken, besonders der junge Bergbauer führte so stachlige Reden, daß der Schulz ganz außer sich heimkehrte und sein ganzes Haus in Aufruhr brachte.
Aber geholfen war den Schreinersleuten damit nicht. Um die Mutter zu pflegen, mußte Lorenz, der seit einem Jahr auf der Wanderschaft war, heimkehren, Meister werden und ein eigenes Geschäft beginnen. Lorenz hätte freilich gerne erst die Welt gesehen, ehe er den eigenen Hausstand gründete und sich für immer an einen Ort fesselte; allein er war ein guter Bruder und Sohn, ohne Murren fügte er sich in die Wendung seines Geschickes. Seine Ersparnisse reichten hin, Handwerkszeug und einen kleinen Vorrath an Brettern anzuschaffen, mit fröhlichem Herzen führte er bald darauf seine Mutter und ein nettes sauberes Weib in das Hinterstübchen beim Ottensmärt – diesmal hatten die Einundzwanzig der Fremden, obgleich sie ganz arm war, die Aufnahme nicht verweigert.
Aber der Kirchbauer ruhte noch nicht; unter allerlei Ausflüchten wußte er die Auszahlung des Wenigen, was den Schneiderskindern von ihrem Erbe geblieben war, zu verzögern, und da der Pfarrfritz und Johann das Geld nicht entbehren konnten, schlug sich Lorenz in's Mittel. Unter der Bedingung, daß der Kirchbauer Bruder und Schwager sofort bezahle, willigte er ein, sein Erbe auf dem Schneiderhaus stehen zu lassen, ja, er begnügte sich zur Sicherstellung desselben sogar mit einer zweiten Hypothek. Der Kirchbauer lachte in's Fäustchen, sah er doch die Zeit nicht allzufern, da ihm das Schneiderhaus abermals zu einer Goldgrube werden mußte.
16Lorenz hatte einen schweren Anfang; er war nicht der einzige Schreiner im Ort, und sein Handwerksgenosse, der Schreinersfrieder war reich und ein tüchtiger Geschäftsmann – zwei Vortheile, gegen die schwer aufkommen ist. Doch schlug sich Lorenz durch; er würde sich auch emporgearbeitet haben, hätte sich nicht das Unglück an seine Fersen geheftet. Nach einigen Jahren erblindete die Mutter, dazu lähmte ein Schlaganfall ihre linke Seite und beraubte sie der Sprache – die Unglückliche mußte verpflegt werden, wie ein hülfloses Kind. Den Geschwistern in Amerika glückte es ebenfalls nicht; zwar kam dann und wann ein Brief mit Versprechungen, allein die Hülfe blieb aus. Als endlich der Tod die Aermste erlöste, athmete Lorenz auf; aber nun folgten schwere Geburten, Kinderkrankheiten, zuletzt warf ein hitziges Fieber Lorenz selber nieder. Als er wieder zu Kräften kam, mußte er seinem Hausherrn, dem Ottensmärt, der ihm zweihundert Gulden geliehen hatte, sein gesammtes Hausgeräth und Handwerkszeug verpfänden. Lorenz unterschrieb unbedenklich das gefährliche Papier, auf seinem Vaterhaus hatte er ja noch zweihundertundfünfzig Gulden stehen, damit konnte er den Ottensmärt befriedigen. Als er jedoch den Uhlstedtern sein Kapital kündigte, lachten sie ihm in's Gesicht: »Der Kirchbauer hat seine erste Hypothek eingeklagt, in vier Wochen wird das Häusle verstrichen, sieh selber zu, wie Du zu Deinem Geld kommst!« Und richtig, beim Verstrich reichte der Erlös grade hin, die erste Hypothek zu löschen und die Gerichtskosten zu bezahlen – Lorenz hatte sein Erbtheil sammt vieljährigen Zinsen verloren. Erst später kam an's Licht, daß der Kirchbauer selber das Schneidershaus um 17 einen Spottpreis erstanden und mit großem Gewinn an den Untermerzbacher Uhrmacherle verhandelt hatte. Darüber kam es im Wirthshaus zu großem Lärm, aber der Kirchbauer lachte die Bergheimer aus; an den Schreinerslorenz, der doch am schlimmsten gefahren war, dachte Niemand. Der saß daheim, wußte vor Angst und Verzweiflung nicht wo ein noch aus; soeben hatte ihm der Ottensmärt – wie er selber gestand, auf den Rath seines Schwagers, des Kirchbauern – die zweihundert Gulden gekündigt und gedroht: »Kannst Du in einem Vierteljahr das Geld nicht schaffen, greif ich nach Deinen Sachen!« Vergeblich waren alle Bitten und Vorstellungen, der Ottensmärt blieb auf seinem Sinn; vergebens war auch alle Mühe, das Geld an einem andern Ort aufzutreiben, nirgends fand Lorenz Hülfe. So ging das Vierteljahr herum – heute sollte ihm all sein Hab und Gut abgepfändet werden, mit Weib und Kind sollte er als Bettler in's Hirtenhaus wandern!
3. Ein trüber Morgen.
Das war es, soweit es ihm bekannt sein konnte, was jetzt leise an Lorenzens Geist vorüberzog. Böse, gefährliche Erinnerungen weckten zum Kummer auch noch Haß und Zorn! War es nicht allein der Leichtsinn, die Bosheit seiner Nebenmenschen was ihn so tief in's Elend stürzte? Der Spruch über der Thür des Vaterhauses war ihm noch nie so verächtlich vorgekommen als heute. Freilich plagte sich der Vater nicht mit Kummer, aber statt die Sorgen zum Teufel hatte er 18 seine Kinder in's Elend gejagt. Und nun gar die Falschheit und Niedertracht des Kirchbauern! Unwillkürlich ballten sich seine Fäuste; fast blutig biß er sich die Lippen, den Fluch, der sich gegen den Kirchbauer, den Ottensmärt, die Einundzwanzig, gegen alle Reichen auf seine Zunge drängte nicht laut hinauszuschreien. Aber wozu auch? – Er wäre ja doch ungehört verhallt, machtlos zerflattert. Was focht ein Fluch die Reichen, Glücklichen an? – Die schliefen ruhig, sicher; erfreuten sich vielleicht im Traum des sichern Glückes im Kasten – was kümmerte sie der verzweifelnde Arme? – Und warum war er so arm und so unglücklich? – Hätte sich sein Geschick nicht anders fügen können? – Wie Messerstiche bohrten sich diese Gedanken in sein Hirn; heftig fuhr er zusammen, als ihm eine Hand sanft über die Stirn strich, und eine Stimme neben ihm flüsterte: »Ich habe groß Unrecht gethan, so schlecht zu reden. Muß Dir das sagen, eh' werd' ich nicht ruhig. Du könntest ja meinen, ich wollte Dir einen Vorwurf machen, daß es so weit mit uns kommen ist. Denk das ja nicht, Lorz, ich bitt' Dich! Ach, ich weiß ja gut genug, Du brauchtest nur die Hand auszustrecken, und an jedem Finger hattest Du ein reiches Mädle. Und jetzt wärest Du geborgen, könntest am Ende den Schreinersfrieder selber auslachen. Aber, Lorenz, ich kann ja auch nicht für meine Armuth; Du hast vorher gewußt, wie's um mich steht, laß mich's jetzt nicht entgelten. – Ich will nimmer murren, will arbeiten, was ich vermag, über die Kinder wachen Tag und Nacht – mehr kann ich nicht, Lorz; wirst Du damit zufrieden sein?«
Lorenz erbebte, hatte die Frau seine verborgensten 19 Gedanken errathen? Er wollte sie unterbrechen, sein Unrecht eingestehen; doch hielt ihn der Gedanke zurück: Alles müsse auseinanderfallen, wenn er jetzt seine Schwachheit zeige. Nach Athem ringend begann er: »Hör' auf, Margelies, laß mich das nimmer hören, ich sag's ernstlich. Wir gehören zusammen und müssen erleiden, was über uns kommt, das ist die Ordnung. Du bist eine brave Frau und mir lieb und werth, damit ist's abgethan, jetzt und immer. Gieb mir Deine Hand, was wir uns gelobt, wir halten es!«
Margelies drückte ihm die Hand und stand geräuschlos auf, es war schon sechs Uhr geworden. Lorenz blieb noch liegen und schloß in stillem Sinnen die Augen, wunderlich wogte es in ihm auf und ab. Er war seiner Margelies im Herzen dankbar, daß sie seinen bösen Gedanken so rasch Stillstand geboten; wohin hätte es ihn führen müssen, wenn sie erst Raum in seiner Seele gewannen? Daneben quälte ihn doch auch die Sorge, ob nicht am Ende eine Absichtlichkeit in ihren Worten gelegen, ob sie ihn durchschaut und besser kannte, als er sich selbst, ob sie ihn nun nicht verachten müsse? Zuletzt aber schüttelte er alle Bedenklichkeiten ab, er hatte eine brave Frau und er wollte ein rechtschaffener Ehemann bleiben – was bedurfte es weiter?
»So, Kind, nun geh' in die Schule und laß Dich's nicht anfechten, wenn Dich Deine Kameraden hänseln,« sagte die Mutter, nachdem das Frühstück still verzehrt war. »Flenn nicht, Du wirst nur mehr ausgelacht. Gieb Dich zufrieden, Du hast ja noch Deine Eltern und der Herrgott 20 lebt auch noch. Geh' jetzt und sei lustig, Du siehst, ich und der Vater sind auch zufrieden.« Damit trocknete sie Marie die Thränen ab und schob sie aus der Thür.
Lorenz legte den Löffel nieder und starrte hinaus in das wilde Schneegestöber. Der alte Jammer quoll in ihm auf; warum konnte er das Leid nicht allein tragen, warum mußten auch die unschuldigen Kinder darunter leiden? Er nahm einen Hobel, legte ihn aber gleich wieder nieder, nicht einmal der Trost der Arbeit war ihm geblieben. Als seine Blicke über das blanke Handwerkszeug glitten, zerdrückte er heimlich den Tropfen, der ihm im Auge zusammenlief. Die Griffe waren glatt und glänzend, wie polirt vom Gebrauch, da und dort hatte seine Hand dem harten Holz Spuren eingedrückt. Wer wird in Zukunft mit den Geräthen schaffen, werden sie wieder in treue, ehrliche Hände kommen? –
Der Wind wirbelte den Schnee von den Dächern und verfing sich heulend im engen Hofraum; die Spatzen verkrochen sich unter den Dächern, kläglich piepend; die Hühner standen mit gesträubten Federn auf dem Miste vor dem Fenster, gaben jedoch bald das Scharren auf und setzten sich in langer Reihe auf die Wagenleitern im Holzschuppen. Drüben in der Scheune lehnten sich die Drescher auf die Flegel und schauten durch das halboffene Thor vergnüglich in das Gestöber. Erröthend trat Lorenz vom Fenster zurück, er schämte sich von fleißigen Menschen müssig gesehen zu werden. Herb empfand er seine Heimathlosigkeit. Den Spatzen gönnt man die Löcher, die Hühner finden einen Unterschlupf, – ihn trieb man auf die Gasse, oder, was noch schlimmer war, in's Hirtenhaus! Er beneidete die 21 Drescher! Sie hatten Arbeit, Nahrung; was sollte aus ihm und den Seinen werden? Er empfand seine Hülflosigkeit wie körperliche Mattigkeit, setzte sich auf den Hackeklotz und stützte den Kopf in die Hände. – Und dennoch war ja die Noth nicht einmal das Schlimmste! Bis heute durfte er stolz auf seinen ehrlichen Namen sein, morgen war auch das vorbei. Seine Habseligkeiten reichten nicht zur Hälfte hin, die Forderung des Ottensmärt zu decken, und konnte er jemals daran denken, seinen Verpflichtungen nachzukommen, wenn ihm Handwerkszeug und Alles genommen ward? »Mein guter, ehrlicher Name!« seufzte er. »Mit mir ist's aus für alle Zeiten! – Bankrotter Schuldner und Hirtenhäusler! – – O mein Gott!«
Margelies hatte die letzten Worte gehört; schoß ihr gleich das Wasser in die Augen, bezwang sie sich doch, legte ihre Hand auf seine Schulter und sagte leise: »Was Gott thut, das ist wohlgethan, dabei will ich verbleiben; es mag mich auf die rauhe Bahn Noth, Tod und Elend treiben: so wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten, drum laß ich ihn nur walten! – Hast Du das vergessen?«
»Zu verwundern wär's kaum; aber sei still, ich werde nimmer seufzen!«
Er wartete, bis die Drescher drüben einen neuen Umgang begannen, dann drückte er sich scheu an der Wand hin in das Vorderhaus. Der Ottensmärt saß mit rothem Gesicht am Tisch; als Lorenz eintrat, verschluckte er eine heftige Rede. Dafür fuhr die Bäuerin zwischen Stube und Küche hin und her; ohne dem Hausmann einen Sitz zu bieten, brach sie los: »Das hat man von seiner 22 Gutherzigkeit! Jetzt kommen wir ums Geld und in Verruf obenein! Daß wir Dir aus der Noth geholfen und so lange Geduld gehabt, davon redet kein Mensch, Alles schreit nur über unsere Garstigkeit. Ich hab' es meinem Märt gleich gesagt, er sollte sich mit Dir nicht zu tief einlassen, der erste Verdruß sei alleweil besser als der letzte, aber der läßt sich ja nichts einreden. – Und jetzt komme nur nicht und bettele, 's ist jedes Wort vergebens, wir können einmal nicht anders und müssen auf unsere Kinder sehen. Ehe wir alles einbüßen, nehmen wir was zu haben ist. Du thust mir auch leid, und Deine Kinder erbarmen mich gar sehr, aber heut zutag darf man eben nicht blind und so in den Tag hineinfreien, man muß auch an die Zukunft denken!«
Lorenz stand still an der Thür und zerknitterte seine Mütze; als endlich die Bäuerin schwieg und der Bauer verlegen mit dem Fuß scharrte, begann er kleinlaut: »Es ist nur leid, daß ich so ungelegen ankomme. Betteln wollt ich nicht, nur anfragen, ob mir der Bauer nicht gegen eine Entschädigung wenigstens das allernöthigste Handwerkszeug auf einige Wochen überlassen wollte?«