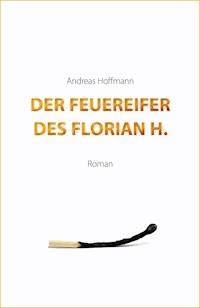2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Plötzlich stand es vor mir auf dem Schreibtisch, das alte fleckige Tintenfass. Es verlangte, nicht mehr vergessen zu sein, schaute mich stolz an und verhandelte: "Werfe mich nicht weg, du wirst es nicht bereuen." Ich erfüllte seinen Wunsch, schaffte mir die passende Schreibfeder an und ließ meinen Gedanken freien Lauf. Aus der Feder flossen Geschichten, Alte, Neue, Traurige, Fröhliche, inspiriert durch meine Heimatstadt Rudolstadt. Es mischten sich Erinnerungen in die Tinte, an Orte der Vorfahren in Böhmen und dem Rest der Welt. Manchmal benötigte ich eine Pause zum Nachdenken. Dann redeten wir miteinander: "Gedulde dich, das Schreiben geht bald weiter." Ja, das Tintenfass hörte auf mich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Geschichten aus dem Tintenfass
Erzählungen für brave Leser von Andreas Hoffmann
Geschichten aus dem Tintenfass
© 2021 Andreas Hoffmann
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage
Covergrafik: Nina Otto
www.autor-andreas-hoffmann.de
Verlag & Druck: tredition GmbH,
Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-347-38914-4
Hardcover
978-3-347-38915-1
e-Book
978-3-347-38916-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Prolog
Der große Nikolas
Kopflos
Die gute Stimme
Rückkehr einer Operette
Zuckerkuchen
Der Lindwurm
Brausepulver
Gespensterbahn
Das tödliche Maß – ein Rudolstadt-Krimi
Das Erbe
Schillers heimliche Geliebte
Das verhängnisvolle Spiel
Das Gartenwunder
Das Tagebuch
Prolog
Plötzlich stand es vor mir auf dem Schreibtisch. Das alte, fleckige Tintenglas, verlangte nicht mehr vergessen zu sein, schaute mich stolz an, verhandelte:
„Werf mich nicht weg, du wirst es nicht bereuen.“ Ich erfüllte seinen Wunsch, und ab dem Zeitpunkt wurde alles anders.
Es spielte wundersame Trümpfe aus, schenkte mir Geschichten, Alte, Neue, Einheimische, Fremde, Traurige, Fröhliche, Tiefsinnige und Belanglose.
Mit jeder Erzählung begann ein verschwundenes Land zurückzukehren, breitete sich im Kopf aus, floss durch die Feder direkt auf das Papier. Die Geschichten wechselten einander ab, wie es Jahreszeiten gefällt, nur meine Prognose war im Voraus nicht möglich. Unerwartet fegte ein Sturm mitten hinein in die Gedanken, dann verschwanden alle Wolken und Sonne brachte das Gras zum Schwitzen.
Es war genug, eine Pause wurde nötig.
Das Tintenglas blieb auf seinem Platz und manchmal fühlte ich mich beobachtet. Dann redeten wir miteinander:
„Gedulde dich, das Schreiben geht bald weiter.“ Ja, es hörte auf mich.
Der große Nikolas
Professor Gummeltwist öffnete das Fenster, streckte sich davor ausgiebig, beobachtete im Nachbargarten einen Grünspecht, kehrte zurück ins frisch gelüftete Zimmer, griff erneut nach dem Füllhalter.
Seine Gedanken kamen trotzdem nicht so recht in Bewegung. Und dass, bei dem Kapitel über Rudolf Ditzen, der sich später Hans Fallada nannte und dessen Zeit als Gymnasiast in Rudolstadt. Eigentlich schreibt er über die Suizidalität in der Literatur vor 1914, benötigte passende Biografien.
Nervös drehte er an seinem Ehering.
Drehen am Ehering hatte sich in fünfundvierzig Ehejahren als Gedankenfluss fördernde Methode bewährt.
„Es muss werden! Es muss!“
Er hustete und wischte sich in den Augen, seufzte, fuhr mit der rechten Hand über das leere Papier, schaute nach dem Tintenfass auf seinem Schreibtisch, als würde aus dem bauchigen Glas dunkelblau Hilfe emporsteigen.
Professor Gummeltwist hatte Prinzipien.
„Das lasse ich mir nicht nehmen, ich schreibe mit Füller.“ Er hustete und drehte ein zweites Mal am Ring.
„Es ist zu spät, mein Kopf benötigt Ruhe, mehr Bewegung, mehr frische Luft.“ Professor Gummeltwist schüttelte seinen Kopf, dachte an einen Spaziergang, hustete ein weiteres Mal, schob mit der linken Hand das leere Blatt Papier zur Seite und beschloss, für heute die Arbeit am Buch zu beenden.
Am nächsten Tag, gerade als er sich ausgiebig streckte, kamen Erinnerungen an seine Zeit im Yogakurs. Der Professor öffnete das Fenster, glaubte zu spüren, wie sofort die Gedanken in Bewegung kamen:
„Es muss werden! Es muss!“
Schon floss ein Satz aus seinem Füller, ein Satz mit zwanzig Kommas, der kein
Ende nahm. Professor Gummeltwist erschrak beim einundzwanzigsten Komma:
„Vielleicht ist es das falsche Thema?“
Er schüttelte seinen Kopf, hüstelte verlegen.
„Noch nie habe ich in den vielen Jahren meiner Professur das falsche Thema bearbeitet. Das letzte Buch über Objektivität gelangte in die Top Ten der wissenschaftlichen Belletristik: Dafür hatte ich ein ganzes Tintenfass leergeschrieben.“
In kreativen Zeiten drehte er oft am Ehering, lüftete mehrmals am Tag das Zimmer, aß fast ausschließlich Rohkost und trank den von seiner Frau selbstgepflückten und mit Liebe aufgebrühten Tee.
Bei seinem neuen Buch waren bisher hundertsiebenundvierzig Seiten zusammengekommen, das Tintenfass zum Drittel geleert.
„Es muss werden! Es muss!“
Der viel zu lange Satz wurde kurz vor dem zweiundzwanzigsten Komma abgebrochen.
Das dritte Drehen am Ehering sorgte zumindest für Ideenfluss: Hatte nicht ein kluger Mensch irgendwann vorgeschlagen, man solle von Zeit zu Zeit das kindliche Element im Leben aktivieren. Eine regelmäßige Portion Unschuld schmiert den Geist.
Er zog die Schultern nach vorn und sprach zu sich selbst:
„Ich verschwinde jetzt aus dieser Studierstube ins Kinderzimmer und gönne mir eine
Pause von mehreren Tagen.“
Dabei schaute er sich vorsichtig in der Wohnung um, wollte nicht, dass seine Frau von diesem Plan etwas mitbekam. Dann trank er, als Liebesbeweis, eine Tasse Kräutertee von ihr, diesmal in der Zusammenstellung von Linde, Brombeere, Himbeere, Pfefferminze, Holunder und Mädesüß. Professor Gummeltwist beobachtete erneut nachdenklich sein bauchiges Tintenfass und dachte dabei:
„Am Anfang war die Erde wüst und leer, doch es gab Tinte und einen passenden Füllhalter. Der erste nackte Mensch konnte beides nutzen. Und aus den Neandertalklecksen entwickelten sich lesbare Buchstaben.“
Plötzlich glaubte er, einen dunkelblauen Buben mit Kräuselhaaren aus dem Glas heraushuschen zu sehen. Professor Gummeltwist juchzte:
„Aha, ich beginne die Welt mit der Phantasie eines Kindes zu betrachten! Hervorragend! Das ist der richtige Zeitpunkt, um Kinderliteratur wiederzuentdecken. Genau!“
Sofort lief er auf den Dachboden, wo eine Kiste mit Kinderbüchern stand. „Ich greife da jetzt hinein und das Schicksal wird entscheiden.“ So geschah es, und das Schicksal entschied sich für:
„Geschichten vom Struwwelpeter“ aufgeschrieben von Heinrich Hoffmann.
„Genau das richtige Buch!“
Professor Gummeltwist schlug eine Seite auf und landete bei der Geschichte von den „Schwarzen Buben“.
„Ach ja, das sind die richtigen Geschichten“, sprach er vergnügt.
Und er las die Strophe, die ihm sein Schicksal spontan vor Augen führte:
„… bis übern Kopf ins Tintenfaß, taucht sie der große Nikolas.“ Sein Blick fiel wieder auf das Tintenfass auf seinem Schreibtisch.
„Am Anfang war das Tintenglas“, sprach der Mann und spürte große Müdigkeit. Sein
Blick auf die Uhr verriet ihm, es ist für Kinder zu spät.
„Aha, genau die richtige Zeit ins Bett zu gehen.“
Seiner Frau, die erst gegen zweiundzwanzig Uhr von der Arbeit nach Hause kommen sollte, schrieb er einen Zettel:
„Ich schlafe bereits.“
Und Professor Gummeltwist schlief so schnell ein, wie es nur ein artiges Kind tat, das nicht in die Hände und ins Tintenfass des großen Niklas geraten möchte.
Er träumte von einem schwarzen Buben, der in der Schule verspottet wurde. Drei Klassenkameraden waren frech und brutal, Professor Gummeltwist bekam richtig Wut im Schlaf. Er musste in dieser Nacht laute Selbstgespräche geführt haben, denn seine Frau war in den Nachbarraum ausgezogen.
Noch beim Aufwachen am Morgen spürte er Aufregung.
„Du hast auf mich eingeboxt, dass ich in den Nachbarraum bin“, bestätigte Frau Gummeltwist. Zum Glück sah man keine Blessur in ihrem Gesicht. Der Professor zuckte unschuldig mit den Schultern.
„Deshalb benötige ich heute Ruhe und Entspannung. Ich werde durch den Wald springen und Hasen aufscheuchen.“
„Was willst du machen?“
„Irgendetwas Anderes, Verrücktes, etwas, was Kinder gern tun.“
„Aha!“
Langsam scheint er mir überstudiert, dachte sie besorgt.
Professor Gummeltwist trank zum Frühstück Kakao und aß ein Pflaumenmussbrot.
„Heute lege ich eine Pause ein, weil mir das guttut.“
Dabei zog er Jacke und Schuhe an, verließ zufrieden lächelnd die Wohnung.
Er beobachtete den Grünspecht im Nachbargarten, pflückte eine Birne, ließ deren Saft beim Reinbeißen links und rechts aus den Mundwinkeln laufen.
Anschließend rannte er in den nahegelegenen Wald, verzichtete aber auf das Hasenaufscheuchen und Springen, denn das ungewohnte Rennen brachte ihn an körperliche Grenzen. Die spürbare Erschöpfung sorgte für ein Glücksgefühl.
„Ach ist das herrlich, unbekümmert durch die Natur zu laufen.“
Heute sprudelten die Ideen in seinem Kopf: Als Erstes ergriff er einen Stock und fuchtelte mit diesem wild in der Luft herum.
„Ich bin ein Ritter! Wo bist du, schöne Prinzessin.“ Außer einem Eichelhäher, der mit krächzender Stimme von oben herab warnte, reagierte niemand. So konnte der Ritter ungestört seine Prinzessin befreien. Nur musste die Schöne sofort die Flucht ergriffen haben, denn zu sehen war sie nicht. Dann balancierte er gewagt über einen Baumstamm, stellte sich auf eine Wurzel, um der Welt eine Rede zu halten, klopfte an alle möglichen Hölzer, komponierte neue Tonreihen. Um die dicke, im Weg stehende Buche spielte er allein Verstecken, legte sich anschließend zufrieden ins Moos, hatte aber Mühe wieder aufzustehen. Die alten Knochen knarzten gar nicht so kindlich.
„Herrlich! Genau die richtigen Ideen!“ Der Eichelhäher warnte wiederholt.
Nach seiner Waldtour verspürte er das Verlangen, an einer Grundschule vorbeizulaufen, dachte dabei an das Gebäude in der Nachbarschaft.
Das Schicksal wollte, dass dort die große Pause begann.
Er erkannte auf dem Pausenhof sofort Gruppenspiele aus seiner Kinderzeit.
„Sie spielen Fangens und Verstecken. Das ist ja wirklich hervorragend.“
Doch eine andere Beobachtung störte das unschuldige Bild: Wilhelm, der Junge von nebenan, schlug mit einem Gegenstand auf einen schwarzen Jungen mit Kräuselhaaren und machte sich lustig, dass dieser weinte.
Professor Gummeltwist war entsetzt, wollte dem schwarzen Buben zur Hilfe eilen.
„Das sind nicht die richtigen Spiele!“
Doch die pädagogisch stoppende Hand einer Lehrerin verwies ihn des Platzes. Kopfschüttelnd entfernte er sich, lief nach Hause, konnte das Gesehene nicht aus seinen Gedanken verbannen.
„Dieser Wilhelm, dieser Raufbold. Das ist ja genauso wie in der Geschichte von den schwarzen Buben.“
Seiner Frau erzählte der Professor von der Schulhofbeobachtung, zog sich anschließend ins Schlafzimmer zurück, um mit Hilfe von Mittagsschlafträumen das Erlebnis noch einmal zu ordnen.
Erst am späten Nachmittag, nach einer weiteren Tasse Kakao, fragte er seine Frau, ob sie das alte Tierratespiel mitmachen würde. Als sie irritiert den Kopf schüttelte, gab er nach und beide entschieden sich für Mensch-Ärgere-Dich-nicht.
Am nächsten Vormittag berichtete Frau Gummeltwist ihrem Mann, dass sie die Mutter von Wilhelm getroffen hätte, und diese habe ihr von unerklärlichen Tintenklecksen im Gesicht, sowie auf dem Schlafanzug des Jungen berichtet. Entdeckt hatte sie die Kleckserei am Morgen. Ihr sei jedoch völlig unklar gewesen, wie das habe passieren können.
Der Professor reagierte mit einem hinterhältigen Grinsen:
„Alles wie in der Geschichte. Da war der große Nikolas am Werk.“ Danach begann er seinen nächsten kindlichen Spaziergang, beobachtete den Grünspecht in Nachbars Garten, balancierte auf Baumstämmen suchte sich einen Stock und verkündete laut rufend in den Wald: „Ich bin ein Räuber, ein Gerechter, der Rächer der Armen.“
Rief so laut, dass ein verunsicherter Eichelhäher die restliche Welt alarmierte. Er hüpfte Kreuz und quer, manchmal sogar auf einem Bein, was ihm dann doch zu gewagt erschien, verjagte einen Hasen, spielte allein Verstecken um eine Buche: „Eins zwei drei, versteck dich. Ich komme …“
Nachdem alle Verstecke aufgestöbert waren, spazierte er zurück zur Stadt, entschied, wieder auf dem Pausenhof der Grundschule in der Nachbarschaft die Kinder zu beobachten. Schließlich musste jemand auf alle schwarzen, grünen, roten Buben aufpassen. Diesmal ging es bereits auf das Ende der Pause zu. Was er aber sah, entsetzte ihn erneut. Anstatt Hüpfekästchen, Verstecken oder Fangen zu spielen, drangsalierten drei höhnisch lachende Jungen einen kleineren Buben mit grüner Jacke, schubsten ihn in ihrer Mitte von einer Seite auf die Andere. Beteiligt war wieder dieser Wilhelm, ein Junge namens Friedrich, der andere hieß Paul. Alle drei wohnten in der Nachbarschaft.
Diesmal ist also der grüne Bube das Opfer! Das sind die falschen Spiele!
Aber der große Nikolas kennt auch farbige Tinte, dachte Professor Gummeltwist, vergaß das Kind im Manne, sprang auf den Schulhof, ignorierte die stoppende Pädagogik der Lehrerin, lief so energisch auf die prügelnden Kinder zu, dass Friedrich, Paul und Wilhelm erschraken, ihre Köpfe einzogen, dann schnell ins Schulgebäude verschwanden.
Professor Gummeltwist fuchtelte mit den Händen, fühlte sich in diesem Moment als Ritter. Oder war er doch der Räuber, jener Rächer der Armen und Bedrängten?
Als Lohn bekam er nicht die schöne Prinzessin, sondern eine aufgeregt schimpfende Lehrerin:
„Sie können nicht einfach die Schulhofordnung verletzen.“
„Und ich kann sie wegen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht anzeigen“, konterte der Professor.
Die aufgeregte Lehrerin wurde hochrot im Gesicht und Gummitwist auch. Oder war es mehr so eine Art Tintenblau?
Der Mann ließ die rot eingefärbte Lehrerin wortlos stehen, um hinter die Ereignisse einen Schlusspunkt zu setzen.
„Das mit dem Kindsein, ist nicht so einfach.“
Am Abend beschloss er, diese Phase zu beenden, denn die Sache mit der Unschuld funktionierte nicht richtig.
„Was für eine Farbe hat die Unschuld? Kann man mit ihr klecksen? Wenn sie weiß ist, macht es keinen Sinn, denn weiße Tinte gibt es nicht.“
Seine Aufmerksamkeit ging wieder zum wie immer tiefblau gefüllten Tintenglas auf dem Schreibtisch.
Es schien zu warten, dass er endlich mit der Schreiberei fortfuhr.
Der Mann kratzte sich am Kopf, drehte den goldenen Ehering, überlegte.
„Eigentlich würde ich gern noch mal mit farbiger Tinte zaubern, dem grünen Buben zuliebe.“
Sein Blick hatte etwas Entschiedenes und das Tintenglas leerte sich soeben. Professor Gummeltwists Augen funkelten rot, gelb, blau, doch er konnte es nicht sehen.
„Morgen wird weitergeschrieben. Vielleicht eine Yogaübung zuvor, aber dann geht es los. Mein Tintenglas ist schon nervös.“
Auch diesmal legte er sich, zur Überraschung seiner Frau, zeitig ins Bett, schlief rasch ein, durchlebte einen unruhigen Traum, aber keine Erinnerung. Am Morgen schmerzten alle Muskeln, als wären sie die ganze Nacht durch Yogaübungen gefordert worden.
Seine Frau war einkaufen, brachte heute die Brötchen und alle Neuigkeiten aus der Nachbarschaft mit.
„Gummeltwist, du glaubst es nicht, in unserer Stadt ist was los. Zuerst traf ich die Mutter von Wilhelm, die heute kurz vor einem Nervenzusammenbruch stand. Der Bub ist über und über mit roten Tintenklecksen aufgewacht.
Dazu kam der Vater von Friedrich und schimpfte, dass der Junge voller gelber Tintenflecken aufstand. Schließlich kamen, ebenfalls wütend und erregt, der Opa von Paul. Und Paul war blau bekleckst.“
Der Professor grinste hintersinnig, brummte nur: „So, so; hat der große Nikolas sein Unwesen getrieben.“
„Alle aufgebrachten Eltern und Großeltern fordern ein Gespräch in der Schule, sogar mit Beteiligung der Polizei. Sie deuten diese Kleckserei als Protestaktion ihrer Kinder und vermuten einen negativen fremden Einfluss.“
„Vielleicht liegt es am Fernsehprogramm.“ Seine Frau schüttelte den Kopf:
„Das sind alles Eltern, die das richtige Fernsehprogramm einstellen..“
Frau Gummeltwist war so aufgeregt, als wäre sie selbst betroffen. Sie hatte sogar rote Flecken im Gesicht. Noch am Nachmittag besuchte sie die Mutter von Wilhelm. Da hatte das Gespräch, im Beisein der drei Schüler, der Klassenlehrer, Eltern, Großeltern und eines Kriminalbeamten stattgefunden.
Die Jungen wurden einzeln verhört, ihre Erzählungen glichen sich trotzdem fast wörtlich:
Erst kam die große unerklärliche Müdigkeit. Dann, vor dem Einschlafen, erschien eine riesige Gestalt, gehüllt in einen glänzenden blauen Mantel, so eine Art Morgenmantel, seltsamerweise mit Sternen darauf. Das Gesicht des Mannes konnten sie, obwohl bekannt, nicht beschreiben. Sie fühlten sich in die Höhe gehoben, ihnen wurde schwarz, blau, rot, gelb vor den Augen.
Alle Gesprächsteilnehmer blieben ratlos, da Tinte, in ihrem Haushalt keine Rolle mehr spielte.
Professor Gummeltwist rezitierte während des Berichtes seiner Frau laut lachend: „Da kam der große Nikolas und steckte sie alle ins Tintenfass.“ „Wie?“, fragte seine Frau, ohne die Sache zu verstehen. „Na, wie im Buch vom Struwwelpeter, die Geschichte von den schwarzen Buben.“ Sie betrachtete ihren Mann misstrauisch.
„Gummeltwist, wie kommst du auf den Struwwelpeter?“
„Ich habe die Geschichte erst gestern, vorgestern und vorvorgestern gelesen.“ Ihr war die Überraschung, mit etwas Phantasie, blau ins Gesicht gezeichnet.
„Wie, ich denke, du beschäftigst dich mit Suizidalität in der Literatur vor 1914, Hans Fallada und so. Doch nicht mit Struwwelpeter? Oder gibt es neue Erkenntnisse?“ Professor Gummeltwist winkte ab:
„Schon gut, ab heute arbeite ich wieder ernsthaft. Jeder Mensch, selbst ein Professor, braucht mal eine Pause, in der er über Schuld und Unschuld nachdenkt.“
Dann verabschiedete er sich zum Schreibtisch, tauchte den Füller in das Tintenglas und schrieb an seiner unterbrochenen wissenschaftlichen Arbeit weiter.
Kopflos
Franz Wilhelm war wütend.
Franz Wilhelm lief allein den Weg von der Schule nach Hause ins Dorf. Er nannte das Dorf heute ein „Scheiß-Kaff“, dachte sich: Da wohnen nur Idioten, trat vor den Zaun des ersten Hauses. Ein Hund bellte vom Grundstück des dritten Hauses. Dem Tier schäumte die Wut aus dem Maul. Der Junge trat noch kräftiger an den Zaun des dritten Hauses und die Wut des Hundes überschlug sich. Am Fenster erschien ein alarmiertes Frauengesicht. Franz-Wilhelm lief spöttisch grinsend weiter, dachte an den Streit mit dem Mathelehrer. Der hatte zum Abschluss des Unterrichts, tief durchgeatmet, dann das Programm auf seinem Laptop mit einem Knall beendet, war dabei bedrohlich rot im Gesicht.
„Du besuchst die achte Klasse des Gymnasiums, zeigst aber keinerlei Ehrgeiz für den Unterrichtsstoff.“
Der Lehrer hatte gegen Luftnot und seinen Bluthochdruck gekämpft.
„Überlege, ob du an der Schule bleiben möchtest. Wir vertreten einen gewissen
Anspruch. Du, Franz-Wilhelm, erfüllst ihn nicht.“
Den Schulbus hatte der Junge heute bewusst verpasst.
„Ich hätte auch mit dem Moped fahren können. Aber das ist kaputt, genauso wie dieser Lehrer, die ganze Schule, das Kaff hier.“
Die Fortsetzung seiner Unzufriedenheit bekam auf dem Heimweg ein verträumter Schüler aus der Grundschule zu spüren, als ihm Franz-Wilhelm überfallartig den Rucksack wegnahm und diesen gegen eine Hauswand schleuderte.
Dem Grundschüler kamen die Tränen, doch wen störte das schon.
Zu Hause war er allein, Lust zum Reparieren des Mopeds hatte er nicht, dafür aber eine Flasche Obstler zu leeren, selbstgebrannter Pflaumenschnaps vom Vater. Dessen Obstler wurde gelobt, gern getrunken, den liebten alle.
„Es wird Zeit, dass in dem Kaff etwas passiert“, dachte Franz-Wilhelm.
„Ich halte es hier nicht länger aus, muss weg, weg, weg.“
Heute blieb ihm nur die Flucht zum versteckten Lieblingstreff mit seinen Freunden. Das lag zugewachsen oben auf dem Hügel, in der Nähe des Friedhofes.
Eine Reihe von Bäumen und Sträuchern bildeten höhlenartig Schutz vor neugierigen Blicken und für die letzten liegengebliebenen Steine eines längst abgerissenen Hauses.
Der Junge lief den Hügel hinauf, setzte sich wie gewohnt auf einen der Steine, bespuckte dreimal den Boden. Er schäumte vor Ärger, wollte schreien oder bellen wie der Hund bei Haus Nummer drei. Die Kälte stieg in seinen Körper. Septemberkälte. Ihm wurde schwindlig.
Vielleicht war es doch zu viel ungewohnter Obstler? Egal! Franz Wilhelm spürte Bauch- und Kopfschmerzen und wollte sterben. Dazu gab es aber den Friedhof. Mit Vaters Obstler im Bauch ließ es sich dort bestimmt gut sterben.
Er stand auf, schwankte zum eisernen Tor des Friedhofs, hielt sich daran fest, überschaute erst einmal das Gelände.
„Alles Tote aus diesem Scheiß-Kaff!“
Das Tor war nur angelehnt, so konnte er den Friedhof betreten.
Dessen Mitte bildete die Dorfkirche, an deren Außenmauer figurenreich, die wertvollsten Grabsteine ihren Platz hatten: Engel, weinende Frauen, trauernde Knaben, Schalen und Urnen.
Alles Revanchisten, grunzte Franz-Wilhelm, spürte kurz heftigen Urindruck, dem er an der Friedhofsmauer nachgab.
„Ich muss pinkeln, glotzt nicht so!“
Als er sich wieder den Gräbern zuwandte, fiel ihm eine jugendliche, steinern trauernde Frauengestalt, direkt an der Kirchenmauer stehend, auf. Die Frau schien nicht tot, stützte sich nachdenklich auf ein Kreuz.
Franz-Wilhelm ließ die Figur nicht aus den Augen, bewegte sich, langsam und unsicher auf sie zu.
Sie gefiel ihm, und er glaubte, ihre Lebenswünsche zu erahnen.
Vielleicht wollte sie reisen, nur weg von hier. Aber das ging nicht, nicht als Frau. Ihr langes Kleid, mit den vielen Falten – das war elegant. Bestimmt schenkte es ihr ein Geliebter. Für den hatte sie die blonden Haare geflochten. Ganz sicher waren sie blond.
Und die Frau war die Maienkönigin im Kaff. Nur die vielen unbeweglichen Jahre auf dem Friedhof ließen sie ergrauen.
Bestimmt hatte sie kein Geld für den Arzt. Deshalb musste sie so jung sterben. Hätte ihr der Geliebte nur das Arztgeld gegeben.
„Sie ist so schön. Sie kann nichts für den Irrtum der Welt. Sie nicht“, brummte er. Und seine Gedanken bekamen jetzt etwas Versöhnliches.
Ja, die Figur ist nicht aus Stein, sie schläft, ich muss sie nur küssen, sie will geweckt und geliebt werden. Die Arme wurde verkleidet und an die Kirchenwand gefesselt. Erst spürte er Mitleid und da die Bauchschmerzen sich wieder stärker zurückmeldeten, kippte die Stimmung.
Eventuell ist aber auch alles Lüge, will sie mich täuschen, auf die Tränendrüse drücken, diese – diese falsche Schlange.
Er pfiff die Luft durch die Zähne, der Bauch bellte, im Kopf begann sich eine Sirene in Gang zu setzen, Melancholie war nicht angesagt:
„He, Frau, schau mich an! Du verarschst mich.“
Die Sirene löste Schwindel aus, Franz-Wilhelm schwankte so bedrohlich, dass sich alle Grabsteine um ihn herum abduckten, schnell in Sicherheit brachten. An einem, der das Abducken nicht rechtzeitig schaffte, konnte er sich gerade noch festhalten.
„Alles Lüge! Frau, und du weisst es. Auch du würdest mich verlassen, in den Hintern treten und lachen. Scheinheilig. Scheinheilig ist hier jeder Stein.“
Franz-Wilhelm fühlte, dass Friedhof und Kirche schuld waren an seinen Bauchschmerzen.
Ein abgeduckter Grabstein bekam einen Tritt, genauso kräftig wie der Zaun bei Haus Nummer drei. Der Grabstein wehrte sich, trat ihm gefühlt in den Bauch, Franz-Wilhelm, so grau im Gesicht, wie die steinernen Figuren an der Kirchenmauer, musste sich übergeben.
Mit dem rechten Handrücken wischte er anschließend den ausgespuckten Moder vom Mund.
„Friedhof, Kirche, ha, es wird Zeit das etwas passiert.“
Die schöne trauernde Frau schien sich in seiner Nähe stärker an das Kreuz zu klammern.
„Alles Lüge, in diesem Kaff gibt es keine Heiligen, nur Gespenster, die unter einer Decke stecken.“
Seine Wut lies sich nicht mehr besänftigen, gab Franz-Wilhelm einen Stein in die Hand, krächzte: „Tu es! Räche dich!“
Und er tat es und rächte sich, warf den Stein gegen den Kopf der Frau. Aus ihrem schlanken Hals schienen blaue Adern hervorzutreten, dünne Linien, aus denen Risse wurden. Sogar ihre geflochtene Frisur, fiel wie ein Kranz vom Kopf. Kein Sieg war ihr gegönnt.
Der Junge überspielte einen Schreckmoment. Dass er das nicht wollte, stimmte nicht. Seine Wut feuerte ihn weiter an.
Franz-Wilhelm griff sich denselben Stein, der inzwischen zurück vor seine Füße gerollt war. Ein zweites Mal schleuderte er ihn gegen den Kopf der Figur. Doch anstatt dass sie ihm endlich alles erklärte, eine Entschuldigung aussprach, zeigten sich Blessuren im Gesicht, Narben, die aber nicht bluteten.
Wieder rollte der Stein vor seine Füße, Franz-Wilhelms Wut griff erneut danach, schleuderte ihn ein drittes Mal gegen den schon gezeichneten Kopf, der sich nun langsam vom Hals löste, herunterfiel und in viele kleine Splitter zerbrach.
Der Junge schwankte, fing an zu frieren. Diesmal rollte der Stein nicht zurück. Wo war seine Wut hin? Ließ ihn ausgerechnet jetzt allein.
Wo war ihr schönes Gesicht, der schlanke Hals, die geflochtene Frisur?
Ihr langes Kleid warf Schatten, hatte etwas Gespenstisches.
Die Übelkeit in seinem Bauch nahm zu.
Ihn überkam plötzlich das Bedürfnis, etwas wieder gutzumachen. Er suchte abgesplitterte Teile des Gesichtes, aber sie zerfielen zwischen seinen Fingern zu Staub.
Zu spät, krächzte die Wut, zerstöre sie. Tu es!
Doch diesmal tat er es nicht. Er übergab sich erneut, danach kamen die Tränen. Sie brannten erbarmungslos in seinem Gesicht, das er glaubte, dieses breche ebenfalls gleich auseinander.
Um ihn herum sah er nur die abgeduckten, ängstlich wartenden Grabsteine. An denen konnte er sich nicht einmal mehr festhalten. Sie standen zusammen, hatten sich scheinbar gegen ihn verbündet.
Er wollte sterben, hoffte, dass sein Gesicht auch endlich zerbrach, doch der Friedhof ließ ihn nicht los. Franz-Wilhelm fühlte sich in einem Labyrinth gefangen, aus dem er nicht mehr heraus kam. Was war jetzt alles möglich!
Franz-Wilhelm hatte Angst, wusste anschließend nicht mehr, wie er nach Hause gekommen war. Ein Albtraum, aus dem er am Morgen, durch die Vorwürfe der Eltern erwachte.
„Junge, Junge, da müssen wir ein Machtwort mit dir sprechen. Du hast wieder gefeiert und dich mit Klamotten ins Bett gelegt. Das Leben besteht nicht nur aus Party.“
Das Machtwort war gesprochen, die Zeit verging und es wendete sich vieles zum Guten.
Franz-Wilhelm blieb am Gymnasium, weil sich, zur Überraschung der Lehrer, seine Leistungen verbesserten. Er wurde ehrgeizig, manche nannte ihn schon „Streber“. Den alten Treffpunkt bei der Ruine mied er lange, schlug Freunden einen anderen Platz vor, an den sich alle gewöhnten.
Überhaupt gab er sich die größte Mühe, das Geschehene zu verdrängen. Es vergessen ging aber nicht, schon, weil die zerstörte Figur der Frau für Aufregung im Dorf sorgte.
„Wer macht so etwas?“
„Keine Ehrfurcht vor einem Friedhof.“
„Das ist pervers!“
„Es war das Gesicht von Anna Leon, das Antlitz dieser Frau, die vor hundertdreißig Jahren, durch Krankheit, recht jung vom Tod dahingerafft wurde.“