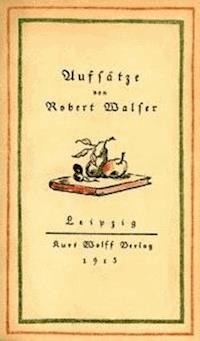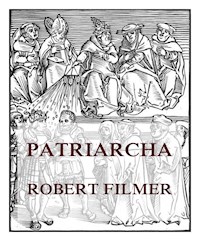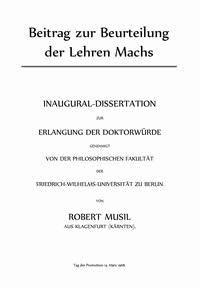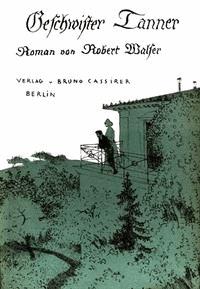
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Ähnliche
Anmerkungen zur Transkription:
Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurden übernommen; lediglich offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Änderungen sind im Text gekennzeichnet, der Originaltext erscheint beim Überfahren mit der Maus. Eine Liste der vorgenommenen Änderungen findet sich am Ende des Textes.
Geschwister Tanner
Geschwister Tanner
RomanvonRobert Walser
Zweite Auflage
Verlag von Bruno Cassirer Berlin
Erstes Kapitel.
Eines Morgens trat ein junger, knabenhafter Mann bei einem Buchhändler ein und bat, daß man ihn dem Prinzipal vorstellen möge. Man tat, was er wünschte. Der Buchhändler, ein alter Mann von sehr ehrwürdigem Aussehen, sah den etwas schüchtern vor ihm Stehenden scharf an und forderte ihn auf, zu sprechen. »Ich will Buchhändler werden,« sagte der jugendliche Anfänger, »ich habe Sehnsucht darnach und ich weiß nicht, was mich davon abhalten könnte, mein Vorhaben ins Werk zu setzen. Unter dem Buchhandel stellte ich mir von jeher etwas Entzückendes vor und ich verstehe nicht, warum ich immer noch außerhalb dieses Lieblichen und Schönen schmachten muß. Sehen Sie, mein Herr, ich komme mir, so wie ich jetzt vor Ihnen dastehe, außerordentlich dazu geeignet vor, Bücher aus Ihrem Laden zu verkaufen, so viele, als Sie nur wünschen können zu verkaufen. Ich bin der geborene Verkäufer: galant, hurtig, höflich, schnell, kurzangebunden, raschentschlossen, rechnerisch, aufmerksam, ehrlich und doch nicht so dumm ehrlich, wie ich vielleicht aussehe. Ich kann Preise herabsetzen, wenn ich einen armen Teufel von Studenten vor mir habe, und kann Preise hochschrauben, um den reichen Leuten ein Wohlgefallen zu erweisen, von denen ich annehmen muß, daß sie manches Mal nicht wissen, was sie mit dem Geld anfangen sollen. Ich glaube, so jung ich noch bin, einige Menschenkenntnis zu besitzen, außerdem liebe ich die Menschen, so verschiedenartig sie auch sein mögen; ich werde also meine Kenntnis der Menschen nie in den Dienst der Übervorteilung stellen, aber auch ebensowenig daran denken, durch allzu übertriebene Rücksichtnahme auf gewisse arme Teufel Ihr wertes Geschäft zu schädigen. Mit einem Wort: meine Liebe zu den Menschen wird angenehm balancieren auf der Wage des Verkaufens mit der Geschäftsvernunft, die ebenso gewichtig ist und mir ebenso notwendig erscheint für das Leben wie eine Seele voll Liebe: Ich werde schönes Maß halten, dessen seien Sie zum voraus versichert.« – Der Buchhändler sah den jungen Mann aufmerksam und verwundert an. Er schien im Zweifel darüber zu sein, ob sein Vis-à-vis, das so hübsch sprach, einen guten Eindruck auf ihn mache, oder nicht. Er wußte es nicht genau zu beurteilen, es verwirrte ihn einigermaßen und aus dieser Befangenheit heraus frug er sanft: »Kann ich mich denn, mein junger Mann, geeigneten Ortes über Sie erkundigen?« Der Angeredete erwiderte: »Geeigneten Ortes? Ich weiß nicht, was Sie einen geeigneten Ort nennen! Mir würde es passend erscheinen, wenn Sie sich gar nicht erkundigen wollten. Bei wem sollte das sein, und was für einen Zweck könnte das haben? Man würde Ihnen allerlei über mich hersagen, aber genügte denn das auch, Sie meinetwegen zu beruhigen? Was wüßten Sie von mir, wenn man Ihnen zum Beispiel auch sagte, ich sei aus einer sehr guten Familie entsprossen, mein Vater sei ein achtbarer Mann, meine Brüder tüchtige, hoffnungsvolle Menschen und ich selber sei ganz brauchbar, ein bißchen flatterhaft, aber zu Hoffnungen nicht unberechtigt, ein bißchen dürfe man mir schon vertrauen, und so weiter? Sie wüßten doch nichts von mir und hätten absolut nicht die kleinste Ursache, mich nun mit mehr Ruhe in Ihr Geschäft als Verkäufer anzunehmen. Nein, Herr, Erkundigungen taugen in der Regel keinen Pfifferling, ich rate Ihnen, wenn ich mir Ihnen, dem alten Herrn gegenüber einen Ratschlag herausnehmen darf, entschieden davon ab, weil ich weiß, daß, wenn ich geeignet und beschaffen wäre, Sie zu hintergehen und die Hoffnungen, die Sie, gestützt auf Informationen, auf mich setzen, zu täuschen, ich dies in um so größerem Maße täte, je besser besagte Erkundigungen lauten würden, die dann nur gelogen hätten, weil sie Gutes von mir sagten. Nein, verehrter Herr, wenn Sie gedenken, mich zu verwenden, so bitte ich Sie, etwas mehr Mut zu bezeigen als die meisten andern Prinzipale, mit denen ich zu tun hatte, und mich einfach auf den Eindruck hin anzustellen, den ich Ihnen hier mache. Außerdem würden einzuziehende Erkundigungen über mich nur schlecht lauten, um offen die Wahrheit zu sagen.«
»So? Warum denn? –«
»Ich bin noch überall, wo ich gewesen bin,« fuhr der junge Mensch fort, »bald weitergegangen, weil es mir nicht behagt hat, meine jungen Kräfte versauern zu lassen in der Enge und Dumpfheit von Schreibstuben, wenn es auch, nach aller Leute Meinung, die vornehmsten Schreibstuben waren, zum Beispiel gerade Bankanstalten. Gejagt hat man mich bis jetzt noch nirgends, ich bin immer aus freier Lust am Austreten ausgetreten, aus Stellungen und Ämtern heraus, die zwar Karriere und weiß der Teufel was versprachen, die mich aber getötet hätten, wenn ich darin verblieben wäre. Man hat, wo ich auch immer gewesen bin, regelmäßig meinen Austritt bedauert und mein Tun beklagt, mir eine schlimme Zukunft versprochen, aber doch den Anstand besessen, mir Glück auf meine fernere Laufbahn zu wünschen. Bei Ihnen (und des jungen Mannes Stimme wurde auf einmal treuherzig), Herr Buchhändler, werde ich es sicherlich jahrelang aushalten können. Jedenfalls spricht vieles dafür, Sie zu veranlassen, einmal einen Versuch mit mir zu machen.« Der Buchhändler sagte: »Ihre Offenherzigkeit gefällt mir, ich will Sie probeweise acht Tage in meinem Geschäft arbeiten lassen. Taugen Sie, und machen Sie dann Miene, weiter bei mir zu bleiben, so wollen wir weiter miteinander reden.« Mit diesen Worten, die zugleich des jungen Stellesuchers vorläufige Entlassung bedeuteten, klingelte der alte Herr an der elektrischen Leitung, worauf, wie von einem Strom herbeigeweht, ein kleiner, ältlicher, bebrillter Mann erschien.
»Geben Sie diesem jungen Herrn eine Beschäftigung!«
Die Brille nickte. Damit war nun Simon Buchhandlungsgehilfe geworden. Simon, ja so hieß er nämlich. –
Um diese Zeit herum machte sich einer der Brüder Simons, der in einer Residenzstadt wohnhafte und dort namhaft bekannte Doktor Klaus, Sorgen wegen seines jungen Bruders Betragen. Es war dies ein guter, stiller, pflichttreuer Mensch, der gar zu gern gesehen hätte, wenn seine Brüder so wie er, der Älteste, im Leben einen festen, achtunggebietenden Boden unter die Füße bekommen hätten. Dies war aber so sehr nicht der Fall, wenigstens bis jetzt, ja so sehr war das Gegenteil der Fall, daß Doktor Klaus anfing, in seinem Herzen sich Selbstvorwürfe zu machen. Er sagte sich zum Beispiel: »ich hätte derjenige sein sollen, der schon längst allen Grund hätte haben müssen, diese Brüder auf die rechte Bahn zu leiten. Ich habe es bis jetzt versäumt. Wie konnte ich nur diese Pflicht versäumen und so weiter.« Doktor Klaus kannte tausende von kleinen und großen Pflichten, und es mochte bisweilen den Anschein tragen, als sehne er sich nach noch mehr Pflichten. Er war einer von den Menschen, die sich, aus Pflichterfüllungsbedürfnis, in ein ganzes, beinahe zusammenstürzendes Gebäude von lauter sauren Pflichten stürzen, aus Angst, es möchte vorkommen, daß ihnen eine geheime, wenig bemerkbare Pflicht davonliefe. Sie schaffen sich viele unruhige Stunden wegen solcher unerfüllten Pflichten, denken nicht daran, daß eine Pflicht immer eine neue auf den Übernehmer der ersten ladet und glauben, schon etwas wie eine Pflicht erfüllt zu haben, wenn sie sich wegen deren dunklen Vorhandenseins ängstigen und beunruhigt fühlen. Sie mengen sich leicht in Vieles, was sie, wenn sie weniger sorgenvoll darüber nachdächten, in Gottes Welt gar nichts angeht, und wollen auch gern andere so sorgenbelastet sehen. Sie pflegen mit Neid auf Unbefangene und Pflichtenfreie zu blicken und sie dann leichtfertige Menschenbrüder zu schelten, weil sie so schön, mit so leicht erhobenem Kopf, durch das Leben ziehen. Doktor Klaus zwang sich des öftern zu einer gewissen kleinen, bescheidenen Sorglosigkeit, aber immer wieder kehrte er zu den grauen, trüben Pflichten zurück, in deren Bann er wie in einem dunklen Gefängnis schmachtete. Er hatte vielleicht einmal die Lust zum Abbrechen, damals als er noch jung war, aber ihm fehlte die Kraft, etwas, das wie eine mahnende Pflicht aussah, unerledigt hinter sich zu lassen und darüber mit einem Lächeln der Wegwerfung hinwegzuschreiten. Wegwerfung? O, er warf nie etwas weg! Es hätte ihn, so deuchte ihn, wenn er es einmal versuchen wollte, von unten bis oben zerschnitten; er würde immer des Weggeworfenen mit Schmerz gedacht haben. Er warf nie etwas weg und er verlor sein junges Leben damit, zurechtzulegen und zu untersuchen, was nie der Untersuchung, Prüfung, Liebe und Beachtung wert war. So war er denn älter geworden, und weil er denn doch durchaus nicht etwa ein empfindungs- und phantasieloser Mensch war, machte er sich oft schwere Vorwürfe darüber, daß er die Pflicht versäumte, selbst ein bißchen glücklich zu sein. Das war nun wieder ein neues Pflichtversäumnis und bewies nur auf das Allertreffendste, daß es eben Pflichtmenschen nie gelingt, alle ihre Pflichten zu erfüllen, ja, daß es solchen am leichtesten vorkommen kann, über ihre Hauptpflichten hinwegzusehen, um erst später, wenn es vielleicht schon zu spät geworden ist, ihrer wieder zu gedenken. Doktor Klaus war mehr als einmal traurig über sich, wenn er des lieblichen Glücks gedachte, das ihm entschwunden war, des Glücks, sich mit einem jungen, lieben Mädchen verbunden zu sehen, das natürlich ein Mädchen aus tadelloser Familie hätte sein müssen. Um diese Zeit herum, als er mit Wehmut seiner selber gedachte, schrieb er an seinen Bruder Simon, den er aufrichtig lieb hatte und dessen Betragen in der Welt ihn beunruhigte, einen Brief, der ungefähr folgendermaßen lautete:
Lieber Bruder. Du scheinst gar nichts über Dich schreiben zu wollen. Vielleicht geht es Dir nicht gut und schreibst deshalb nicht. Du bist wieder, wie nun schon so oftmals, ohne eine feste, fixierte Tätigkeit, ich habe es zu meinem Leidwesen erfahren müssen, und zwar von fremden Menschen. Von Dir darf ich, wie es scheint, keine aufrichtigen Berichte mehr erwarten. Glaube nur, dies schmerzt mich. Es sind jetzt so viele Dinge, die mich nur unangenehm berühren, mußt auch Du, von dem ich mir immer vieles versprach, dazu beitragen, meine Stimmung, die aus vielen Ursachen keine rosige ist, zu verdunkeln? Ich hoffe noch, aber laß mich, wenn Du Deinen Bruder noch ein bißchen lieb hast, nicht allzulang vergeblich auf Dich hoffen. Mache doch einmal etwas, das einen berechtigen könnte, an Dich, sei es in dieser oder jener Hinsicht, noch zu glauben. Du hast Talent und besitzest, wie ich mir gerne einbilde, einen hellen Kopf, bist auch sonst klug, und in allen Deinen Äußerungen spiegelte sich immer der gute Kern wieder, den ich in Deiner Seele von jeher wußte. Warum nun aber, da Du doch die Einrichtungen dieser Welt einmal kennst, immer wieder so wenig Ausdauer, so rasch wieder der Sprung in etwas anderes? Ängstigt Dich Dein eigenes Betragen gar nicht? Ich muß Kraft in Dir vermuten, daß Du diesen immerwährenden Berufswechsel, der zu nichts in der Welt taugt, ertragen kannst. Ich an Deiner Stelle würde längst an mir verzweifelt haben. Ich verstehe Dich wirklich nicht in diesem Punkt, aber ich gebe gerade aus diesem Grunde keineswegs die Hoffnung auf, Dich nun einmal energisch eine Laufbahn ergreifen zu sehen, nachdem Du sattsam genug mußtest die Erfahrung gemacht haben, daß ohne Geduld und guten Willen auf der Welt nichts zu erreichen ist. Und Du willst doch sicher etwas erreichen. So ganz unehrgeizig kenne ich Dich wenigstens nicht. Mein Rat ist nun der: Harre aus, füge Dich drei oder vier kurze Jahre unter eine strenge Arbeit, folge Deinen Vorgesetzten, zeige, daß Du etwas leisten kannst, aber auch, daß Du Charakter besitzest, dann wird sich Dir eine Bahn eröffnen, die Dich durch die ganze bekannte Welt führt, wenn Du Lust zum Reisen hast. Welt und Menschen werden sich Dir in ganz anderer Weise zu erkennen geben, wenn Du wirklich etwas bist, wenn Du der Welt etwas bedeuten kannst. So, scheint es mir, wirst Du vielleicht weit mehr Genugtuung am Leben finden, als selbst der Gelehrte, der, obschon er die Fäden, an denen alles Leben und Wirken hängt, genau erkennt, doch an die enge Welt seines Studierzimmers gefesselt bleibt, wo ihm, wie ich aus eigener Erfahrung sagen darf, oft nicht behaglich zumute ist. Noch ist es Zeit, daß Du ein ganz hervorragend tüchtiger Kaufmann werden kannst, und Du weißt gar nicht, in welchem Maße gerade der Kaufmann Gelegenheit hat, sein Leben zu einem von Grund aus lebensvollen Leben zu gestalten. Wie Du jetzt bist, schleichst Du nur so um die Ecken und durch die Spalten des Lebens: das soll aufhören. Vielleicht hätte ich da früher, viel früher eingreifen, hätte Dir mehr mit Taten als mit bloßen, ermahnenden Worten emporhelfen sollen, aber ich weiß nicht bei Deinem stolzen Sinn, der darauf gerichtet ist, Dir immer und überall selber zu helfen, hätte ich Dich vielleicht eher kränken als Dich wirklich überzeugen können. Was tust Du jetzt mit Deinen Tagen? Erzähle mir doch davon. Ich verdiene es vielleicht, um der Sorge willen, die ich mir Deinetwegen mache, daß Du etwas gesprächiger und mitteilsamer mir gegenüber wirst. Ich selber, was bin ich denn für einer, daß man sich hüten sollte, mir unbefangen und vertraulich in die Nähe zu treten? Bin ich Dir ein Gefürchteter? Was gibt es an mir zu meiden? Etwa den Umstand, daß ich der »Ältere« bin und vielleicht etwas mehr weiß, als Du? Nun denn, so wisse, daß ich froh wäre, noch einmal jung zu werden, und unvernünftig und unwissend. Ich bin nicht ganz so froh, lieber Bruder, wie es der Mensch sein sollte. Ich bin nicht glücklich. Vielleicht ist es zu spät für mich, noch glücklich zu werden. Ich bin jetzt in einem Alter, wo der Mann, der noch kein eigenes Heim hat, nicht ohne die schmerzlichste Sehnsucht der Glücklichen gedenkt, die die Wonne genießen, über der Leitung ihres Haushaltes eine junge Frau besorgt zu sehen. Ein Mädchen zu lieben, das ist schön, Bruder. Und es ist mir versagt. – Nein, Du brauchst mich gar nicht zu fürchten, ich bin es, der Dich wieder aufsucht, der Dir schreibt, der hofft, es werde ihm freundlich und zutraulich geantwortet. Du stehst vielleicht reicher da, als ich, hast mehr Hoffnungen und viel mehr Recht, solche zu hegen, hast Pläne und Aussichten, von denen ich mir nicht einmal etwas träume, ich kenne Dich eben nicht mehr ganz, und wie wäre das auch möglich nach Jahren der Trennung. Laß mich Dich wieder kennen lernen und zwinge Dich, mir zu schreiben. Vielleicht erlebe ich es noch, meine Brüder alle glücklich zu sehen; Dich möchte ich jedenfalls froh wissen. Was macht Kaspar? Schreibt Ihr Euch? Was macht seine Kunst? Ich möchte gerne auch von ihm etwas erfahren. Lebe wohl, Bruder. Vielleicht sprechen wir bald einmal miteinander. Dein Klaus.
Nach Ablauf von acht Tagen trat Simon, als es Abend wurde, zu seinem Prinzipal ins Kabinett und hielt diesem folgende Ansprache: »Sie haben mich enttäuscht, machen Sie nur nicht solch ein verwundertes Gesicht, es läßt sich nicht ändern, ich trete heute aus Ihrem Geschäft wieder aus und bitte Sie, mir meinen Lohn auszubezahlen. Bitte, lassen Sie mich ausreden. Ich weiß nur zu genau, was ich will. In den acht Tagen ist mir der ganze Buchhandel zum Greuel geworden, wenn er darin bestehen soll, vom frühen Morgen bis am späten Abend, während draußen die sanfteste Wintersonne scheint, an einem Pult zu stehen, den Buckel zu krümmen, weil das Pult viel zu klein für meine Figur ist, zu schreiben wie der verflucht-erst-beste Schreiber und eine Beschäftigung zu erfüllen, die sich für meinen Geist nicht ziemt. Ich kann ganz anderes leisten, mein Herr Buchhändler, als was man hier glaubt, für mich erübrigen zu können. Ich glaubte, ich könne bei Ihnen Bücher verkaufen, elegante Menschen bedienen, einen Bückling machen und adieu sagen zu Käufern, wenn sie im Begriffe sind, den Laden zu verlassen. Auch dachte ich, ich bekäme Gelegenheit, einen Blick in das geheimnisvolle Wesen des Buchhandels zu werfen und die Züge der Welt im Gesichte und Gang des Geschäftes zu erhaschen. Aber nichts von alledem. Glauben Sie, es stände so schlimm mit meiner Jugend, daß ich nötig hätte, sie in einem nichtsnutzigen Bücherladen zu verkrümmen und zu ersticken? Sie irren sich zum Beispiel auch, wenn Sie der Meinung sind, der Buckel eines jungen Menschen sei dazu da, um krumm zu werden. Warum haben Sie mir nicht ein gutes, anständiges, mir angemessenes Sitz- oder Stehpult angewiesen? Gibt es nicht prachtvolle Schreibpulte nach amerikanischem Schnitt? Wenn man schon einen Angestellten will, so meine ich, muß man ihn auch unterzubringen wissen. Das wußten Sie, wie es scheint, nicht. Weiß Gott, es wird alles mögliche von einem jungen Anfänger verlangt: Fleiß, Treue, Pünktlichkeit, Takt, Nüchternheit, Bescheidenheit, Maß und Zielbewußtheit und wer weiß was noch alles. Wem aber fiele es je ein, irgend welche Tugenden von einem Herrn Prinzipal zu verlangen. Soll ich meine Kräfte, meine Lust, tätig zu sein, meine Freude an mir selber, und das Talent, daß ich das so glänzend imstande bin, an ein altes, mageres, enges Buchladenpult wegwerfen? Nein, ehe ich das täte, könnte es mir vorher einfallen, unter die Soldaten zu gehen und meine Freiheit vollends zu verkaufen, nur um sie überhaupt nicht mehr zu besitzen. Ich bin nicht gern, gnädiger Herr, der Besitzer von etwas Halbem, lieber will ich zu den ganz Besitzlosen gehören, dann gehört mir meine Seele wenigstens noch an. Sie werden denken, es zieme sich wenig, so heftig zu reden, und dies sei auch nicht der schickliche Ort zu einer Rede: Wohlan, ich schweige, bezahlen Sie mich, wie es mir zukommt, und Sie werden mich nie wieder zu Gesicht bekommen.«
Der alte Buchhändler war ganz erstaunt, den jungen, stillen, schüchternen Menschen, der während der acht Tage so zuverlässig gearbeitet hatte, nun in solcher Weise sprechen zu hören. Aus dem anstoßenden Arbeitsraume sahen und horchten einige fünf zusammengedrängte Köpfe von Beamten und Handlungsdienern der Szene zu. Der alte Herr sprach: »Wenn ich das von Ihnen vermutet hätte, Herr Simon, würde ich mich besonnen haben, Ihnen in meinem Geschäfte Arbeit zu geben. Sie scheinen ja ganz merkwürdig wankelmütig zu sein. Weil Ihnen ein Schreibpult nicht paßt, will Ihnen gleich das Ganze nicht passen. Aus welcher Gegend der Welt kommen Sie denn her und gibt es dort lauter junge Leute von Ihrem Schlag? Sehen Sie, wie Sie nun vor mir altem Manne dastehen. Sie wissen wohl selbst nicht, was Sie in Ihrem unreifen Kopf eigentlich wollen. Nun, ich halte Sie nicht davon ab, von mir wegzugehen, hier ist Ihr Geld, aber offen gestanden, es hat mir nicht Freude gemacht.« Der Buchhändler zahlte ihm sein Geld aus, Simon strich es ein.
Als er nach Hause kam, sah er den Brief seines Bruders auf dem Tisch liegen, er las ihn und dachte dann bei sich: »Er ist ein guter Mensch, aber ich werde ihm nicht schreiben. Ich verstehe es nicht, meine Lage zu schildern, sie ist auch gar nicht des Beschreibens wert. Zu Klagen habe ich keinen Anlaß, zu Freudesprüngen ebensowenig, zu schweigen allen Grund. Es ist wahr, was er schreibt, aber eben deshalb will ich es bei der Wahrheit bewenden lassen. Daß er unglücklich ist, hat er mit sich selbst abzumachen, aber ich glaube gar nicht, daß er so sehr unglücklich ist. Das klingt in Briefen so. Man wird während des Schreibens einfach fortgerissen zu unvorsichtigen Äußerungen. In den Briefen will die Seele immer zu Wort kommen und sie blamiert sich in der Regel. Ich schreibe also lieber nicht.« – Damit war die Sache abgetan. Simon war voller Gedanken, schöner Gedanken. Wenn er dachte, kam er ganz unwillkürlich auf schöne Gedanken. Am nächsten Morgen, die Sonne blendete hell, meldete er sich beim Stellenvermittlungsbureau. Der Mann, der dort saß und schrieb, stand auf. Der Mann kannte Simon sehr gut und pflegte mit ihm mit einer Art spöttischer, hübscher Vertrautheit zu verkehren. »Ah, Herr Simon! Sind Sie wieder da! In welcher Angelegenheit kommen Sie denn?«
»Ich suche eine Stelle.«
»Sie haben schon zu wiederholten Malen Stelle gesucht bei uns, man möchte versucht sein, zu sagen: Sie suchen mit einer unheimlichen Schnelligkeit Stellen.« Der Mann lachte, aber leise, denn eines groben Lachens war er doch nicht fähig. »Wo waren Sie denn zuletzt beschäftigt, wenn man Sie fragen darf?«
Simon erwiderte: »Ich war Krankenwärter, und es stellte sich heraus, daß ich alle Eigenschaften besitze, um die Kranken pflegen zu können. Warum staunen Sie so sehr bei dieser Eröffnung? Ist es so fürchterlich seltsam, wenn ein Mann in meinem Alter verschiedenen Berufsarten nachgeht, wenn er den Versuch macht, sich den verschiedenartigsten Menschen nützlich zu erweisen? Ich finde das hübsch an mir, weil ich dabei etwas tue, was einen gewissen Mut erfordert. Mein Stolz wird in keiner Weise verletzt dadurch, im Gegenteil, ich bilde mir etwas darauf ein, allerhand Lebensaufgaben lösen zu können und nicht vor Schwierigkeiten zu zittern, vor denen die meisten Menschen zurückschrecken. Man kann mich brauchen, diese Gewißheit genügt mir, um meinen Stolz zu befriedigen. Ich will nützlich sein.«
»Warum sind Sie denn nicht bei dem Krankenwärterberuf geblieben?« fragte der Mann.
»Ich habe keine Zeit, bei einem und demselben Beruf zu verbleiben,« erwiderte Simon, »und es fiele mir niemals ein, wie so viele andere, auf einer Berufsart ausruhen zu wollen wie auf einem Sprungfederbett. Nein, das bringe ich, und wenn ich tausend Jahre alt werde, nicht fertig. Lieber gehe ich unter die Soldaten.«
»Passen Sie auf, daß es nicht mit Ihnen noch so weit kommt.«
»Es gibt auch noch andere Auswege. Das mit den Soldaten ist eine flüchtige Redensart von mir, die ich mir angewöhnt habe, um meine Reden zu beschließen. Was hat ein junger Mann, wie ich, nicht für Auswege. Ich kann, wenn es Sommer ist, zu einem Bauern gehen, ihm auf dem Felde helfen, daß die Ernte beizeiten unter Dach kommt, er wird mich willkommen heißen und meine Kraft schätzen. Er wird mir zu essen geben, gutes Essen, denn man kocht gut auf dem Lande, er wird mir, wenn ich von ihm wegziehe, etwas Bargeld in die Hand drücken, und seine junge Tochter, ein frisches, bildschönes Mädchen, wird mir zum Abschied zulächeln, in einer Weise, daß ich lange daran denken muß, während ich weiter wandere. Was schadet es, zu wandern, auch wenn es regnet oder gar schneit, wenn man seine gesunden Glieder hat und sich weiter keine Sorgen macht. Sie, in Ihrer gedrückten Enge, stellen sich nicht vor, wie köstlich das Laufen auf Landstraßen ist. Sind sie staubig, so sind sie es eben, wer frägt da lange darnach. Nachher sucht man sich an einem Waldrande ein kühles Plätzchen aus, wo der Blick, wenn man so daliegt, die herrlichste Aussicht genießt, wo die Sinne auf eine natürliche Weise ausruhen und die Gedanken nach Lust und Geschmack denken können. Sie werden mir entgegenhalten, das könne ein anderer, zum Beispiel Sie selber, auch haben, während Ihrer Ferien. Aber Ferien, was ist das! Darüber kann ich nur lachen. Ich will mit Ferien nichts zu tun haben. Ich hasse die Ferien geradezu. Verschaffen Sie mir nur nicht einen Posten mit Ferien. Das hat nicht den geringsten Reiz für mich, ja ich würde sterben, wenn ich Ferien bekäme. Ich will mit dem Leben kämpfen, bis ich meinetwegen umsinke, will weder Freiheit noch Bequemlichkeit kosten, ich hasse die Freiheit, wenn ich sie so hingeworfen bekomme, wie man einem Hund einen Knochen hinwirft. Da haben Sie Ihre Ferien. Wenn Sie etwa denken, Sie hätten in mir einen Menschen vor sich, den es nach Ferien gelüstet, so irren Sie sich, aber ich habe leider alle Ursache, zu vermuten, Sie denken so von mir.«
»Hier ist eine Aushilfsstelle bei einem Advokaten zu besetzen, für ungefähr einen Monat. Paßt Ihnen das?«
»Gewiß, mein Herr.«
Damit war Simon beim Advokaten. Er verdiente dort ein ganz hübsches Geld und war ganz glücklich. Nie erschien ihm die Welt schöner, als während dieser Advokatenzeit. Er machte angenehme Bekanntschaften, schrieb leicht und mühelos den Tag über, rechnete Rechnungen nach, schrieb nach dem Diktat, was er außerordentlich gut verstand, betrug sich, zu seinem Erstaunen ganz reizend, so daß sein Vorgesetzter sich lebhaft um ihn bekümmerte, trank jeweilen nachmittags seine Tasse Tee, und träumte, während er schrieb, zum luftigen, hellen Fenster hinaus. Träumen, und doch seine Pflicht nicht hintenansetzen, das verstund er prächtig. »Ich verdiene so viel Geld, dachte er bei sich, daß ich eine junge Frau damit haben könnte.« Der Mond schien oft, wenn er arbeitete, zum Fenster hinein, das entzückte ihn sehr.
Seiner kleinen Freundin Rosa gegenüber äußerte sich Simon folgendermaßen: »Mein Advokat hat eine lange, rote Nase und ist ein Tyrann, aber ich komme sehr gut aus mit ihm. Ich empfinde sein mürrisches, gebieterisches Wesen als Humor und wundere mich, wie gut ich mich allen seinen, und oft ungerechten Geboten unterziehe. Ich liebe es, wenn es ein wenig scharf zugeht, das paßt mir, das schwingt mich bis zu einer gewissen warmen Höhe hinauf und reizt meine Arbeitslust. Er hat eine schöne, schlanke Frau, die ich malen möchte, wenn ich ein Maler wäre. Sie hat, glauben Sie es nur, wunderbar große Augen und herrliche Arme. Oft macht sie sich etwas bei uns im Bureau zu schaffen; wie muß sie da auf mich armen Schreibteufel herabsehen. Ich zittere, wenn ich solche Frauen sehe und bin doch glücklich. Lachen Sie? Ihnen gegenüber bin ich leider gewöhnt, ohne Schranken offen zu sein, und ich hoffe, Sie sehen das gerne an mir.«
Rosa liebte es in der Tat, wenn man offen zu ihr war. Sie war ein merkwürdiges Mädchen. Ihre Augen hatten einen wundervollen Glanz, und ihre Lippen waren geradezu schön.
Simon fuhr fort: »Wenn ich morgens um acht Uhr zur Arbeit gehe, fühle ich mich so schön verwandt mit allen denen, die ebenfalls morgens um acht Uhr anzutreten haben. Welche große Kaserne, dieses moderne Leben! Und doch wie schön und gedankenvoll ist gerade diese Einförmigkeit. Man sehnt sich beständig nach etwas, das an einen herantreten sollte, das einem begegnen müßte. Man hat ja so sehr nichts, ist so sehr armer Teufel, kommt sich so verloren vor in all der Gebildetheit, Geordnetheit und Exaktheit. Ich steige die vier Treppen hinauf und trete ein, sage guten Tag und beginne mit meiner Arbeit. Du guter Gott, wie wenig muß ich leisten, wie wenig Kenntnisse verlangt man doch von mir. Wie wenig scheint man zu ahnen, daß ich noch ganz anderes fähig wäre. Aber mir behagt jetzt diese reizende Anspruchslosigkeit seitens meiner Arbeitgeber. Ich kann, während ich arbeite, denken, ich habe alle Aussicht ein Denker zu werden. Ich denke oft an Sie!«
Rosa lachte: »Sie sind ein Schlingel! Aber fahren Sie fort, es interessiert mich, was Sie da sagen.«
»Die Welt ist eigentlich herrlich,« sprach Simon weiter, »ich kann da bei Ihnen sitzen, und es hindert mich niemand daran, stundenlang mit Ihnen zu plaudern. Ich weiß, daß Sie mir gerne zuhören. Sie finden, daß ich nicht ohne Anmut spreche, und ich muß jetzt innerlich furchtbar lachen, weil ich das gesagt habe. Aber ich sage eben alles, was mir gerade durch den Sinn schießt, wäre es auch zum Beispiel gerade ein Eigenlob. Ich kann mich auch mit ebensolcher Leichtigkeit tadeln, und es freut mich sogar, wenn ich dazu Gelegenheit habe. Sollte man denn nicht alles aussprechen dürfen? Wie vieles geht verloren, wenn man es erst langsam prüfen will. Ich mag nicht lange überlegen, bevor ich spreche, und ob es sich schickt oder nicht, es muß eben heraus. Wenn ich eitel bin, so muß eben meine Eitelkeit ans Licht treten, wäre ich geizig, der Geiz spräche aus meinen Worten, bin ich anständig, so wird ohne Zweifel die Honettheit aus meinem Munde tönen, und würde mich Gott zu einem braven Menschen gemacht haben, so redete die Tüchtigkeit aus mir, was ich auch immer spräche. Ich bin in dieser Beziehung ganz sorglos, weil ich mich und uns ein wenig kenne und weil ich mich davor schäme, im Gespräch Furcht zu bezeigen. Wenn ich beispielsweise mit Worten jemanden beleidige, verletze, kränke oder ärgere, kann ich den üblen Eindruck nicht mit den paar nächsten Worten wieder gutmachen? Ich denke über mein Sprechen erst nach, wenn ich auf dem Gesicht meines Zuhörers unangenehme Falten sehe, so wie jetzt auf Ihrem Gesicht, Rosa.«
»Das ist etwas anderes.« –
»Sind Sie müde?«
»Gehen Sie nach Hause, nicht wahr, Simon. Ich bin allerdings jetzt müde. Sie sind hübsch, wenn Sie sprechen. Ich habe Sie sehr lieb.«
Rosa streckte ihrem jungen Freund ihre kleine Hand entgegen, dieser küßte die Hand, sagte gute Nacht und ging fort. Als er weg war, weinte die kleine Rosa lange still für sich. Sie weinte um ihren Geliebten, einen jungen Mann mit Locken auf dem Kopf, elegantem Schritt, edelgeschnittenem Mund, aber liederlicher Lebensart. »So liebt man die, die es nicht wert sind,« sagte sie für sich, »und doch, liebt man etwas deshalb, weil man einen Wert abschätzen möchte? Wie lächerlich. Was geht mich das Wertvolle an, wo ich das Geliebte haben möchte.« Dann ging sie zu Bett.
Zweites Kapitel.
Eines Tages klingelte Simon, es war in der Mittagsstunde, vor einem eleganten, freigelegenen Hause, das einen Garten hatte, ziemlich schüchtern an. Ihm war, als ob da ein Bettler geklingelt hätte, wie er es läuten hörte. Wenn er jetzt drinnen im Hause zum Beispiel als Hausinhaber gesessen hätte, vielleicht gerade beim Mittagstisch, würde er, sich zu seiner Frau träge umwendend, gefragt haben: Wer klingelt denn jetzt, gewiß ein Bettler! »Vornehme Leute,« dachte er, während er wartete, »denkt man sich immer an der Tafel, oder in der Kutsche, oder beim Anziehen, wo ihnen Diener und Dienerinnen behilflich sind, dagegen Arme immer draußen in der Kälte, mit emporgezogenen Mantelkragen, wie ich jetzt, vor einer Gartentür herzpochend wartend. Arme Leute haben in der Regel schnelle, pochende, hitzige Herzen, Reiche kalte, weite, geheizte, gepolsterte und vernagelte! Ach, wenn nur rasch jemand herbeigesprungen käme, wie würde ich aufatmen. Dieses vor einer reichen Türe Warten hat etwas Beengendes. Wie stehe ich doch, trotz meinem bißchen Welterfahrung, auf schwachen Beinen.« – In der Tat, er zitterte, als ein Mädchen herbeisprang, um dem Draußenstehenden zu öffnen. Simon mußte immer lächeln, wenn jemand ihm eine Tür öffnete und ihn zum Eintreten ersuchte, auch jetzt ging es nicht ohne dieses Lächeln ab, das wie eine leise Bitte im Gesicht aussah, und das vielleicht bei vielen Menschen zu beobachten ist.
»Ich suche ein Zimmer.«
Simon nahm seinen Hut vor einer schönen Dame ab, die den Ankommenden aufmerksam prüfte. Simon war es lieb, daß sie das tat; denn er fühlte, daß sie ein Recht dazu hatte, und weil er sah, daß sie dabei ihre Freundlichkeit nicht verlor.
»Wollen Sie kommen? Da! Die Treppe hinauf.«
Simon bat die Dame, voranzugehen. Er machte dabei zum ersten Male in seinem Leben mit der Hand eine Handbewegung. Die Dame zeigte dem jungen Mann das Zimmer, indem sie eine Tür öffnete.
»Welch ein schönes Zimmer,« rief Simon, der wirklich überrascht war, »viel zu schön für mich, leider, viel zu fein für mich. Sie müssen wissen, ich bin ein so wenig für ein so feines Zimmer geeigneter Mensch. Und doch, ich würde sehr gerne darin wohnen, allzugerne, viel, vielzugerne. Es ist eigentlich von Ihnen nicht gut getan gewesen, mir dieses Gemach zu zeigen. Viel besser, Sie würden mich zu Ihrem Hause hinausgewiesen haben. Wie komme ich dazu, meine Blicke in einen so heiteren, schönen, wie als Wohnung für einen Gott geschaffenen Raum zu werfen. Welch schöne Wohnungen bewohnen doch die Wohlhabenden, die, die etwas besitzen. Ich habe nie etwas besessen, bin nie etwas gewesen, und werde trotz den Hoffnungen meiner Eltern nie etwas sein. Welch schöne Aussicht aus den Fenstern, und so hübsche, glänzende Möbel, und so reizende Vorhänge, die dem Zimmer etwas Mädchenhaftes geben. Ich würde hier vielleicht ein guter, zarter Mensch werden, wenn es wahr ist, wie man sagen hört, daß Umgebungen den Menschen verändern können. Darf ich es noch ein wenig anschauen, hier noch eine Minute stehen bleiben?«
»Gewiß dürfen Sie das.«
»Ich danke Ihnen.«
»Was sind Ihre Eltern, und, wenn ich fragen darf, inwiefern sind Sie »nichts«, wie Sie sich vorhin ausdrückten?«
»Ich bin ohne Stelle!«
»Das würde mir ganz gleichgültig sein. Es kommt drauf an!«
»Nein, ich habe wenig Hoffnungen. Zwar, das darf ich, wenn ich ohne Falsch sprechen soll, auch nicht sagen. Ich bin voll Hoffnung. Nie, nie verläßt sie mich. – Mein Vater ist ein armer, aber lebensfröhlicher Mensch, dem es nicht einmal von ferne einfällt, seine jetzigen kargen Tage mit den früheren glänzenden zu vergleichen. Er lebt wie ein Junger von fünfundzwanzig Jahren und gibt sich in keiner Weise Gedanken über seine Lage hin. Ich bewundere ihn und suche ihn nachzuahmen. Wenn er bei seinem schneeweißen Alter noch munter sein kann, so muß es dreißig-, ja hundertmal seines jungen Sohnes Pflicht sein, den Kopf hoch zu tragen und die Menschen mit Augen wie der Blitz anzuschauen. Aber die Mutter gab mir, und meinen Brüdern weit mehr als mir, Gedanken mit auf die Welt. Die Mutter ist gestorben.«
Der Dame, die sehr lieb dastand, kam ein klagendes Ach aus dem Munde.
»Sie war eine herzlich gute Frau. Wir Kinder sprechen immer und immer über sie, wann und wo wir auch immer zusammentreffen. Wir leben zerstreut auf dieser runden, weiten Welt, und das ist sehr gut, denn wir haben alle solche Köpfe, wissen Sie, die nicht lange zueinander taugen. Wir haben alle eine etwas schwere Art, die hinderlich sein würde, wenn wir verbunden unter den Menschen aufträten. Das tun wir gottlob nicht, und jedes von uns weiß genau, warum wir es nicht tun wollen. Doch lieben wir uns, wie es sich geziemt. Einer meiner Brüder ist ein nicht unbekannter Gelehrter, ein anderer ist ein Spezialist im Börsenfach, wieder ein anderer ist weiter nichts als mein Bruder, weil ich ihn mehr als einen Bruder liebe, und es mir, wenn ich an ihn denke, nicht einfiele, noch sonst etwas anderes hervorzuheben an ihm, als eben den Umstand, daß er der meinige ist, der, der so aussieht, wie er, sonst nichts. Mit diesem Bruder zusammen möchte ich hier bei Ihnen wohnen. Groß genug wäre das Zimmer. Aber es geht wohl nicht gut. Wieviel kostet es?«
»Was ist Ihr Bruder?«
»Landschaftsmaler! Wieviel würden Sie für das Zimmer verlangen? – – So viel? Es ist sicherlich nicht zu viel für dieses Zimmer, aber für uns ist es viel zu viel. Auch, wenn ich recht bedenke, und wenn ich Sie eindringlich anschaue, sind wir zwei Menschen nicht dazu geeignet, in diesem Hause aus- und einzugehen, als ob wir darin ansässig wären. Wir sind noch so grob, wir würden Sie enttäuschen. Auch haben wir die Gewohnheit, mit Bettbezügen, Möbelstücken, Wäschegegenständen, Fenstervorhängen, Türklinken, Treppenabsätzen hart umzugehen, das würde Sie erschrecken, Sie würden uns böse werden, oder Sie würden vielleicht verzeihen, ein Auge bemühen zuzudrücken, was noch schmählicher wäre. Ich möchte nicht veranlassen, daß Sie später mit uns Ärger hätten. Sicher, sicher! Wehren Sie nur nicht ab. Ich sehe es zu deutlich. Wir haben, im Grunde genommen, für alles feine Wesen auf die Länge wenig Hochachtung übrig. Dergleichen Menschen, wie wir sind, müssen vor reichen Gartengittern stehen, wo ihnen die Freiheit gelassen wird, über den Glanz und die Sorgfalt spöttische Bemerkungen zu machen. Wir sind Spötter! Adieu!«
Die Augen der schönen Frau hatten einen tiefen Glanz angenommen, und nun sagte sie auf einmal: »Ich möchte doch Ihren Herrn Bruder und Sie annehmen. Ich werde, was den Preis betrifft, mit Ihnen schon einig werden.«
»Nein lieber nicht!«
Simon schritt schon die Treppe hinunter. Da rief ihm die Stimme der Dame nach: »Bitte, bleiben Sie doch noch.« Und sie eilte ihm nach. Unten holte sie ihn ein und veranlaßte ihn, stehen zu bleiben und auf sie zu horchen: »Was fällt Ihnen ein, so schnell wegzugehen. Sehen Sie, ich will, ich möchte Sie beide dabehalten. Und wenn Sie auch nicht bezahlen! Was macht das? Gar nichts, gar nichts, kommen Sie doch, kommen Sie. Treten Sie mit mir in dieses Zimmer. Marie! Wo bist du? Bringe doch gleich den Kaffee hier ins Zimmer.«
Drinnen sagte sie zu Simon: »Ich habe den Wunsch, Sie und Ihren Bruder näher kennen zu lernen. Wie konnten Sie nur davonrennen. Ich bin oft so allein in diesem abgelegenen Hause, daß es mich ängstigt. Mein Mann ist die ganze Zeit abwesend, auf weiten Reisen, er ist Forscher, segelt auf allen Meeren, von deren bloßem Vorhandensein seine arme Frau keine Ahnung hat. Bin ich nicht eine arme Frau? Wie heißen Sie? Wie heißt der andere, Ihr Bruder? Ich heiße Klara. Nennen Sie mich einfach: Frau Klara. Ich mag gern diesen einfachen Namen hören. Sind Sie nun etwas zutraulicher geworden? Würde mich sehr, so sehr freuen. Glauben Sie nicht, das wir miteinander leben und auskommen können? Gewiß, das wird schon gehen. Ich halte Sie für einen zarten Menschen. Ich fürchte mich nicht, Sie in meinem Hause zu haben. Sie haben ehrliche Augen. Ist Ihr Bruder älter als Sie?«
»Ja, er ist älter und ein viel besserer Mensch, als ich.«
»Sie sind ein braver Mensch, daß Sie das sagen dürfen.«
»Ich heiße Simon und mein Bruder heißt Kaspar.«
»Mein Mann heißt Agappaia.«
Sie erbleichte, als sie das sagte, doch sammelte sie sich rasch und lächelte.
Simon schrieb an seinen Bruder Kaspar: »Wir sind eigentlich seltsame Käuze, wir zwei. Wir treiben uns auf diesem Erdboden umher, als ob nur wir, und sonst keine anderen Menschen darauf lebten. Wir haben eigentlich eine verrückte Freundschaft geschlossen, als ob es sonst unter den Männern nichts ausfindig zu machen gäbe, was wert könnte genannt werden, Freund zu heißen. Eigentlich sind wir gar keine Brüder, sondern Freunde, wie zwei sich einmal auf der Welt zusammenfinden. Ich bin wirklich nicht für die Freundschaft gemacht und begreife nicht, was ich so Tolles an Dir nur finde, das mich zwingt, mich immer wieder an Deine Seite, gleichsam an Deinen Rücken heranzudenken. Dein Kopf kommt mir jetzt bald wie der meinige vor, so sehr bist Du schon in meinem Kopf; ich werde vielleicht im Verlauf einiger Zeit, wenn es so weiter geht, mit Deinen Händen greifen, mit Deinen Beinen laufen und mit Deinem Mund essen. Unsere Freundschaft hat sicher etwas Geheimnisvolles, wenn ich Dir sage, daß es gar nicht so unmöglich ist, daß im Grunde genommen unsere Herzen voneinander wegstreben, daß sie nur nicht können. Ich bin ja nun noch recht froh, daß Du noch immer nicht zu können scheinst, denn Deine Briefe klingen sehr artig und ich wünsche vorläufig auch von mir, daß ich im Banne dieses Geheimnisvollen sitzen bleibe. Für uns ist es ja gut, aber, wie kann ich nur gar so trocken reden: ich finde es einfach, um nicht zu lügen, entzückend. Warum sollten nicht einmal zwei Brüder über das Maß hauen. Wir passen ganz gut zusammen, wir paßten auch schon damals zusammen, als wir uns haßten und beinahe totprügelten. Weißt Du noch? Es braucht nichts als diesen Aufruf, mit einer Portion gesunden Lachens vermischt, um in Dir Bilder aufzurühren, zu leimen, zu malen, zu heften, die wahrhaftig der Rückerinnerung mehr als wert sind. Wir waren, ich weiß nicht mehr aus welcher Ursache heraus, Todfeinde geworden. O, wir verstunden es, einander zu hassen. Unser Haß war entschieden erfinderisch im Auffinden von Qualen und Demütigungen, die wir uns gegenseitig bereiteten. Beim Eßtisch warfst Du mir einmal, um nur ein einziges Beispiel dieses jammervollen und kindischen Zustandes anzuführen, eine Platte mit Sauerkraut entgegen, weil Du mußtest, und sagtest dazu: »Da, pack!« Ich muß Dir sagen, damals zitterte ich vor Wut, schon deshalb, weil es für Dich eine schöne Gelegenheit war, mich aufs grimmigste zu kränken, und ich dazu nichts sagen konnte. Ich packte die Platte an, und war eben dumm genug, den Schmerz der Kränkung bis zur Kehle hinauf voll auszukosten. Weißt Du noch, wie eines Mittags, es war ein stiller, totenstiller, sommerheißer, vor Totenstille ganz toller Sonntagnachmittag, dann einer zu Dir in die Küche herangezaudert kam und Dich bat, mir wieder gut zu sein. Es war ein unglaubliches Werk der Überwindung, kann ich Dir sagen, sich so durch das Gefühl der Beschämung und des Trotzes hindurchzuwinden, bis zu Dir, der Gestalt des zur ablehnenden Verachtung neigenden Feindes. Ich tat es, und ich bin mir dankbar dafür. Ob Du auch mir, ist mir freudig und duftig egal. Das kann nur ich abschätzen. Geh mir weg, da willst Du mir was dazwischenreden. Einfach nicht möglich. Weg da! – Wie viele köstliche Stunden habe ich von da an mit Dir genossen. Ich fand dich auf einmal zart, liebend rücksichtsvoll. Ich glaube, die Wonne der Freude brannte uns beiden auf den Wangen. Wir streiften, Du als Maler, ich als Zuschauer und Dreinreder, über die Matten auf den breiten Bergen, wateten im Duft des Grases, in der Nässe des kühlen Morgens, in der Hitze des Mittags und im feuchten, verliebten Untergehen der Sonne. Die Bäume sahen uns zu, was wir da oben trieben und die Wolken ballten sich zusammen, gewiß aus Zorn, daß sie keine Macht besaßen, unsere neugebackene Liebe zu brechen. Abends kamen wir gräßlich zerbrochen, verstaubt, verhungert und vermüdet nach Hause, und auf einmal gingst Du dann weg. Weiß der Teufel, ich half Dir wegreisen, als ob ich dazu durch Handgeld verpflichtet gewesen wäre, oder als hätte ich Eile gehabt, Dich verduften zu sehen. Gewiß war es mir eine heilige Freude, Dich abreisen zu sehen, denn Du reistest der großen Welt entgegen. Wie wenig groß ist die große Welt, Bruder.
Komm doch ja bald hierher. Ich kann Dich beherbergen, wie ich eine Braut beherbergen würde, von der ich annehmen müßte, daß sie gewohnt sei, auf Seide zu liegen und von Bedienten bedient zu werden. Ich habe zwar keine Dienerschaft, aber doch ein Zimmer wie für einen gebornen Herrn. Ich und Du, wir beide haben ein prachtvolles Chambre einfach geschenkt, vor die Füße gelegt bekommen. Du kannst hier ebensogut Bilder malen, wie dort in Deiner dicken, fernen Landschaft, Du hast ja Phantasie. Eigentlich sollte es jetzt Sommer sein, daß ich Deinetwegen im Garten ein Gartenfest mit chinesischen Lichtern und Bändern von lauter Blumen veranstalten könnte, um Dich einigermaßen Deiner würdig zu empfangen. Komm eben so, aber mach nur, daß dieses Kommen rasch vorwärtskommt, sonst komme ich und hole Dich. Meine Herrin und Wirtin drückt Dir die Hand. Sie ist davon überzeugt, daß sie Dich bereits aus meinen Schilderungen von Dir kennt. Wenn sie Dich erst kennen wird, wird sie weiter auf der Erde niemand mehr kennen lernen wollen. Hast Du einen stattlichen Anzug? Schlottern Dir Deine Hosen nicht gar so sehr um die Kniee herum und darf man Deine Kopfbedeckung noch Hut nennen? Sonst darfst Du nicht vor mir erscheinen. Alles Spaß, alles Dummheiten. Laß Dich von Deinem Simönchen umarmen. Leb wohl, Bruder. Hoffentlich kommst Du bald.« –
Einige Wochen waren verflossen, es fing an, wieder Frühling zu werden, die Luft war feuchter und weicher, es meldeten sich unbestimmte Düfte und Klänge, die aus der Erde herauszukommen schienen. Die Erde war weich, man schritt auf ihr wie auf dicken, biegsamen Teppichen. Man glaubte, Vögel singen hören zu müssen. »Es will Frühling werden,« so redeten sich die empfindungsvollen Menschen auf der Straße an. Selbst die kahlen Häuser bekamen einen gewissen Duft, eine sattere Farbe. Es ging ganz sonderbar zu, und war doch eine so alte, bekannte Erscheinung, aber man empfand es als gänzlich neu, es regte zu einem seltsamen, stürmischen Denken an, die Glieder, die Sinne, die Köpfe, die Gedanken, alles regte sich, wie wenn es hätte von neuem wachsen mögen. Das Wasser des Sees glänzte so warm und die Brücken, die sich über den Fluß schlangen, schienen einen kühneren Bogen bekommen zu haben. Die Fahnen flatterten im Winde, und es machte den Menschen Vergnügen, sie flattern zu sehen. Die Sonne erst trieb die Leute in Reihen und Gruppen auf die schöne, weiße, saubere Straße, wo sie stehen blieben und den Kuß der Wärme begierig fühlten. Viele Mäntel von vielen Menschen wurden abgelegt. Man konnte die Männer wieder freier sich bewegen sehen und die Frauen machten so sonderbare Augen, als möchte ihnen etwas Seeliges zu den Herzen herauskommen. In den Nächten hörte man wieder zum ersten Mal den Klang der vagabondierenden Gitarren, und Männer und Frauen standen im Gewühl der fröhlichen, spielenden Kinder. Die Lichter der Laterne flackten wie Kerzen in stillen Stuben, und man empfand, wenn man über nachtdunkle Wiesen hinschritt, das Blühen und Regen der Blumen. Das Gras wird bald wieder wachsen, die Bäume werden ihr Grün bald wieder über die niederen Hausdächer schütten und den Fenstern die Aussicht nehmen. Der Wald wird prangen, üppig, schwer, o, der Wald. – – Simon arbeitete wieder in einem großen Handelsinstitut.
Es war ein Bankhaus von weltbedeutendem Umfang, ein großes Gebäude von palastähnlichem Aussehen, in welchem hunderte von jungen und alten, männlichen und weiblichen Leuten beschäftigt waren. Diese Leute schrieben alle mit emsigen Fingern, rechneten mit Rechnungsmaschinen, auch wohl bisweilen mit ihren Gedächtnissen, dachten mit ihren Gedanken und machten sich nützlich mit ihren Kenntnissen. Es gab da etliche junge, elegante Korrespondenten, die vier bis sieben Sprachen schreiben und sprechen konnten. Diese schieden sich durch ihr feineres, ausländisches Wesen von dem übrigen Rechnervolk aus. Sie waren schon auf Meerschiffen gefahren, kannten die Theater in Paris und New-York, hatten in Jokohama die Teehäuser besucht und wußten, wie man sich in Kairo vergnügte. Nun besorgten sie hier die Korrespondenz und warteten auf Gehaltserhöhung, während sie spöttisch von der Heimat sprachen, die ihnen ganz klein und lausig vorkam. Das Rechnervolk bestund zumeist aus älteren Leuten, die sich an ihre Posten und Pöstlein wie an Balken und Pflöcken festhielten. Sie hatten alle lange Nasen von dem vielen Rechnen und gingen in zersessenen, zerschabten, zerglätteten, zerfalteten und zerknickten Kleidern. Es gab aber etliche intelligente Leute unter ihnen, die vielleicht im Geheimen seltsamen, kostbaren Liebhabereien frönten und so ein wenn auch stilles und abgelegenes so doch immerhin würdiges Leben führten. Viele von den jungen Angestellten waren dagegen feinerer Zeitvertreibe nicht fähig, diese stammten meist von ländlichen Grundbesitzern, Gastwirten, Bauern und Handwerkern ab, waren, da sie in die Stadt kamen, sofort bemüht, städtisch-feines Wesen anzunehmen, was ihnen jedoch schlecht gelang, und kamen über eine gewisse tölpische Grobheit nicht hinaus. Indessen, es gab da auch stille Bürschchen von zartem Betragen, die seltsam abstachen von den andern Flegeln. Der Direktor der Bank war ein alter, stiller Mann, der überhaupt nie gesehen wurde. In seinem Kopfe schienen die Fäden und Wurzeln des ganzen ungeheuren Geschäftsganges ineinandergeworfen zu liegen. Wie der Maler in Farben, der Musiker in Tönen, der Bildhauer in Stein, der Bäcker in Mehl, der Dichter in Worten, der Bauer in Strichen Landes, so schien dieser Mann in Geld zu denken. Ein guter Gedanke von ihm, zur guten Zeit ausgedacht, brachte in einer halben Stunde dem Geschäft eine halbe Million. Vielleicht! Vielleicht mehr, vielleicht weniger, vielleicht nichts, und gewiß, manchmal verlor dieser Mann ganz im stillen, und alle seine Untergebenen wußten nichts davon, gingen, wenn die Glocke zwölf schlug, zum Essen, kamen um zwei Uhr wieder, arbeiteten vier Stunden, gingen fort, schliefen, erwachten, standen zum Frühstück auf, gingen wieder, wie am gestrigen Tag ins Gebäude, nahmen die Arbeit wieder auf und keiner wußte, denn keiner hatte Zeit, etwas von diesem Geheimnisvollen in Erfahrung zu bringen. Und der stille, alte, grämliche Mann dachte im Direktionszimmer. Für die Angelegenheiten seiner Angestellten hatte er nur ein mattes, halbes Lächeln. Es hatte etwas Dichterisches, Erhabenes, Entwerfendes und Gesetzgeberisches. Simon versuchte oft, sich in Gedanken an die Stelle des Direktors zu setzen. Aber im allgemeinen verschwand ihm dieses Bild, und wenn er darüber nachdachte, verschwand ihm überhaupt jeder Begriff: »Etwas Stolzes und Erhabenes ist dabei, aber auch etwas Unbegreifliches und beinahe Unmenschliches. Warum gehen nur alle diese Leute, Schreiber und Rechner, ja sogar die Mädchen im zartesten Alter, zu demselben Tor in dasselbe Gebäude hinein, um zu kritzeln, Federn anzuprobieren, zu rechnen und zu fuchteln, zu büffeln und nasenschneuzen, zu bleistiftspitzen und Papier in den Händen herumtragen. Tun sie das etwa gern, tun sie es notgedrungen, tun sie es mit dem Bewußtsein, etwas Vernünftiges und Fruchtbringendes zu verrichten? Sie kommen alle aus ganz verschiedenen Richtungen, ja einige fahren sogar mit der Eisenbahn aus entfernten Gegenden daher, sie spitzen die Ohren, ob es noch Zeit ist, vor Antritt einen privaten Gang zu unternehmen, sie sind so geduldig dabei wie eine Herde von Lämmern, verstreuen sich, wenn es Abend wird, wieder in ihre speziellen Richtungen, und morgen, um dieselbe Zeit, finden sie sich alle wieder ein. Sie sehen sich, erkennen sich am Gang, an der Stimme, an der Manier, eine Türe zu öffnen, aber sie haben wenig miteinander zu tun. Sie gleichen sich alle und sind sich doch alle fremd und wenn einer unter ihnen stirbt oder eine Unterschlagung macht, so verwundern sie sich einen Vormittag lang darüber, und dann geht es weiter. Es kommt vor, daß einer einen Schlaganfall bekommt während des Schreibens. Was hat er dann davon gehabt, daß er fünfzig Jahre lang im Geschäft »arbeitete«. Er ist fünfzig Jahre lang jeden Tag zu derselben Türe ein und ausgegangen, er hat tausend und tausendmal in seinen Geschäftsbriefen dieselbe Redewendung geübt, hat etliche Anzüge gewechselt und sich öfters darüber gewundert, wie wenig Stiefel er des Jahres verbrauche. Und jetzt? Könnte man sagen, daß er gelebt hat? Und leben nicht tausende von Menschen so? Sind vielleicht seine Kinder ihm der Lebensinhalt, ist seine Frau die Lust seines Daseins gewesen? Ja, das kann es sein. Ich will lieber über solche Dinge nicht klugreden, denn mir will scheinen, als zieme es mir nicht, da ich noch jung bin. Draußen ist jetzt Frühling und ich könnte zum Fenster hinausspringen, so weh tut mir dieses lange, lange Glieder-Nicht-Bewegen-dürfen. Ein Bankgebäude ist doch ein dummes Ding im Frühling. Wie nähme sich eine Bankanstalt etwa auf einer grünen, üppigen Wiese aus? Vielleicht würde meine Schreibfeder mir wie eine junge, eben aus der Erde gesprossene Blume vorkommen. Ach, nein, spotten mag ich nicht. Vielleicht muß das alles so sein, vielleicht hat alles einen Zweck. Ich erblicke nur nicht den Zusammenhang, weil ich zu sehr den Anblick erblicke. Der Anblick ist wenig entmutigend: vor den Fenstern dieser Himmel, im Gehör dieses süße Singen. Die weißen Wolken gehen am Himmel und ich muß da schreiben. Warum habe ich ein Auge für die Wolken. Wenn ich ein Schuhmacher wäre, so machte ich doch wenigstens Schuhe für Kinder, Männer und Damen, diese gingen im Frühlingstag in meinen Schuhen auf der Gasse spazieren. Ich würde den Frühling empfinden, wenn ich meinen Schuh an dem fremden Fuß erblickte. Hier kann ich den Frühling nicht empfinden, er stört mich.«
Simon ließ seinen Kopf hängen und war zornig über seine weichen Gefühle.
Eines Abends, als er nach Hause ging, fiel Simon auf der abendlich beleuchteten Brücke ein Mensch, der vor ihm mit langen Schritten daherging, auf. Die Gestalt in ihrer bemäntelten Schlankheit flößte ihm einen süßen Schrecken ein. Er glaubte diesen Gang, dieses Paar Hosen, diesen sonderbaren Kessel von Hut, die flatternden Haare erkennen zu sollen. Der fremde Mann trug eine leichte Malmappe unter dem Arm. Simon ging mit etwas rascheren Schritten, von zitternden Ahnungen befallen, und plötzlich, mit dem Schrei »Bruder«, stürzte er dem Gehenden an den Hals. Kaspar umarmte seinen Bruder. Sie gingen laut miteinander plaudernd nach Hause, das heißt, sie hatten einen ziemlich steilen Weg den Berg hinauf zu machen, über dessen Abhang sich die Stadt mit Gärten und Villen hinzog. Ganz oben am Berge schauten ihnen die kleinen, verfallenen Vorstadthäuschen entgegen. Die untergehende Sonne flammte in den Fenstern und machte sie zu strahlenden Augen, die starr und schön in die Ferne blickten. Unten lag die Stadt, weit und wohllüstig über die Ebene gebreitet, wie ein flimmernder, glitzernder Teppich, die Abendglocken, die immer anders sind als Morgenglocken, tönten herauf, der See lag schwach gezeichnet, in seiner zarten unaussprechlichen Form zu Füßen der Stadt, des Berges und der vielen Gärten. Noch blitzten viele Lichter nicht, aber die, die leuchteten, brannten mit einer herrlichen, fremdartigen Schärfe. Die Menschen gingen und liefen jetzt da unten in all den krummen, versteckten Straßen, man sah sie nicht, aber man wußte es. »In der eleganten Bahnhofstraße würde es jetzt herrlich zu gehen sein,« dachte Simon. Kaspar ging schweigend. Er war ein prachtvoller Kerl geworden. »Wie er daherschreitet,« dachte Simon. Endlich kamen sie vor ihrem Hause an. »Wie? Am Waldesrande wohnst du?« lachte Kaspar. Sie traten beide ins Haus.
Als Klara Agappaia den neuen Ankömmling erblickte, ging in ihren großen müden Augen ein seltsames Flammen auf. Sie schloß ihre Augen und bog ihren schönen Kopf auf die Seite. Es schien nicht, daß sie sehr große Freude empfunden hätte, diesen jungen Mann zu sehen, es erschien wie etwas ganz anderes. Sie versuchte unbefangen zu sein, zu lächeln, wie man zu lächeln pflegt, wenn man jemanden willkommen heißt. Aber sie vermochte es nicht. »Geht hinauf,« sagte sie, »heute bin ich so müde. Wie sonderbar. Ich weiß wirklich nicht, was ich habe.« Die beiden suchten ihr Zimmer auf: Der Mond beleuchtete es. »Wir zünden gar kein Licht an,« sagte Simon, »laß uns so zu Bette gehen.« – Da klopfte jemand an die Türe, es war Klara, sie sagte, draußen stehend: »Habt ihr auch alles Notwendige, fehlt euch nun nichts?« – »Nein, wir liegen schon im Bett, was könnte uns fehlen.« – »Gute Nacht, Freunde,« sagte sie, und öffnete ein wenig die Türe, schloß sie wieder und ging. »Sie scheint eine seltsame Frau zu sein,« meinte Kaspar. Dann schliefen sie beide.
Drittes Kapitel.
Am andern Morgen packte der Maler seine Landschaften aus der Mappe und es fiel zuerst ein ganzer Herbst heraus, dann ein Winter, alle Stimmungen der Natur wurden wieder lebendig. »Wie wenig das ist von allem dem, was ich gesehen habe. So schnell das Auge eines Malers ist, so langsam, so träge ist seine Hand. Was muß ich noch alles schaffen! Ich meine oft, ich müßte verrückt werden.« Alle drei, Klara, Simon und der Maler, umstanden die Bilder. Es wurde wenig, aber nur in Ausrufen des Entzückens gesprochen. Plötzlich sprang Simon zu seinem Hut, der auf dem Boden des Zimmers lag, setzte ihn wild und zornig auf den Kopf, stürzte zur Türe hinaus, mit dem Ausruf: »Ich habe mich verspätet.«
»Eine Stunde zu spät! Das sollte bei einem jungen Manne nicht vorkommen!« wurde ihm auf der Bank gesagt.
»Wenn es aber doch vorkommt?« fragte der Gescholtene trotzig.
»Wie, Sie wollen noch aufbegehren? Meinetwegen! Machen Sie, was Sie wollen!«
Das Betragen Simons wurde dem Direktor gemeldet. Dieser beschloß, den jungen Mann zu entlassen, er rief ihn zu sich und sagte es ihm mit ganz leiser, sogar gütiger Stimme. Simon sprach: