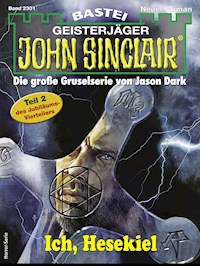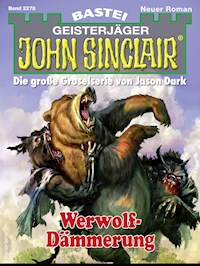1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Knochenkirche
Sedlec, 1511
Libor spürte das Ziehen und Reißen in seinen müden Gelenken. Gerade jetzt im November, wo die Nächte lang, kalt und feucht waren, fühlte er den Schmerz, der ihn nicht zur Ruhe kommen ließ. Er faltete die knotigen Hände zum stillen Gebet.
Langsam hob er den Kopf und blickte auf das große Kreuz, an dem der Leib des Erlösers hing. Seit mittlerweile sieben Nächten plagten ihn die Träume, machten die kurze Zeit, in der er Schlaf fand, zu einem Martyrium. Der Zisterzienser-Mönch war sich absolut sicher, dass nur Gott ihm diese Träume hatte schicken können, und dass der Herr von ihm einen letzten Dienst erwartete ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Die Knochenkirche
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati/BLITZ-Verlag
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-8185-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Die Knochenkirche
von Ian Rolf Hill
Wohin mit 40.000 Skeletten eines Klosterfriedhofs, die von Pestopfern oder Gefallenen in den Hussitenkriegen stammten?
Im Jahr 1511 errichtete ein angeblich halbblinder Mönch, dessen Name nicht überliefert ist, daraus sechs Pyramidenhaufen.
Die Fürstenfamilie Schwarzenberg von Orlik fand, als sie 1866 das Klostervermögen samt Kapelle und die Gebeine kaufte, eine weitere Antwort, was damit machbar wäre …
Prolog
Sedlec, 1511
Libor streckte sich und spürte das Ziehen und Reißen in seinen müden Gelenken und den alten Muskeln, die dem Alter ihren Tribut hatten zollen müssen.
Gerade jetzt im November, wo die Nächte lang, kalt und feucht waren, fühlte er den Schmerz, der ihn nicht zur Ruhe kommen ließ. Er faltete die knotigen Hände zum stillen Gebet, ehe er langsam auf die Knie sank, das Haupt mit dem spärlichen weißen Haar senkte, das wie alte Spinnweben seinen Kopf umgab.
»Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.«
Langsam hob Libor den Kopf und blickte auf das große Kreuz, an dem der Leib des Erlösers hing. Seit mittlerweile sieben Nächten plagten ihn die Träume, machten die kurze Zeit, in der er Schlaf fand, zu einem Martyrium. Der Zisterzienser-Mönch war sich absolut sicher, dass nur Gott ihm diese Träume hatte schicken können, und dass der Herr von ihm einen letzten Dienst erwartete.
»Oh, Herr, was auch immer du für mich ausersehen hast, ich werde dir folgen und deinen Willen erfüllen. Ich spüre, dass du mich bald abberufen wirst, um meine Seele zu dir zu nehmen. Aber bitte sage mir, was ich tun muss.«
Libor schloss die Augen und beschwor im Geiste die Bilder der Träume, die so plastisch waren, dass er mit Sicherheit wusste, dass es sich um Spiegelungen der Wirklichkeit handelte. Eine weit zurückliegende Wirklichkeit, die er selbst noch nicht erlebt hatte, denn sie lag tief in der Vergangenheit begraben.
Die traurigen Augen zweier Kinder blickten ihn an und zerrissen ihm das Herz, Tränen rollten den beiden Mädchen über die Wangen, doch er hörte nur das Schluchzen ihrer Mutter, die betend vor dem Bett kniete.
Sie selbst zeigte schon deutliche Anzeichen der tödlichen Krankheit, von der Libor auch heute noch nicht wusste, ob Gott oder der große Widersacher sie den Menschen gesandt hatte.
Das Elend hatte vor fast zweihundert Jahren den gesamten Landstrich entvölkert und auch diese kleine Familie mit sich in den Schlund des Todes gerissen.
Schwarze Beulen übersäten den Leib der Mutter, krochen über die Körper der Kinder, und Libor wäre sich sicher gewesen, dass dies ein Zeichen seines Gottes war, der dadurch die Schlechtigkeit der Menschen kenntlich machen wollte. Doch allein der Umstand, dass auch die beiden kleinen Mädchen Opfer des Schwarzen Todes wurden, ließ Libor zweifeln. Kein Gott konnte so grausam sein, die Unschuldigen derart hart zu bestrafen.
Langsam öffnete der alte Mönch die trüben Augen, die die Schönheit Gottes nur mehr verschwommen wahrnahmen. Sein Augenlicht verlosch zunehmend, wie auch das Licht seiner Seele zu verglimmen drohte.
»Libor, komm.«
Sein Herzschlag beschleunigte sich. Hatte er das eben wirklich vernommen? Sein Gehör war im Ausgleich zu der stetigen Erblindung nicht besser geworden, sondern hatte ebenfalls dem fortgeschrittenen Alter Tribut zollen müssen. Das karge Leben hinter den kalten, feuchten Klostermauern hatte sein Übriges dazu beigetragen, seine Gesundheit zu untergraben. Wie ein unterirdischer Bachlauf, der die Fundamente eines Hauses marode machte und das Gebäude nach jahrelanger Standhaftigkeit zum Einsturz brachte.
»Bitte, Libor, komm zu uns.«
Es war nur ein Hauch gewesen, der an die Ohren des alten Mannes gedrungen war. Doch er hatte erkannt, dass es niemand aus dem Kloster gewesen sein konnte, denn hier lebten ausschließlich Männer, die meisten im höheren Alter. Doch die Stimme, die ihn gerufen hatte, war eindeutig weiblich gewesen – und kindlich. Ein Mädchen rief ihn. Und er würde folgen, denn er wusste, dass dies zu Gottes Plan gehörte.
Libor legte die Hand mit der Pergamenthaut und den knotigen Gelenken auf die kalte Klinke der Tür. Das leise Quietschen der Angeln erinnerte ihn an das resignierte Greinen zahlloser Seelen im Fegefeuer. Die Luft auf dem steinernen Gang roch klamm und nach Vergänglichkeit. Der Wind zog durch die Belüftungsschlitze und brachte von draußen den Odem vergehender Natur mit. Libor schritt langsam voran.
Auf eine Kerze hatte er verzichtet. Er kannte das Kloster und seine Umgebung wie das Ave Maria. Das grelle Licht der Flamme hätte seine trüben Augen nur geblendet und Libor war es gewohnt, in der Dunkelheit zu wandeln.
Stand da nicht eine kleine, weiße Gestalt am Ende des Gangs?
»Folge uns, Libor.«
Wieder hörte der Mönch das leise Rufen der Mädchenstimme, und während er sich auf den Schemen, keine zwanzig Schritte vor sich konzentrierte, vernahm er das helle Lachen eines zweiten Kindes, das ihn von hinten erreichte.
Dann rannte die kleine weiße Gestalt schon an ihm vorbei zu ihrer Schwester. Das Nachthemd wehte im kühlen Lufthauch der Nacht. Libor folgte den Mädchen, die jetzt Seite an Seite gingen, sich an den Händen haltend, immer wieder über die Schulter blickend, um sich zu versichern, dass er ihnen auf den Fersen war.
Libor näherte sich den langsam dahinschreitenden Mädchen und erkannte, dass sie keine Nacht- sondern Leichenhemden trugen, deren weißes Leinen schwer von ihren Schultern hing. Ihre nackten Füße schimmerten blau im Mondlicht. Die Schulter der rechten Gestalt war nackt und zeigte eine hässliche schwarze Pustel. Das Mädchen links schien immer wieder abgelenkt und bestaunte neugierig seine Umgebung, als wäre es lange nicht mehr hier gewesen.
Dabei gewahrte Libor ebenfalls eine schwarze Pustel, die auf der linken Wange des Kindes saß. Mittlerweile hatten sie den Klostergarten erreicht und gingen in Richtung Kapelle. Es war zwar schon Mitte November und empfindlich kalt, was Libor vor allem in seinen schmerzenden Gelenken spürte, aber es hatte die letzten Tage über nicht mehr gefroren.
Väterchen Frost hatte ein Einsehen mit den hart arbeitenden und betenden Mönchen. So sanken Libors Füße immer wieder leicht in den mit Laub bedeckten Boden ein.
Kaum hatten sie das Eingangsportal der Kapelle erreicht, waren die Mädchen verschwunden. Libor war verwirrt und umklammerte den Rosenkranz fester. Beim Näherkommen bemerkte er den schmalen Spalt am Eingangsportal. Die Kapelle war offen! Und tatsächlich standen die beiden Mädchen im Inneren des Gotteshauses, Hand in Hand und blickten Libor auffordernd entgegen.
»Komm, Libor, dein Weg ist noch nicht zu Ende.«
Mit diesen Worten drehten sie sich um und gingen weiter. Jedoch nicht in die Kapelle hinein, sondern auf eine schmale Tür an der rechten Seite zu. Libor wusste, dass dahinter eine steinerne Treppe lag, die direkt ins Beinhaus führte. Ein Schauer des Entsetzens floss über seinen Rücken.
Was wollten die Kinder dort? Libor war sich sicher, dass es die Mädchen aus seinen Träumen waren, und dass Gott die Kinder zu ihm geschickt hatte, damit sie ihm seinen Willen kundtun konnten. Als er die schmalen Stufen der Treppe hinunter schritt, sich langsam an der Wand hinabtastend, und die weißen Leiber der Kinder wie Irrlichter vor sich schweben sah, kam ihm zum ersten Mal der Gedanke, dass es nicht der Herr, sein Gott, war, der ihm die Kinder als Boten geschickt hatte, sondern dessen Widersacher. Wieder begann Libor zu beten. Kaum hörbar flossen die Worte über seine rissigen Lippen, während er Perle für Perle des Rosenkranzes zwischen den Fingern seiner rechten Hand hindurchgleiten ließ.
Finsternis umgab den alten Mönch, der ohnehin kaum noch etwas sehen konnte. Nur die Leiber der offensichtlich toten Kinder leuchteten in einem fahlen, weißen Licht.
Die steinernen Stufen in das Beinhaus hinab waren feucht und glitschig. Mehr als einmal rutschte Libor aus, konnte sich aber immer wieder fangen, ohne dass er stürzte. Die Mädchen hatten bereits das Ende der Treppe erreicht. Leichtfüßig gingen sie in die Mitte des Raums. Ihre Schritte wurden von einem klappernden Geräusch begleitet, als ihre Füße die Gebeine zur Seite schoben.
Obwohl der Boden mit Abertausenden von Menschenknochen übersät war und ein normales Gehen schier unmöglich machte, stolperten sie nicht. Im Gegensatz zu Libor, der bereits bei seinem ersten Schritt einen Schädel zermalmte. Abrupt blieb er stehen, schloss die Augen und bekreuzigte sich. Inständig hoffte er, der Herr, sein Gott, möge ihm verzeihen.
Libor wusste, wessen Gebeine hier unten lagerten. Es waren die Opfer der großen Pest und des grausamen Krieges gegen die Hussiten, die den Heiligen Vater in Rom nicht anerkannten. Doch im Tod waren Gottes Kinder alle gleich, und egal, wessen Schädel Libor gerade zerstört hatte, es war Sünde. Sofort begann der alte Mönch wieder seinen Rosenkranz und das Ave Maria zu beten.
»Libor.«
Erschrocken hielt er inne, blickte auf und sah die beiden bleichen, toten Mädchen Hand in Hand keine zwanzig Schritte vor sich in der Mitte des Beinhauses stehen. Sah sie, als ob seine Augen noch die Kraft der Jugend hätten und blickte direkt in die stumpfen, seelenlosen Augen der beiden Geschöpfe.
»Erfülle dein Schicksal, Libor. Diese Stätte ist heilig. Ordne die Knochen der Gefallenen und errichte die Mahnmale des Todes.«
Und Libor gehorchte. Der Rosenkranz glitt aus seinen Fingern, während er mit zitternden Händen nach den ersten Knochen griff. Kein Licht erhellte die Finsternis.
✞
Am nächsten Morgen suchten ihn seine Brüder verzweifelt und ahnten Schreckliches, ehe sie ihn fanden. Inmitten der Gebeine von Tausenden Toten hockte er auf dem kalten Boden, sprach mit Personen, die die Mönche nicht wahrnahmen und errichtete sechs Knochenberge. Sein Rosenkranz lag unbeachtet am Eingang des Beinhauses.
Libors Brüder wollten den alten Mann von seinem Tun abhalten und ihn zwingen in das Kloster zurückzukehren. Doch er wehrte sich vehement und es war der Abt der Zisterzienser, der schließlich ein Einsehen mit dem alten Mann hatte, der offensichtlich seinen Verstand verloren hatte. Fortan brachten sie ihm Nahrung und Wasser.
Bis zu jenem Tag als in dem Beinhaus sechs Pyramiden standen, bestehend aus sorgfältig aufeinandergeschichteten menschlichen Knochen. Die leeren Augenhöhlen starr auf die Mönche gerichtet, die ratlos im Raum standen. Kein einziges Knöchelchen war übrig geblieben. Vier der sechs Pyramiden standen in den Ecken des riesigen Kellers, zwei in der Mitte. Von Libor fehlte jede Spur.
✞
Der Dämon zerrte und riss an den Ketten, die ihn an diesen alten, gebrechlichen Körper fesselten, ihn somit an diesen Ort bannten. Er heulte in grenzenloser Agonie; fluchte, wimmerte und schrie. Er flehte Satan um Beistand an und verfluchte tausendfach dessen Widersacher, doch weder das eine noch das andere trug Früchte. So fügte er sich schließlich, zog sich zurück in die hintersten Gefilde eines vom Zerfall gezeichneten Verstandes und wartete. Jahrhundertelang, denn Zeit war ab jetzt bedeutungslos geworden. Er würde sich befreien, irgendwann. Und seine Rache würde furchtbar sein …
Kapitel 1
Kutná Hora, Tschechische Republik, Gegenwart.
Antonin Cerny hatte bei diesem Job von Anfang an kein gutes Gefühl gehabt. Aber die Auftragslage war schlecht, und als Privatdetektiv verdiente man sich ohnehin keine goldene Nase. Schon gar nicht in Prag, wo der Konkurrenzdruck hoch war.
Am besten liefen immer noch die Beschattungen untreuer Ehefrauen und –männer, und wenn man Glück hatte wurde man auf die Gehaltsliste einer Versicherung oder eines Großkonzerns gesetzt.
Mordfälle landeten nie auf Cernys Schreibtisch, dafür war immer noch die Polizei zuständig, und die sah es gar nicht gerne, wenn man ihr ins Handwerk pfuschte. Und wenn man Pech hatte, kam man dem organisierten Verbrechen in die Quere und konnte gleich einpacken.
Zuerst hatte Cerny bei einer privaten Sicherheitsfirma angefangen, nachdem er bei den Aufnahmemodalitäten für die Polizeischule schnell gemerkt hatte, dass er keine Lust verspürte, für die Offiziellen zu arbeiten, wie er die Staatsdiener insgeheim nannte.
Doch auf die Dauer waren die nächtlichen Bewachungsdienste äußerst anstrengend gewesen und hatten ihn mehr als eine Beziehung gekostet. Dass dabei vielleicht auch seine jähzornige und introvertierte Art eine Rolle gespielt hatte, übersah er geflissentlich.
Jedenfalls stand für ihn schnell fest, dass er sich selbstständig machen würde und wenige Monate später hatte er sein Detektivbüro eröffnet. Das hieß, unregelmäßige Arbeitszeiten, keinen festen Urlaubsplan und jede Menge Freizeit, die er nicht nutzen konnte, weil ihm das nötige Kleingeld fehlte.
Wie gesagt, die Auftragslage war mies, und so musste Cerny immer Gewehr bei Fuß stehen, um die Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen. Diese Gelegenheit ergab sich, als sich ein neureicher Geschäftsmann bei ihm meldete, der sich für eine Kapelle interessierte, die unweit von Prag in dem kleinen Ort Kutná Hora stand.
Diese Kapelle, und zugleich ein ehemaliges Beinhaus, das zu einem morbiden Kunstwerk umgestaltet worden war, war ein Touristenmagnet der Superlative. Es waren fast alle Nationalitäten und jede Altersgruppe vertreten, die sich die mit menschlichen Gebeinen ausgeschmückte Kapelle ansehen wollten. Schulklassen gehörten ebenso zum Publikum, wie die Rentner auf der obligatorischen Butterfahrt oder japanische Besucher, die in Windeseile jeden Winkel mit ihren Digitalkameras aufnahmen, um so schnell wie möglich zur nächsten Attraktion zu gelangen.
Betrachtet wurden sich die Sehenswürdigkeit erst daheim. Fast-Food-Tourismus par excellence. Sein Auftraggeber war ein Exzentriker und Sammler außergewöhnlicher Kunst, wie es oft bei Männern mittleren Alters der Fall war, die sehr schnell und sehr illegal zu jeder Menge Geld gekommen waren.
Nun fehlte ihm noch das eine oder andere Schmuckstück aus eben jener Knochenkirche. Da kam ihm Antonin Cerny gerade recht. Der Privatdetektiv war pleite. Mehr noch. Wenn er nicht bald wieder liquide war, konnte er sein Büro dichtmachen. Ob das seinen Gläubigern gefallen würde, war mehr als fraglich. So war ihm nichts anderes übrig geblieben, als den Auftrag anzunehmen und sich möglichst unauffällig unter die Besucher zu mischen.
Cerny hatte gut recherchiert. So wusste der Privatdetektiv, dass Kirche und Beinhaus einst zu einem Kloster gehörten und die Knochen des eigenwillig arrangierten Interieurs von den Opfern der Pest und der Hussitenkriege stammten.
František Rint war es schließlich gewesen, der von den Schwarzenbergs den Auftrag erhalten hatte, die Kapelle wieder angemessen herzurichten. Seine bizarren Vorstellungen von Kunst hatten dem alten Adelsgeschlecht, welches das Klostervermögen nebst Kapelle erworben hatte, sehr imponiert.
Unwillkürlich hielt Cerny den Atem an, als er an einem kalten, sonnigen Oktobermorgen mit einer Gruppe schwatzender Schulkinder die Kapelle betrat. Bei einem schlaksigen jungen Mann mit schwarzen lockigen Haaren hatte er den Eintrittspreis bezahlt und sah bereits auf den ersten Blick, was den Besucher hier erwartete. Dem Touristen wurde alles geboten, was sich das morbide Herz wünschte: Plastiktotenschädel, Schneekugeln, Postkarten, Broschüren, und allerhand Nippes rund um die berühmte Knochenkirche.
Lange wollte Cerny allerdings nicht am Eingang verweilen, und selbst wenn er gewollt hätte, die drängelnde Masse pubertierender Kids schob ihn unerbittlich weiter, auf die breite Treppe zu, die hinunter ins Beinhaus führte.
Bereits an der rechten Seite gewahrte der Detektiv einen Kelch, der aus etlichen menschlichen Knochen errichtet worden war. Erstaunt über die Kunstfertigkeit des Schnitzers, der dieses Werk vollbracht hatte, blieb Cerny nun doch stehen und wurde prompt von zwei kichernden Mädchen angerempelt.
Automatisch murmelte er eine Entschuldigung und ging rasch einen Schritt nach vorne, um sich den Kelch von Nahem anzusehen. Der Detektiv war anatomisch bei Weitem nicht so bewandert, dass er alle Knochen dem menschlichen Körper hätte zuordnen können, doch viele Stücke meinte er dennoch wiederzuerkennen. Beispielsweise einen Wirbelkörper, Schulterblätter, Oberschenkelknochen und natürlich die Schädel, die den Rand des Kelches säumten und auch die Nische, in der das Kunstwerk stand, umrankten.