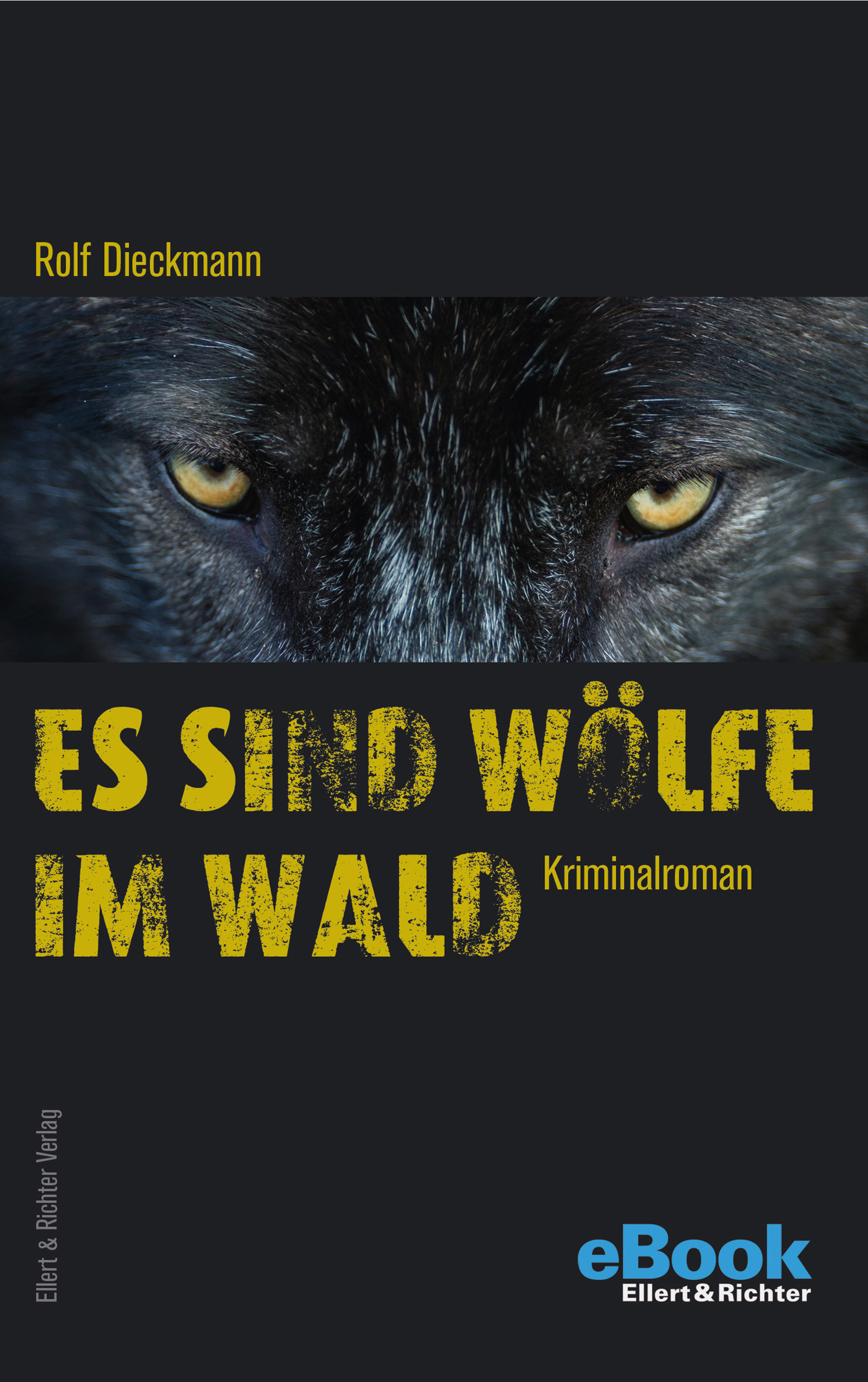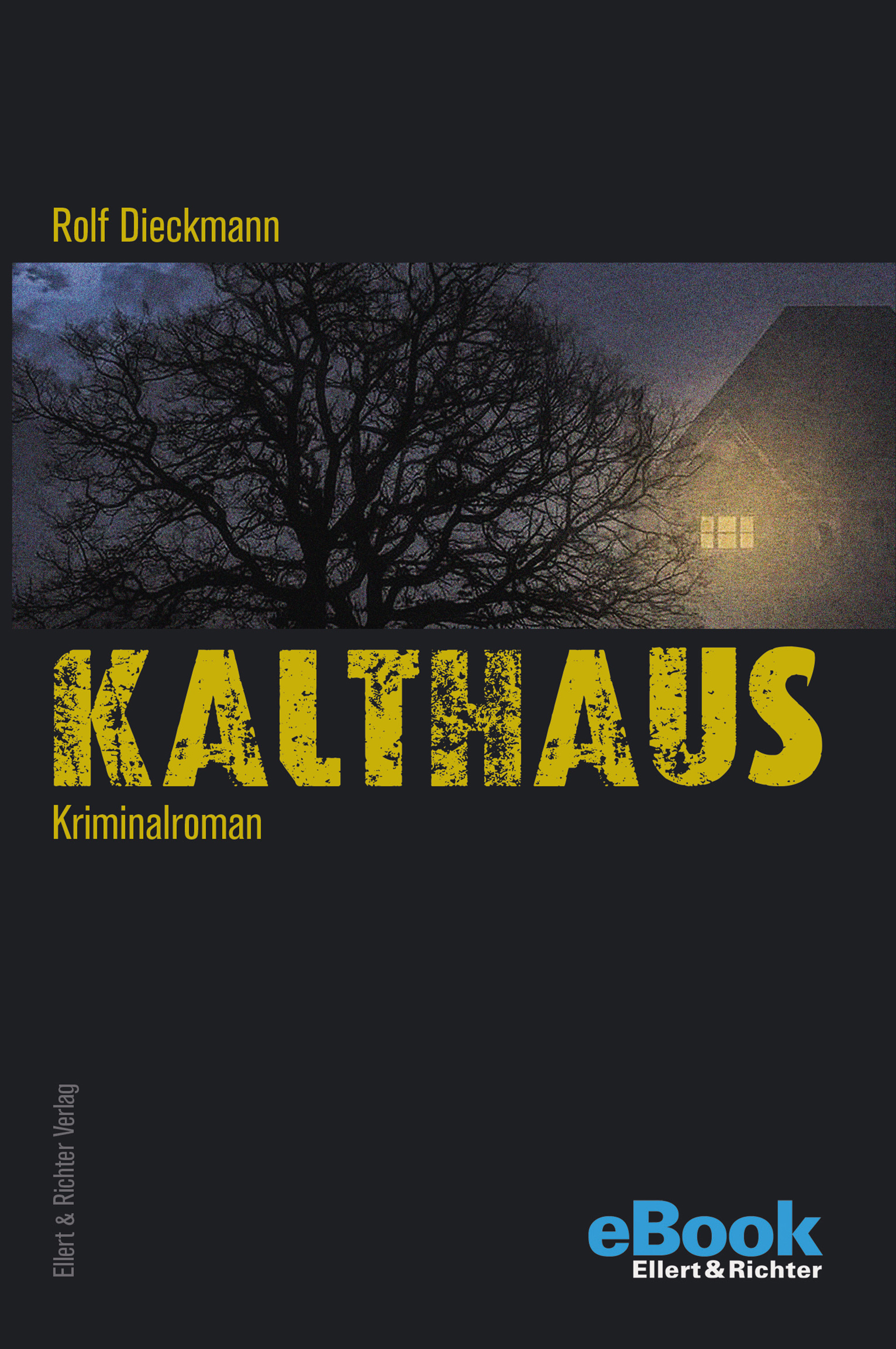11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ellert & Richter
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eigentlich will der Hamburger Expolizist und Hobbylandwirt Erik Corvin nur herausfinden, wohin seine Hühner verschwinden. Darum stellt er eine Wildkamera auf, die den Dieb auf frischer Tat ertappen soll. Doch es kommt mal wieder völlig anders, denn die Kamera zeichnet auch ein Geschehen auf, das Corvin sich zunächst nicht erklären kann. Dann ist da noch diese Frau, die glaubt, ein Mörder verfolge sie. Und deren Mann behauptet, sie sähe nur Gespenster. In einem alten Bauernhaus spukt es, ein geheimnisvoller Engländer ist auf der Suche nach einem verschwundenen Landsmann und ein Erpresser droht, die "Kulturelle Landpartie" in die Luft zu sprengen. Wieder einmal überschlagen sich die Ereignisse und Corvin merkt langsam, welche Zusammenhänge da bestehen. Und dass sich viel größere Dimensionen auftun, als er zunächst angenommen hatte. Diese Erkenntnis kommt sehr spät, fast zu spät. Denn inzwischen ist er selbst ein Störfaktor, der beseitigt werden soll. Auch der vierte Band um den Ermittler wider Willen spielt im Wendland mit seinen einzigartigen Dörfern und deren eigenwilligen Bewohnern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
GESPENSTER
Rolf Dieckmann
GESPENSTER
Erik Corvins vierter Fall
Der Wendland-Krimi
Ellert & Richter Verlag
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig und sind nicht beabsichtigt.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Die Personen
Der Autor
1
Sie hatte sich fest vorgenommen, noch vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause zu sein, aber dann war sie wieder einmal mit Marianne von einem Thema zum anderen gekommen und es tat ihr gut, an etwas anderes zu denken.
Dass ihr die Kette vom Fahrrad ausgerechnet auf diesem dunklen Teil des Weges abgesprungen war. Verdammt noch mal, warum musste immer ihr so etwas passieren? Marianne hatte ihr noch angeboten, sie nach Hause zu fahren, aber auf dem Fahrrad fühlte sie sich einigermaßen sicher und für den Weg brauchte sie nur knapp eine Viertelstunde.
Die Kette wieder auf das Zahnrad zu bekommen, das schaffte sie allein nicht. Schon gar nicht im Dunkeln. Du bist gleich zu Hause, dachte sie, gleich bist du zu Hause. Ihr Herz pochte und sie spürte den Schweiß auf ihrer Stirn. Sie versuchte schneller zu gehen, aber das Fahrrad war ziemlich schwer, und sie merkte, wie ihre Kraft nachließ.
„Du wirst nicht mehr lange leben. Wir kriegen dich“, hatte in dem Brief gestanden. Es war schon die zweite schriftliche Drohung, die mit der Post gekommen war. Und dann diese Anrufe. Immer nur diese zwei Sätze.
Dann war sie zu Marianne in die alte Wassermühle hinübergeradelt, um auf andere Gedanken zu kommen. Marianne hatte so etwas Handfestes, sie ließ sich nicht so schnell beeindrucken. Bei Robert spürte sie, dass er sich große Sorgen um sie machte, und sie wollte ihn nicht noch mehr belasten.
Sie hätte eine Taschenlampe mitnehmen sollen, denn der Scheinwerfer am Rad funktionierte nur während der Fahrt mit einem Dynamo. Du bist gleich zu Hause, gleich bist du zu Hause.
Schritte. Ganz dicht hinter ihr. Mit weichen Knien blieb sie stehen und horchte. Es war still, aber sie spürte: Da war jemand. Ganz in ihrer Nähe. Sie meinte den Atem hören zu können. Sie griff in die Jackentasche. Das Handy. Wo war ihr Handy? Sie musste es wieder auf dem Küchentisch liegengelassen haben. Obwohl Robert ihr eingeschärft hatte, es immer griffbereit zu haben. Mit aller Kraft schob sie das Fahrrad so schnell sie konnte. Aber auch die Schritte hinter ihr wurden schneller.
Jetzt konnte sie die erste Straßenlampe an der Dorfstraße sehen. Gleich hast du es geschafft, gleich bist du zu Hause. Keuchend schob sie weiter. Im Schein der Lampe blieb sie stehen. Horchte nach hinten in die Dunkelheit. Keine Schritte mehr. Nur das Rauschen der Blätter in den Bäumen.
In der Diele brannte Licht. Robert war noch wach. Sie lehnte das Fahrrad von innen an den Zaun. Öffnete die schwere Eichentür, die noch nicht abgeschlossen war.
Robert kam ihr entgegen.
„Kristine, was ist los? Du siehst ja schrecklich aus.“
Er streckte die Arme aus und drückte sie an sich. Sie atmete immer noch heftig.
„Er hat mich wieder verfolgt. Die Kette vom Rad ist ab. Ich musste schieben.“
Robert sah sie an.
„Wer hat dich verfolgt?“
Sie strich sich die schweißnassen Haare aus dem Gesicht.
„Er war es wieder. Da bin ich sicher. Wo ist der Brief? Er hat hier gelegen.“
Robert sah sie verständnislos an.
„Was für ein Brief. Wovon redest du?“
Sie sah ihn mit großen Augen an.
„Der Brief. Dass ich sterben muss. Ich habe ihn dir gezeigt.“
Er ging nicht darauf ein.
„Hast du deine Tabletten genommen? Du solltest dich jetzt gleich hinlegen. Ich nehme an, du hast bei Marianne gegessen?“
Sie nickte geistesabwesend.
„Aber ich sage dir …“
Er hielt ihr sanft den Mund zu.
„Du weißt doch, du sollst dich nicht aufregen. Leg dich jetzt hin. Alles wird gut.“
2
Lilo stemmte beide Fäuste in die Hüften und hielt die Luft an.
„Da hört sich doch alles auf. Das ist jetzt schon das Dritte.“
Diese empörten Worte entfuhren ihr wie ein Aufschrei, was zur Folge hatte, dass Corvin, der gerade die Salatpflanzen goss, seine Kanne zu Boden sinken ließ, um der Entsetzten zu Hilfe zu eilen.
„Lilo, was ist denn los?“
Sie stand in ihrer ganzen Massigkeit, die durch die geblümte Kittelschürze noch unterstrichen wurde, vor dem Maschendraht des Hühnerstalls und starrte auf das Hühnervolk, das in konzentrierter Geschäftigkeit den Boden nach Körnern absuchte.
Lilo drehte sich zu Corvin um.
„Es ist schon wieder eins verschwunden. Das ist jetzt das Dritte. Zwölf waren es am Anfang, jetzt sind es nur noch neun.“
Corvin legte die Stirn in Falten.
„Vielleicht hast du dich verzählt“, sagte er, streckte den Zeigefinger aus und begann murmelnd zu zählen.
„Tatsächlich. Nur noch neun. Und ein Hahn.“
Lilo machte ein beleidigtes Gesicht.
„Das hättest du dir sparen können. Ich verzähle mich nie.“
Corvin zuckte mit den Schultern und ging nicht darauf ein.
„Was meinst du, wer das war? Ein Fuchs? Oder ein Marder?“
Sie schüttelte energisch den Kopf.
„Wo sollten die durchgekommen sein? Und außerdem: Wenn das Raubzeug gewesen wäre, lägen jetzt hier büschelweise Federn herum. Und davon ist ja wohl nichts zu sehen.“
Corvin grinste.
„Willst du damit sagen, dass sich hier ein menschliches Wesen als Hühnerdieb betätigt hat?“
Lilo zog die Unterlippe nach vorn.
„Kann schon sein. Erwin haben sie doch vor drei Jahren mal die ganzen Angorakaninchen geklaut. Wer das war, ist nie rausgekommen.“
Corvin machte ein gespielt amtliches Gesicht.
„Okay, dann werden wir der Sache mal auf den Grund gehen. Als Erstes besorge ich eine Wildkamera. Ich muss sowieso nachher noch zur Bank nach Lüchow. In Möllers Fotoladen in der Langen Straße werde ich sowas bestimmt kriegen. Wir werden den Dieb schon fassen.“
Lilo machte ein skeptisches Gesicht.
„War vielleicht doch keine so gute Idee, den Stall so nahe am Wald zu bauen“.
Einige Stunden später saßen sie am großen Eichentisch in der Küche. Corvin wickelte das Paket aus, das er aus Lüchow mitgebracht hatte. Er öffnete den Pappkasten, auf dem in geschlungenen Buchstaben „Wildcam“ stand und beförderte eine etwa fünfzehn Zentimeter hohe Kamera in Tarnfarbenoptik zu Tage.
Lilo nahm den Kasten in die Hand und las laut:
„Wildkamera mit Bewegungsmelder, extra großer Überwachungszone und unsichtbarem Blitz.“
Sie schüttelte den Kopf.
„So ein Quatsch. Wie kann denn ein Blitz unsichtbar sein. Wenn man ihn nicht sieht, dann ist er auch kein Blitz.“
Corvin machte ein gequältes Gesicht.
„Mein Gott, Lilo. Das ist ein Infrarotlicht mit einer Wellenlänge, die außerhalb der menschlichen, und natürlich auch der tierischen Wahrnehmung liegt. Glaub’ mir, das funktioniert.“
Lilo schüttelte abermals den Kopf.
„Ich glaube nur das, was ich sehen kann. Und das hier kann ich nicht sehen. Wieso soll ich daran glauben?“
Corvin bemerkte, dass er bei der Diskussion mit seiner meinungsstarken Haushälterin mal wieder einen Punkt erreicht hatte, bei dem jeder Überzeugungsversuch zwecklos war.
„Okay, du wirst es ja sehen. Jetzt machen wir die mal schussbereit und vielleicht erwischen wir den Hühnerdieb auf diese Weise.“
Lilo sagte nichts mehr, zuckte mit den Schultern und begann die Geschirrspülmaschine auszuräumen.
„Da bin ich ja mal gespannt. Du und Technik. Das nimmt meistens kein gutes Ende.“
Nachdem er sich die Gebrauchsanweisung zweimal durchgelesen hatte, ging Corvin hinaus, um einen geeigneten Standpunkt für die Kamera zu suchen. Der immer dunkler werdende Himmel und aufkommender Wind waren unmissverständliche Zeichen, dass ein Gewitter im Anmarsch war. Etwa zehn Meter vom Hühnerstall entfernt stand eine Birke. Das ist ein guter Platz, dachte Corvin und nahm das militärisch-olivfarbene Band aus der Tasche, mit der man die Kamera befestigen konnte. Er zog das Band durch die vorgesehenen Ösen, zurrte es auf die richtige Länge und ließ den Schnappverschluss einrasten.
„Dann woll’n wir doch mal sehen“, sagte er zu sich selbst, schaltete die Kamera auf Automatik und ging zurück ins Haus.
Eine Stunde später fegte ein heftiges Gewitter über das Wendland. Begleitet von prasselnden Wolkenbrüchen und orkanartigen Windböen. Corvin saß in seinem Sessel und überlegte, ob Fenster und Türen fest geschlossen waren und ob er bei allen empfindlichen Geräten den Stecker gezogen hatte. Im vorigen Jahr hatte ein Blitz die Pappel an der Hofweide getroffen, für Überspannung im Netz gesorgt und seinen neuen Laptop geschrottet. Das sollte nicht wieder vorkommen. Doch genauso schnell, wie es gekommen war, zog das Gewitter wieder davon, hinterließ einige geknickte Bäume, dafür aber gereinigte Luft. Hoffentlich hat die Kamera das überlebt, dachte Corvin. Er war aber zu müde, um jetzt noch hinauszugehen und nachzusehen.
Am nächsten Morgen stand er bereits um sieben Uhr in aufrechter Haltung im Badezimmer. Eine halbe Stunde früher, als er es gewohnt war. Lilo war noch nicht da und er wollte nachschauen, ob er mit der Kamera alles richtig gemacht hatte. Sollte das nicht der Fall sein, konnte er sich so ihren Kommentaren entziehen und sich notfalls eine Ausrede einfallen lassen.
Während er sich in der Diele die Schuhe zuband, hörte er, wie die Küchentür ins Schloss fiel. Sekunden später erschien Lilo in der Diele.
„Moin, Erik, bist du aus dem Bett gefallen? Ich muss heute eine Stunde früher gehen, darum komme ich etwas früher. Hast du schon nach der Kamera geschaut?“
Corvin lächelte gequält und suchte nach einer Ausrede. Leider fiel ihm keine ein.
„Nein, ich wollte mich gerade auf den Weg machen.“
Er merkte, wie es in Lilos Augen aufblitzte. Offenbar hatte sie ihn durchschaut.
„Da komme ich mit. Mal sehen, ob deine Ermittlungen erfolgreich waren, Herr Kommissar.“
Corvin quälte sich abermals ein Lächeln ab und ging wortlos zur Tür.
Nach wenigen Minuten hatten sie den Hühnerstall erreicht. Schon von weitem sah er, dass die Kamera nicht mehr an der Birke hing. Lilo grinste hinterhältig.
„Na? Wo ist denn nun dein Zauberkasten? Ist es etwa das verdreckte Ding, dass da unter dem Baum liegt?“
Eine Gewitterböe musste das Band, mit dem er die Kamera an der Birke festgezurrt hatte, losgerissen haben, so dass sie im freien Fall auf dem völlig aufgeweichten Erdboden gelandet war.
Lilo lachte hell auf.
„Ich sag’s ja. Du und Technik.“
Corvin, der das ignorierte, war inzwischen in die Hocke gegangen und befand, dass der Matsch, der nun an dem Gerät klebte, eigentlich ganz gut zur Tarnfarbenoptik passte. Die Kontrolllampen leuchteten noch und auch sonst machte die Kamera einen intakten Eindruck. Ist ja schließlich auch eine Wildkamera, dachte er.
„Ich mache sie jetzt erst einmal sauber und schließe sie an meinen Laptop an. Auf dem großen Bildschirm sieht man besser, was drauf ist.“
Lilo prustete lauthals los.
„Falls was drauf ist.“
Ach, Lilo, seufzte Corvin und ging zurück ins Haus.
Auf dem Display der Kamera konnte er erkennen, dass sie neun Mal in dieser Nacht ausgelöst worden war.
Ein leichtes Triumphgefühl stieg in ihm auf.
„Da bin ich jetzt aber mal gespannt“, sagte er laut zu sich selbst.
Er verband die Kamera mit dem Laptop über die USB-Buchse und Sekunden später zeigte der das Gerät auf dem Bildschirm an. Er klickte auf das Symbol der ersten Aufnahme und konnte seine Enttäuschung nicht verbergen. Die Kamera musste bereits auf dem Boden gelegen haben und nahm eine Position ein, die zum größten Teil die Geschehnisse auf dem Erdboden dokumentierte. Außerdem war sie nicht mehr in Richtung Hühnerstall ausgerichtet, sondern in Richtung Waldrand. So waren es bei der ersten Aufnahme zwei Feldmäuse, die in die Infrarotfalle gehuscht waren. Dasselbe Bild bot sich bei der zweiten und dritten Aufnahme, erst bei der vierten schlich ein Marder durchs Bild. Bei der fünften und sechsten setzte sich eine getigerte Hauskatze in Szene, wahrscheinlich auf der Suche nach den Mäusen, die aber längst wieder in ihren Löchern verschwunden waren.
„Na, hast du den Hühnerdieb auf der Festplatte“, hörte er hinter sich Lilos Stimme, die einen Hauch von Spott nicht verbergen konnte.
Corvin schüttelte nur stumm den Kopf und klickte auf die siebte Aufnahme. Beine, die offenbar zu einem Reh gehörten, stolzierten an dem Objektiv vorbei, kurz darauf noch eins und dann noch ein drittes. Plötzlich stutzte er. Er setzte den Cursor noch einmal auf Anfang und ließ die Aufnahme erneut ablaufen.
„Findest du das so spannend, dass du es zweimal anschauen musst?“, fragte Lilo. Immer noch mit leicht spöttischem Unterton.
Corvin schüttelte den Kopf.
„Nein, das nicht. Aber achte mal auf den Hintergrund, wenn das dritte Reh ins Bild kommt.“
Lilo beugte sich auf Schulterhöhe zu ihm herunter und schaute angestrengt auf den Bildschirm. Corvin streckte seinen Zeigefinger aus.
„Da. Siehst du? Im Hintergrund, am Waldrand. Da sind doch zwei Menschen. Total unscharf, aber das sind keine Tiere, das sind Menschen.“
Lilo kniff die Augen zusammen.
„Seh ich nicht. Mach noch mal.“
Als die Beine des dritten Rehs ins Bild kamen, drückte Corvin auf Stop.
„Da, siehst du? Zwischen den Rehbeinen. Ganz im Hintergrund. Da sind zwei Kerle aus dem Wald gekommen.“
Lilo zog die Unterlippe nach vorn.
„Da muss man aber schon sehr viel Fantasie haben. Und woher willst du wissen, dass es zwei Kerle sind?“
Corvin schaute sie tadelnd an.
„Auf jeden Fall sind es zwei Menschen, die Hosen tragen. Bei Waldtieren wäre diese Art der Bekleidung eher ungewöhnlich. Warte mal, zwei Aufnahmen sind noch da.“
Wieder waren Rehbeine zu sehen, es mussten mehr als drei Tiere gewesen sein. Wahrscheinlich ein ganzes Rudel. Er kniff die Augen zusammen.
„Sieht aus, als wenn der eine irgendwas gräbt. Mist, das war’s.“
„Kann man das Bild größer machen?“ fragte Lilo.
Corvin nickte.
„Ja, kann man. Aber damit wird es nicht schärfer. Im Gegenteil.“
Er startete noch einmal die siebte Aufnahme, dann die achte. Die Zeitanzeige stand auf null Uhr sechzehn.
„Warum hat die Kamera das nicht durchgehend aufgenommen?“ fragte Lilo.
„Weil zwischen dem dritten und dem vierten Reh keine Bewegung mehr da war. Dann schaltet sie ab. Erst beim vierten hat sie wieder eingeschaltet.“
„Aber die Typen im Hintergrund bewegen sich doch.“
Corvin zog die Augenbrauen hoch.
„Die sind zu weit weg. So weit reicht der Sensor nicht. Aber warte mal, hier ist noch eine.“
Diesmal hatten huschende Mäuse die Kamera wieder ausgelöst. Corvin kniff die Augen zusammen.
„Jetzt seh‘ ich nur noch einen. Verdammt, das war offenbar alles.“
Wieder und wieder sahen sie sich die Aufnahmen an. Lilo streckte sich schließlich in eine aufrechte Position, wobei sie ein leichtes Stöhnen nicht unterdrücken konnte.
„Ich muss mal wieder in die Küche. Meinst du, dass das die Hühnerdiebe waren?“
Corvin lachte.
„Ach was. Nur frage ich mich, was die da nach Mitternacht im Wald zu schaffen haben.“
Lilo grinste.
„Vielleicht ein Pärchen, das keine eigene Wohnung hat. Wer weiß?“
Grinsend ging sie hinaus und schloss die Tür hinter sich.
Noch mehrere Male schaute sich Corvin die Sequenzen an, dann klappte er den Deckel des Laptops zu und stand auf.
„Dann wollen wir uns die Sache mal aus der Nähe ansehen“, murmelte er vor sich hin und ging hinaus.
Eigentlich war es kein richtiger Wald, der dort an der Nordgrenze von Corvins Hof wuchs. Es war eher ein breiter, dicht mit Laubbäumen bewachsener Streifen, den man in drei Minuten durchquert hatte. Auf der anderen Seite lief parallel ein holpriger Weg, der zum asphaltierten Wirtschaftsweg führte, über den die Bauern mit ihren Treckern die Felder erreichen konnten. Im Wendland ließ man zwischen und auf den Feldern noch Hecken und Baumgruppen stehen, weil von hier aus die Vögel auf Insektenjagd gingen und damit die angebauten Pflanzen vor gefräßigen Schädlingen schützten.
Nach wenigen Minuten erreichte Corvin die Stelle, an der er meinte, nächtliche Aktivitäten zweier Personen ausgemacht zu haben. Tatsächlich waren Brennnesseln und Giersch heruntergetreten. Am Ende dieser Spur standen zwei Eichen, die so schief gewachsen waren, dass sich ihre Stämme in der Mitte kreuzten. Davor fiel sein Blick auf eine Senke mit frischer Erde. Da hatte jemand etwas ausgegraben und dann den Aushub wieder zurückgeschoben. Es musste ein mittelgroßer Gegenstand gewesen sein, der da zu Tage gefördert worden war, denn die Erde füllte das Loch nicht mehr aus. Außerdem musste er schwer gewesen sein, denn von dieser Stelle führte eine Schleifspur bis zum Wirtschaftsweg hinter den Bäumen. Dort war sie plötzlich verschwunden. Derjenige, der die Last bis hierhin gezogen hatte, dachte Corvin, wird sie hier wahrscheinlich in ein Auto verladen haben. Aber er meinte doch, zwei Kerle gesehen zu haben. Was einer schleifen kann, können zwei Männer sicher auch tragen. Er ging in die Hocke und untersuchte den Weg, der eigentlich nur aus einer Treckerspur bestand und auf dem in der Mitte ein Streifen Gras wuchs. Das hier könnte eine Reifenspur sein, dachte er und strich mit dem Finger über einen Profilabdruck im feuchten Sand. Aber die könnte eigentlich von jedem Fahrzeug sein, das hier schon einmal entlang gefahren war.
Die Wolke, die bisher die Sonne verdeckte, hatte sich verzogen und gab die wärmenden Strahlen wieder frei. Für eine Zehntelsekunde blitzte in dem Grasstreifen etwas auf. Corvin beugte sich wieder hinunter und entdeckte eine silberne Münze zwischen den Grashalmen. Er griff danach und hielt die Münze ins Licht. Nein, das war keine Münze, es war ein Knopf. An der Öse auf der Rückseite, mit der man den Knopf an einem Mantel oder einer Jacke befestigen konnte, hingen noch einige Fäden. So, als sei der Knopf mit Gewalt abgerissen worden.
Auf der Vorderseite war ein wappenähnliches Motiv zu sehen. Ein Adler, der seine Schwingen ausbreitete, darüber eine Krone. Auf dem breiten Rand waren kreisförmig die Worte PER ARDUA AD ASTRA eingraviert.
Schade, dass ich in der Schule kein Latein hatte, dachte Corvin und steckte den Knopf in die Tasche. Er würde Helfried Schuster fragen. Der war ein gebildeter Mann und wusste das sicher.
3
„Entschuldige, Marianne, dass ich noch so spät störe“, sagte Robert Belitz, „aber Kristine schläft jetzt und ich fürchte, sie hatte wieder einen ihrer Anfälle. Sie war doch den Abend über bei dir. Kam sie dir irgendwie merkwürdig vor?“
Marianne Heine wechselte das Mobiltelefon an das linke Ohr und nahm mit der rechten Hand die Zigarette, an der sich bereits eine lange Asche gebildet hatte, aus dem Aschenbecher. Ihre Stimme war tief und rau.
„Guten Abend, Robert. Du störst überhaupt nicht. Ich weiß doch, wie sehr dich Kristines Zustand bedrückt. Um deine Frage zu beantworten: Sie hat mir von einem Brief mit einer Drohung erzählt, aber ich habe dann so schnell wie möglich ihr Interesse auf andere Themen gelenkt und dann haben wir uns über Gott und die Welt unterhalten. Weißt du von diesem Brief?“
Sie hörte, wie Robert tief ausatmete.
„Da war kein Brief, Marianne, den hat sie sich wieder mal eingebildet. Du weißt doch, als sie mir das erste Mal erzählte, dass sie jemand verfolgt und bedroht hat, bin ich mit ihr zur Polizei gegangen. Aber dort konnte sie keinerlei Beweise liefern und dann hat sie sich auch in Widersprüche verwickelt. Ich habe dann später noch mit dem Kommissar … wie hieß er doch gleich … achja Feindt, Andreas Feindt, allein gesprochen. Und der sagte, er kenne das. Das sei wohl eher ein Fall von Paranoia.
Marianne drückte ihre Zigarette im Aschenbecher aus und räusperte sich.
„Das weiß ich doch alles, Robert. Ich bin der Meinung, Kristine sollte eine richtige Therapie in einer guten Klinik machen. Ich habe mich mal erkundigt. Es gibt da einige, die auf sowas spezialisiert sind.“
Robert schüttelte den Kopf.
„Ich habe mit dem Thema ja auch schon ganz vorsichtig angefangen. Aber da beißt du bei ihr auf Granit. Sie sei nicht verrückt, sagt sie immer, und wenn ich sie zwinge, bringt sie sich um. Ich bin schon froh, dass sie damals zu Doktor Senger mitgekommen ist. Aber der ist ja kein Psychotherapeut und hat ihr nur etwas zur Beruhigung und gegen ihre Schlaflosigkeit verschrieben.“
Marianne hatte sich die nächste Zigarette angezündet und blies hörbar den Rauch aus.
„Ich kann mich jetzt richtig ärgern, dass ich sie allein habe nach Hause fahren lassen. Das nächste Mal werde ich darauf bestehen, dass ich sie fahre, wenn sie wieder mal hier ist. Wir sollten sie so wenig wie möglich allein lassen.“
Robert seufzte.
„Ich bemühe mich ja schon und ich bin froh, dass ich vieles von zu Hause aus erledigen kann. Aber immer kann ich natürlich auch nicht hier sein.“
Marianne lehnte sich in ihrem Sessel zurück.
„Mir tut das alles so leid. Du weißt, wie gern ich Kristine habe. Aber immer kann ich natürlich auch nicht. Auf alle Fälle: Wenn du mich brauchst, lass es mich wissen.“
Robert nickte.
„Danke, Marianne. Du glaubst nicht, wie froh ich bin, dass du so eine gute Freundin bist.“
Marianne räusperte sich.
„Ich habe schon gedacht, es müsste jemand da sein, der aus irgendeinem praktischen Grund immer in ihrer Nähe ist, so dass sie gar nicht merkt, dass diese Person auf sie aufpasst. Verstehst du, was ich meine?“
„Das habe ich auch schon überlegt und wollte für sie eine Art Haushälterin einstellen. Aber das wollte sie nicht. Sie schafft das allein, hat sie gesagt. Ich denke weiter darüber nach. Schlaf gut.“
Er drückte auf die rote Taste seines Mobiltelefons und steckte es in die Hosentasche, bückte sich und zog seine Schuhe aus. Dann durchquerte er die große Diele und ging auf Socken so leise wie möglich die Treppe hinauf. Vor der Schlafzimmertür, die nur angelehnt war, blieb er stehen und horchte in das dunkle Zimmer hinein. Als er Kristines gleichmäßige Atemzüge vernahm, lächelte er ein wenig. Dann stieg er genauso leise, wie er gekommen war, die Treppe hinab und ging zurück zu seinem Sessel und seinem Buch in der großen Diele.
Die ganz in Schwarz gekleidete Gestalt, die kurz vorher durch eines der kleinen Fenster auf der Ostseite in den großen, nur schwach beleuchteten Raum spähte und sich dann wieder ins Dunkel der Nacht zurückzog, hatte er nicht bemerkt.
4
Die Stimmung im Wendenhof war gereizt. Wie immer, wenn eine politische Entscheidung ins Haus stand, die den meisten höchst unsinnig erschien, bildete sich Widerstand. Und darin war man im Wendland sehr geübt.
Dass es brodelte, merkte Corvin bereits, als er zwei Tage nach seinen nächtlichen Beobachtungen um achtzehn Uhr die Tür der Wende, wie die Zentrale wendländischer Kommunikation liebevoll genannt wurde, öffnete und ihm die konfliktschwangere Luft entgegenwehte.
„Sie werden es nicht durchsetzen“, hörte er eine schneidende und ihm wohlbekannte Männerstimme. „Hundert Bäume für eine Überholspur. Das kommt überhaupt nicht in Frage!“ Die Falsettstimme gehörte Martin Ballauf, engagierter Naturschützer, parteiloser Lokalpolitiker und militanter Radfahrer, der immer dann besonders schnell das Kriegsbeil ausgrub, wenn es der Natur zugunsten des verhassten Autos an den Kragen gehen sollte. Seine Kriegserklärung wurde mit lautem Beifall gewürdigt.
Elisabeth Meier-Brockenfels, Sprecherin der feministisch-ökologischen Gruppe „Stachelbeere“, unterstützte Ballaufs Ansage mit ebenso lauter Stimme, hatte sie doch das Automobil, den dazu gehörigen Straßenbau und folgerichtig die Überholspur schon lange als Penissymbol und Unterdrückungsinstrument des patriarchalischen Machtapparates entlarvt.
Am großen Ecktisch wechselte die Künstlergruppe um den Maler Uno Brömmer aus aktuellem Anlass das Thema und diskutierte jetzt die Frage „Überholt die Kunst den Menschen oder umgekehrt?“
Frank Matthes, Wirt der Wende, der Corvin im Gebrodel der Diskutanten entdeckt hatte, zeigte auf ein Köpiglas und Corvin hob wie immer den Daumen zum Zeichen der Einwilligung in die Höhe, worauf Wirt Matthes ein frisch geschenktes Pils dem nächsten Gast mit Nennung des Adressaten überreichte, der es mit gleicher Zielangabe an den Nächsten weitergab bis es – mehrfach leicht übergeschwappt – den durstigen Expolizisten aus Hamburg mit Dauerwohnsitz im Wendland zur Erfrischung erreichte.
„Ich glaube, ich weiß, wie wir diesen unsinnigen Bau stoppen können.“
Obwohl der Mann nicht besonders laut sprach, verstummten plötzlich alle. Helfried Schuster, pensionierter Oberstudienrat aus Lüchow, war eine Autorität, war er doch für viele im Raum Anwesende ihr Lehrer gewesen, vor dem sie immer noch Respekt hatten. Er hatte schüttere weiße Haare, die über den Kragen fielen und trug eine Nickelbrille mit runden Gläsern, durch die zwei wache hellblaue Augen blitzten. Wie immer war er bekleidet mit einer grünen Wolljacke, die ihm viel zu groß war, die er aber sommers wie winters trug. Eigentlich waren Deutsch und Geschichte seine Hauptfächer gewesen, aber auch die Natur interessierte ihn sehr und so hatte er sich mit den Jahren ein umfangreiches Wissen angeeignet. Er bewohnte mit seiner Frau Erika ein kleines Fachwerkhaus in der Wallstraße, das so mit Büchern vollgestopft war, dass nur noch schmale Gänge in den Zimmern zum Hin- und Herbewegen zur Verfügung standen.
Martin Ballauf fand als Erster wieder Worte.
„Und wie wollen Sie das machen?“
Schusters Augen blitzten auf.
„Anthaxia salicis.“
Ballauf kratzte sich verlegen an der Schläfe.
„Und was heißt das?“
Schuster lächelte abermals mit hintergründigem Augenaufschlag.
„Auf einigen Bäumen, die zum Fällen anstehen, lebt der Weidenprachtkäfer, lateinisch Anthaxia salicis. Der gilt als fast schon ausgestorben. Auf jeden Fall steht er auf der Roten Liste gefährdeter Arten.“
Ballauf schaute ihn verständnislos an.
„Wieso Weidenprachtkäfer? Unter den Bäumen, die gefällt werden sollen, gibt es doch gar keine Weiden?“
Schuster schüttelte lächelnd den Kopf.
„Sie leben auch auf Eichen. Und von denen gibt es dort drei Stück.“
Ballauf kratzte sich abermals am Kopf.
„Aber warum heißt ein Tier Weidenkäfer, wenn es auf Eichen lebt?“
Schuster schaute Ballauf streng an und der hatte einen plötzlichen Rückfall in seine gut dreißig Jahre zurückliegende Schulzeit. Schon weil Schuster jetzt einen strengen Tonfall anschlug, der ihn sehr daran erinnerte, was für ein miserabler Schüler er gewesen war.
Schuster räusperte sich.
„Der Zoologe und Begründer der wissenschaftlichen Entomologie Johann Christian Fabricius hat ihn 1776 als Erster mit den Worten beschrieben: Habitat in Germaniae Salice, das heißt, dass er in Deutschland auf Weiden lebt. Dem ist nicht so, nur die Bezeichnung ist geblieben. Aber das ist wissenschaftlich auch nicht relevant.“
Ballauf nickte heftig.
„Egal. Hauptsache, er ist gefährdet.“
Jetzt meldete sich Elisabeth Meier-Brockenfels zu Wort.
„Prachtkäfer sagen Sie? Dann ist er wohl besonders groß und prächtig.“
Schuster machte einen spitzen Mund.
„So fünf bis acht Millimeter lang ist er.“
Ballauf schaute ihn erschrocken an.
„Fünf bis acht Millimeter? Und Sie haben ihn schon gesehen?“
Schuster schüttelte den Kopf.
„Nicht direkt, kann man sagen.“
Ballauf sank auf einen Stuhl.
„Was heißt das?“
Jetzt lächelte Schuster wieder.
„Nicht ihn direkt, sondern seinen Kot.“
Ballauf riss die Augen auf.
„Seinen Kot? Wollen Sie damit sagen, Sie sind in einer dreißig Meter hohen Eiche herumgeklettert, um den Kot eines acht Millimeters großen Käfers zu finden? Das ist doch…“
Schuster hob die Hand und augenblicklich verstummte Ballauf.
„Für wie schwachsinnig hältst du mich? Auch dein altmodischer Lehrer geht mit der Zeit. Ich habe mir eine Drohne mit einem Spezialobjektiv zugelegt. Mit der kann ich Makros in erstaunlicher Auflösung machen. Bereits auf dem Monitor habe ich die Hinterlassenschaften des Anthaxia salicis identifizieren können. Für die Artenschützer dürfte das reichen.“
Er erhob sich von seinem Stuhl.
„Und jetzt gehe ich nach Hause und werde meine Studien fortsetzen. Ich halte euch auf dem Laufenden.“
Schuster drehte seinen Zuhörern den Rücken zu und sofort setzte das allgemeine Gemurmel wieder ein. Erste Stimmen wurden laut, ob denn ein maximal acht Millimeter langes Tier, das bisher offenbar nur ein Naturforscher aus dem 18. Jahrhundert mit eigenen Augen gesehen und mit einem unpassenden Namen versehen hatte, dazu geeignet sei, straßenbauwütige Behörden zu stoppen.
„Ich glaube, der Alte ist schon ein bisschen senil“, raunte Claas Vormann, der wie immer in seiner übergroßen Lederweste auf der Querbank am Tresen saß.
Blitzschnell hatte Schuster sich umgedreht.
„Aber er hört noch gut“, raunzte er und man konnte geradezu die Pfeile sehen, die in Vormanns Richtung flogen. Was den sonst so Schwergewichtigen und Wortgewaltigen im Bruchteil einer Sekunde auf Weidenprachtkäfergröße schrumpfen ließ.
Inzwischen war Corvin aufgestanden und ging mit schnellen Schritten zur Tür.
„Entschuldigen Sie, Herr Schuster, darf ich Sie etwas fragen?“
Schuster schaute ihn nach Lehrermanier streng an.
„Haben Sie auch Zweifel an dem Anthaxia salicis?“
Corvin lächelte und schüttelte den Kopf.
„Nein, ich möchte ganz was Anderes. Sie haben mir schon einmal geholfen, die Gravur auf einer Pfeilspitze zu entziffern. Mein Name ist Erik Corvin.“
Schuster schaute ihn für ein paar Sekunden durchdringend an. Dann lächelte auch er.
„Ach ja, Sie sind der Junge, dessen Großvater einen Kolonialwarenladen in Gusborn hatte.“
Corvin riss die Augen auf.
„Donnerwetter, Ihr Gedächtnis möchte ich haben.“
Dann griff er in seine Hosentasche und legte den silbernen Knopf auf seine Handfläche.
„Können Sie mir sagen, woher dieser Knopf stammen könnte?“
Schuster nahm den Knopf, besah ihn von allen Seiten und hielt ihn dann mit der Vorderseite dicht an seine Brille.
„Per ardua ad astra. Nun, besser bekannt ist die Aussage ähnlichen Inhalts: Per aspera ad astra, was wörtlich ‚Durch das Raue zu den Sternen‘ heißt. Ardua ist mehr der Begriff für Härte oder Strebsamkeit.“
Corvin nickte.
„Und was bedeutet das in Zusammenhang mit dem Adler und der Krone?“
Schuster runzelte die Stirn.
„Genau weiß auch ich das nicht. Aber ich habe mal gelesen, dass es das Motto der Royal Air Force ist. Könnte doch sein, dass der Knopf von einer Jacke eines Mitglieds der britischen Luftstreitkräfte stammt. Wo haben Sie ihn gefunden?“
Corvin schaute nachdenklich.
„Auf einem Feldweg in der Nähe von Waddeweitz. Viel Sinn macht das nicht.“
Schuster zog die Mundwinkel nach unten.
„Das will ich nicht sagen. Immerhin gehörte auch Lüchow-Dannenberg nach dem Krieg zur britischen Besatzungszone. Bringt Sie das weiter?“
Corvin lächelte verlegen.
„Im Moment nicht so sehr. Ich werde darüber nachdenken. Aber erst einmal vielen Dank für Ihre Erklärungen. Und viel Erfolg für Ihren Antalya Salikus.“
„Anthaxia salicis“, verbesserte Schuster lächelnd.
„Oder so“, lächelte Corvin zurück.
5
Kristine Belitz fühlte sich nach einem erholsamen Schlaf und einem ausgiebigen Frühstück endlich einmal wieder entspannt. Ein Gefühl, das sie seit Langem nicht mehr gehabt hatte. Dazu trug auch das heitere Sommerwetter bei. Und die Beruhigungsmittel zeigten ebenfalls ihre Wirkung. Sie schaute durch das Fenster im Esszimmer in den Garten. Die Sonne schien auf das prachtvolle Rosenbeet, der alte Walnussbaum bewegte seine Blätter im leichten Wind und projizierte geheimnisvolle Schattenspiele auf das Kopfsteinpflaster des Weges, der zum Haupttor führte. Da sie noch einiges in Lüchow zu erledigen hatte, ohne dass dabei große Lasten zu tragen waren, beschloss sie, mit dem Fahrrad zu fahren. An so einem hellen Tag plagten sie keine Angstgefühle und außerdem hatte Doktor Senger ihr abgeraten, mit dem Auto zu fahren, solange sie die Beruhigungsmittel nahm. Von einem Fahrrad hatte er nichts gesagt.
Auf der Landstraße waren kaum Autos unterwegs. Ein großer Trecker fuhr an ihr vorbei und der Fahrer hob grüßend die Hand. Kristine winkte zurück. Sie konnte zwar nicht genau erkennen, wer da am Steuer saß, weil die Windschutzscheibe die Sonne reflektierte, aber sie grüßte zurück. Egal, dachte sie, Treckerfahrer werden sowieso immer gegrüßt.
Mit ihrem neuen E-Bike kam sie zügig voran und sie genoss es, ohne Anstrengung von einer unsichtbaren Kraft geschoben zu werden. Robert hatte darauf bestanden, dass ein Rückspiegel an ihrem Lenker befestigt wurde, so dass sie auch beim Linksabbiegen sehen konnte, ob nicht ein ignoranter Autofahrer noch im letzten Augenblick versuchte, sie zu überholen. Ach, Robert, dachte sie. Manchmal behandelte er sie wie ein Kind, das vor allen Gefahren des Lebens beschützt werden muss.
Sie lächelte. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen, als er ihr auf der Geburtstagsfeier ihres Vaters vorgestellt wurde. Er betrieb einen erfolgreichen Futtermittelhandel und war frisch geschieden, seine Ehe war kinderlos geblieben. Er wirkte energisch und zielbewusst, war aber auch gleichzeitig sehr zugewandt. Eine Mischung, die Kristine sehr gefiel. Dass er mit seinen blonden Haaren, den blauen Augen und seinem Siegerlächeln ziemlich gut aussah, beeindruckte die eher zurückhaltende junge Frau zusätzlich.
Als ihr Vater so plötzlich an den Folgen eines Herzinfarktes starb und sie als einzige lebende Verwandte den Hof und alles, was damit zusammenhing erbte, war sie froh, dass Robert ihr zur Seite stand. Ihre Mutter war an Krebs gestorben, als Kristine sechzehn war und noch zur Schule ging. Ein paar Wochen nach dem Tod ihres Vaters hatte Robert ihr einen Heiratsantrag gemacht, den sie ohne langes Zögern annahm. Das war kurz nach ihrem dreißigsten Geburtstag. Mit diesem Mann an ihrer Seite fühlte sie sich allen Herausforderungen des Lebens gewachsen. Dass er fünfzehn Jahre älter war als sie, störte sie nicht.
Es hatten natürlich einige Neider ein begehrliches Auge auf den Besitz geworfen, zumal es unter den großen Ländereien auch Bauerwartungsland gab. Besonders unangenehm war ein Makler aus Hamburg gewesen, der noch nicht mal eine gewisse Schamfrist in der Trauerzeit abgewartet hatte, sondern Kristine gleich nach der Beerdigung bedrängt hatte den ganzen Hof zu verkaufen. Er handele im Auftrag eines sehr potenten Klienten. Und dann hatte er angedeutet, dass er von gewissen Geschäften ihres Vaters wüsste, die nicht ganz legal gewesen seien. Dabei hatte er schmierig gegrinst. Sie war froh, dass Robert dazu kam und den Mann kurzerhand vor die Tür setzte. Wir sehen uns noch, hatte er in Kristines Richtung gerufen, bevor Robert ihn in sein Auto drängte und die Tür mit einem großen Knall zuschlug.
Plötzlich fiel ein schwarzer Schatten auf ihr Gemüt. Da waren sie wieder, die Ängste, die sie trieben und ihr die Luft zum Atmen nahmen. Hätte sie doch bloß nicht an diesen Widerling gedacht. Aber er ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Er hatte sie noch einmal angerufen und einen drohenden Tonfall gehabt, aber sie hatte mitten im Satz aufgelegt.
Inzwischen hatte sie das Ortsschild von Lüchow passiert. Sie hielt vor der Apotheke, bückte sich und schloss ihr Rad mit einer Schließkette an einem einbetonierten Bügel an.
„Hallo Kristine, lange nicht mehr gesehen.“
Sie drehte sich ruckartig um.
Vor ihr stand ein großgewachsener Mann von Mitte dreißig mit kurzgeschorenem dunklem Haar, gebräunter Haut und braunen Augen. Er trug eine helle Cordhose und ein kariertes Hemd mit aufgekrempelten Armen, die den Blick auf seine kräftigen Arme freigaben.
Kristine lächelte verlegen.
„O, Boris. Ich hatte dich gar nicht gesehen.“
Boris Sarreitz war so etwas wie ihr Jugendfreund gewesen. Sie kannten sich von der Schule, er ging in eine Klasse über ihr. Vielen galten sie als ein Paar, nur Kristine sah in Boris mehr den platonischen Freund als den Geliebten. Geschlafen hatten sie nie miteinander, obwohl er sie immer wieder bedrängte. Aber sie hatte ihn stets abgewiesen. Seine Eltern besaßen einen kleineren Hof und sie wären nicht abgeneigt gewesen, wenn ihr Sohn die Erbin eines der größten Höfe im Wendland geehelicht hätte. Boris war immer noch unverheiratet und wann immer er Kristine traf, konnte er sich nicht verkneifen, eine Bemerkung über ihren Ehemann zu machen.
So auch dieses Mal. Nachdem er sich förmlich nach ihrem Befinden erkundigt hatte, bekam sein Gesicht wieder diesen spöttischen Ausdruck.
„Und dein Mann? Ist er noch berufstätig?“
Kristine zog die Augenbrauen nach oben.
„Wenn du mit dieser Frage mal wieder dezent auf unseren Altersunterschied hinweisen willst, dann lass es doch einfach. Robert steckt jeden Dreißigjährigen in die Tasche. In jeder Hinsicht. Finde dich doch endlich damit ab, dass ich mich für ihn entschieden habe.“
Sie wollte grußlos gehen, aber Boris hielt sie am Arm fest.
„Entschuldige Kristine, so war das nicht gemeint.“
Sie wollte sich ihm entwinden, aber er hielt sie fest. Sie sah ihn hasserfüllt an.
„Lass mich jetzt bitte los, sonst mache ich dir hier mitten auf der Straße eine Szene.“
Er ließ von ihr ab und sie eilte davon.
„Frustriert und dann auch noch humorlos“, hörte sie ihn noch rufen.
Über den Tag, der so schön begonnen hatte, waren jetzt rabenschwarze Wolken in ihren Kopf gezogen. Kristine erledigte alles, was sie sich vorgenommen hatte, in großer Eile, öffnete das Schloss vom Fahrrad und hatte nur ein Ziel. Sie wollte so schnell wie möglich wieder nach Hause.