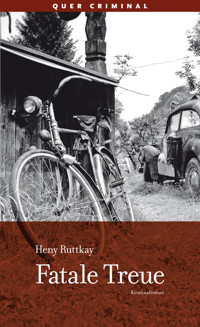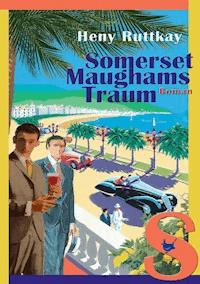Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Querverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eva und Heinrich, entfernte Cousins und frühere Spielkameraden, sehen sich im Jahre 1931 auf einem Familienfest in Karlsruhe wieder und stellen fest, dass sie einiges gemeinsam haben. Sie sind beide homosexuell, sehnen sich nach einem Leben in Berlin und haben eine reiche, kinderlose Tante, die sich Ersatzenkel wünscht. Eva und Heinrich gehen eine Scheinehe ein und ziehen mit dem Geld ihrer Verwandten nach Berlin. Beide lernen die geschlossenen Klubs, Lokale und Vereine der homosexuellen Szene kennen und genießen das Berliner Nachtleben. Als ein arbeitsloser Vetter bei einem Besuch ihr Geheimnis entdeckt, erkaufen sie sein Schweigen dadurch, dass sie ihn finanziell unterstützen und in ihrer gemeinsamen Wohnung wohnen lassen. Eva lernt eine Armenärztin kennen und lieben, Heinrich verliebt sich in einen kommunistischen Kader. Ihr Glück bleibt nicht lange ungetrübt, denn ihre Tante kommt nach Berlin, um nach dem Rechten zu sehen. Auch die politische Lage verdüstert sich und Evas und Heinrichs Leben nehmen eine unerwartete Wendung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Alle Charaktere, Schauplätze und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden und toten Personen sind unbeabsichtigt.
© Querverlag GmbH, Berlin 2013
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung einer Fotografie aus dem Jahre 1934 von Yolla Niclas (Ullstein Bild).
ISBN 978-3-89656-539-7
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH
Akazienstraße 25, 10823 Berlin
www.querverlag.de
Widmung
Für Marie-Hélène Goix
Karlsruhe, 1931
Ich fürchte mich zu kennen und kann mich doch nicht ignorieren.
Voltaire
1 EVA
Eigentlich hatte ich nicht zu der Geburtstagsfeier gehen wollen.
Ich war noch keine zwei Wochen zurück aus Berlin und die sieben Tage, die ich dort verbracht hatte, rückten allmählich weiter weg, wurden unaufhaltsam zur bloßen Erinnerung. Die Gerüche und Farben verblassten, die Bilder wurden stumpf, der Zauber schwand dahin, obwohl ich angestrengt versuchte, mir jede Einzelheit zu vergegenwärtigen.
Helga war mir hierbei keine Hilfe. Wäre ich weniger enthusiastisch, weniger auf mich konzentriert gewesen, hätte ich längst bemerkt, dass sie seit unserem Berlin-Aufenthalt einsilbig geworden war und mir auswich.
Ich war es gewesen, die auf der Reise bestanden hatte. Schon als kleines Kind hatte ich aus Erwachsenengesprächen mitbekommen, dass Berlin ein Sündenbabel sei, eine Stadt, in der alles möglich und erlaubt sei. Obwohl ich mich vollkommen still verhielt – unter der langen Tischdecke oder hinter einem wuchtigen Sessel versteckt –, wurde ich jedes Mal entdeckt und aus dem Zimmer geschickt, bevor ich Näheres erfahren konnte.
Hätte ich jedoch nicht in der Aktentasche von Fräulein Merz, unserer Deutschlehrerin, die Zeitschrift Die Freundin gefunden, als ich heimlich eine gepresste Rose hineinlegen wollte, hätte ich wohl erst viel später – vielleicht zu spät – erfahren, dass die Hauptstadt voller Frauen sei, die so empfanden wie ich.
Ich hatte die Zeitschrift mehrmals durchgelesen, bis ich sie fast auswendig kannte, hatte mir die Adressen der Lokale, Klubs und Vereine notiert und beschlossen, unsere gemeinsame Reise nach dem Abitur müsse nach Berlin führen anstatt ins Elsass.
Helga hatte nur einen kurzen Blick in die Zeitschrift geworfen und gemeint, sie habe Fräulein Merz schon immer für eine komische Person gehalten. Ich hatte sie mit meiner Begeisterung überrumpelt und sie war mir nach Berlin gefolgt, aber der Verkehr und der Lärm erschreckten und ermüdeten sie und so blieb sie die ganzen fünf Tage schlechter Laune.
Als wir eines Nachmittags in ihrem Zimmer saßen und ich versuchte, meine Erinnerungen an unsere Reise mit ihr zu teilen, unterbrach sie mich nach den ersten Worten mit einer für sie ungewohnt festen Stimme.
Sie möchte nie wieder etwas von Berlin hören. Nie wieder, ob ich es endlich begreifen könne. Es sei dort schrecklich gewesen, ganz einfach scheußlich und abstoßend. Sie verstehe mich nicht, wie ich mich für die schmutzige Stadt und jene komischen Lokale – sie gebrauchte das Wort „komisch“ grundsätzlich für Personen und Dinge, die ihr missfielen – so begeistern könne. Ich sei doch nicht eine von jenen …
Sie beendete ihren Satz nicht und die unausgesprochenen Worte hingen drohend zwischen uns, während ich sie ungläubig anstarrte. Früher war mir nie aufgefallen, dass sie so viele Flecken im Gesicht hatte. Es kam mir auch vor, als ob ihre Vorderzähne mehr hervorstünden und ihr reichliches, rötliches Haar, das ich früher so bewundert hatte, wäre stumpf, gliche nicht mehr einem feuerfarbenen Heiligenschein, verlieh ihr nicht mehr dieses ätherische Aussehen. Ein höchst durchschnittliches, blasses Mädchen, das Angst vor dem Anderssein, vor mir und vor sich selbst hatte. Ein Dutzendgesicht, das ich rasch vergessen, das ich auf dem Foto unserer Abschlussklasse in einigen Jahren nur mit Mühe wiedererkennen würde.
Einem unhörbaren, aber bestimmten Befehl gehorchend, stand ich plötzlich auf und ging grußlos aus dem Haus. Ich schaute nicht einmal ins Wohnzimmer hinein, um Helgas Eltern Auf Wiedersehen zu sagen. Ich wusste, dass Helga mir nicht nachkommen würde. In einigen Monaten würde sie sich selbst davon überzeugt haben, dass zwischen uns nie etwas gewesen war, dass ich lediglich zu einem Albtraum gehörte, aus dem sie rechtzeitig aufgewacht war.
Im Nachhinein erstaunte es mich selbst, dass ich auf diese abrupte Weise Helga verließ, mit einer selbstverständlichen Gedankenlosigkeit, wie wenn man aus einem Zug steigt, denn ich war monatelang aufrichtig und überschwänglich in sie verliebt gewesen. Es kam mir vor, als hätte ich seit Langem unbewusst auf diesen Augenblick gewartet.
Ihre vor Angst atemlose Stimme, die mich anflehte, doch vernünftig zu sein, wenn ich ihr hinter einer angelehnten Tür einen Kuss stahl, ihre blicklosen, entsetzten Augen, während ich sie in Berlin allnächtlich von Lokal zu Lokal schleppte, ihre verkniffenen Lippen, als mich an einem Abend eine Frau mit blitzendem Monokel zum Tanzen aufforderte, all das muss heimlich, aber ausdauernd an meinen Gefühlen für sie gezehrt haben.
Auf der Rückfahrt von Berlin, erschöpft von ihrem beharrlich missbilligenden Schweigen, hatte ich mich zu fragen begonnen, was ich noch für sie empfand. Unsere erste gemeinsame Nacht, am Ende der Sommerferien, bevor die Oberprima begann, lag fast ein Jahr zurück und ihre Schüchternheit und Ziererei im Bett fand ich nicht mehr rührend, sondern schlicht langweilig.
Im Gegensatz zu ihrer sexuellen Fantasielosigkeit war sie imstande, die erstaunlichsten Ausreden zu erfinden, warum wir nicht die Nacht zusammen verbringen konnten.
Ich hatte früher öfter bei ihr übernachtet; als Vorwand benutzten wir das gemeinsame Lernen fürs Abitur. Helgas Eltern mochten mich gern und fanden es selbstverständlich, dass ich bei ihr im Zimmer auf dem Feldbett schlief. Gleich nach den schriftlichen Abiturprüfungen verschwand jedoch dieses Alibibett für einige Zeit, da ihre Familie, wie Helga behauptete, es jemandem geliehen habe. Kurz darauf kam ihr ältester Bruder zu Besuch, und weil sein Zimmer sich gleich neben dem ihren befand und die Zwischenwand dünn war, meinte sie, es sei zu riskant, wenn ich die Nacht über bliebe, vor allem weil ich mich nicht beherrschen könne. Dann erklärte sie – und da horchte ich misstrauisch auf –, ihr Vater habe begonnen, unter Somnambulismus zu leiden, und könne nachts jederzeit durch die Tür hereinspazieren.
Es kam nicht infrage, dass sie bei mir schlief, da ich mein Zimmer mit meiner Schwester teilte. Als Anna dann Ende Mai heiratete, hatten sich meine Gefühle bereits abgekühlt und ich fand, in Berlin würden wir genügend Zeit füreinander haben. Es kam aber ganz anders, ich entdeckte eine andere Welt und neben all diesen fantastischen Frauen der Großstadt wirkte Helga plötzlich farblos und fade und es lohnte sich nicht, sich weiter um sie zu bemühen.
Auf dem Heimweg ging es mir noch gut, denn ich fühlte mich erleichtert, wie von einem bohrenden Zahnweh befreit. Es war Anfang Juli und sehr heiß, der Asphalt glühte durch meine dünnen Schuhsohlen hindurch und ich achtete darauf, im Schatten der Bäume zu bleiben.
Mit knatterndem Motor fuhr ein Automobil vorbei und der penetrante Benzingeruch erinnerte mich wieder an Berlin. Ich begann mir ein Leben in jener magischen Stadt auszumalen, stellte mir vor, wie ich mich durch die unüberschaubaren Menschenmengen drängte, sah mich in einem der Kaffeehäuser am Kurfürstendamm sitzen, auf die Straßenbahn – die „Elektrische“ – springen und spätabends zu einem jener Damenlokale eilen, die Helga so abgestoßen hatten.
Als ich das Gartentor öffnete, fiel mir ein, dass ich immer noch nicht wusste, wie ich in Berlin überleben könnte. Eine Wolke schob sich plötzlich vor die Sonne und verdüsterte die freundlichen Farben des Sommers.
Ich war nie für längere Zeit aus Karlsruhe hinausgekommen, aber es war mir klar, dass es nicht leicht sein würde, eine Stelle zu finden, wenn man keine andere Ausbildung vorzuweisen hatte als das Abitur eines Mädchengymnasiums, sei es noch so bekannt und angesehen.
In den Schulferien hatte ich hin und wieder im Putzmachergeschäft einer Großtante ausgeholfen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, den ganzen Tag in einem Laden zu stehen. Bürogehilfin, Sekretärin oder Kontoristin kamen nicht infrage, dafür spuckten die Handelsschulen alljährlich Heerscharen von Mädchen aus, die sich in diesen Krisenzeiten um die kümmerlich bezahlten Stellen schlugen.
Ich wusste, was draußen in der Welt los war; jeden Abend las ich Vaters Tageszeitung von der ersten bis zur letzten Seite und so hatte ich auch erfahren, was das Leben einer alleinstehenden Frau kostete.
Ein Studium in Berlin hätte mir mein Vater nicht bezahlt, selbst wenn er die Mittel dazu gehabt hätte, und es war kein Geheimnis, dass es meinen Eltern seit zwei Jahren finanziell schlechter ging, wie fast allen Menschen in unserer Umgebung. Mit uns Kindern sprachen sie nie über Geld, aber es gab nur noch zweimal in der Woche Fleisch zum Mittagessen und die zweite Haushaltshilfe wurde entlassen.
Einmal hatte ich es gewagt, zaghaft anzudeuten, dass ich gern Literatur und Politikwissenschaften studieren würde, aber selbst meine Mutter hatte mich gescholten, ich solle doch vernünftig sein und etwas Praktisches erlernen; eine Ausbildung zur Grundschullehrerin war das Äußerste, was ich erhoffen konnte, da mein Vater fest damit rechnete, dass ich in absehbarer Zeit heiraten würde.
Ich hatte etwas Geld gespart, aber es reichte gerade noch für eine Bahnkarte dritter Klasse nach Berlin.
Ich stieg die Treppenstufen hoch, trat in die Halle, drückte die Tür mit dem Rücken zu und blieb stehen. Es war sehr ruhig im Haus, als wäre es verlassen, und die Stille erinnerte mich daran, wie einsam ich war. Helga war die Einzige gewesen, die mich wirklich gekannt hatte und die wusste, wer ich war.
Hätte ich nur früher den Mut gefunden, zu Fräulein Merz zu gehen. Ich sah wieder ihr sorgenvolles, blasses Gesicht vor mir, das mich während der Prüfungen an meinen Diebstahl gemahnt hatte, und meine Augen begannen zu brennen wie damals, als ich zwei Tage nach der Abiturprüfung mit einem Blumenstrauß vor ihrer Wohnungstür gestanden hatte.
Ich hatte lange vergeblich geklingelt, bis die Nachbarin herauskam und sagte, Fräulein Merz sei fortgezogen. Sie habe ihre Stelle gekündigt und die Stadt verlassen. Ich hatte den Blumenstrauß der erstaunten Nachbarin in die Hände gedrückt und war die Treppe hinuntergestürzt, halb blind vor Tränen.
Ich hatte Fräulein Merz sagen wollen, dass sie sich wegen der verschwundenen Zeitschrift keine Sorgen machen solle, dass ihr Geheimnis bei mir gut aufgehoben sei. Dass sie schon immer meine Lieblingslehrerin gewesen sei, schon bevor ich gewusst hatte, dass wir etwas Wesentliches gemeinsam hätten. Deswegen die Rose in der Aktentasche. Ob sie denn nie bemerkt habe, wie ich sie anhimmelte, wenn sie vor meiner Bank stand, oder wie ich rot wurde, wenn sie mich ansah?
Sie hatte die Abiturfeier als Erste verlassen und ich hatte ihrer dunkel gekleideten, sehr schmalen Gestalt nachgesehen. Wäre ich nicht gerade von meiner Familie umringt gewesen, wäre ich ihr nachgelaufen und hätte sie aufgehalten. Sie hätte erfahren, dass sie keine Angst zu haben, dass sie nicht zu kündigen und zu fliehen brauchte.
Ich hörte die Schritte meiner Mutter am oberen Treppenabsatz und löste mich von der Tür.
„Ich dachte, du wolltest den ganzen Nachmittag bei Helga bleiben.“
Sie lief die Treppe hinunter – sie konnte sich nie anders bewegen als in Eile – und musterte mich aufmerksam von oben bis unten, als wäre sie in Gedanken woanders.
„Ihre Eltern hatten Besuch und …“
„Was ziehst du morgen zu Tante Rosemaries Geburtstag an?“
Sie zupfte an meinem Kleid, hob dann den Blick zu meinem Haar – ich war um Einiges größer als sie – und strich es mir aus dem Gesicht. Unter der Berührung ihrer warmen Hand schloss ich kurz die Augen. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass sie mehr von mir ahnte, als sie es sich anmerken ließ. Sie war Helga gegenüber weniger herzlich gewesen, hatte sie weniger gemocht als meine anderen Freundinnen, so als wäre sie auf dieses Mädchen ein wenig eifersüchtig gewesen.
Ich wollte antworten, dass ich nicht zum Fest gehen wollte, aber ich hielt mich rechtzeitig zurück. Mutter ließ mir viel durchgehen, verteidigte meinen „Eigensinn“ gegen Vater, da ich ihr von allen ihren Kindern am ähnlichsten war, aber ich kannte die Grenzen ihrer Geduld. Rosemarie war die Königin der Familie, und wenn sie zu ihrem sechzigsten Geburtstag ein Fest veranstaltete, hatten alle vollzählig zu erscheinen.
Da ich nichts sagte, entschied meine Mutter für mich, dass ich das hellblaue Kleid mit der weißen Bordüre anziehen solle, es sei fast neu, und die weißen Schuhe dazu.
Dann eilte sie in die Küche und ich blieb allein in der Halle zurück.
2 HEINRICH
Er ließ seine Mutter und seinen Stiefvater mit einer Gruppe lärmender, bereits leicht angetrunkener Gäste zurück und begab sich in den hinteren Teil des Gartens. Neben dem Gewächshaus stand bestimmt noch die wackelige Bank, im Schatten einer alten Akazie verborgen.
Er schritt quer über den Rasen vor dem Haus, umging im weiten Bogen die u-förmig angeordneten, weiß gedeckten Tische, stolperte fast über den Ball, den eines der Kinder verloren hatte, und wich den Dienstmädchen aus, die vollgeladene Servierbretter trugen.
Weiter hinten im Garten waren weniger Gäste, einige junge Pärchen, die zusammen spazierten, und zwei kahlköpfige Männer mit üppigen Schnurrbärten, die Zigarren rauchend in der Gartenlaube saßen.
Heinrich ließ den gepflegten Teil des Gartens hinter sich, ging am Gewächshaus vorbei und bog um den Geräteschuppen.
Die Bank war besetzt. Am linken Ende, dort, wo die kleine Mulde im Holz war und zum längeren Verweilen einlud, saß jemand. Er verlangsamte den Schritt und im nächsten Augenblick erkannte er das Mädchen im hellblauen Kleid wieder.
Die junge Frau wäre ihm nicht weiter aufgefallen, wenn sie ihm beim Mittagessen am Tisch nicht schräg gegenübergesessen hätte. Er hatte zunächst nur mechanisch registriert, dass die Farbe des Kleides genau ihrer Augenfarbe entsprach, dann nicht weiter auf sie geachtet, bis er zufällig wieder den Kopf in ihre Richtung gedreht hatte.
Eine Serviererin in weißer Schürze hatte sich über den Tisch gebeugt, um nach einer Platte zu greifen, und das Mädchen hatte in ihr tiefes Dekolleté gestarrt, das den Ansatz eines üppigen Busens enthüllte. Die Platte war lang und schwer und die Frau hatte Mühe, sie richtig zu greifen und anzuheben, und während dieser langen Sekunden hatte die andere mit ihren hellen Augen den Busenansatz fixiert, als hätte sie die Welt um sich herum vergessen. Als es der Serviererin endlich gelungen war, sich mit der Platte in der Hand wieder aufzurichten, hatte das Mädchen rasch weggesehen und sich auf ihrem Stuhl zurückgelehnt.
Plötzlich wusste Heinrich, wer sie war. Bis zu seinem dreizehnten Lebensjahr hatten sie alle Sommerferien zusammen verbracht. Vor allem sie beide, obwohl er zwei Jahre älter war als sie, waren damals unzertrennlich gewesen, hin und wieder hatten einige andere Vettern und Cousinen mitgespielt. In seiner Erinnerung waren es die schönsten Tage seines Lebens gewesen. Tage, wie man sie im Allgemeinen nostalgisch mit der Kindheit verbindet, ausgefüllt von Spielen und Entdeckungsreisen im Freien, eine verzauberte Parallelwelt, die er nur mit Eva zusammen erlebt hatte.
Ein inneres, seltsam erleichtertes Lachen war in ihm hochgestiegen und er hatte sie ansprechen wollen, als von hinten Tante Rosemarie beide Hände auf seine Schultern gelegt hatte. Sie hatte darauf bestanden, ihn dem Chefredakteur des Mittelbadischen Kuriers vorzustellen. Als er einige Minuten später zu seinem Stuhl zurückgekehrt war, war Eva nicht mehr da gewesen. Er hatte sie in der Menschenmenge gesucht und nicht gefunden, wahrscheinlich hatte sie sich nach dem Essen gleich hier nach hinten verzogen, wie sie es beide als Kinder bei Familienfesten getan hatten.
Sie bemerkte ihn nun auch und verschränkte abwehrend beide Arme vor der Brust. Er trat näher, öffnete sein Zigarettenetui und hielt es ihr hin. Nach einem winzigen Zögern nahm sie eine Zigarette und ließ sich von ihm Feuer geben.
Sie blies sofort den Rauch aus wie jemand, der nicht daran gewöhnt ist zu rauchen, und sah ihm direkt ins Gesicht.
„Ich weiß nicht, ob du mich wiedererkannt hast, Eva. Ich bin Heinrich, Veronikas Sohn.“ Da sie nicht reagierte, fügte er hinzu: „Aus München.“
„Natürlich erinnere ich mich an dich. Ich habe dich nicht gleich erkannt, aber jetzt weiß ich, wer du bist. Wir haben hier früher oft zusammen gespielt.“
Ihr Blick belebte sich, verlor etwas von seiner durchsichtigen blauen Kälte.
„Du hast einmal Werner und Rainer hier hinter dem Gewächshaus verprügelt, weil sie mich geärgert hatten.“ Heinrich grinste. „Du warst zwar zwei Jahre jünger als sie und etwas kleiner, aber viel verbissener. Danach haben sie sich so geschämt, dass wir für den Rest des Sommers Ruhe vor ihnen hatten.“
Sie lächelte ein überraschend breites Lächeln, das Grübchen in ihren Wangen bildete.
„Sie nehmen es mir heute noch übel. Vorhin haben sie mir beide kaum Guten Tag gesagt.“
Er lachte und setzte sich neben sie.
„Hast du Marie gesehen? Ich weiß nicht einmal, ob sie heute da ist. Sie war auch so ein Wildfang wie du.“
„Sie ist heute nicht da, aber du würdest sie wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Sie hat im Januar in aller Eile geheiratet, nur im Beisein von zwei Zeugen.“
„Davon wusste ich nichts. Meine Mutter muss vergessen haben, es mir zu erzählen. Wieso in aller Eile?“
Sie sah ihn von der Seite an und zuckte lächelnd mit den Schultern.
„Verstehe. Ist das Kind schon da?“
„Nein, aber es wird in den nächsten Tagen damit gerechnet.“
Heinrich drückte seine halb gerauchte Zigarette aus und merkte, dass seine Hände zitterten. War es möglich, dass der verrückte Plan, der vor einigen Jahren in seinem Hirn herangereift war und den er immer wieder als unrealistisch verworfen hatte, doch zu verwirklichen war? Vorhin, als er Evas eindeutigen Blick auf dem Busen des Dienstmädchens bemerkt hatte, hatte er gleich wieder daran gedacht, an diesen ausgeklügelten Betrug, der ihm ein freies Leben ermöglichen sollte.
Er musste vorsichtig sein, denn es konnte sein, dass er sich irrte, dass er sich alles eingebildet hatte, schließlich kannte er Eva nicht. Als Kind war sie ein halber Junge gewesen, aber Marie, die künftige Mutter, hatte ihr damals in nichts nachgestanden.
Die Sommer mit Eva waren eine endlose Reihe von Abenteuern gewesen, in denen sie Szenen aus Büchern von Karl May und Alexandre Dumas nachgespielt hatten, die sie alle auswendig kannte. Obwohl Eva es war, die den anderen Kindern die Rollen zuteilte und die Regie führte, hatte sich niemand von ihr gegängelt gefühlt. Sie flüsterte ihnen so überzeugend ihre eigenen Empfindungen und Gedanken ein, dass sie ihr willenlos folgten, als wären sie Gestalten, die ihren Träumen entwichen wären.
Er sah zu, wie Eva versuchte, mit dem Zigarettenrauch Ringe zu blasen, und lächelte, als ihr einer fast gelungen war. Wahrscheinlich war sie immer noch so fantasiebegabt und verspielt wie vor acht Jahren, als er sie zuletzt gesehen hatte, aber sie schien etwas von sich krampfhaft zurückzuhalten; es lag eine Anspannung über ihren Zügen, die sie um Einiges älter wirken ließ, als sie war.
„Lebst du immer noch in München?“
Ihre Frage überraschte ihn und er ließ sich mit der Antwort Zeit.
„Ja, leider.“
„Warum leider?“
Er betrachtete ihr Gesicht aus der Nähe.
„Aus mehreren Gründen. Ich bin dort nie heimisch geworden.“
„Stimmt, du hast nicht einmal die Mundart angenommen.“
Seine Mutter war oft umgezogen, ihren Sohn im Schlepptau, und sie hatte sich in München erst niedergelassen, als sie ihren zweiten Mann kennengelernt hatte. Nachdem sie sich mit ihrer Schwester Rosemarie zerstritten hatte, durfte er in den Schulferien nicht mehr nach Karlsruhe kommen und der Rest seiner Kindheit blieb in seiner Erinnerung einsam und trostlos.
Heinrichs erster Impuls war, Eva alles zu erzählen, aber er schwieg und überlegte, wie er sie testen, wie er mehr über sie herausfinden konnte.
„Und jetzt zu dir: Wann hast du vor zu heiraten?“ Er hörte sich in einem erwachsenen, gönnerhaften Ton sprechen, den er bei anderen verabscheute. „Deine Freundinnen sind bestimmt schon alle unter der Haube.“
Sie rührte sich nicht, aber er konnte spüren, wie sie sich von ihm zurückzog. Sie blickte über seine Schulter zum Haus, wo Musik erklang.
„Nie.“
„Niemals? Bist du sicher?“
„Natürlich. Ich weiß genau, was ich vom Leben erwarte.“
„Und? Was ist es?“
Sie sah ihn wieder an. Er nahm ein sehr kurzes, kaum merkliches Aufflackern wahr, wie vorhin, als sie ihn wiedererkannt hatte, ein Signal, dass sie immer noch über ihre alte, unbezähmbare Energie verfügte, dann erlosch es gleich wieder.
„Ich möchte studieren und in Berlin leben.“
Er holte wieder seine Zigarettendose hervor. Sie bediente sich und es gelang ihm, seine Hände ruhig zu halten, während er ihr das Feuerzeug hinhielt.
„Weshalb Berlin?“
Sie wandte den Kopf ab, während sie den Rauch ausblies.
„Aus vielen Gründen.“
Er seufzte. „Ich würde auch gern in Berlin leben.“
Sie nickte abwesend und schwieg.
„Meine Mutter würde nicht zulassen, dass mein Stiefvater mir ein Studium in Berlin bezahlt. Ich bin ihr einziges Kind und sie will mich in ihrer Nähe haben.“
Eva gab einen mitfühlenden Laut von sich.
Heinrich zwang sich, weiterzusprechen, und hatte dabei das Gefühl, als fiele er in bodenlose Tiefe.
„Schon seit Jahren träume ich davon, nach Berlin zu gehen, vor allem seit ich weiß, dass es einen Weg gäbe, dort ganz bequem zu leben, dank Tante Rosemarie.“
Hörte sie ihm überhaupt zu? Sie saß vollkommen entspannt da, die Beine lässig von sich gestreckt, wie er es noch bei keiner Frau gesehen hatte, und versuchte weiterhin, kunstvolle Rauchwolken zu formen.
„Tante Rosemarie hatte schon immer eine Schwäche für mich, ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil ich ihr einziger Neffe bin und sie keine Kinder hat. Vor zwei Jahren ist sie nach München zu meiner Abiturfeier gekommen. Sie hat mir eine Uhr geschenkt und versprochen, wenn ich mal heirate, mir zur Hochzeit ihre Wohnung in Berlin zu schenken und monatlich eine großzügige Summe zur Verfügung zu stellen.“
Eva musste versehentlich Rauch inhaliert haben, denn sie hustete. „War es ihr ernst?“
Sein Magen zog sich schmerzhaft zusammen und er sprach immer schneller.
„Sie hatte es mir fest versprochen, vor mehreren Zeugen, beim Mittagessen mit der halben Familie. Ich dachte zunächst, sie wollte nur meine Mutter ärgern, da sie wusste, wie besitzergreifend sie ist, und auch weil ich sie öfter wegen Berlin ausgefragt hatte, aber dann schwor sie feierlich, sie würde beim Notar ein entsprechendes Schriftstück hinterlegen für den Fall, dass sie vor meiner Hochzeit stirbt. Sie fügte sogar hinzu, dass meine erstgeborene Tochter, wenn sie ihren Namen erhielte, die Hälfte ihres Vermögens erben würde.“
Eva blickte zum Haus. „Tante Rosemarie hat angeblich drei Millionen Dollar von ihrem Mann geerbt und geht mit dem Geld sehr großzügig um. Sie hat mir meine Reise nach Berlin bezahlt, als Geschenk zum Abitur, obwohl wir uns nie besonders nahestanden. Du hast Glück, dass sie dich mag. Jetzt musst du nur noch jemanden zum Heiraten finden.“
Er stand auf, tat einige Schritte und kam wieder zurück. Er verkrampfte seine Hände in den Hosentaschen.
„Ich habe die Glückliche schon gefunden.“
Sie drückte ihre Zigarette aus und bückte sich nach ihrer Schuhschnalle, an der ein Grashalm steckte.
„Und wer ist es?“
„Du.“
Sie hielt ganz kurz inne, riss am Grashalm und rieb ihre grün gewordene Schuhspitze mit der Hand ab.
„Sehr witzig.“
Er sprach lauter, mit zitternder Stimme. „Es ist mir ernst, du wirst es sein oder keine. Sobald ich dich gesehen hatte, wusste ich, dass du die Richtige bist.“
Sie hob abrupt das Gesicht zu ihm. In den zurückliegenden Minuten hatte er gelernt, darin zu lesen, und es überraschte ihn nicht, als sie aufstand, so dass sie ihn auf ihren Absätzen um einige Zentimeter überragte und auf ihn herabblicken konnte.
„Ich lasse mich nicht kaufen.“
„Möchtest du nicht wissen, wieso ich sofort an dich gedacht habe?“ Er ließ ihr keine Zeit zu antworten. „Ich habe dich vorhin beobachtet, wie du die mollige Serviererin angestarrt hast. Ich weiß, dass du Frauen magst, dass du an Männern nicht interessiert bist. Ich kann mir auch denken, warum du unbedingt nach Berlin willst.“
Er biss sich auf die Unterlippe und wartete. Vielleicht hatte er auf der ganzen Linie verloren. Sie würde ungläubig nach Luft schnappen, alles schockiert von sich weisen, zu ihrer Mutter rennen oder zu Rosemarie …
Eva ließ sich auf die Bank zurücksinken. Er atmete laut auf, aber er wandte nicht den Blick von ihrem Gesicht. Sie wirkte wie damals als Kind, als sie von der Gartenmauer gefallen war und sich den Knöchel verrenkt hatte, erschreckt und erstaunt darüber, verwundbar zu sein. Er sprach hastig auf sie ein.
„Keine Angst, wir sitzen im selben Boot. Was glaubst du, warum ich es in München nicht mehr aushalte. Gut, ich will von Mutter weg, aber auch, weil ich es nicht mehr ertrage, wie ein Eunuch zu leben.“ Jemand weiter vorne im Garten lachte laut auf und er unterbrach sich und sah über die Schulter. Es war niemand zu sehen und er fuhr gehetzt fort, verschluckte in seiner Eile Worte und verhaspelte sich immer wieder. „Mein Stiefvater scheint etwas zu ahnen. In letzter Zeit kommt es mir vor, als würde er mich beobachten. Er hat einige Bemerkungen fallen lassen über meine Hände und meine Bewegungen, er sagte, ich würde verweichlichen, weil ich keinen Sport treibe. Und er fragte, warum ich nicht mit der Tochter seines Direktors ausgehe, offensichtlich gefiele ich ihr und es würde seiner Stellung in der Firma zugutekommen, ich solle doch etwas für ihn tun. Zum Glück hält meine Mutter alle Frauen von mir fern, sonst würde er bestimmt irgendwann die Frage stellen, warum ich nie mit Mädchen ausgehe.“
Heinrich ballte die Hände in seinen Taschen zu Fäusten. Wut und Hass waren bisher nur leere Begriffe gewesen; er hatte sich nie eingestehen wollen, dass er so heftig empfinden konnte. Er hatte sich eine lauwarme, stille, duldsame Persönlichkeit zurechtgebastelt, um das Leben mit seiner Mutter und seinem Stiefvater ertragen zu können, aber jetzt, da die Erlösung unerwartet in Sicht war, merkte er, wie verbittert er über all die Jahre gewesen war, wie viel Groll er mit sich herumgetragen hatte.
Eva, die ihm im stummen Erstarren zugehört hatte, rührte sich. „Sieht man es mir so sehr an?“
Sie sprach nicht mit ihrer gewöhnlichen Stimme; sie klang dünn und kläglich.
„Nein, nur wenn man ein solcher Kenner ist wie ich.“ Er entspannte sich und lächelte. „Und mir? Sieht man es mir sehr an?“
Sie fixierte ihn mit weit geöffneten Augen. „Ich glaube nicht. Aber ich kenne mich bei Männern nicht aus. In Berlin bin ich nur in Damenlokalen gewesen.“
Er sah sich wieder um und senkte die Stimme. „Ich habe auch nicht viel Erfahrung. Wenn du wüsstest, was für ein Dorf München ist, jeder kennt jeden. Zweimal bin ich mit knapper Not der Polizei entwischt, als sie Razzien in Lokalen gemacht haben, danach traute ich mich nie wieder hin …“
Er rieb sich die Stirn und schob die peinliche Erinnerung von sich.
„Als Tante Rosemarie mir vor zwei Jahren dieses Versprechen machte, habe ich gleich daran gedacht, dass ich eine Scheinheirat eingehen könnte. Meiner künftigen Frau kann ich eine halbe Wohnung in Berlin anbieten, die Hälfte des Geldes, das Tante Rosemarie mir zugedacht, hat und die Zusicherung, dass ich mich in keiner Weise wie ein Ehemann benehmen werde.“ Er tastete in seiner Tasche nach dem Zigarettenetui. „Ich wusste einfach nicht, wie ich eine Frau finden sollte, die an dieser Art von Ehe interessiert wäre und der ich genügend vertrauen könnte, aber als ich dich heute gesehen habe …“
Eva antwortete nicht und er holte sein Zigarettenetui hervor. Sie schüttelte den Kopf, als er es ihr hinhielt.
„Ich weiß, für dich kommt alles sehr überstürzt. Ich habe seit Monaten nichts anderes im Kopf, ich kann fast an nichts anderes denken.“ Er zündete sich die Zigarette an und inhalierte tief, als hätte er seit Tagen nicht geraucht. „Ich habe daran gedacht, eine Anzeige aufzugeben, habe aber zu viel Angst gehabt.“
Eva schwieg immer noch.
„Du hast eine Woche zum Überlegen. Meine Mutter hat Rosemarie versprochen, zehn Tage in Karlsruhe zu bleiben, aber ich glaube nicht, dass der Friede zwischen den beiden lange halten wird. Da sie weiß, dass Rosemarie mich gern um sich hat, wird sie bestimmt bald einen Grund finden, um sie zu beleidigen, meinen Stiefvater gegen seine Schwägerin aufzubringen und die Koffer zu packen.“
Eva befeuchtete ihre Lippen mit der Zunge.
„Ich verstehe es nicht so ganz. Du bist volljährig, Heinrich. Warum lässt du deine Mutter nicht einfach zurück nach München gehen und du bleibst bei Rosemarie? Wenn sie dich so gern hat, wie du sagst, wird sie dir vielleicht sogar das Studium in Berlin bezahlen und du musst nicht heiraten.“
Heinrich lächelte bitter.
„Schön wär’s! Rosemarie hat keine Kinder und träumt von Ersatzenkeln, das hat sie mir eines Tages ganz klar gesagt. Würde ich hier bei ihr wohnen, würde sie bestimmt alles dransetzen, um mich rasch zu verheiraten. Sie ist freundlich und großzügig, aber sie ist es gewohnt zu bekommen, was sie will. Niemals würde sie mir ohne eine passende Frau ihre Wohnung überschreiben. Und die finanzielle Unterstützung ist auch an gewisse Bedingungen geknüpft. Keine Scheidung, kein Umzug und eine anständige, sprich bürgerliche Lebensführung.“
Er hatte viele Nächte lang mit weit geöffneten Augen davon geträumt, einfach den Zug zu nehmen und nach Berlin zu fliehen. Während er im Bett lag, fühlte er den Sog, der von jener Stadt ausging, wie vom Auge eines Zyklons, aber sein Körper widerstand ihm, bewegungslos und schwer. Die Jahre in der Rolle des willenlosen, gehorsamen Sohnes hatten ihn geprägt und er wusste, dass er, mittellos und unerfahren, wie er nun einmal war, in der Großstadt nicht überleben würde.
Er schleppte sich durch die Seminare und Vorlesungen seines langweiligen Germanistikstudiums wie ein Sträfling durchs Labyrinth der Gefängniskorridore und wartete auf ein Wunder, das ihn befreien würde.
Eine Amsel flog schimpfend dicht über ihren Köpfen vorbei. Die Musik im Haus war verstummt und sie hörten das Stimmengewirr und das Gelächter, das weiter entfernt schien, als es in Wirklichkeit war.
Eva sprach wieder, sie musste sich räuspern. „Diese Wohnung in Berlin … Kennst du sie?“
Ihr Sinn fürs Praktische überraschte ihn.
„Nein, aber da Rosemarie mit ihrem amerikanischen Ehemann ein paar Monate lang darin gewohnt hat, muss sie groß sein. Er war daran gewöhnt, viel Platz zu haben. Sechs, sieben Zimmer bestimmt.“ Er zog ausgiebig an seiner Zigarette. „Es würde uns beiden bestimmt reichen, wir müssten uns kaum über den Weg laufen. Nur für die Familie müssten wir hin und wieder Theater spielen.“
„Und du …“ Sie zögerte kurz. „Bist du ganz und gar homosexuell?“
„Keine Angst, von mir hast du nichts zu befürchten. Ich habe es nie mit einer Frau versucht, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich physisch dazu imstande wäre.“
Eva lächelte, aber sie sagte nichts.
„Was die Kinder betrifft, werden wir unserer Familie eben erzählen, dass wir von Arzt zu Arzt gelaufen sind und dass uns leider keiner von unserer Unfruchtbarkeit heilen konnte …“
Sie unterbrach ihn. „Wenn wir erst einmal in Berlin sind, werden wir uns vor niemandem mehr rechtfertigen müssen.“
Für einen Augenblick verschlug es ihm den Atem.
„Was meinst du damit? Sagst du Ja?“
Sie stand auf. „Jeder führt seinen eigenen Haushalt und sein eigenes Leben, wir werden uns nur die Küche und das Bad teilen. Einverstanden?“
Er hätte sie am liebsten umarmt, aber er wollte kein Missverständnis aufkommen lassen.
„Dein Wunsch ist mir Befehl. Lass uns aber so schnell wie möglich heiraten, ja?“
3 EVA
Wir trafen uns täglich, damit sich unsere Umgebung daran gewöhnte, uns zusammen zu sehen.
Ich hatte Heinrich als einen stillen, farblosen Jungen in Erinnerung gehabt, der mir immer wie ein Schatten an den Fersen klebte, aber als Erwachsener war er bei Weitem nicht so langweilig wie die meisten Männer in seinem Alter. Er versuchte nicht, Eindruck auf mich zu machen, und nichts davon, was ich sagte oder tat, schien ihn zu befremden. Meine Abenteuer in Berlin amüsierten ihn und er beneidete mich, denn er war allein noch nie so weit gereist. Seine Mutter hatte es mit ihrer halb wahren, halb eingebildeten Herzkrankheit und gut berechneten Gefühlsausbrüchen immer zu verhindern gewusst.
Ich fragte mich später, warum Tante Veronika in mir keine Konkurrentin gewittert hatte, als er begann, alle Nachmittage im Hause meiner Eltern zu verbringen. Als hässlich galt ich nicht. Ich war zwar sehr groß, was für eine Frau im Allgemeinen als Nachteil angesehen wurde, aber sehr blond, was auf dem Heiratsmarkt anscheinend viel wert war. Auch meine langen Beine und der „unmodisch üppige“ Busen, wie die Schneiderin geseufzt hatte, als sie das blaue Kleid für meine Abiturfeier angefertigt hatte, waren zu meinem Erstaunen nach gängiger Meinung vorteilhaft.
Was sie jedoch unmöglich übersehen haben konnte, waren meine wenig weibliche Art, mich zu bewegen, mit großen Schritten, rollenden Schultern und abrupten Bewegungen, und das Fehlen jeglicher Koketterie, wenn ledige Männer anwesend waren. Dies muss Veronika beruhigt haben, wahrscheinlich betrachtete sie mich als eine dieser – ihrer Meinung nach bedauernswerten – Mädchen, die dazu geboren waren, als alte Jungfern zu enden.
Niemals hätte sie – die andere Frauen nur als Rivalinnen sehen konnte und sich in ein Raubtier verwandelte, wenn es darum ging, die Aufmerksamkeit eines Mannes auf sich zu ziehen – eine Lesbierin in mir vermutet. Bestimmt hatte sie bereits von „solchen Frauen“ gehört oder gelesen, aber in ihrer Vorstellung mussten es absonderliche, verunstaltete Wesen sein, deren Abartigkeit man von Weitem sehen konnte, denn welche einigermaßen passable Frau würde sich mit einer anderen Frau abgeben?
Der Sinn des Lebens bestand ihrer Meinung nach darin, die Aufmerksamkeit möglichst vieler Männer auf sich zu ziehen, einen von ihnen für immer an sich zu binden und Kinder zu kriegen, vorzugsweise Söhne. Und auch nach der Heirat ging für Veronika der erbarmungslose Wettkampf unter den Frauen weiter; sie wollte die Schönste sein, die beste Ehefrau und Mutter, sie musste den erfolgreichsten Mann und den artigsten Sohn haben.
Ein anstrengendes Leben, an dessen Ende sie zwangsläufig als Verliererin dastehen musste, da ihr Altern und das Erwachsenwerden ihres Sohnes nicht vorgesehen waren.
Wenn ich mit Heinrich über sie sprach, bemitleidete ich sie aufrichtig, aber er sagte, ich solle meine Gefühle nicht an sie verschwenden, sie habe die seinen in einem langen Zermürbungskampf aufgezehrt, er könne nichts mehr für sie empfinden.
Meine Mutter, die Veronikas Lebenskonzept nicht teilte und sie nie besonders geschätzt hatte, hatte offensichtlich nichts gegen ihren Sohn und sah ihn nicht ungern bei uns im Haus. Sie sprach jedes Mal kurz mit ihm, brachte uns Kaffee und ließ uns dann allein, nicht aus Diskretion, sondern weil sie immer zu tun hatte. Sie hatte zwar ein Hausmädchen, das Böden schrubbte, sich um die Wäsche kümmerte und in der Küche half, aber sie war dennoch ununterbrochen beschäftigt.
Mein Vater begrüßte Heinrich freundlich, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, und tauschte einige nichtssagende Sätze mit ihm. Meine beiden jüngeren Brüder waren erstaunt, dass ich Herrenbesuch hatte, und beäugten ihn jedes Mal neugierig.
Am vierten Tag fragte meine Mutter Heinrich, ob er zum Abendessen bleiben wolle, und er lehnte höflich ab. Am folgenden Tag wiederholte meine Mutter beiläufig ihr Angebot und er nahm an.
Das Essen verlief besser, als ich gedacht hatte. Heinrich fragte meine Eltern nach Cousinen, Vettern, Onkeln und Tanten aus und sie erzählten von Geburten und Beerdigungen, Hochzeiten und Krankheiten.
Ich hatte Heinrich gewarnt, dass er auf keinen Fall vom Krieg reden durfte. Mein ältester Bruder war nur wenige Wochen vor Kriegsende gefallen und die Trauer meiner Eltern hatte sich in eine Art stummen Verleugnens der Vergangenheit verwandelt. Die Jahre zwischen 1914 und 1918 hatte es demnach nie gegeben und ihr ältester Sohn wurde vor uns Kindern nie erwähnt, nur seine Fotografie im Wohnzimmer wurde regelmäßig abgestaubt.
Heinrich erinnerte sich sehr genau an meinen Bruder, wie er in Uniform zu Rosemarie gekommen war, um sich zu verabschieden, denn er hatte ihn ungewöhnlich gut aussehend gefunden.
Nach dem Kompott half ich dem Hausmädchen, den Tisch abzutragen, und Heinrich folgte meinen Eltern ins Wohnzimmer. Meine Knie zitterten, als ich die Kompottschüsseln abstellte. Das Hausmädchen blickte mich von der Seite an und fragte, ob mir unwohl sei.
Ich verneinte und sagte, ich hätte zu viel gegessen. Sie widersprach, meinte, ich sei zu dürr, ich erwiderte, das sei ich auf keinen Fall, und so hielt ich angestrengt ein Gespräch mit ihr im Gange, während ich die Wanduhr über dem Tisch fixierte und zerstreut mit den Messinggewichten der Küchenwaage spielte.
Der Minutenzeiger war mühsam fünf Striche weitergerückt, als die Tür aufging und meine Mutter mir winkte, ich solle ihr folgen. Ich hatte gerade noch Zeit, ihr in Verwunderung erstarrtes Gesicht zu sehen, dann hatte sie sich schon umgedreht und ich hatte Mühe, ihr zu folgen, als wir den Flur und das Esszimmer durchquerten.
Im Wohnzimmer setzte sie sich neben Vater aufs Sofa, blickte auf Heinrich, der hinter einem Sessel stand, und dann auf mich. Vater räusperte sich.
„Tja, Eva, es scheint, Heinrich und du möchtet heiraten.“
Ein stummes Nicken schien mir die passendste Antwort zu sein.
„Ich muss sagen, ich bin etwas überrascht. Ihr kennt euch kaum …“
„Wir kennen uns seit Jahren“, unterbrach ich ihn. „Wir haben uns heimlich geschrieben, seitdem wir Kinder sind.“
Meine Mutter öffnete ein wenig den Mund, ihre Augen rundeten sich, denn in diesem Augenblick wusste sie, dass ich log, aber sie sagte nichts.
„So, heimlich.“ Mein Vater sah keinen Grund, mir nicht zu glauben, was mich unerwartet rührte. Er war ein sehr stiller, ernster Mann, den ich seit dem Tod meines Bruders nie wieder hatte lachen sehen. Mit seinem geraden, grau glänzenden Haarscheitel und weißen, gestärkten Hemdkragen wirkte er immer ausgesprochen sauber und korrekt und ich war mir sicher, dass er in seinem ganzen Leben nie gelogen hatte. Ich stand ihm nicht besonders nahe; ohne dass er es ausgesprochen hätte, wusste ich, dass er Töchter weniger ernst nahm als Söhne, aber als er mir nun freundlich zunickte, tat es mir leid, dass ich ihn anlügen musste. „Das erklärt einiges. Es gefällt mir, dass ihr euch so …treu geblieben seid. Aber eine Ehe ist mehr als nur Freundschaft, das wisst ihr.“
„Ja, natürlich.“
Wir antworteten fast gleichzeitig und ich starrte angespannt auf die linke Schulter meines Vaters, aus Angst, laut aufzulachen.
„Außerdem seid ihr …“ Mein Vater zögerte und rückte seine Brille zurecht. „Nun, ihr seid verwandt. Ihr seid Vetter und Base.“
Diesen Einwand hatten wir vorhergesehen.
„Nicht ganz, wenn ich anmerken darf“, sagte Heinrich. „Unsere Mütter sind Cousinen, nicht Schwestern. Demnach sind wir Cousins zweiten Grades.“
„Ja, das stimmt. Aber nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft sollte man wegen möglicher Erbschäden bei den Kindern möglichst überhaupt nicht innerhalb der Verwandtschaft heiraten.“ Ich setzte zum Sprechen an, aber mein Vater kam mir zuvor. „Das wollte ich nur gesagt haben. Ansonsten habe ich ganz und gar nichts gegen eure Heirat einzuwenden. Heinrich ist dieses Jahr volljährig geworden, und soweit ich verstanden habe, hat er eine Stelle in Berlin in Aussicht und Rosemarie schenkt ihm eine Wohnung.“
Die Stelle als Reporter bei der Berliner Morgenpost war pure Erfindung – eine Lüge mehr –, weil wir wussten, dass dies meinen Eltern gefallen würde.
„Bist du sicher, dass du mit dem Studieren aufhören willst, Heinrich?“, fragte meine Mutter.
„Ganz sicher. Wenn ich sehe, wie viele Akademiker heutzutage arbeitslos sind, habe ich keine Lust, noch Jahre mit dem Geldverdienen und der Heirat zu warten. Wenn sich eine günstige Gelegenheit bietet, soll man zugreifen.“
Daraufhin erhoben sich meine Eltern, mein Vater küsste mich auf die Stirn und schüttelte Heinrich die Hand und meine Mutter umarmte uns beide. Das Hausmädchen und meine Brüder wurden hereingerufen und wir erhielten jeder einen Fingerbreit Sherry zur Feier des Tages. Den Sekt, so mein Vater, würden wir bei der offiziellen Verlobung aufmachen.
Ich war zunächst erleichtert, weil alles so glattgelaufen war, aber als meine Mutter mich weder an dem Abend noch am folgenden Morgen auf meine Heirat ansprach, wurde ich unruhig. Als meine Schwester Anna sich verlobt hatte, war sie freudig aufgeregt gewesen und hatte wochenlang von nichts anderem geredet.
Es kam mir sogar vor, als miede sie meinen Blick und verbrächte möglichst wenig Zeit mit mir in einem Raum.
Wie vorhergesehen reagierte Veronika sehr heftig auf die Nachricht. Am Morgen nach unserer Verlobung packte sie die Koffer, ließ auf dem Weg zum Bahnhof Rosemaries Chauffeur einen Umweg fahren und stürmte ins Haus meiner Eltern.
Ich war zufällig nicht zu Hause, weil mich meine Mutter Seife kaufen geschickt hatte. Es kam zu einem Auftritt, den sie mir gegenüber später als hässlich bezeichnete, aber über den sie nicht weiter reden wollte.
„Kaum zu glauben, dass Heinrich ihr Sohn ist. Er ist ein so netter junger Mann.“ Meine Mutter sah mich durchdringend an, wie früher, als ich ein Kind war und sie mich einer Lüge verdächtigte. „Hast du ihn ein wenig gern?“
„Ja, natürlich.“
Ich sagte die Wahrheit, ich hatte ihn ganz gern gewonnen.
„Gut.“
Sie wandte sich von mir ab und fuhr fort, die Zahlenkolonnen in ihrem Haushaltsbuch zu addieren.
Ich räusperte mich.
„Mutti, was ist, hast du etwas dagegen, dass ich heirate?“
Sie hielt inne und drehte sich wieder nach mir um. „Nein, ich habe nichts dagegen …“ Sie stützte ihren Arm auf die Rückenlehne des Stuhles und sah mich aufmerksam an, mit dem Bleistift gegen das Holz klopfend. „Es passt nur nicht zu dir, so überstürzt zu handeln. Ich hätte nie gedacht, dass du so schnell heiraten würdest.“
„Wieso nicht?“
Sie hob die Schultern. „Du warst immer ganz anders als Anna. Du hast nie Liebesromane gelesen und hast nie geflirtet. Du warst immer so gewitzt und so neugierig auf die Welt dort draußen. Ich dachte, du würdest zumindest einige Jahre arbeiten, bevor du …“
Ich wurde rot.
„Arbeiten? Als Lehrerin?“ Ich hatte die Stimme erhoben, was ich mir meiner Mutter gegenüber nie zuvor erlaubt hatte. „Ich wollte nie Lehrerin werden!“
Meine Mutter schien überrascht zu sein.
„Du hast nie gesagt, dass du nicht Lehrerin werden wolltest. Eigentlich hast du nie gesagt, welcher Beruf dich interessieren würde. Du hast sehr vage von einem teuren Studium gesprochen.“
„Als ob es etwas nutzen würde, wenn jemand in dieser Familie sagt, was er möchte. Weißt du noch, was Vater erwidert hat, als Anna Balletttänzerin werden wollte?“
Ich hörte meine eigene schneidende Stimme und wusste, dass meine Wut meiner Mutter unverständlich sein musste, aber ich konnte mich nicht beherrschen.
Behutsam legte sie ihren Bleistift weg. Vielleicht war sie zu überrascht, um mich wegen meines Tons zurechtzuweisen.
„Woher kommt diese Bitterkeit, Eva? Ist es deswegen, dass du so überstürzt heiratest? Um von zu Hause wegzukommen?“
Ich atmete tief durch. Je mehr wir miteinander redeten, desto weiter entfernten wir uns voneinander.
„Nein, so kann man es nicht sehen. Ich heirate nicht, um von euch wegzukommen.“
Sie stellte die nächstliegende Frage nicht und ich sprach nicht weiter. Schweigend sahen wir beide zu Boden; für Offenheit und Vertrauen war es zu spät. Sie war eine fürsorgliche und zärtliche Mutter gewesen, aber gewisse Dinge wollte sie über ihre Kinder nicht wissen.
„Ich hoffe, du wirst glücklich werden.“
Ich nickte und ging hinaus.
„Er ist ein wirklich netter junger Mann“, hörte ich meine Mutter murmeln.
Tante Rosemarie bestand darauf, sowohl die Verlobung als auch die Hochzeitsfeier zu organisieren. Zum kleinen, verschwiegenen Verlobungsfest, das sie uns versprochen hatte, lud sie zu unserer Bestürzung fünfzig Gäste ein.
Als ich später die Fotografien sah, begriff ich, warum sich sogar meine Mutter mehr Sorgen um Heinrich machte als um mich; ich überragte ihn auf allen Bildern und schien ihn mit meinen üppigen Formen zu erdrücken. Er stand neben mir, dunkelhaarig, schmal und schüchtern lächelnd wirkte er eher wie ein lästiges Anhängsel als wie ein Ehemann.
„Der Fotograf hätte euch einen Schemel für Heinrich geben sollen, so wie er es bei Annas Hochzeit getan hat“, war der Kommentar meiner Mutter.
4 HEINRICH
Heinrich merkte, dass er sich selbst überschätzt hatte. Er war überzeugt gewesen, dass all die Jahre des Schweigens und Verschweigens, des Versteckspielens und der Heimlichkeiten ihn gestärkt und ihn für die Blicke der anderen undurchdringlich gemacht hatten. Er hatte nicht bedacht, dass er noch nie gezwungen gewesen war, eine Rolle ununterbrochen aufrechtzuerhalten. Ebenso hatte er nicht wissen können, wie ermüdend die Angst vor einem fatalen Fehler, einem Versprecher sein konnte, wenn man so viel zu verlieren hatte wie er.
Auch das plötzliche Verschwinden seiner Mutter belastete ihn mehr, als er es sich eingestehen wollte. Sie hatte ihm das Leben in den letzten Jahren wirklich schwer gemacht, aber er war nie länger als für einige Stunden von ihr getrennt gewesen und sie fehlte ihm.
Zu Anfang war er erleichtert, ihr nicht mehr allmorgendlich am Frühstückstisch gegenübersitzen zu müssen, während sie sich über ihre zahlreichen Krankheiten beschwerte, über andere Frauen lästerte und ihn ausfragte, wie er den Tag zu verbringen gedachte.
Dann begann er sich daran zu erinnern, wie ausdauernd sie sich um ihn gekümmert hatte, als er sich ein Jahr zuvor eine Bronchitis zugezogen hatte, wie gut sie roch, wenn sie ihm den obligatorischen Gutenachtkuss gab, und wie sie darauf achtete, dass seine Krawatten gut gebunden und seine Hemdkragen sauber waren.
Vielleicht vermisste er sie nur wie eine schlechte Gewohnheit, sagte er sich mit gezwungener Ironie, wie zum Beispiel das Nägelkauen, das er sich mit viel Willenskraft abgewöhnt hatte, aber dann tauchte unvermittelt ihr Gesicht vor ihm auf und er spürte wieder einen dumpfen Schmerz.
Es gab niemanden, mit dem er darüber hätte reden können. Rosemarie war nur zu froh, ihn für sich allein zu haben, und vor Eva hatte er seine Mutter so schlechtgemacht, dass er sich schämte, sie überhaupt vor ihr zu erwähnen.
Um ihr nicht nachzutrauern, zwang er sich, an ihren Abschied zu denken, an ihre Reaktion, als er seine Heirat angekündigt hatte. Ihren Schwächeanfall hatte er vorhergesehen, ebenso ihre sanften, weinerlichen Vorwürfe und das missbilligende Schweigen seines Stiefvaters.
Was ihn schockierte, war ihr Verhalten danach. Als Rosemarie Heinrich begeistert gratulierte und seine Mutter erfuhr, dass ihre Schwester ihr Versprechen halten wollte, ihm ihre Berliner Wohnung zu überschreiben und ihn finanziell zu unterstützen, gab sie übergangslos die Rolle der Leidenden auf.
Mit gesammelter, ruhiger Stimme sagte sie, Rosemarie tue dies alles nur, um sie zu verletzen und ihr Heinrich wegzunehmen. Ihre Schwester sei immer eifersüchtig auf sie gewesen, weil sie keine Kinder von ihrem reichen, senilen Amerikaner gekriegt hatte. Und im Übrigen könne und wolle sie niemals ihre Zustimmung zu dieser grotesken Verbindung mit Eva geben.
„Dein Sohn braucht deine Zustimmung nicht“, wandte Rosemarie ein. „Er ist dieses Jahr einundzwanzig geworden, das heißt, er ist volljährig.“
Veronika ignorierte ihre Schwester und wandte sich zu Heinrich, ihr Gesicht war nicht einmal mehr gerötet.
Ob er sich nicht bewusst sei, wie lächerlich er sich mit Eva mache, fragte sie. Dieses spröde, höchst uninteressante Mädchen sei um etliche Zentimeter größer als er. Wie er es sich vorstelle, die Braut über die Schwelle zu tragen? Sie könne sich eher denken, dass ihn dieses hochgeschossene Weibsstück huckepack nehmen müsse.
„Meine Entscheidung steht fest“, erwiderte Heinrich. „Und es tut mir weh, dass du so schlecht über Eva sprichst.“