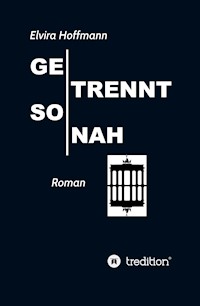
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Getrennt so nah Berlin-Ost 1965: Die Fotografin Silvia, mit einer kirchlichen Reisegruppe aus Westdeutschland angereist, lernt die künstlerisch begabte Agnes kennen, die aus politischen Gründen im Gefängnis saß und deren Großfamilie wegen ihres christlichen Bekenntnisses Repressalien ausgesetzt ist. Über Jahrzehnte hinweg entwickelt sich eine schwierige Frauenfreundschaft, die sich in Licht und Schatten bewähren muss. Im wechselseitigen Verstehen und Missverstehen müssen beide Frauen auch ihre jeweils eigene Position in Frage stellen, und sie erkennen, was sie trennt und was sie wirklich vereint. Dank ihrer scharf beobachteten Details bietet diese Erzählung zugleich - aus ungewohnter Perspektive - ein kontrastreiches Bild deutsch-deutschen Lebens im Vierteljahrhundert vor der Wiedervereinigung. Der Buchtitel reflektiert das Grundthema der Verbundenheit über politische Grenzen und persönliche Differenzen hinweg. Von etlichen seit 1989 erschienenen Romanen wie etwa "Der Turm" von Uwe Tellkamp oder "Nicolaikirche" von Erich Loest unterscheidet sich "Getrennt so nah" durch den Blick von West nach Ost und durch die christliche Perspektive. Der Roman trägt der Tatsache Rechnung, dass persönliche Beziehungen zwischen Familien in West und Ost oftmals über kirchliche Verbindungen und kirchlich organisierte Reisen angebahnt wurden. Diese besondere Art des westöstlichen Austauschs, der Kommunikation, aber auch der Streitkultur und des Missverstehens ist bisher kaum literarisch verarbeitet worden; ihre Schilderung dürfte bei vielen Leserinnen und Lesern Wiedererkennungseffekte auslösen und auch diejenigen interessieren, die die Zeit der "Ostpakete" mit der Aufschrift "Geschenksendung, keine Handelsware" und der tränenreichen Abschiede am Berliner Grenzübergang Friedrichstraße nicht selbst erlebt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Elvira Hoffmann • Getrennt so nah
Elvira Hoffmann
Getrennt so nah
West-östliche Scherenschnitte
Roman
Motto: Fast die Wahrheit.
Ähnlichkeiten mit wirklichen Personen wären dennoch unbeabsichtigt.
© 2016 Elvira Hoffmann
Umschlaggestaltung: Richard Stölzl
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Paperback: 978-3-7345-2275-8
ISBN Hardcover: 978-3-7345-2276-5
ISBN e-Book: 978-3-7345-2277-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1965
Die Austriaken sind ein bemerkenswertes Volk, sagt Dr. Steglich. Sie haben es geschafft, den Amis weiszumachen, Beethoven sei Österreicher gewesen und Hitler ein Deutscher. Das behauptet immerhin ein weltberühmter Regisseur aus der k. u. k. Monarchie, der nicht von ungefähr jetzt Amerikaner ist.
Silvia bestätigt ihren Gastgeber, wundert sich aber, woher er das weiß ohne Reisemöglichkeit und Westzeitungen. Sie sitzt in Ost-Berlin am Mittagstisch der Familie Steglich. Im Kinderzimmer ist ein ausziehbarer Küchentisch gedeckt worden. Mit Silberbesteck und Messerbänkchen, mit Porzellan aus den zwanziger Jahren und winzigen Asternsträußchen in Blau und Weiß.
Auf ein Eßzimmer hätten sie leider keinen Anspruch, entschuldigt sich der Hausherr. Und das Wohnzimmer sei mit Schreibtisch und Bücherschrank bereits überladen. Nur mit Mühe biete es noch Platz für zwei Sessel und einen Rauchtisch, auf dem man zur Not ein halbes Schock Schnapsgläser abstellen könne.
Silvia rechnet, wie viele das sind.
Soso, in felix Austria habe sie also mit Mann und Maus, Verzeihung: Sohn den Sommerurlaub verbracht?
Silvia nickt. Zwei Wochen. Weil der Junge eine Luftveränderung gebraucht habe und die Unterkunft in Österreich billiger sei als in Deutschland.
Aha, bemerkt Steglich und widmet sich der Scheibe Fleisch auf seinem Teller.
Aber Sie essen ja gar nicht! Die Hausfrau schaut besorgt auf den Gast aus dem Westen. Schmeckt es Ihnen nicht?
Silvia Weller versichert, das Essen sei ganz ausgezeichnet. Besser habe ihr Sauerbraten nie zuvor geschmeckt.
Stammt vom Pferd, klärt Steglich sie auf. Ich hab da meine Beziehungen. Als Sauerbraten läßt sich Pferdefleisch doch gut essen, oder?
Seine Frau wird unruhig. Gestern habe es nur grüne Heringe gegeben. Darum das Pferdefleisch. Es mache dem Gast doch hoffentlich nichts aus?
Die Besucherin wiederholt das Lob nachdrücklich. Sie sei einfach zu aufgeregt, um noch einmal nachzufassen. Erst das frühe Aufstehen, dann am Übergang Friedrichstraße in der Katakombe stundenlang festgehalten worden. Nein, am köstlichen Gericht liege es ganz bestimmt nicht.
Was, Agnes, sagt Dr. Steglich in leicht spöttischem Ton, wir hätten gern Frau Wellers Part übernommen? Dafür wären wir ohne Murren frühmorgens zwischen vier und viertel fünf aufgestanden und hätten uns im Tränenpalast ein paar Stunden festhalten lassen. Du auch, Schwiegermutter, wie?
Die alte Dame seufzt und legt das Besteck ab, daß sie besser nachdenken kann, wie das wohl wäre.
Ihre Tochter antwortet nicht. Sie nimmt ein behäkeltes Taschentuch und tupft dem fünfjährigen Ulf braune Soße vom Kinn.
Die zwei Jahre ältere Uta hat die Besucherin lange aus den Augenwinkeln gemustert. Sie jefallen mir, bekennt sie. Aba nich wejen det Jeschenk. Und sie nimmt die ungewöhnlich lange Tafel belgischer Schokolade vom Schoß und hebt sie triumphierend in die Höhe.
Der Vater tickt mit einem zierlichen Stöckchen auf ihre Hand. Erstens für das falsche Deutsch. Man vergreift sich nicht an seiner Muttersprache. Zweitens, weil du wieder einmal bei Tisch ohne Aufforderung geredet hast.
Oje! denkt Silvia bei sich. Strenge Sitten. Und registriert, daß ein Vater trotz bedrängender äußerer Umstände versucht, seine Kinder so zu erziehen, wie er selber vermutlich erzogen worden ist: Mit dem Wissen um die Grenzen. Silvia spürt die Doppeldeutigkeit. Jedes Wort muß sie wägen. Gedankenlosigkeit kann sie sich hier nicht erlauben. Daß sie bei der Grenzkontrolle manches auf keinen Fall sagen darf, leuchtet ein. Aber nun geschieht es in privatem Kreis, daß sich Wörter selbständig machen. Vielleicht kehren sie sich auf dem Weg von ihrem Mund zum Ohr der Empfänger gar in der Bedeutung um? Sie muß auf der Hut sein. Denn sie will niemanden verletzen, zuallerletzt die Menschen, die ihr heute Gastfreundschaft gewähren.
Agnes Steglich gibt das Zeichen zum Aufbruch. Frau Weller und ich müssen los. Zu ihrem Gast gewandt, fährt sie fort: Mich interessiert, was Sie zwischen dem Aufstehen heute früh und Ihrem ersten Schritt im Osten erlebt und empfunden haben. Uns bleibt auf dem Weg ins Gemeindehaus etwas Zeit zur Unterhaltung.
Sie sei das dritte Mal in Ost-Berlin, stellt Silvia richtig. Dieser Besuch sei nur insofern eine Premiere, als sie nie vorher bei einer Familie Aufnahme gefunden habe. Sie kenne in der DDR niemanden. Im Westteil von Berlin seien ihr Mann und sie oft gewesen. Zweimal seien sie bei solchen Besuchen auch in den Osten gefahren, um ein Zeichen zu setzen. Sie gehörten zu jenen, die dem Aufruf der Initiative „Unteilbares Deutschland“ folgten und an bestimmten Tagen Kerzen ins Fenster stellten, um ihre Verbundenheit mit den Landsleuten drüben zu bekunden. Den Schnitt durch das Land betrachte sie als großes Unglück. Sie fühle sich verpflichtet, dafür zu sorgen, daß nicht auch noch ein Riß durchs Volk gehe. Mit ihren geringen Möglichkeiten freilich, doch immerhin.
Immerhin, ja. Darauf kommt es an. Erzählen Sie von heute früh?
*
Oktober ist es. Ein Sonntag. Früh um sechs findet sie sich in einem der karg ausgestatteten Mehrbettzimmer eines West-Berliner Gästehauses, das der Kirche gehört. Angereist ist sie als Mitglied einer Gruppe tags zuvor mit einer BEA-Maschine aus Düsseldorf. Um sie herum stehen fünf Frauen unterschiedlichen Alters und ein Pfarrer Ende vierzig, der sie alle überragt.
Nichts sei sicher an diesem Tag, verkündet der Pastor. Darum müsse man zum frühestmöglichen Zeitpunkt am Übergang Friedrichstraße sein. Als Mannschaft, die im Osten erwartet werde, hätten sie keine Chance, hinter die Mauer zu gelangen. Jeder möge sich gleich in der S-Bahn die ihm zugewiesene private Besuchsgeschichte ins Gedächtnis rufen, um auf entsprechende Fragen der Grenzpolizisten einen plausiblen Grund für den Besuch nennen zu können.
Seid listig wie die Schlangen, fährt es Silvia durch den Kopf. Sie wüßte gern, ob den Pfarrer Schuldgefühle plagen, wenn er aus Not „falsch Zeugnis“ redet. Doch dies ist nicht der Moment, ihn danach zu fragen.
Er wolle jetzt keine Morgenandacht halten. Was es zu sagen gebe, werde er später in der Predigt zum Ausdruck bringen. Für die Gelegenheit dazu sei er dankbar. Jetzt bitte er nur einen Augenblick um Stille, er wolle sich für ein kurzes Gebet der Worte eines Größeren bedienen. Mit jenem Größeren meint er Paul Gerhardt. „Gib, daß wir heute,/ Herr, durch dein Geleite/ auf unsern Wegen unverhindert gehen/ und überall in deiner Gnade stehen./ Lobet den Herren!“
Besser lasse sich nicht ausdrücken, was sie bewegt, findet Silvia.
Unverhindert. An dieses Wort wird sie erinnert, als sie vier Stunden später auf der Friedrichstraße steht. Die „Grenzorgane“ hatten sie absichtlich vergessen. Sie weiß nicht warum. Scharen von Menschen, auffallend viele ärmlich gekleidete Mütterchen mit der unvermeidlichen Waschpulvertrommel an der einen und dem Netz, durch dessen Maschen die Bananen und Orangen leuchten, an der andern Hand, sind an ihr vorbeigezogen. Ihre Lebensgeschichten hätten Silvia interessiert. Doch private Unterhaltung findet so gut wie nicht statt. Sie vermutet, daß die Leute wegen der unsichtbaren Abhörgeräte vorsichtig sind, vielleicht schweigen sie auch aus Furcht, eine Aufforderung zu überhören.
Wie merkwürdig es riecht! Silvia zieht prüfend die Luft ein und glaubt feuchten Manchester, Eau de Cologne und Baldrian zu erkennen. Aber keiner in ihrer Nähe trägt Cordhosen. Mit dem Beruhigungsmittel dagegen liegt sie richtig. Neben ihr in der Schlange steht eine alte Frau und träufelt Medizin auf ein Stück Zucker. Das reicht sie einem jungen Mann, der beide Hände auf die linke Brust preßt und tief durchatmet. Wie viele Menschen mögen in diesem Raum schon vor Aufregung kollabiert sein? fragt sich Silvia. Flüsternd bietet sie einigen der Umstehenden Pfefferminzbonbons an. Keiner bedient sich.
Als sie endlich aufgerufen wird, muß sie sich in eine Untersuchung fügen, die sie als planlos empfindet. Möglicherweise liegt darin das System. Sie steht in einem fensterlosen Kabuff. Eine Art Tresen, der vom Boden bis in Wadenhöhe offen ist, nimmt die gesamte Länge des Raumes ein. An den Schmalseiten des Kabäuschens befindet sich je eine Tür, deren Kunststoffblatt in einem grau gestrichenen Metallrahmen steckt. Sogar die Farbe weint, stellt sie fest, und zählt die Ölfarbentränen. Silvia, sagt sie zu sich, jetzt wirst du kitschig.
Der Sachse hinter dem Schalter folgt ihrem Blick mißtrauisch. Was suchen Sie? Hier spielt die Musik!
Silvia fährt zusammen. Sogar fürs Umschauen wird man gerüffelt. Sie entschuldigt sich. Wofür auch immer.
Was sie hergeführt habe, will der Mann wissen, und verlangt, daß sie die Handtasche öffnet. Während sie antwortet, nimmt er ihren Lippenstift und dreht ihn bis zum Anschlag heraus, so daß er abbricht. Das Mißgeschick ist ihm kein Wort des Bedauerns wert. Er zieht Silvias blauen Nylonbeutel zu sich heran und greift hinein. Die als Gastgeschenk für die angebliche Cousine zweiten Grades bestimmten Kaffeebohnen kippt er auf den nach ranziger Butter riechenden Tresen und schiebt sie ungeschickt in die aufgerissene Tüte zurück. Anschließend fährt der Beamte mit der Handkante wie in Zeitlupe über die Schokoladentafeln, um dann barsch zu fordern, Silvia solle ihre Handtasche leeren, der er vorhin nur den Lippenstift entnommen hat. Der Mann wird überraschend abgelöst von einer älteren Kollegin, die ihre Kommandos ebenfalls mit Ulbrichtscher Sprachfärbung bellt. Was sie in der Deutschen Demokratischen Republik wolle, wen sie zu treffen gedenke? Die Beamtin spricht den Namen ihres Staates verstümmelt aus: Deuschn Demogroschn Repblik. Silvia spult den auswendiggelernten Text zum zweitenmal ab: Besuch einer Verwandten mütterlicherseits, Besichtigung der Stadt. Museen, Dom und Zeughaus möchte sie sehen. Die Frau klappt ein Brett am Tresen hoch und benutzt den Durchgang, um neben die Besucherin zu treten. Sie zupft ihre Uniformjacke zurecht und verlangt, daß Silvia aus den Schuhen steigt. Mit einer Taschenlampe leuchtet sie in die Pumps. Bisher hat Silvia angenommen, genügend Phantasie zu besitzen. Jetzt reicht ihre Einbildungskraft nicht aus, sich vorzustellen, was die Hüter des Sozialismus’ in einem Schuh und hinter einem Lippenstift vermuten.
Das alles ließe sich besser ertragen, wenn sie zu den Vorgängen wenigstens einen Kommentar abgeben könnte. Silvia fürchtet zu platzen vor unterdrückter Wut.
Ganz unvermutet wird sie entlassen. Sie genn’n gähn, hat ihr die Grenzbeamtin erlaubt, und das läßt sich Silvia nicht zweimal sagen. Auf einem anderen Weg als bei den vorigen Malen gelangt sie ins Freie. Leider nicht in die Freiheit, denkt sie. Auf einem riesigen Transparent prangt die Parole: Sozialismus, das ist die Zukunft Deutschlands.
Der Magen knurrt. Die andern sitzen vermutlich längst in der Patengemeinde beim verspäteten Frühstück. Ein Blick auf die Uhr tröstet Silvia wenigstens insofern, als der Gottesdiest noch nicht begonnen hat. Er ist wegen des auswärtigen Predigers und der zu erwartenden Gäste auf elf Uhr verschoben worden. Man hat seine Erfahrungen und plant Eventualitäten ein.
Kein Taxi weit und breit. Silvia macht sich zu Fuß auf den Weg. Vielleicht kann sie später einen Wagen heranwinken. Nach wenigen Metern verflucht sie die Pfennigabsätze. Hoffart will Pein leiden, pflegte ihr verstorbener Großvater zu sagen. Flachbeschuht liefe es sich zweifellos bequemer, doch die ganze Wirkung wäre hin. Also vorwärts, Hoffärtige!
Der Eindruck fortschreitenden Verfalls, dazu der beißende Gestank, den die knatternden Autos in dreckigen Schwaden zurücklassen und der aus jedem qualmenden Schornstein dringt, nicht zuletzt die farbliche Tristesse schlagen aufs Gemüt. Sie fühlt sich allein wie seit Kindheitstagen nicht mehr. Damals, erinnert sie sich, hat sie an einem heißen Sommernachmittag, kurz nach Kriegsende ist das gewesen, auf einer langen Straße gestanden. Alle gehfähigen Erwachsenen erweisen einer bekannten Persönlichkeit die letzte Ehre. Sie selbst ist zu jung, um zur Trauerfeier mitgenommen zu werden. Lange steht sie da, auf einer holprigen Straße mit Schlaglöchern, ähnlich der, auf der sie gerade jetzt geht, und fühlt sich ausgeschlossen. Das Leben und der Tod spielen sich dort ab, wo sie nicht ist. An jenem Sommernachmittag ist sie überzeugt, daß sich an ihrem Ausgesperrtsein nie mehr etwas ändern werde.
*
Daß Sie zu uns kommen würden, sagt Agnes Steglich, weiß ich seit zwei Wochen. Sie sind uns nicht zugeteilt worden. Ich habe Sie mir ausgesucht.
Das möchte Silvia genauer wissen.
Wegen Ihres Berufes.
Silvia begreift nicht. Sie habe sich als Angestellte eingetragen.
Offiziell. Ihr und unser Pfarrer haben einen Kode entwickelt. Sie verschlüsseln Daten über Personen und Ereignisse so geschickt, daß die berufsmäßigen Schnüffler an harmlose Hirtenbriefe glauben. Bisher jedenfalls mal noch. Und so wußte ich zum Beispiel, daß unter Ihnen eine Fotografin ist. Die habe ich mir ausgesucht. Sie müssen gut beobachten können und sehen die Dinge, wie sie wirklich sind.
Sieht nicht jeder nur, was er sehen will? Dinge kann man schönen.
Das weiß ich. Aber ich gehe davon aus, daß eine Fotografin an der Wirklichkeit interessiert ist. Und ich bin überzeugt, daß Sie geübt sind im Umgang mit Menschen. Ich habe mir gedacht, Sie würden nicht gleich in Ohnmacht fallen, wenn Sie erführen, daß ich vier Jahre im Zuchthaus gesessen habe. Als politische Gefangene.
Vier Jahre, wiederholt Silvia, um Zeit zu gewinnen. Allein die Vorstellung, vier Jahre von der Familie getrennt zu werden, läßt sie schaudern. Der kleine Ulf muß noch ein Baby gewesen sein, als man seine Mutter abholte. Silvia schluckt. Seit wann sind Sie …?
Frei, wollten Sie sagen. Sie zögern mit Recht. Denn wer wollte behaupten, hier sei jemand frei? Ich bin im März aus dem Zuchthaus entlassen worden. Wofür ich gesessen habe, will ich Ihnen auch gleich verraten: Mir ist eine kritische Bemerkung über die allgemeine Versorgungslage zum Verhängnis geworden. Ich hatte vor einem Schaufenster laut nachgedacht.
Silvia bleibt stehen und ergreift die Hand der Frau. Was immer sie jetzt sagen wird, kann nur ein untauglicher Versuch sein, Mitgefühl zu bekunden. Angemessen, das spürt sie, kann sie auf das Gehörte mit Worten allein nicht reagieren. Sie sollen nicht bereuen, mich ausgesucht zu haben, sagt sie und meint das in erster Linie in bezug auf finanzielle Unterstützung. Eigentlich hat sie hinzufügen wollen, sie sei allerdings nicht gerade auf Rosen gebettet. Aber dann schämt sie sich. Ihr geht es wirtschaftlich eher mäßig, das ist wahr. Wegen des Kindes arbeitet sie nur vormittags. Mit anderthalb Gehältern kann eine junge Familie keine großen Sprünge machen. Doch im Vergleich zu der Frau neben ihr ist sie reich. Sie lebt in einem freien Land, darf frei reden, frei reisen, frei über sich bestimmen. Wenn sie Gäste erwartet und ihnen Sauerbraten servieren möchte, hindert kein Versorgungsengpaß sie daran, Rindfleisch zu kaufen. Sie muß weder Pferdefleisch organisieren noch auf grüne Heringe ausweichen.
Ich erwarte im nächsten Frühjahr unser drittes Kind. Nehmen Sie mir bitte nicht übel, daß ich Sie ganz direkt darauf anspreche: Wenn Sie von Ihrem Sohn abgelegte Kleidungsstücke oder Spielzeug haben, geben Sie die mir. Ich kann versuchen, sie gegen Babysachen einzutauschen. Es wäre mir eine große Hilfe.
Silvia geniert sich. Abgelegte Sachen mag sie nicht schicken.
Sie müssen nur bitte eine Desinfektionsbescheinigung beifügen. Die Parteigenossen unterstellen dem Klassenfeind, daß er via Wollpullover Pest und Cholera einschmuggelt. Ich habe gehört, daß es bei Ihnen die Möglichkeit gibt, ein Kleidungsstück desinfizieren zu lassen und dafür eine Blankobescheinigung zu erhalten, auf der Sie bis zu zehn Posten aufführen können. Man ist ja so menschlich bei Ihnen.
Silvia weiß von Behördengängen, bei denen ihr alles andere als Menschlichkeit begegnet ist. Aber sie widerspricht nicht.
Auch wenn Sie mal von sich oder Ihrem Mann Bekleidung ausrangieren, sind wir dankbare Abnehmer. Sie ahnen nicht, wie schwierig es ist, den Mangel zu verwalten. Als ich aus dem Zuchthaus kam, habe ich gedacht, ich sei im Schlaraffenland. Wenn Sie sich vier Jahre lang mit zwei anderen Frauen eine Pritsche geteilt haben und kein anständiges Essen bekamen, sondern laffen, lieblosen Fraß und nicht mal Weihnachten etwas Süßes, dann muß Ihnen eine Wohnung, in der Sie einen ganzen Brotlaib, gefüllte Einweckgläser und sogar Tischwäsche vorfinden, als Dorado erscheinen. Erst allmählich merken Sie, daß es an beinahe allem fehlt: An Babykost in Gläschen, die es bei Ihnen in so großer Auswahl gibt, an frischem Obst und Saft für die Kinder, an Kerzen und guter Seife, an richtigem Waschpulver und Papiererzeugnissen. – Schade, wir sind schon da. Ich hätte Sie gern noch ein wenig für mich allein gehabt.
Wir setzen unser Gespräch irgendwann fort, verspricht Silvia.
Wer weiß, ob wir uns jemals wiedersehn, meint Agnes versonnen. Sie versucht ein Lächeln. Ich fürchte, ich bin für die Partei der Optimisten ein für allemal verloren. Man muß kein Defätist sein, um die Zukunft grau in grau zu malen. Mit einem Federstrich können sie die Grenze auch von der andern Seite wieder undurchlässig machen. Dann ist die Trostlosigkeit perfekt. Ach, manchmal denke ich, es wäre besser gewesen, mein Mann hätte sich nach meiner Verhaftung mit den Kindern in den Westen abgesetzt. Das war kurz vor dem Mauerbau. Gelegenheit zur Flucht hätte er gehabt. Er arbeitete damals schon in der Veterinärmedizinischen Klinik. Als Tierarzt wurde er Anfang der sechziger Jahre ab und zu auf Höfen in Grenznähe eingesetzt. Sicher: Für mich wäre der Verlust meiner Familie schmerzlich gewesen. Aber der Gedanke, daß es den Kindern gutgeht, hätte mich getröstet. Beide sind begabt. Was würden sie drüben für eine Ausbildung erhalten! Und sie wären nicht jeden Tag stundenlanger Beeinflussung ausgesetzt. Indoktrination statt Bildung! Was dabei herauskommt, kann ich mir denken. Stellen Sie sich vor, die Uta ist von ihrer Lehrerin aufgefordert worden zu berichten, was mein Mann und ich untereinander reden. – Ach je, wir stehen hier und plaudern, und der Küster möchte die Tür absperren.
*
Als letzte treffen sie im Gemeindesaal ein. Fünf Minuten zu spät. Das ist Silvia peinlich. Sie hat stets vermieden, unpünktlich zu sein. Leute, die es scheinbar genießen, unangenehm aufzufallen, sind ihr immer verhaßt gewesen. Ihr wird beim Anblick der Säumigen heiß. Es ist, als müsse sie sich schämen, wenn notorisch Zuspätkommende halbe Sitzreihen für sich aufstehen lassen.
Sie bleibt an der Saaltür stehen. Wir entschuldigen uns für die Verspätung, sagt sie, und fänden es nur gerecht, wenn Sie uns zur Strafe an den Katzentisch setzen würden.
Der Berliner Pfarrer erhebt sich schmunzelnd. Wir sind zwar in Preußen. Aber doch nicht beim Kommiß. Zudem befinden Sie sich noch im akademischen Viertel. Also nehmen Sie an unserer langen Tafel Platz. Wir rücken noch ein wenig zusammen und freuen uns, daß Sie beide in unserer Mitte sind.
Es duftet nach frischgebrühtem Kaffee.
Das riecht ja wie beim Konditor! schwärmt Silvia. Ich freue mich richtig auf eine Tasse Kaffee.
Frau Steglich nickt. Schnuppern genügt. Das ist nicht unser Rondo mit den karamelisierten Bohnen, sondern echter Bohnenkaffee Marke West. Hmmm. Sie muß gleich noch einmal tief einatmen, diesmal mit geschlossenen Augen. Das Wort „Bohnenkaffee“ hat sie ausgesprochen, als hätte es am Ende nur ein „e“.
Auf dem Tisch stehen helle Türme mit Apfelkuchen vom Blech und gestreifte mit „Kalter Hundeschnauze“. Die Zutaten stammen aus dem Westen und sind in mehr als dreißig Paketen an verschiedene Mitglieder der Ostberliner Patengemeinde geschickt worden. Im August wurden die Sendungen auf den Weg gebracht. Vor einer Woche sind die letzten zwei Pakete bei ihren Empfängern eingetroffen. Immerhin pünktlich zum Backtermin, wie die Frau des Küsters gutmütig anmerkt.
Die Herzlichkeit, mit der sie aufgenommen wird, rührt Silvia. Ihr und den andern aus der Besuchergruppe schlägt eine Dankbarkeit entgegen, die sie beschämt. Was haben sie denn schon vollbracht? Sie sind, auf eigene Kosten zwar, aber ganz bequem per Flugzeug angereist, ein bißchen früher als sonst aufgestanden, haben die Aufregung an der Grenze ohne sichtbaren Schaden überstanden und sich zum Mittagessen in eine fremde Familie einladen lassen. Ob die Menschen in ihnen vielleicht Multiplikatoren sehen, die dafür sorgen sollen, daß noch mehr Westpakete rollen? Silvia schaut in die Gesichter der Menschen und verwirft den Gedanken an berechnende Freundlichkeit.
Aber daß sie zur Hilfe aufgerufen ist, daran besteht für sie kein Zweifel. Silvia läßt sich die Adresse einer Familie geben, von der sie hört, daß sie durch Krankheit zusätzlich in Not geraten sei. Sie beschließt, diesen Leuten und den Steglichs von nun an regelmäßig Pakete zu schicken. Die Mittel dafür muß sie durch Einsparungen erwirtschaften. Sie weiß noch nicht wo, sie weiß nur: daß.
Die Kaffeekannen sind längst geleert, die Kuchentürme bis aufs Fundament abgebaut. Da geht das Licht aus. In dieser Lage haben sich die Besucher aus dem Westen nach Kriegsende nicht mehr befunden, es sei denn, sie selbst hätten einen Kurzschluß ausgelöst. Ängstliches Gemurmel. Jemand ruft nach dem Küster. Als das Wort „Zählerkasten“ fällt, kommt trocken die Antwort des Praktikers: Wär ick von alleene nich drauf jekomm’n. Ick dachte, jemand hätte ‘ne Schwarzlichtbürne einjedreht.
Keine Aufregung, gleich wird’s hell, tönt die Stimme des WestPfarrers aus dem Dunkel. Der überzeugte Nichtraucher findet im Jackett ein Feuerzeug, in dessen Lichtschein er zu den Kleiderhaken geht und eine weiße Stumpenkerze aus seiner Manteltasche fördert. Er stellt das flackernde Licht mitten auf den Tisch.
Allzeit bereit, lobt sein Berliner Amtsbruder und klopft ihm kameradschaftlich auf die Schulter.
Silvia schaut amüsiert von einem zum andern. Beide sind ungewöhnlich hochgewachsen und wären unter dem Preußenkönig Friedrich Wilhelm I Gefahr gelaufen, als Lange Kerls in die Leibgarde gepreßt zu werden. Mit der Größe endet die Gemeinsamkeit freilich. Denn im Umfang unterscheiden sie sich wesentlich. Für Silvia gleicht der gastgebende Pfarrer einer Tanne, sein wohlgenährter jüngerer Kollege eher einem Gebirge.
Im Kerzenschein ist es ja noch viel gemütlicher! ruft die Frau des Küsters in kindlicher Begeisterung aus.
Selbst die Gemütlichkeit wird uns verordnet. Ich danke.
Das war Frau Steglich. Nach vier Jahren Zuchthaus wegen lauten Nachdenkens. Silvia duckt sich unwillkürlich. Sie weiß nicht, ob sie die Äußerung mutig oder leichtsinnig finden soll. Gefährlich ist sie auf jeden Fall. Woher die zerbrechlich wirkende Dame immer noch die Kraft nimmt, aufzubegehren? Sie persönlich wäre an einem Schicksal ähnlich dem der Frau Steglich nach kurzer Gefangenschaft zerbrochen. Das glaubt sie zu wissen, weil sie sich kennt. Sie hat den Impuls aufzuspringen und die Unbeugsame zu umarmen. Im Vergleich zu ihrer neuen Bekannten kommt sie sich schwach vor und feige. Heute morgen am Übergang hat sie gekuscht wie ein Hund. Und wird nachher wieder unterwürfig sein, kriechend und knechtisch wie ein geborener Lakai. Sogar die Selbstrechtfertigung für ihre Servilität hat sie parat: Sie darf keinen Konflikt riskieren. Was soll denn aus ihrem Jungen werden, wenn sie wegen Widerspenstigkeit hinter Gitter kommt?
Die Grenzbeamten, malt sie sich aus, müßten eigentlich allesamt größen-wahnsinnig werden. Tag für Tag erleben sie, daß berühmte Persönlichkeiten und Würdenträger oder „normale“ Menschen, die ihnen geistig, moralisch oder körperlich überlegen sind, vor ihnen zu Kreuze kriechen. Das kann unmöglich ohne Folgen auf ihre Psyche bleiben.
Und ausgerechnet hier im Osten führt ein Widerspruchsgeist in schmächtigem Körper den willfährigen Untertanen aus dem Westen vor, was Schneid ist. Frau Steglichs Beweggründe mögen Haß oder Mut der Verzweiflung sein, vielleicht auch der Wille, der eigenen Überzeugung treu zu bleiben. Auf jeden Fall verdienen sie Hochachtung. Silvia hat in letzter Zeit öfter darüber nachgedacht, wie sie in einer Diktatur zurechtkäme. Die Antwort auf ihre Selbstbefragung lautete stets: Sie würde das Unrecht eine Weile stumm erdulden. Doch sobald sich ein bestimmtes Maß an Zorn in ihr aufgestaut hätte, würde sie – an falschem Ort, zu falscher Zeit – Dampf ablassen. Das wäre dann das Ende.
Silvia wünscht sich helleres Licht, um an den Mienen abzulesen, wie die unvorsichtige Äußerung auf die andern gewirkt hat. Im schwachen Schein erkennt sie nur, daß die meisten mit gesenktem Kopf dasitzen. Was, so fragt sie sich bang, was, wenn auch nur ein Denunziant unter ihnen ist?
Plötzlich steht der Pfarrer aus dem Westen auf. Alle sehen ihn an. Noch bevor sie über das, was er vorhat, spekulieren können, stimmt er ein Lied an. Er singt die ersten sechs Wörter der unvorsichtigen Bemerkung auf die bekannte Bachsche Melodie „C-A-F-F-E-E“. Zögernd reihen sich andere ein. Den Musikalischsten gelingt es, die Einsätze für den Kanon zu verteilen. Der Chor klingt mächtiger. Silvia sieht sich um, so gut es das Kerzenlicht zuläßt. Tatsächlich: Inzwischen bewegen alle die Lippen! Ihr ist zum Heulen vor Freude. Von einer Sekunde zur andern ist die Not gewendet. Daß jemand, der Notwendiges tut, anderer Menschen Not wendet, darüber wird sie später in Ruhe nachdenken. Fürs erste zollt sie ihrem Pastor innerlich Respekt für die spontane Idee und seine Zivilcourage. Bisher hat sie ihn nur als Prediger geschätzt. Seit heute weiß sie, daß er eine für seinen Berufsstand erstaunliche Bodenhaftung besitzt.
Sind Sie schon lange in Ihrer Kirchengemeinde aktiv?
Silvia wendet sich der Fragerin zu, einer Frau um die Siebzig mit wachen Augen und einem lieben Gesicht. Aktiv bin ich sicher nicht, entgegnet sie. Offen gestanden besuche ich nur den Sonntagsgottesdienst. Und auch das nicht regelmäßig.
Die grauhaarige Frau mit der schlichten Einschlagfrisur fragt ungläubig, wieso sie dann mitgefahren sei?
Unser Pfarrer hat unter seinen Mitarbeitern nachgefragt, ob ihnen jemand bekannt sei, der sich für eine Reise zur Ost-Berliner Patengemeinde interessiere. Einer wußte, daß ich von Zeit zu Zeit nach Berlin fahre und den Ostteil bereits besucht habe, ohne dort einen Menschen zu kennen.
Oh, da mußten Sie aber eine Menge Geld ausgeben, wo Sie bloß eine lockere Beziehung zur Kirche haben. Ich hörte vorhin, daß es nur die Übernachtung umsonst gibt. Die Kosten für den Flieger müssen Sie selber tragen, nicht? Und dann noch fünf Mark West fürs Visum und drei Mark Mindestumtausch. – Essen Sie noch ein Stück Kuchen, damit Sie wenigstens das Geld fürs Abendbrot sparen.
Silvia lacht. Sie könne nur staunen, sagt sie, wie genau man hier informiert sei. Die Steglichs hätten sie vorhin auch schon verblüfft. – Ihr liege viel an diesem Besuch. Die wertvollen Begegnungen wögen die Kosten bei weitem auf. Nein, essen könne sie nichts mehr. Aber sie finde es nett, daß sich jemand so um sie sorge.
Ihre Nachbarin lächelt und drückt Silvias Unterarm. Wie schön, daß Sie gekommen sind.
Und Sie? erkundigt sich Silvia. Seit wann gehören Sie zur hiesigen Gemeinde?
Für die Antwort muß ich ein bißchen ausholen. Ich hatte fromme Eltern. Ihnen zuliebe bin ich hin und wieder in den Gottesdienst gegangen. Mein Mann und unsere Söhne sind in der Partei. Sie behaupten, daß es keinen Gott gibt. Früher haben sie immer wieder versucht, mir die Kirche auszureden. Mein Mann war vor seiner Pensionierung Berufsschullehrer. Stabü hat er unterrichtet. Was glauben Sie, wie verbittert er darüber ist, daß er ausgerechnet seine Frau nicht zum Marxismus-Leninismus bekehren konnte.
Stabü?
Staatsbürgerkunde. Ich ärgere mich über die Abkürzerei, und dann mache ich selber dabei mit. – Unser jüngster Sohn arbeitet im gleichen Beruf wie früher sein Vater. Um die sozialistische Politik zu … verkaufen, will ich einmal sagen, da muß einer schon vom System überzeugt sein.
Das kann ich mir denken.
Bei der Armee natürlich auch, wo unser Ältester als Offizier dient. Ach, da fällt mir ein, heute kommt er aus Thüringen zurück. Er hat am Manöver „Oktobersturm“ teilgenommen, das die NVA vom 16. bis zum 24. Oktober zusammen mit den Streitkräften der UdSSR, Polens und der ČSSR veranstaltet.
Ich kann Sie nur bewundern. Allein gegen die ganze Familie – ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer schaffte.
Die alte Frau hebt zur Antwort die gefalteten Hände. Dann erzählt sie weiter. Nach dem Mauerbau habe ich mir gesagt, es wäre gut, wenn wir letzten Christen nun etwas näher zusammenrückten. In unserer Gemeinde finde ich Menschen, denen ich vertrauen kann.
Silvia denkt an das allgemeine Erschrecken über Frau Steglichs Kommentar. Gilt das für alle? Ich meine: Dringt nichts nach außen, was hier gesprochen wird?
Ach, wissen Sie, es gibt Leute, die halten sich immer gerade zu dem Haufen, von dem sie sich im Augenblick am meisten Vorteile versprechen. Sobald sie nicht mehr genug zu erwarten haben, kriechen sie woanders unter. Ob die, wenn es hart auf hart käme…?
Den letzten Teil der Unterhaltung hat ihr Pfarrer mitangehört. Er beugt sich vor. Silvia bekommt endlich Gelegenheit, den sympathischen Herrn, besonders seine strohfarbenen Augenbrauen, von nahem zu betrachten. Die grannenartigen Brauen faszinieren sie. Einige „Ährenborsten“ reichen bis zum Wimpernansatz. – Um die alte Dame zu unterstützen, schaltet sich der Pastor ein: Nein, Verschwiegenheit sei auch in einer christlichen Gemeinschaft nicht garantiert. Menschen könnten dermaßen unter Druck geraten, daß sie sogar an den eigenen Familienmitgliedern zum Verräter würden. Jede Diktatur deformiere den Charakter.
Ausnahmslos bei allen? möchte Silvia wissen.
Auf jeden Fall treffe das auf einen hohen Prozentsatz der Geknechteten zu. Das besondere Unglück der älteren DDR-Bevölkerung sei es, daß man erst versucht habe, sie in die extrem rechte und danach in die ganz linke Ecke zu drängen. Er mit seinen sechzig Jahren könne ein langes, trauriges Lied von verordneten Rassen- und Klassenfeinden singen, Gott sei’s geklagt.
Sehen Sie? Silvia schaut lebhaft von der Frau neben sich auf den Pfarrer. Deshalb bin ich hier. Es ist ja nicht mein Verdienst, ein paar Kilometer weiter westlich geboren worden zu sein und in einer Demokratie leben zu dürfen. Der bekannte Kabarettist Werner Finck hat es auf den Punkt gebracht, als er sagte: Und so halte ich auch zu jeder Regierung, bei der ich nicht sitzen muß, wenn ich nicht zu ihr stehe. – Ich habe das Bedürfnis, meinen Dank abzustatten für dieses unverdiente Glück. Der Besuch bei Ihnen bietet mir dafür eine Gelegenheit.
Wir freuen uns über jeden Beweis der Verbundenheit.





























