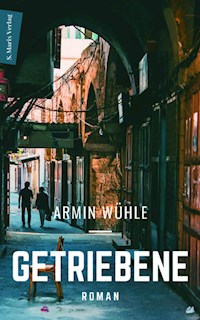
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Aktivistin, die vor Strafverfolgung ins Ausland flieht. Sechs Jugendliche, die inmitten eines Bürgerkriegs ein Theaterstück auf die Bühne bringen. Und ein Journalist auf der Suche nach der großen Geschichte. Für eine Reportage über den florierenden Kriegstourismus reist Vincent nach Thikro. In der zerstörten Stadt flanieren Reisende zwischen Ruinen, eine Aussichtsplattform bietet Blicke über die Demarkationslinie. Bei seinen Recherchen begegnet er der Entwicklungshelferin Cora und dem Dolmetscher Milo, der die Belagerung Thikros selbst miterlebt hat. Aus ihren Blickwinkeln setzt sich eine Stadt zusammen, in der die Gräuel der Vergangenheit und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft allgegenwärtig sind. Ein Roman, der von den Gegensätzen unserer Zeit erzählt, von Wohlstand und Elend und von Idealen, die ihren Preis verlangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ARMIN WÜHLE
GETRIEBENE
ROMAN
Inhalt
Erster Teil:Vincent
Zweiter Teil:Cora
Dritter Teil:Milo
Vierter Teil:Die andere Seite
Dank
Mit festem Schritt näherte sich Cora dem Flughafengebäude. Es war früher Nachmittag und ein milchiger Dunst verdeckte die Sonne. Sie überquerte die stark befahrene Straße, schob sich an einem rauchenden Taxi-Fahrer vorbei und betrat das Terminal. Im Gehen blickte Cora auf ihre Armbanduhr. Sie lag gut in der Zeit.
Es herrschte reger Betrieb in der Halle, und vor den Schaltern der Fluggesellschaften bildeten sich lange Schlangen. Auf einer Anzeigetafel suchte Cora nach ihrem Flug. Als sie ihn gefunden hatte, presste sie die Daumenbeugen gegen die Riemen ihres Rucksacks und ging weiter. Den Rucksack trug sie nur zum Schein. Er war leer, abgesehen von ihrem Reisepass und einer Jacke, die den Hohlraum ausbeulen sollte. Cora schloss zu einer losen Traube Reisender auf und verlor sich in der Menge.
Sie hatte auf unauffällige Kleidung geachtet: flache Schuhe, dunkle Stoffhose, eine Bluse, darüber einen schiefergrauen Blazer. Sie trug dezentes Make-up und Ohrstecker, das lange Haar hatte sie zu einem Dutt gebunden. Sie unterschied sich nicht von den Geschäftsfrauen, die ihr im Terminal immer wieder begegneten. Am Morgen hatten sie zu dritt vor ihrem Kleiderschrank gestanden und über die passende Garderobe diskutiert. Eine Dreiviertelstunde hatte es gedauert, bis alle mit dem Ergebnis zufrieden waren. Allein die neuen Schuhe drückten unangenehm. Cora blieb stehen, schob einen Finger hinter die Ferse und versuchte, das Kunstleder zu weiten. Als sie aufsah, kam ihr eine Polizeistreife entgegen. Die Männer trugen olivfarbene Schutzwesten und langläufige Schusswaffen. Wie an einer Felsformation teilte sich der Menschenstrom an ihnen. Die Blicke der Streife trafen Cora und glitten über sie hinweg. Sie strich sich über die Augenbrauen und senkte den Blick. Sie verbarg ein Lächeln.
Die Sicherheitskontrolle verlief reibungslos. Es war ohnehin ausgeschlossen, dass sie etwas an ihr entdeckten. Cora schob ihren leeren Rucksack auf das Fließband. Mit verschränkten Armen wartete sie, bis sie durch den Metalldetektor gerufen wurde. Sie betastete den Dutt, der sich wie ein Geschwür an ihrem Kopf anfühlte. Nahid hatte ihn am Morgen gebunden, mit konzentriertem Blick und den Haarnadeln zwischen den Lippen. Gesprochen hatten sie wenig. Der Kaffee, den Nahid für alle gemacht hatte, stand unberührt in den Tassen. Faiz telefonierte im Nebenraum. Seine Stimme drang dumpf durch die geschlossene Tür. Cora nippte an dem inzwischen kalten Kaffee und blickte zum Hinterhof hinaus, der im Licht der aufgehenden Sonne lag. Sie ignorierte ihre schmerzende Kopfhaut. »Entschuldige«, murmelte Nahid und schob ihr die letzte Nadel ins Haar.
Eine Sicherheitsbeamtin winkte Cora mit ihrer behandschuhten Rechten durch den Metalldetektor. Sie schritt hindurch, nahm auf der anderen Seite ihren Rucksack entgegen und reihte sich in die nächste Schlange vor der Passkontrolle. Cora hatte keine Angst. Selbst das bittere Gefühl, einem ungewissen persönlichen Schicksal entgegenzugehen, schreckte sie nicht. Sie schob ihren Pass durch den Schlitz und der Grenzbeamte nahm ihn wortlos entgegen. Er blätterte ihn mit blinden Augen durch, legte die laminierte Seite auf einen Scanner. Der Beamte schob den Pass zurück und die letzte Schranke öffnete sich.
Im Wartebereich saß Cora einer jungen Mutter gegenüber. Sie trug ein buntgemustertes Kleid, wie es in den Afro-Shops am Stadtrand verkauft wurde. Sie hatte die Beine übereinandergeschlagen, das Kinn aufgestützt, den Blick gedankenverloren auf das Rollfeld gerichtet. In der Hand hielt sie einen leeren Pappbecher. Neben ihr saß ein Mädchen mit abstehenden Zöpfen, dessen Füße nicht auf den Boden reichten. Mit großen Augen sah sich das Mädchen in der Abflughalle um. Cora hoffte, dass es niemanden gab, der die beiden in Khartum erwartete. In dem nachdenklichen Blick der Frau suchte Cora den Beweis zu sehen, dass sie den Flug ohnehin nicht antreten wollte. Cora nahm ihre Tasche und spazierte durch die Duty-Free-Läden, bis ihr Flug aufgerufen wurde.
Eine Stewardess in blauem Kostüm und mit geknotetem Halsband bot den Passagieren eine Schale Lutschpastillen. Cora nahm dankend an und bog in den Rumpf der Kabine. Sie ließ ihren Blick wie beiläufig über die Sitzreihen streifen und entdeckte die Gruppe am anderen Ende des Flugzeugs. Man hatte die beiden Männer getrennt von den anderen Passagieren einsteigen lassen. Die beiden Zivilpolizisten, die sie begleiteten, saßen auf den Gangplätzen und versperrten ihnen den Weg. Cora versuchte, ihre Blicke einzufangen, doch die Rücken der einsteigenden Gäste schoben sich immer wieder dazwischen. Es war ohnehin klüger, nicht erkannt zu werden. Vor der ihr zugewiesenen Sitzreihe blieb sie stehen und rutschte zum Fensterplatz durch. Sie zog das Bordmagazin aus dem Gitternetz und las einen Beitrag über andalusischen Wein.
Die Kabinentüren schlossen sich mit einer Verspätung von zehn Minuten. Das Flugzeug wurde rückwärts aus der Parkposition gezogen, und die Stewardessen gingen durch die Reihen und schlossen die Ablagefächer. Cora dachte daran, wie sie das Ticket vor zwei Tagen an einem Schalter der Fluggesellschaft gekauft hatte. »Ich brauche nur einen Hinflug«, hatte Cora gesagt und sich gefühlt, als habe sie sich dadurch bereits verraten. Doch der Angestellte registrierte ihre Antwort mit einem kaum merklichen Nicken. Schweigend starrte er auf den Bildschirm, bis ein Drucker die Buchungsbestätigung ausgab. Cora bezahlte in bar. Von der Leichtigkeit des Vorgangs etwas betäubt, aber nicht minder entschlossen, radelte sie nach Hause. Jetzt saß sie hier und wartete auf den richtigen Moment. Sie betrachtete das Terminal, das an ihrem Fenster vorbeizog, die Wartungshallen, die Futtermaisfelder. Sie zählte von Zehn rückwärts und öffnete bei Eins den Gurt.
Sie bat ihre Sitznachbarinnen, ihr Platz zu machen und schob sich an den beiden älteren Damen vorbei. Sie musste sich an den Rückenlehnen der vorderen Sitze festhalten, um nicht umzufallen – die Geschwindigkeit, mit der das Flugzeug zur Landebahn rollte, war höher als gedacht. Cora trat auf den Gang und setzte sich auf den Boden. Einige Köpfe drehten sich zu ihr um. Cora umschloss zu beiden Seiten die Metallstreben, an denen die Sitzreihen verankert waren. Sie saß entgegen der Fahrtrichtung, blickte den Gang hinunter wie eine Rodelbahn. Mittlerweile hatte sie die Aufmerksamkeit eines guten Dutzends Passagiere erregt. Eine Stewardess, halb versteckt hinter dem Vorhang zur Bordküche, bemerkte das Geschehen. Sie schnallte sich ab und eilte den Gang hinauf. Vor Cora ging sie in die Hocke.
»Madame, haben Sie ein gesundheitliches Problem?«
»In diesem Flugzeug befinden sich Personen, die nicht transportiert werden möchten, und ich werde mich nicht bewegen, bis diese Personen das Flugzeug verlassen dürfen.«
Die Stewardess wich zurück. Sie kräuselte die Stirn und blickte um sich, als suche sie Zeugen, die ihr bestätigten, was sie soeben gehört hatte.
»Madame, Sie müssen auf Ihren Platz zurück, sonst können wir den Flug nicht fortsetzen.«
Cora wusste nicht, was sie dem Offensichtlichen entgegnen sollte, und schwieg.
»Madame!«, insistierte die Stewardess und zog schwach und ohne Überzeugungskraft an ihren Handgelenken. Einer der Passagiere fragte laut vernehmbar, was los sei, und lenkte damit weiteres Interesse auf die Situation. Die Stewardess stand sichtlich ratlos vor ihr und entschied sich für einen vorläufigen Rückzug. Die ältere Dame, die neben Cora gesessen hatte, berührte sie an der Schulter und fragte, was los sei. Cora begegnete der freundlich gestellten Frage mit derselben Freundlichkeit und erklärte erneut, dass sich in diesem Flugzeug Personen befänden, die nicht transportiert werden wollten, und dass sie sich nicht bewegen würde, bis diese Personen das Flugzeug verlassen durften.
Es dauerte nicht lange, bis die Stewardess in Begleitung eines männlichen Flugbegleiters zurückkam. Sie waren mittlerweile auf dem Rollfeld zum Stehen gekommen. Auch die beiden Männer in der hintersten Reihe hatten von der Aktion erfahren. Sie reckten ihre Hälse und verfolgten das Geschehen, blieben aber ruhig. Es war sicherlich das vernünftigste Verhalten in ihrer Situation. Der junge Flugbegleiter ging vor Cora in die Hocke. Er war offensichtlich gerufen worden, um mehr Eindruck zu schinden als seine weiblichen Kolleginnen. Sein zierlicher Körper strahlte keine Dominanz aus, doch eine gewisse rhetorische Fähigkeit konnte ihm Cora nicht absprechen. Er sprach von den rechtlichen Konsequenzen ihrer Aktion, von Strafverfahren mit hohen Geldbußen, von lebenslangen Flugverboten und Schadensersatzforderungen. Er bekräftigte gleichzeitig die Rechtmäßigkeit ihres politischen Anliegens, doch ihr Aktionismus sei in diesem Fall aussichtslos. »Sie können diesen Menschen nicht helfen. Wenn sie heute nicht fliegen, werden sie in die nächste Maschine gesetzt. Ersparen Sie sich und uns allen den Ärger. Eine junge Frau wie Sie sollte sich nicht die Zukunft verbauen.«
Cora starrte an ihm vorbei. Keine Diskussionen, darüber hatten sie immer wieder gesprochen. Sie schwieg, bis der Flugbegleiter von ihr abließ und sich flüsternd mit seiner Kollegin beratschlagte. Unter den übrigen Passagieren wurden Stimmen laut, die das Geschehen kommentierten. Ein Mann in der Reihe vor ihr beugte sich vor und suchte ihren Augenkontakt. »Ich weiß nicht, was sie dir über unser Land erzählt haben, Mädchen. In den Tod fliegen diese Leute aber nicht. Der Rest von uns sitzt doch freiwillig in diesem Flugzeug. Meinst du, wir würden hier sitzen, wenn es so gefährlich wäre?«
Cora dachte an Faiz, um sich abzulenken. Sie dachte an Faiz und an Nahid, und sie dachte an ihren Bruder, der heute seine Stelle als Assistenzarzt antrat – ein Gedanke an eine gänzlich andere Welt. Die beiden Flugbegleiter verschwanden in Richtung des Cockpits. Ihr Gegenüber setzte gerade zu einer neuen Argumentation an, als sich ein fülliger Geschäftsmann von seinem Platz erhob. Sein grauer Anzug spannte über dem Bauch. Er blickte herausfordernd um sich, als spräche er zu der versammelten Menschenmenge.
»Bringt jetzt endlich jemand die Fotze zur Vernunft?«
Die Luft schien wie eingesogen. Gespräche verstummten und wichen einer abwartenden Stille. Der Zorn saß Cora glühend heiß in der Brust. Sie schnellte hoch, ohne ihren Griff von der Strebe zu lösen.
»Halt’s Maul, Arschloch!«
Der Mann drängte sich an seinem Nachbarn vorbei. Seine schwerfälligen, gleichzeitig energischen Bewegungen versprachen eine Hitzköpfigkeit, die ihr nur entgegenkommen konnte. Er ging auf sie zu, drohend den Finger ausgestreckt. Besser konnte es für Cora nicht laufen. Die Situation eskalierte.
»Du kleine Fotze gehst jetzt auf deinen Platz«, sagte er und packte sie an den Beinen. Cora schrie aus vollen Kräften und versuchte, seine Hände abzustrampeln. Ein Raunen schwoll in der Kabine an. Mehrere Passagiere erhoben sich von ihren Plätzen, unschlüssig, ob sie eingreifen sollten oder nicht. Der Hitzkopf versuchte, sie über den Gang zu schleifen, und Cora musste alle Kraft aufwenden, um sich an den Metallstreben zu halten. Von der Hüfte abwärts hing sie in der Luft. Die Männer in der letzten Reihe protestierten lautstark und konnten von ihren Betreuern nur mühsam in Zaum gehalten werden. Stimmen überlagerten sich, immer mehr Menschen drängten sich auf den Gang. Ein Mann mit kahlgeschorenem Kopf kämpfte sich zu ihnen vor. Er packte den Angreifer an den Schultern und redete in dessen Landessprache auf ihn ein. Die beiden führten ein heftiges Streitgespräch, das den Hitzkopf nicht davon abhielt, weiter an Coras Beinen zu zerren. Ihre Muskeln brannten und begannen schwach zu werden. Sie hörte weitere Schritte auf sich zukommen und hoffte auf Unterstützung, doch die Person, die nun hinter ihr kniete, versuchte ihr die Finger von den Metallstreben zu lösen. Cora beschimpfte die Person lautstark, doch es half nichts. Ein Finger nach dem anderen wurde ihr umgebogen, bis sie den Halt ihrer linken Hand verlor und seitlich einknickte. Der Hitzkopf schleifte sie einige Meter über den Gang, bis ihre Hände erneut eine Metallstrebe fanden. Eine herbeigeeilte Stewardess stand hilflos vor der Szene und presste sich die Hand vor den Mund. Cora strampelte mit einem letzten hysterischen Aufbäumen ihrer Kräfte, bis die Hände ihres Kontrahenten von ihr ließen. Ihr kahlgeschorener Helfer und die Stewardess nutzten den Moment und stellten sich schützend vor sie. Der Hitzkopf schnaufte wie ein Stier, seine Brust hob und senkte sich. Er spuckte vor Cora auf den Boden und murmelte einen Fluch. Die Stewardess forderte mit zitternder Stimme alle Beteiligten auf, zu ihren Plätzen zurückzukehren, als sich das Flugzeug mit einem Ruck in Bewegung setzte. Die Stewardess musste sich an einer Stuhllehne festhalten, um nicht zu stürzen, und alle, die sich erhoben hatten, kehrten schwankend auf ihre Plätze zurück. Cora starrte mit weit aufgerissenen Augen zur Decke und ignorierte die schrillen Beschimpfungen, die ihr entgegengeschleudert wurden. Ihre um die Metallstreben verkrampften Finger lockerten sich. Sie nahm ihr klopfendes Herz wahr, das sie bis in die Schläfen hinein spürte. Sie überhörte darüber fast die Durchsage des Kapitäns, der den Passagieren mitteilte, dass der Flug aus Sicherheitsgründen abgebrochen werde und sie nun zum Flugsteig zurückkehrten. Aus der Ferne hörte sie Flüche und leisen Jubel aufbranden. Cora leerte ihre Gedanken, bis sie der grauen Decke über ihr gehörten und der sanften Vibration unter ihrem Rücken.
Cora leistete keinen Widerstand. Nachdem die beiden Männer das Flugzeug verlassen hatten, nahm sie ihren Rucksack und folgte den Polizisten zum Ausgang. Sie passierte dabei den Piloten, der vor seine Kabine getreten war. Er hielt die Arme verschränkt, musterte Cora von oben bis unten und verabschiedete sie mit einem verächtlichen Schnalzen der Zunge. In der Fluggastbrücke wurden ihr Handschellen umgelegt. Cora blickte durch einen schmalen Spalt zwischen Brücke und Maschinenrumpf nach draußen. Einsatzwagen hatten das Flugzeug umstellt, Blaulicht flackerte über das Rollfeld. Die Polizisten nahmen Cora in einen schmerzenden Griff und brachten sie ins Terminal. Sie wurde einen Flur entlanggeführt, der von den wartenden Passagieren nur durch eine Glaswand getrennt war. Hunderte Augenpaare richteten sich auf sie. Cora suchte sich selbst in den Blicken dieser Menschen zu erkennen. Ein blondes Mädchen im Polizeigriff war nicht das, was sie erwarteten. Sie drehte sich ein letztes Mal nach dem Flugzeug um, bevor sie von den Beamten zurückgerissen und weitergeschleppt wurde. Was auch immer jetzt geschah, der Flug würde ohne die beiden Männer stattfinden. Im schmerzenden Griff der Beamten begann sie zu lächeln.
Erster Teil:Vincent
1
Die Maschine setzte unsanft auf, aber die Passagiere applaudierten trotzdem. Einer pfiff sogar durch die Finger. Er stieß seinem Sitznachbarn den Ellbogen in die Rippen und zeigte ihm, wie man besonders kräftig in die Hände klatschte. Hinter den Fenstern zog sandsteinfarbene Steppe vorbei, mit Stacheldraht von der Landebahn abgegrenzt. Eine Stimme vom Tonband wünschte einen angenehmen Aufenthalt. Vincent konnte es nicht erwarten, das Flugzeug zu verlassen. Er rieb sich die müden Augen und nahm sich vor, in der Wohnung einen Mittagsschlaf zu machen.
Der Flug war um 6:45 Uhr gestartet. Die frühe Uhrzeit hatte manche nicht davon abgehalten, noch vor dem Abflug ihr erstes Bier zu trinken. Vincent hatte zwei Männer beobachtet, die Sombreros trugen und an einem Stehtisch beisammenstanden. Draußen war es noch dunkel gewesen, und die Panoramafenster hatten das hellerleuchtete Terminal gespiegelt. Einer der Männer knabberte Nüsse aus einer Schale, der andere blickte verschlafen vor sich hin. Sein Weißbierglas war noch fast voll.
»Was ist denn mit dir?«, sagte sein Kumpel mit Blick auf das Glas.
»Ist schon bisschen früh, ne …«
»Also Tommi, sag mal.« Er klopfte dem anderen aufmunternd auf die Schulter. »Was muss, das muss. Könnte ja dein letztes sein.«
»Sag so was nicht!«
Tommi bekreuzigte sich und lachte. Er nahm einen demonstrativen Schluck von seinem Bier.
»Wer weiß. Vielleicht hat einer von denen noch ’nen Mörser rumliegen. So lang ist es nicht her. Kriegt ’nen Flashback und schon hast du ’n Loch im Kopf.«
»Bei ’nem Mörser hast du mehr als nur ’n Loch im Kopf.«
»Oder, noch besser, die sehen so ein großes Ding vom Himmel kommen und denken: Oh Scheiße, was kommt da denn runter? Und werfen sich alle zu Boden.«
Er streckte die Hände von sich und bewegte seinen Oberkörper auf und ab, als bete er zu einer Gottheit. Er ließ ein gackerndes Lachen los, das von hartnäckigem Tabakkonsum gezeichnet war, und schob sich den Sombrero zurück auf den Kopf. Vincent saß in der Nähe und notierte die Szene mit.
Ein heißer Wind drückte Vincent ins Gesicht, als er das Flugzeug verließ. Über das Rollfeld liefen sie auf ein heruntergekommenes Gebäude zu. Wirklich neu schien nur der Schriftzug auf dem Dach zu sein: Thikro International Airport. Vincent folgte den übrigen Passagieren ins Innere und stellte sich vor das Gepäckband, das sich ruckend in Bewegung setzte. Von einer letzten Schraube gehalten, hing eine Uhr kopfüber von der Wand. Die Batterie war noch intakt, sodass sich der Sekundenzeiger ungeachtet weiterdrehte. Er griff seinen Rucksack und steuerte auf den Ausgang zu.
Unmittelbar nach der Passkontrolle wurden sie von Soldaten in Empfang genommen. Die Männer trugen Tarnmuster und beigefarbene Schirmmützen. Sie zählten je zwanzig Personen ab, die sie unter Waffenschutz zum Ausgang begleiteten. Einer der Soldaten erklärte das Vorgehen, zuerst in gebrochenem Englisch, dann pantomimisch. Er zog mit seinem Gewehrlauf einen Kreis über ihre Köpfe und machte eine Bewegung, als werfe er eine Angelschnur aus. Ein verständiges Nicken ging durch die Menge. Vincent wurde einer Gruppe zugeteilt, in der sich Abiturienten, Senioren in Sandaletten und ein Mann mit Hakenkreuz-Tattoo befanden. Vincent überlegte, ob er bereits einige O-Töne sammeln sollte, aber er war müde und ließ es bleiben.
Der Soldat, nicht älter als achtzehn, führte sie durch die verwaiste Ankunftshalle. Im Gegensatz zu anderen Flughäfen, in denen sich Großfamilien in die Arme fielen und Taxifahrer lautstark ihre Dienste anboten, empfing sie hier lediglich Stille. Bauschutt lagerte hinter den Schaufenstern der Geschäfte, Stromkabel hingen von der Decke. Vincent hörte ihre Schritte widerhallen.
Vor dem Gebäude stand bereits ein Bus mit laufendem Motor, der ebenfalls von Soldaten mit Maschinengewehren bewacht wurde. Ihre Gesichter waren hinter den großen Sonnenbrillen nicht zu erkennen. Sie bildeten einen Korridor, der vom Gebäude zum Buseingang führte und erzeugten damit das wohlige Gruseln, das sich die Touristen von ihrem Ausflug versprachen. Mit nervöser Eile wurden sie in den Bus getrieben. Ein paar Reihen vor ihm gingen Tommi und sein Freund, sie waren an ihren Sombreros leicht zu erkennen. Vincent fragte sich, ob sie die Hüte während des gesamten Flugs getragen hatten.
Vincent rutschte zu einem Fensterplatz durch. Er hatte Lust auf eine Zigarette und schob sich stattdessen ein Pfefferminz in den Mund. Er beobachtete die Soldaten, die sich wie sonnenbebrillte Sphinxen gegenüberstanden und weiterhin Passagiere in den Bus leiteten. Die Bedrohungslage war größtenteils inszeniert. Die Männer waren nicht mal ausgebildete Sicherheitskräfte, sondern Laien-Schauspieler, die aus den naheliegenden Dörfern eingesammelt wurden – das hatte ihm zumindest sein Dolmetscher in einem Vorgespräch berichtet. Vincent warf einen zweifelnden Blick auf die Gewehre. Womöglich waren sie nicht mal geladen.
Als sich die letzten Plätze gefüllt hatten, stiegen zwei der Schauspieler zu ihnen in den Bus. Sie kontrollierten wahllos Handgepäckstücke, bevor sie sich in die erste Reihe setzten und ihre langläufigen Gewehre zwischen die Beine nahmen. Die Hydraulik schnaufte schwer, als der Busfahrer die Türen schloss, und einige Fahrgäste zuckten erschreckt zusammen. Eine Anspannung lag in der Luft, die manche mit ihren Handykameras einzufangen versuchten. Der Bus ließ das Flughafengelände hinter sich und bog auf eine Ausfallstraße, die in gerader Linie nach Thikro führte.
Vincent hatte im Zuge seiner Recherchen mehrere Stunden Filmmaterial gesichtet – es schien ihm, als kehre er nach Thikro zurück, obwohl er noch nie dort gewesen war. Die Stadt lag in einem Talkessel, eingerahmt von leicht geschwungenen Bergen. Die Häuser waren schmucklos und einfarbig und zogen sich in dichten Reihen die Hänge hinauf. Vor dem Krieg hatten etwa dreißigtausend Menschen hier gelebt. Ein Durchlass zwischen den Bergen verband zwei Täler miteinander, und dieses Nadelöhr hatte aus der Stadt eine strategisch bedeutsame Stellung gemacht. Ihre Belagerung und die damit verbundenen Todesopfer waren nicht zuletzt der eigentümlichen Geographie geschuldet.
Seit sich die Rebellen aus der Stadt zurückgezogen hatten und Thikro der Union zugeschlagen worden war, verlief dort eine internationale Grenze. Der Durchlass zwischen den Bergen wurde mittlerweile von einer Mauer versperrt. Sie schnitt durch die Stadt und zog sich in einem teils waghalsigen Winkel die Hügelgrate hinauf. Was sich jenseits der Mauer befand, wurde in einem nicht enden wollenden Bürgerkrieg zerrieben; ganze Städte lagen dort in Schutt und Asche und wurden allmählich vom Wind abgetragen.
Vincent drückte sein Gesicht gegen die Scheibe. Trostlose Hügel und Felder zogen an ihm vorbei, und er dachte daran, nach einer Nachricht von Nina zu sehen. Beim Gedanken an die gestrige Nacht verkrampften sich seine Eingeweide. Er hatte den halben Flug damit verbracht, sich die passenden Worte zusammenzulegen und hatte doch keine gefunden. Unschlüssig hielt er sein Telefon in der Hand, und seine trüben Gedanken lichteten sich erst, als sie die Stadt erreichten.
Mehrstöckige Betonbauten, an denen zerschossene Werbereklamen hingen, säumten die Straße. Die ersten Passagiere entdeckten die Mauer, die sich als grauer Streifen über die Hügel zog, und deuteten mit den Fingern darauf. Die Anspannung, die in der monotonen Vibration der Busfahrt spürbar nachgelassen hatte, regte sich wieder. Manche standen von ihren Sitzen auf, um durch die Windschutzscheibe einen besseren Blick auf die Mauer zu bekommen. Die falschen Soldaten ließen sie gewähren.
An einem Kreisverkehr im Stadtzentrum kamen sie zum Stehen. Die Ankunft des Busses hatte die Aufmerksamkeit fahrender Händler erregt. Noch bevor sich die Türen öffneten, strömten Menschen zusammen, die den Touristen ihre Dienstleistungen anbieten wollten. Einer der Soldaten stieg aus und trieb sie mit dem Gewehr auseinander. Sie wichen um die Länge des Gewehrlaufs zurück, um sich gleich wieder nach vorne und in die erste Reihe zu drängeln. Sie boten Taxifahrten, Unterkünfte oder geführte Touren durch die Grenzanlagen. Auch ein bettelnder Junge war darunter. Er zupfte an den Ärmeln der aussteigenden Besucher und hielt ihnen die offene Handfläche hin. Der Soldat schlug ihm mit dem Gewehrlauf auf die Finger und schrie ihm einen Fluch hinterher, sodass die Sehnen an seinem Hals zutage traten. Vincent verfolgte die Szene mit Befremden und wollte den Soldaten zurechtweisen, wurde aber abgedrängt und mit den anderen Fahrgästen zu den Schaltern der Reiseleiter gelotst. Er scherte aus und zog sich unter den Schatten einer Platane zurück. Die Mittagshitze lag wie ein Bleigürtel auf seinen Schultern.
Vincent zündete sich eine Zigarette an und besah sich die Umgebung. Der Platz wurde von einem Obelisken überragt, der sich inmitten des dreispurigen Kreisverkehrs befand. Ein unansehnlicher Steinpfeiler, der unter den Touristen kaum Beachtung fand. Es war dieser Obelisk, an dem vor fünf Jahren ein Dutzend Jugendlicher festgebunden und erschossen worden war. Den Bewohnern war nicht erlaubt worden, die Leichen zu bestatten. Vincent erinnerte sich an ein entsprechendes Bild in den Zeitungen. Es zeigte Pendler, die mit ihren Einkaufstüten auf den Bus warteten und versuchten, die in den Seilen hängenden Leichen zu übersehen. Das Bild hatte ein französischer Fotograf geschossen, der später selbst in Gefangenschaft geraten und ermordet worden war.
Vincent recherchierte das Original auf seinem Handy und versuchte, den genauen Standort zu finden, von dem aus der Franzose sein Bild geschossen hatte. Er drückte sich durch die Menschenmenge, die von ihren Reiseleitern mittlerweile auf Kleinbusse verteilt wurde. Als Vincent den Standort gefunden hatte, holte er seine Kamera hervor. Er wartete, bis ihm einige Touristen vor die Linse traten und drückte ab. Das Bild war nicht perfekt, aber es konnte dem Fotografen, der kommende Woche anreiste, eine Orientierung geben. Eine Gegenüberstellung der historischen und aktuellen Aufnahme war sicher ein guter Aufhänger für die Reportage.
Er packte seine Kamera ein und winkte einen Jungen heran, der Wasser aus einem Bauchladen verkaufte. Vincent drückte sich die kalte Flasche gegen die Stirn, bevor er daraus trank. Ein weiterer Bus vom Flughafen fuhr ein. Die fliegenden Händler formierten sich um und lösten sich von der mittlerweile ausgedünnten Touristengruppe. Auch der Junge, der ihm das Wasser verkauft hatte, steckte eilig sein Geld ein und lief zu den Neuankömmlingen.
Vincent hob sich den Rucksack auf den schweißnassen Rücken. Er tastete nach seinem Portemonnaie, um sich zu vergewissern, dass der Junge ihn nicht bestohlen hatte, und ging los.
2
Das Apartment lag in der Altstadt von Thikro. Vincent suchte auf dem Klingelschild nach dem Namen der Haushälterin, konnte aber in dem ihm fremden Alphabet nichts erkennen. Er sah sich nach jemandem um, der ihm weiterhelfen konnte, und war dankbar, als eine Frau auf den Balkon trat und ihm zuschrie, ob er der Ausländer sei. Sie warf ihm einen Schlüssel hinunter und rief, sie würden sich im dritten Stockwerk treffen.
Vincent wurde von einer kleinen Alten und ihrer erwachsenen Tochter durch das Apartment geführt. Die Räume waren nach der Belagerung kernsaniert worden und strahlten die klinische Frische eines Neuwagens aus. Die Tochter erklärte ihm die Bedienung der Klimaanlage, des Flatscreens und des Wasserfiltersystems. Am Ende der Runde zählte sie ihm die Schlüssel in der Handfläche ab. Bei Problemen solle er sich an die Mutter wenden, sie wohne im Erdgeschoss und könne den Google Übersetzer bedienen, Kleidung wasche und bügle sie gegen Gebühr. Sie verabschiedeten sich, und Vincent schloss hinter ihnen die Tür. Sie hatten kein einziges Mal danach gefragt, was er die beiden Monate über in Thikro mache. Womöglich konnte man darauf keine ehrbare Antwort erwarten.
Vincent ging ins Badezimmer und ließ das Waschbecken volllaufen. Er wusch sich im Gesicht und unter den Armen und zog sich ein frisches Hemd an. Er setzte sich auf sein Bett, öffnete die schallisolierten Fenster und ließ den Lärm der Straße eindringen. Die Vorhänge bewegten sich leicht im Wind. Zum ersten Mal, seit er frühmorgens ins Taxi gestiegen war, kam er zur Ruhe. Er hätte nun einen Mittagsschlaf machen können, aber die Neugier drängte ihn an die Mauer. Der Gedanke, dass nur wenige Gehminuten entfernt die zivilisierte Welt endete, faszinierte ihn. Er dachte an mittelalterliche Darstellungen der Erdscheibe, an deren Rändern Schiffe in den Abgrund stürzten und im Schlund eines Ungeheuers verschwanden. Neben einer nahezu rührenden Naivität zeugten diese Stiche gleichermaßen von Abenteuerlust. Sie erzählten von den Grenzen dessen, was dem Menschen bekannt und erfahrbar war, und nichts anderes wurde den Touristen in Thikro verkauft. Die Mauer war eine Weltenscheide, die Frieden und Krieg voneinander trennte. Ein geordnetes Staatswesen traf auf die rivalisierenden Machtansprüche verfeindeter Milizen, die sich gegenseitig unter Dauerbeschuss hielten und in Folterkellern jeder Menschlichkeit beraubten. Vincent wusste, dass es eine Aussichtsplattform gab, die den Blick auf die andere Seite der Mauer bot. Er griff sich die Schlüssel und verließ die Wohnung.
Die Gassen der Altstadt gingen steil bergauf, und Vincent musste sich nach vorn beugen, um die Steigung auszugleichen. Schwitzende Leiber drückten sich aneinander vorbei oder begutachteten die Auslagen der Geschäfte. Eine Reisegruppe zog sich wie ein Bandwurm durch die Gasse, angeführt von einer Frau, die einen Regenschirm in die Höhe reckte, um in der Menge erkannt zu werden. In der Luft hing der Geruch von gebratenem Fleisch, das die Straßenköche in Brot drückten und mit tonlosen, allein durch den Zungenschlag variierten Schreien bewarben.
In den engen Häuserschluchten neigten sich die Wände einander zu, Stromleitungen und Balkone schienen sich wahllos zu kreuzen. Neben ihm gingen zwei Rucksacktouristen, offenbar auf der Suche nach ihrer Unterkunft. »Es ist nicht mehr weit«, raunte der Mann seiner Freundin zu, deren Dreads ihr schweißnass ins Gesicht hingen. Vincent horchte das Paar unauffällig aus, stieß jedoch nicht auf verwertbares Material. Er ließ die beiden zurück, als sie einem Jungen auf der Straße Hasch abkauften.
Es dauerte nicht lange, bis sich die Steigung abflachte und die Mauer in Sicht kam. Vincents Pulsschlag beschleunigte sich. Die Gasse mündete in der neuen Hauptschlagader der Stadt, die parallel zu den Grenzanlagen verlief und Boulevard genannt wurde. Mit sichtlichem finanziellem Aufwand war hier eine Amüsiermeile errichtet worden, die aus Bars, Restaurants, Diskotheken und Stripclubs bestand. Die Häuser besaßen nur eine schmale Straßenseite und erstreckten sich schlauchartig nach hinten. Dicht gedrängt, wie mit hochgezogenen Schultern, reihten sie sich aneinander. Gegenüber verlief die Mauer, sechs Meter hoch und gekrönt mit Stacheldraht. Einige Gebäude waren aufgestockt worden, um einen Blick über die Mauer zu ermöglichen. Von den Dachterrassen bot sich freie Sicht ins Kriegsgebiet.
Vincent presste den Rücken gegen eine Hauswand und legte staunend den Kopf in den Nacken. Die Mauer bestand aus unverputztem Beton. Etwa alle zweihundert Meter erhob sich ein Wachturm, der von Stacheldraht und Überwachungskameras umgeben war. Ein schmaler Geländestreifen trennte den Boulevard von der Mauer. Zwei Spurrillen zeigten an, wo sich die Geländewägen der Grenzpatrouillen ihre Bahn schlugen. Gegenüber saßen die Menschen in Sonnenstühlen, ihre Stühle zur Mauer ausgerichtet, als betrachteten sie das Meer.
Vincent spazierte den Boulevard entlang, ohne den Blick von der Mauer zu nehmen. Innerhalb kürzester Zeit wurden ihm Gras, Hasch, Ketamin und MDMA angeboten sowie weitere Drogen, deren Codewörter er nicht kannte. Die jungen Dealer lehnten an Häuserwänden oder begleiteten ihre Zielgruppe ein Stück des Weges. Manche hielten eingeschweißte blauen Pillen zwischen den Fingern. Love-Love zischten sie, rieben das Plastik aneinander und sahen mit ihren eingefallenen Gesichtern und dem ruhelosen Blick nach allem anderen als Love aus.
Trotz der Popmusik, die von den Terrassen der Restaurants zu ihm drang, verlor die Mauer nichts von ihrer unerbittlichen Gewalt. Selfie-Sticks wurden aus der Menge gereckt, um den Grenzverlauf durch die Stadt und über die Berge einzufangen. Vincent verfolgte einige Gespräche, die sich zur Existenz der Mauer meist lobend, seltener kritisch, aber allesamt ehrfürchtig äußerten. Unauffällig notierte er sich O-Töne und ging weiter. Er ignorierte die Versuche der Kellner, ihn an einen Tisch zu lotsen, bis sich ihm einer in den Weg stellte. Der Mann deutete auf überbelichtete Fotos von Würstchen mit gebratenen Tomaten und erklärte, dass das Frühstück im Pork House noch bis sechzehn Uhr serviert werde. Vincent lehnte ab, doch der Mann versperrte ihm abermals den Weg. Er sprach wie zu einem Freund, um dessen Wohlbefinden er sich sorgte. Ob er lieber ein Bier trinken wolle? In der Bar werde Bier in Gallonen ausgeschenkt. Vincent verzichtete auf eine Antwort und schob sich an ihm vorbei.
Er begann, seinen Spaziergang mit der Handykamera aufzuzeichnen, und sprach seine Eindrücke für seine Follower auf. Zwischen den gastronomischen Angeboten befanden sich Läden, in denen billige Handyschalen, Gürtel, Jeans und Fußballtrikots verkauft wurden. Für wenig Geld konnte man sich Tattoos stechen oder Henna auftragen lassen. An den Büros der Tourismusagenturen hingen Bilder von Tagesausflügen, auch Paintball-Gelände und Schießstände wurden beworben. Vincent nahm einen Flyer entgegen und wurde von einem Agenten in ein Gespräch verwickelt. Der Mann hielt ihm einen Ordner hin und zeigte Fotos von Sturmgewehren und Handfeuerwaffen, die sich auf einem nahegelegenen Schießstand abfeuern ließen. Vorschriften gebe es keine, nur volljährig müsse man sein und zum Zeitpunkt des Besuchs nicht alkoholisiert. Vincent ließ sich die Kontaktdaten des Agenten auf den Flyer schreiben und verabschiedete sich. Mit dem guten Gefühl, einen ersten Ansatz für seine Recherchen gefunden zu haben, setzte er seinen Spaziergang fort.
Die Stadt entsprach recht genau den Vorstellungen, die er von ihr gehabt hatte. Allein die Besucherschichten waren heterogener als angenommen – Partyvolk war hier ebenso vertreten wie urbanes Bildungsbürgertum, was es schwieriger machen würde, seine Kritik eindeutig zu adressieren. Auch Söldner entdeckte Vincent immer wieder unten den Passanten. Sie trugen ihre Uniformen selbst in der Freizeit und präsentierten sich mit kaum verhohlenem Stolz. Die Männer gehörten nicht den Streitkräften der Union an, sondern einer paramilitärischen Einheit, die den Grenzverlauf in und um Thikro kontrollierte. Die Solidarische Union – kurz SU genannt – war weltweit in Krisengebieten aktiv. Die Finanzierung der Miliz war undurchsichtig und führte in rechtsradikale Milieus. Vincent beobachtete eine Gruppe Söldner und beschloss, ihnen eine Weile zu folgen. Regelmäßig bildeten sich Trauben um die Männer. Passanten klopften ihnen auf die Schulter oder wollten ihnen die Hand schütteln, viele baten um ein Foto. Es schien nicht wenige zu geben, die sich ihretwegen auf den Weg nach Thikro gemacht hatten. Die Präsenz der Miliz in den sozialen Netzwerken war vorbildlich. Sie versorgte eine wachsende Zahl an Followern mit Bildern und Videos ihrer Einsätze. Ihre Beiträge waren patriotisch, mitunter witzig, und strotzten vor heroischen Posen. Die Söldner stammten aus allen Ländern der Welt und rekrutierten sich vornehmend aus Soldaten, die vorzeitig aus dem Militär geschieden waren. Manche der dreihundert Mann starken Truppe waren zu Internetberühmtheiten avanciert, darunter Frédéric Llosa, der sich nicht selten mit nacktem Oberkörper und seiner M60 fotografierte. Seinen privaten Accounts allein folgten beinahe so viele User wie der gesamten Truppe. Es kursierte ein Kartenspiel, das neben Llosa einunddreißig weitere Milizionäre abbildete, ein kurzlebiger Internethype, ausgelöst von einem Fan, dem die Verbreitung nach einem Rechtsstreit untersagt worden war.
Die Söldnergruppe nahm in einer Bar Platz, und Vincent verlor das Interesse an ihnen. Er war mittlerweile vor der Aussichtsplattform angelangt. Eine Treppe führte vom Boulevard zu einem der Wachtürme hinauf. Stege bogen links und rechts am Turm vorbei und mündeten in einer Plattform, die in das Kriegsgebiet hineinragte. Vor dem Kassenhäuschen verdichtete sich die Menge, ein Bildschirm wies den nächsten freien Slot in einer Stunde aus. Vincent zupfte an seinem Hemd, das durchgeschwitzt an seiner Brust klebte. Er hatte keine Lust, so lange zu warten. Der Boulevard hatte ihn ausgelaugt und die Sinne müde gemacht. Er beschloss, sich nach einem Taxi umzusehen, und sein suchender Blick blieb nicht unbemerkt. Er wimmelte einen Mann ab, der ihm einen früheren Slot für den Plattformbesuch verkaufen wollte, und einen anderen, der ihm Sugar anbot, was auch immer das sein mochte. Vincent schob sich durch die Menge und ließ den überfüllten Boulevard hinter sich. Zwischen den Hotelanlagen, die am Rande der Flaniermeile in die Höhe schossen, wurde es ruhiger. Er spürte, wie der Lärm in ihm nachhallte und die schmucklosen Zweckbauten der Stadt seine Augen entspannten. In einer Seitenstraße fand er einen Taxi-Fahrer und ließ sich in sein Apartment bringen.
3
Vincent lag im Bett und platzierte sein Smartphone auf Stirn und Nasenspitze. Er starrte auf das dunkle Display, spürte dessen sanften Druck auf seinem Gesicht und wartete auf einen Anruf von Nina, den er wohl nicht mehr empfangen würde. Es war bereits kurz vor Mitternacht, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt noch zurückrufen würde, sank mit jeder Minute. Er nahm das Telefon vom Gesicht und schrieb ihr bei WhatsApp, dass er gut angekommen war. Er schickte einige Fotos vom Boulevard und von den Grenzanlagen hinterher und wünschte ihr eine gute Nacht. Er legte das Smartphone zurück auf die Stirn und wartete auf eine Antwort. Er sehnte sich nach einem vertrauten Menschen, dem er von seinen Eindrücken erzählen konnte und dessen Worte seine fiebrigen Wangen streicheln würden. Bislang war Nina dieser Mensch gewesen, doch die vergangene Nacht hatte die Risse in ihrem Verhältnis offenbart.
Eine eingehende Nachricht ließ sein Smartphone vibrieren, und Vincent erschreckte sich derart, dass ihm das Telefon von der Nase glitt und auf den Boden fiel. Ninas Antwort bestand aus zwei Emojis: Daumen hoch, Smiley. Sie war direkt nach dem Versenden offline gegangen. Vincent warf das Smartphone seufzend beiseite und zog die Bettdecke über den Kopf.
Niemand kannte ihn und seine beruflichen Ambitionen besser als Nina. Bis zu ihrer Trennung hatte sie all seine Selbstzweifel, seine Rückschläge und Erfolge begleitet. Ihr verdankte Vincent auch sein erstes großes Thema: Geldtransfers von Migranten in ihre Heimatländer, Summen in Milliardenhöhe, die in manchen Ländern ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts ausmachten. Nina hatte eine Podiumsdiskussion zu dem Thema organisiert und ihn mit den Rednern in Kontakt gebracht, darunter eine Vertreterin der Weltbank. Schon nach den ersten Gesprächen hinter der Bühne hatte Vincent gewusst, dass das Thema brannte. Er wollte nicht nur den Geschäftspraktiken von Western Union und Moneygram nachgehen, die bei jeder Überweisung bis zu zehn Prozent der Überweisungssumme einbehielten, sondern wollte auch jenen Gesicht und Stimme geben, die am anderen Ende der Überweisung standen. Er legte eine Reiseroute fest und bewarb sich mit der Idee um ein Recherchestipendium. Vincent wartete schon lange auf eine Gelegenheit, seine Festanstellung bei einer Lokalredaktion zu kündigen. Er wollte die Entscheidung vom Erhalt des Stipendiums abhängig machen, und als sein Antrag abgelehnt wurde, kündigte er trotzdem.
Er flog auf eigene Kosten nach Abuja und mietete sich zwei Wochen in einem Hotelzimmer ein. Er nahm sich keine freien Tage, recherchierte tagsüber und schrieb nachts. In den Slums entdeckte er Werbeplakate, die ein Anbieter von Geldtransfers geschaltet hatte, um die Bewohner wenig subtil zur Flucht zu motivieren. Wir glauben an Menschen, die in Bewegung bleiben, um ihre Träume zu verwirklichen, man wollte kotzen, wenn man das las, wenn man selbst mit Männern gesprochen hatte, die in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt waren, ohne einen Fuß nach Europa zu setzen; die den direkten Augenkontakt mieden, immer zu Boden starrten und nur die Hälfte dessen erzählten, was sie erlebt hatten, von Schmugglern und Polizei misshandelt, vergewaltigt, in der Wüste ausgesetzt, verschuldet. Vincent schrieb mit Wut im Bauch, und seine Reportagen gelangen ihm gut. Er brachte sie in verschiedenen Medien unter, noch während er in Abuja war. In den wenigen freien Stunden saß er in einem Internetcafé und berichtete Nina von seinem Tag. Sie las seine Texte gegen und fand die richtigen Worte, wenn er an ihnen zweifelte. Als er zurückkam, holte sie ihn vom Flughafen ab, mit einem breiten Lächeln und einer Ausgabe der Tageszeitung, in der eine seiner Reportagen erschienen war.
Thikro würde seine zweite große Recherchereise werden, und er hatte im vergangenen Jahr genügend Beziehungsarbeit gepflegt, um seine Texte auch in größeren Blättern unterzubringen. Der Volxmund zahlte ihm gar einen Spesenzuschuss, was selten genug vorkam. Vincent spürte dieselbe Aufregung wie damals, dieselbe Gewissheit, dass das Thema einschlagen würde. Da sein Zwischenmieter bereits die Wohnung bezogen hatte, fragte er Nina, ob er in der Nacht vor dem Abflug bei ihr unterkommen konnte. Seine Ex-Freundin um einen Schlafplatz zu bitten, war ihm selbstverständlich vorgekommen. Immerhin hatte er seinen Abschied zu feiern, den hoffentlich nächsten großen Sprung auf der Karriereleiter, und mit wem sollte er das feiern, wenn nicht mit ihr.
»Gern«, schrieb sie zurück, einen Tag, nachdem die Häkchen blau geworden waren.
Sie hatte gekocht, sehr aufwendig. In ihrer neuen Küche staute sich der Dampf, alle Herdplatten waren belegt. Die Zucchini hatte sie in dünne Streifen gehobelt, sodass man sie zusammen mit den Tagliatelle auf die Gabel drehen konnte. Sie demonstrierte es ihm auf einem leeren Teller. Ein flüchtiges Lächeln huschte über ihr Gesicht, bevor sie sich wieder den dampfenden Töpfen zuwandte. Vincent begann, sich unwohl zu fühlen. Er musste an Sartres Schmutzige Hände denken, an Olga und ihren ehemaligen Verlobten, der überraschend aus dem Krieg zurückkehrt. Die beiden stehen betreten voreinander, und Olga fragt, ob sie ihm ein Essen richten soll. Ach, antwortet der verprellte Verlobte, es ist so bequem, wenn man etwas geben kann; damit hält man sich die Leute vom Leibe.
Vincent wurde es kalt, als er an die Zeile dachte. Er hatte Nina selbst in der Rolle der Olga gesehen, eingerahmt von einem kubischen Bühnenbild, das fortwährend über die Bühne geschoben wurde und den Verfall strukturalistischer Weltbilder symbolisierte, wie sie sagte. Wunderschön war sie gewesen, talentiert. Er betrachtete ihre hektischen Bewegungen vor den Herdplatten und fragte sich, ob er sich zum Rauchen auf den Balkon entschuldigen sollte, aber da servierte Nina bereits das Essen. Auch der Wein war sehr teuer, was es nur schlimmer machte – er schmeckte ausgezeichnet.
Vincent erzählte von den kommenden Wochen in Thikro und hörte sich selbst nicht richtig zu. Er blickte sich in der Wohnung um, die er zum ersten Mal sah, seit er ihr beim Umzug geholfen hatte. Die beiden verband weiterhin eine Freundschaft, zumindest tagsüber und an neutralen Orten. Mit einem Mal kam ihm seine Anwesenheit wie ein fürchterlicher Fehler vor. Er hätte seine Selbsteinladung gerne ungeschehen gemacht, aber nun saß er schon hier.
»An was denkst du?«, fragte Nina, ihre geschminkten Lippen am Weinglas. Sie blickte ihn fast schon herausfordernd an, als überließe sie ihm die Entscheidung, ob sie offen miteinander reden sollten oder nicht. Vincent brachte sich zu einem Lächeln.
»Ich denke an Sizilien«, sagte er. Es war ein durchschaubarer Trick, aber sie wollten beide, dass er funktionierte. Mit Anekdoten aus ihrer Vergangenheit brachten sie einander zum Lachen, und als sie mit dem Wein auf den Balkon wechselten, hatten sie gar ein paar Stunden miteinander, in denen alles war wie früher. Sie tauchten unter die Oberflächlichkeit des Smalltalks, erzählten von Freunden und Familienmitgliedern, die der jeweils andere seit der Trennung nicht mehr gesehen hatte, teilten ihre Gedanken der letzten Wochen und stritten über Politik. Es war schön. Sie saßen länger beisammen, als es sein frühmorgendlicher Flug eigentlich erlaubt hätte. Vincent stellte sich gar die Frage, ob Nina noch immer die Pille nahm, bis sie die Weingläser in die Spüle stellten und über seinen Schlafplatz diskutierten. Er hatte bis dahin keinen Gedanken daran verschwendet. Vincent legte sich auf die Couch und stellte fest, dass sie um die entscheidenden Zentimeter zu kurz war. Nina bot an, selbst die Couch zu nehmen – sie sei klein genug, um sich dort ausstrecken zu können. Es war ihm jedoch unangenehm, sie aus ihrem Bett zu vertreiben, also richtete sich Vincent einen Schlafplatz auf dem Boden. Er breitete eine dicke Wolldecke als Unterlage aus und wusste, dass er mit Rückenschmerzen aufwachen würde. Er hatte wohl einen Moment zu lange auf den Boden gestarrt, jedenfalls bat Nina ihn, zu ihr ins Bett zu kommen. Die Diskussion um seinen Schlafplatz hatte bereits mehr Raum eingenommen, als es angenehm war, also warf er sein Bettzeug neben sie und löschte das Licht. Sie hatte ein schweres Kissen neben sich aufgebaut, das oberhalb der Hüfte jeglichen Körperkontakt verhinderte. Vincent wusste selbst nicht, was er sich von dem Abend erwartet hatte – das Kissen war es jedenfalls nicht gewesen.
Vincent lag lange wach und achtete auf Ninas Atemzüge. Sie schlief nicht. Es machte ihn nervös, dass sie nebeneinander lagen und nicht schliefen, aber auch nicht miteinander redeten. Er starrte zur dunklen Decke hinauf, bis er nicht mehr wusste, ob er die Augen geöffnet oder geschlossen hatte. Erst, als er ihre tiefen und regelmäßigen Atemzüge hörte, glitt er in einen leichten Schlaf.
Als sein Wecker um halb fünf klingelte, wachte Vincent mit Rückenschmerzen auf, eingezwängt zwischen Kissen und Bettkante. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Er hatte darauf bestanden, dass Nina liegen bleiben solle, und das tat sie auch. Er putzte sich die Zähne, nahm seinen Rucksack und schloss hinter sich die Tür.
4
Vincent verbrachte den ersten Morgen in Thikro damit, sich ohne einen Plan durch die Nachbarschaft treiben zu lassen. Er gefiel sich als Flaneur, der sich seine Umgebung und damit den Gegenstand seiner journalistischen Arbeit mit einer gewissen Distanz erschloss. Die Möglichkeiten der Recherche waren begrenzt und die besten Geschichten fanden sich immer noch durch Zufall. Er hielt sich vom Boulevard fern und stellte fest, dass Thikro abseits dessen eine normale Stadt war. Er blickte in fremde Hinterhöfe und wechselte ein paar Worte mit Kindern, die kichernd ihr Schulenglisch an ihm erprobten. In den Straßen wurden die Rollläden hochgezogen und der Duft von frisch gebackenem Brot hing in der Luft. Vincent suchte nach einem Café, in dem er frühstücken konnte, als sein Telefon klingelte. Es war Héctor, sein Fotograf. Vincent zog sich in eine Häuserschlucht zurück und presste den Finger gegen sein linkes Ohr.
»Du lebst noch!«
»Gerade so«, sagte Héctor und lachte. »Entschuldige, dass ich mich so spät melde. Ich war bis gestern in irgendwelchen Tälern ohne Internetempfang.«
»Wo bist du jetzt?«
»In einem Hotelzimmer in Jammu, und ich habe nicht vor, es so schnell zu verlassen. Ich blättere gerade durch die Flyer der Lieferdienste. Wusstest du, dass es hier Domino’s gibt?
»Die gibt’s doch überall.«
»Gelobt sei der freie Markt, die ganze Welt kommt in den Genuss von Chicken BBQ Pizza. Bist du schon in Thikro?«
»Seit gestern.«
»Dein erster Eindruck?«
»Durchgeknallt«, sagte er und fühlte dem Wort nach, das er gewählt hatte. Er gab sich damit zufrieden. »Ja, durchgeknallt. Vor der Mauer reiht sich eine Bar an die andere, und ein paar Kilometer weiter schlagen Granaten ein. Amgar, die Rebellenhochburg, hast du davon gehört? Du kannst sie von hier aus sehen, es gibt eine Aussichtsplattform dafür. Es ist absurd, aber das Konzept geht auf. Dieses dekorative Elend, ein bisschen Exotik, ein bisschen Gefahr. Aber mit den Annehmlichkeiten eines All-Inclusive-Urlaubs … wann kommst du denn in Thikro an? Ich kann dich von der Busstation abholen.«
»Deswegen rufe ich an«, sagte Héctor in einem unguten Tonfall.
»Sag nicht –«
»Mir täte eine Auszeit gut. Das waren ein paar harte Wochen. Wenig Schlaf, immer auf Hochspannung.« Er setzte kurz ab. »Ich möchte nicht in die Details gehen, aber, naja … ich habe viel Blut gesehen.«
Sie schwiegen eine Weile. Vincent blinzelte zum Himmel hinauf, der sich als schmaler Streifen zwischen den Häuserwänden abzeichnete.
»Brauchst du ausgerechnet mich?«, fragte Héctor. »Der Volxmund hat doch selbst gute Leute. Was ist mit Christina?«
Christina war zu anständig – das war der erste Gedanke, der Vincent in den Sinn kam, und diese Tatsache schockierte ihn selbst ein wenig.
»Kannst du dir Christina auf Streife mit den Söldnern vorstellen? Oder bei Recherchen in einer Drogenküche?«
»Klar. Sie ist ein Profi.«
»Christina geht keine Risiken ein.«
»Und ich schon?«
»Du wägst Risiken ab und entscheidest dich dafür oder dagegen, das ist der Unterschied.«
»Was ist mit Liam?«
»Der ist doch ein Depp.«
Vincent lehnte die Stirn an die kalte Wand und schloss die Augen. Er sah bereits seine gesamte Reportage in sich zusammenstürzen.
»Bist du schon an was dran?«, fragte Héctor, um das Thema zu wechseln.
»Nicht wirklich. Ich komme erst mal an, sehe was sich ergibt. Kommende Woche habe ich ein Interview mit Chris Varga, dem Mann, der das ganze Geld in die Stadt pumpt. Aber du weißt ja, wie das ist. Am Ende fliegst du mit völlig anderen Geschichten zurück als erwartet.«
Auf der Straße ratterte ein Obstkarren übers Pflaster, die Warnrufe des Fahrers eilten ihm voraus. Passanten sprangen zur Seite und drückten sich zu Vincent in die Häuserspalte. Es handelte sich um die entscheidenden Minuten ihres Gesprächs, und die Störung erfüllte ihn mit einem kurzen, irrationalen Hass. Er drehte ihnen den Rücken zu und suchte nach den richtigen Worten.
»Héctor, die Bedingungen sind wirklich ideal. Du musst kein Geld für eine Unterkunft ausgeben, du schläfst in meinem Gästezimmer und kannst solange bleiben, wie du möchtest. Und der Volxmund zahlt gut, das weißt du. Ich nehme dir ein Video für meine Kanäle ab, und wenn es mit dem Intruder klappt, kriegst du auch dort noch Bilder unter. Um die Verwertung musst du dir also keine Gedanken machen. Das sind echte Traumbedingungen.«
Héctor sagte nichts.
»Nimm dir ein paar Tage Auszeit in Thikro. Du musst nicht sofort anfangen, es gibt auch keine Deadline. Ich muss sowieso noch einiges an Recherche erledigen. Du kannst dich in der Zwischenzeit ausruhen und die Sonne genießen, oder ein bisschen Party machen, oder beides. Wenn du soweit bist, starten wir.«
Er spürte der Stille in der Leitung nach. Héctor schien zu überlegen.
»Du bist der beste Fotograf, den ich kenne«, fügte er hinzu, weil er wusste, dass es ihn überzeugen würde, und weil es stimmte. »Komm schon, Héctor, bist du dabei?«
Die Altstadt war ein System an Kapillaren. Es war zu feingliedrig, um den Wegen einen Namen zu geben, und es genügte eine geringe Anzahl an Menschen, um es zu verstopfen. Nur selten traten die Berge zwischen den Häusern hervor und gaben ein wenig Orientierung. Vincent hatte sich verlaufen, aber das war nicht weiter schlimm. In Hochstimmung über die gerettete Reportage lief er einfach weiter, bis er auf eine Straße stieß, die er wiedererkannte. Er deckte sich mit Lebensmitteln ein und traf auf dem Rückweg die Haushälterin bei der Gartenarbeit. Er tippte ihr eine Nachricht in den Google Übersetzer. Ich bekomme einen Gast. Er reist Mittwoch an. Die Frau wischte ihre Finger an der Schürze ab und nahm das Telefon entgegen. Sie tippte eine Antwort ein. Ich beziehe das Bett am Nachmittag.
Vincent hievte die Einkaufstüten in den dritten Stock, stellte die Klimaanlage auf höchste Stufe und setzte Kaffee auf. Er würde den Tag damit verbringen, alte Texte zu redigieren, Rechnungen zu schreiben und bei Redaktionen nachzuhaken, die ihm eine Veröffentlichung oder zumindest ein Ausfallhonorar schuldeten. Er konnte nun die Rückstände der letzten Wochen abarbeiten, ohne in Zeitdruck zu geraten. Sein Aufenthalt in Thikro war großzügig berechnet. Für die Recherchen hatte er drei Wochen veranschlagt und er hatte einen Monat dran gehangen, als er von den billigen Mieten in der Stadt erfuhr. Das Devisengefälle drückte die Preise zusätzlich. Seine Wohnung hatte er überteuert zur Zwischenmiete ausgeschrieben und tatsächlich jemanden gefunden, der ihm den hohen Preis zahlte. Zu dem Zeitpunkt, als Vincent ins Flugzeug stieg, hatte er bereits mehr Geld verdient als mit dem Schreiben einer Reportage.
Er setzte sich an den Schreibtisch und begann zu arbeiten. Regelmäßig wanderte sein Blick auf sein Smartphone, ob er eine Nachricht von Nina erhalten hatte. Genau das hatte er vermeiden wollen. Er wollte sich nicht durch emotionalen Ballast von seiner Arbeit ablenken lassen, und doch fand er keinen Frieden damit, der Böse in dieser Geschichte zu sein, der kräftig Staub aufwirbelte und dann einfach verschwand. Er durchforstete Ninas Social-Media-Kanäle nach einem Anzeichen für ihre Stimmung und fand heraus, dass sie sein erstes Video von der Grenze retweetet hatte. Vincent nahm es als Beweis dafür, dass es um ihr Verhältnis so schlecht nicht stehen konnte, und wandte sich wieder seinen Texten zu.
Am Nachmittag hatte er den Großteil seiner Arbeit erledigt. Die Haushälterin klopfte, um das Gästebett für Héctor zu beziehen, und Vincent machte eine Pause auf dem Flachdach. Er hob den Aschenbecher auf, der dort auf dem Boden lag, und spazierte über die ungenutzte Fläche. Die Sonne reflektierte unangenehm von den hellen Fliesen. Er stellte sich ans Geländer und schirmte seine Augen mit der Hand ab. Unter dem Halbrund seiner Finger ging der Blick kilometerweit. Er zündete sich eine Zigarette an und wartete vergeblich auf einen erfrischenden Windstoß. Vincent erinnerte sich an einen Sommertag, den er mit Nina verbracht hatte. Sie waren durch einen entlegenen Teil des Stadtparks spaziert, der von Teichen und hüfthohen Gräsern durchzogen war. Sie hatten sich eine Bahn durch das Gras geschlagen und mit ihrem Handtuch eine Liegefläche plattgedrückt. Über ihnen der Himmel, begrenzt von einer Korona aus Schilfrohr. Nina hatte ihm einen geblasen, aber er hatte keine wirkliche Freude daran gehabt. Die Luft hatte sich im Gras gesammelt und auf ihnen gelegen wie eine kratzige Wolldecke.
Er drückte die Zigarette nach der Hälfte aus und ging in die Wohnung zurück. Die Haushälterin war bereits verschwunden. Es war kurz nach sechzehn Uhr, der Tag halb angefangen und nicht zu Ende gebracht. Er nahm die Milch aus dem Kühlschrank und trank direkt aus der Flasche, bevor er sie in eine Schüssel goss. Er setzte sich in Unterhosen auf die Ledercouch, die unangenehm an seiner Haut klebte, aß Cornflakes und verfolgte die Nachrichten auf CNN.
Am Abend gestand er sich ein, dass er sich langweilte. Das Wissen, dass sich in der ganzen Stadt Menschen für den Freitagabend verabredeten, machte ihn unruhig. Er fühlte sich in die Pubertät zurückversetzt, als wartete er auf die Einladung zu einer Party, die er gar nicht besuchen wollte. Er saß am Fenster und blickte auf die Stadt, deren Berge einen rosafarbenen Glanz annahmen. In den dunkelnden Straßen leuchteten Reklamen auf. Er betrachtete einen Berghang, der jenseits der Grenze aufragte. Ein verlorenes Stück Erde, dachte er.
Vincent verließ das Apartment und ließ sich durch die Straßen treiben. Menschen, Gespräche und hellerleuchtete Geschäfte zogen an ihm vorbei. Ihm wurden Armbanduhren und einzelne Taschentuchpackungen angeboten, ein Straßenmetzger köpfte vor den Augen schaulustiger Touristen ein Huhn. Im Gedränge vor einer Straßenkreuzung hörte er ein eilig gezischtes Hasch. Er nickte dem Mann zu, der es ausgesprochen hatte, und der Mann deutete an, ihm zu folgen. Vincent wurde aus dem Getümmel der Altstadt zu einem nahegelegenen Mietshaus geführt. Die beiden sprachen kein Wort miteinander. Der Mann schob ein Eisentor auf, das den Zugang zum Innenhof versperrte, und führte ihn an einen Tisch. Leselampen waren auf die Tischplatte gerichtet, um das Sortiment in der Dunkelheit erkennen zu können. Er gab dem Verkäufer ein Zeichen und kehrte wieder um.
»Guten Abend, mein Freund, wie geht es dir?«, sagte der Verkäufer und aschte selbstvergessen in einen Marlboro-Aschenbecher. Vincent murmelte eine Antwort und trat näher. Gras- und Haschsorten lagen in aufgekrempelten Plastiktüten bereit. In einer Schüssel häuften sich kleine Tüten mit bunten Tabletten, daneben wurden Poppers, Viagra und verschieden befüllte Ampullen geboten. Vincent war nicht der einzige Kunde. Neben ihm stand eine Männergruppe in Sommersakkos, die ihren heutigen Rausch beratschlagten. Einer hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt und beugte sich über den Tisch wie über eine Käseplatte. Der Verkäufer scherzte mit ihnen und erklärte die Unterschiede zwischen den Sorten. Er strahlte den Stolz eines Sammlers aus, der seine besten Stücke präsentierte.
Vincent betrachtete das Mietshaus, das sich von allen vier Seiten um den Innenhof schloss. Die Flure waren dem Hof zugewandt, Wäsche hing über den Geländern zum Trocknen. Hinter den Fenstern ging das Leben ungerührt weiter. Aus der Dunkelheit löste sich die Gestalt einer alten Frau, die Tee brachte. Sie stemmte sich das Tablett gegen den Bauch, als sie das leere Teeglas des Verkäufers gegen ein volles tauschte. Sie bot auch Vincent ein Glas, und er griff aus Höflichkeit zu. Der Verkäufer verabschiedete derweil die Männergruppe. Er winkte ihr hinterher, nahm seine Zigarette auf und wandte sich Vincent zu.
»Mein Freund, was kann ich für dich tun?«
Vincent begnügte sich mit zwei Grassorten in geringen Mengen. Der Verkäufer, der sich als Sam vorstellte, beschrieb ihm die Nuancen ihrer Wirkung und schüttelte die Pollen auf eine Grammwaage. Vincent klemmte ihm die Geldscheine unter die Keramikschüssel. Er hätte gleich gehen wollen, aber der Tee zwang ihn, noch eine Weile zu bleiben. Er war zu heiß, um ihn in einem Schluck hinunterzustürzen.
»Bist du alleine unterwegs, mein Freund?«
Vincent nickte.
»Du bist für die Mädchen hier«, sagte er und grinste Vincent zu, in einer Geste der Verbrüderung. »Ich würd’s sofort mit zehn Verschiedenen treiben, aber ich darf nicht.« Er hielt ihm seinen Ehering vors Gesicht. Er drückte die Tütchen mit dem Gras zu und schob sie über den Tisch.
»Wo kommst du her?«
Vincent nannte ihm seine Heimatstadt. Sam machte eine Bewegung, als würde er vor Kälte zittern und lachte. Er war in Plauderlaune und Vincent schimpfte sich selbst, dass er das nicht früher genutzt hatte. Er machte sich locker und warf einen zweiten Blick über den Tisch. Er tat, als wolle er etwas Neues ausprobieren, und ließ sich den Inhalt der Ampullen erklären. Er machte Sam ein Kompliment für sein großes Angebot.
»Du hast wirklich alles, oder?«
»Nicht alles, nein, aber ich kann alles besorgen.«
»Du machst die Leute glücklich, so einen Job hätte ich auch gerne.«
Sam lachte. Er war dicklich, sein Gesicht rund und bärtig. Mit seinem College-Pullover sah er aus wie der Kumpel von nebenan. Vincent nahm einen Schluck von seinem Tee. »Baust du selbst an?«
»Wir haben mehrere Fußballfelder, meine Jungs und ich.«
Sam löste sein Smartphone von dem Ladekabel, das an einer Mehrfachsteckdose unter dem Tisch hing, und tippte etwas ein. Er reckte Vincent das Display hin und wischte mit dem Finger durch eine Galerie. Die Bilder zeigten eine Marihuana-Plantage in den Bergen. Inmitten der Plantage stand Sam, die Pflanzen reichten ihm bis zur Brust. Er feixte in die Kamera und hielt die Arme ausgestreckt, als wolle er sagen: Alles meins.
»Wir sind ein Familienbetrieb. Wenn wir im Herbst ernten, steht die ganze Familie im Feld, vom Neffen bis zur Großmutter. Wir halten zusammen.«
Er scrollte weiter durch die Bildergalerie, die in leichter Variation dasselbe Motiv zeigte: Cannabispflanzen, dicht gedrängt, meterhoch.
»Ist das hier, in Thikro?«
»In den Bergen, nicht weit von hier.«
Er kam zu einem Bild, auf dem ein schwarzer Land Rover zu sehen war. Sam stand mit Arbeitshandschuhen auf der Ladefläche und nahm geerntete Marihuana-Stauden entgegen. Sie waren mit Schnüren zusammengebunden und erinnerten Vincent an Weihnachtsbäume.
»Der Land Rover ist nur für die Arbeit. Ich habe noch einen zweiten Pick-Up, einen Mercedes.«
Er zeigte ihm noch den Mercedes, dann steckte Sam das Handy zurück an das Ladekabel.Vincent deutete auf die Schüssel mit den Tabletten. »Und was ist damit? Da braucht es doch Maschinen und Labore und so was.«
»Dafür haben wir Leute«, sagte Sam kurz angebunden und Vincent verstand, wo dessen Grenzen lagen. Er überspielte den kurzen Einbruch, indem er Sam mit gefälligen Fragen fütterte, und sie kamen auch auf die Polizei zu sprechen. Sam antwortete bereitwillig und ließ Vincent einen zweiten Tee bringen. Die Polizisten seien wie Brüder und verdarben einem nicht das Geschäft, solange man diskret blieb. Man kenne sich in der Stadt und wisse, womit die Leute ihr Geld verdienten. Eine Krähe hacke der anderen nicht das Auge aus, nicht nach dem Unglück, das über die Stadt hereingebrochen war, nicht nach dem, was sie alle durchgemacht hatten. Die Welt habe im Livestream zugesehen, wie die Rebellen sie als lebende Schutzschilde missbrauchten, jede Familie habe Tote zu beklagen, aber das sei für die Geschichtsbücher. Ihre Zeit sei gekommen, ein bisschen was vom Glück abzuhaben, die Stadt blicke nun in die Zukunft.
»Ich gebe dir noch was mit. Ein Geschenk, zum Ausprobieren.«
Er streckte ihm ein Tütchen hin mit einer einzigen blassgelben Tablette.
»Wenn du mal Party machen möchtest. Hält dich wach, macht dich stark und euphorisch. Wie Hulk. Auch untenrum ist mehr los. Keine Sorge, du läufst nicht automatisch mit einem Ständer rum, aber wenn du’s treibst, kannst du länger und öfter.«
Vincent dankte und steckte das Teilchen ein. Sie gaben sich die Hand und Sam hielt den Handschlag aufrecht. Er blickte Vincent in die Augen, als spreche er zu seinem zukünftigen Schwiegersohn. »Wenn du etwas willst, das ich nicht habe, sagst du es mir, ja? Dann besorge ich es.« Vincent nickte. »Klopf das nächste Mal am Tor und frag nach Sam, dann macht dir jemand auf. Mach’s gut, mein Freund.«
Sam zog die Hand zurück und legte sie sich auf die Brust. Vincent tat es ihm gleich und verließ den Innenhof.
Die Straßen waren voller geworden. Er wich einem Junggesellenabschied aus, bei dem man den Bräutigam in ein pinkes Tutu gesteckt hatte, und bog auf den Boulevard. Vincent schob die Hände in die Taschen und spazierte die Mauer entlang, die in orangefarbenes Scheinwerferlicht getaucht war. Das Gefühl, ein Ausgestoßener zu sein, verschwand nicht. Die anderen waren ihm fremd, aber ihre Geschlossenheit machte ihn eifersüchtig. Vincent fragte sich, was er mit dem Abend anfangen sollte, und ließ sich zu einer Bar navigieren, die er online entdeckt hatte. The Garden erhielt in den Reiseforen wenige, aber durchweg positive Bewertungen. Die Bar hatte schon vor dem Krieg existiert. Ein User beschrieb sie als Oase in der Stadt der Idioten, und Vincent war ihr verfallen, ohne sie betreten zu haben.
Die Bar lag am anderen Ende der Stadt, wo die Straßen breiter und die Grundstücke großzügiger wurden. Wie von einem Asthma befreit schien die Stadt erstmals zu atmen. The Garden lag in einem Hinterhof, in dem der Geruch von Marihuana wie eine Dunstglocke zwischen den Bäumen hing. Sessel und Sofas gruppierten sich um niedrige, aus Paletten gezimmerte Tische. Vincent ließ sich nieder und notierte sich Details aus dem Gespräch mit Sam, bevor er sie vergaß.
Er packte sein Gras aus und drehte es in Ermangelung eines langen Zigarettenpapiers in ein kurzes. Die Bar war angenehm voll, aber nicht überfüllt. Katzen strichen um die Füße der Gäste und bettelten um Essensreste. Er beobachtete ein Pärchen, das zu zweit in einer Hängematte lag und regelmäßig einen Arm herausstreckte, um sich vom Boden abzustoßen. Er war in die Stadt gegangen, um sich weniger einsam zu fühlen und hatte das genaue Gegenteil erreicht. Um ihn herum saßen hippe Mittzwanziger, die sich in Fremdsprachen unterhielten und regelmäßig in Gelächter ausbrachen. Vincent war der einzige, der alleine an einem Tisch saß. Er tröstete sich mit dem Gedanken, dass Héctor in wenigen Tagen kam. Gemeinsam würden sie all den Spaß haben, den seine Mitmenschen gerade hatten.
Er nahm den fertig gerollten Joint auf, gab sich Feuer und ließ langsam den Rauch aus seinem Mund steigen. Das Gras war stark und gut. Er lehnte sich zurück und beobachtete zwei junge Frauen, die am Nachbartisch saßen. Er schätzte sie auf neunzehn oder zwanzig. Unter einem Vorwand sprach Vincent die beiden an und setzte sich zu ihnen. Die eine trug Federschmuck im Haar, die andere fiel durch ihre anorektischen Handgelenke und eine senkrechte Körperhaltung auf, die auf frühe Ballettstunden hindeuteten. Ihre Namen hatte Vincent bereits vergessen, als er ihre Hände losließ. Sicherlich belächelten sie die untersetzten und sonnenverbrannten Touristen, die Fotos mit den Söldnern schossen, und kamen sich selbst ganz anders vor. Er bot ihnen den Joint, den sie dankend annahmen.





























