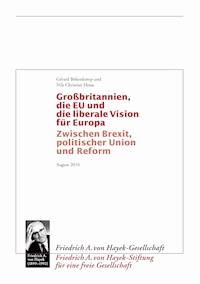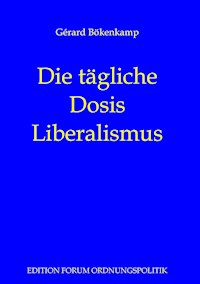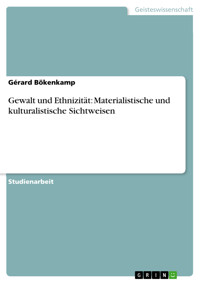
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Kulturwissenschaften - Sonstiges, Note: 1, Freie Universität Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Historiker Thimothy Garton Ash äußerte die Vermutung, dass ein heutiger europäischer Staat mit einer ethnischen Mehrheit von weniger als 80 Prozent im Grunde instabil ist. Die Brisanz dieser These nicht nur für Europa sondern gerade auch mit Sicht auf den außereuropäischen Kontext, in dem die Multiethnizität die Regel und nicht die Ausnahme darstellt, ist offensichtlich. Ein Grund mehr, sich erst einmal die Frage vorzulegen, was genau unter Ethnizität zu verstehen ist. Ziel dieser Arbeit ist es nicht, eine bestimmte theoretische Richtung zu belegen oder zu verwerfen. Vielmehr sollen sowohl die argumentativen Stärken, als auch die Schwächen bestimmter Ansätze herausgearbeitet und ihre Plausibilität anhand verschiedener ethnographischer Beispiele diskutiert werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Page 1
Einleitung
Der Begriff „Ethnos“ bezeichnete in der Antike Stammesstaaten, die nicht zur Kategorie der Polis gehörten. „Ethnos“ zeigte somit lange Zeit eine im Allgemeinen niedrigere Zivilisationsstufe an und taucht erst im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Selbstbeschreibung der eigenen Gruppe auf. Damit wird er zu einem allgemeinen Begriff für Wir-Gruppen1. Seit Beginn der 60er Jahre fand der Begriff Erwähnung in den englischsprachigen Wörterbüchern. Zuerst beschrieb er nur Phänomene in der Dritten Welt, wurde bald jedoch auch auf die separatistischen und nationalistischen Bewegungen der industrialisierten Länder in Westeuropa und Nordamerika angewendet und nach der Auflösung des Ostblocks auch auf politische Kräfte in Osteuropa und der ehemaligen UdSSR.
Nach der Phase der Dekolonisation gab es eine kurze Phase des Optimismus zwischen 1950-1960, die dann mit dem massiven Ausbruch ethnischer Feindseligkeiten in den 60er Jahren ein jähes Ende fand. Stanley Tambiah konstatiert, dass sich die politischen Hoffnungen, die sich mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Bildung unabhängiger Nationalstaaten in der Dritten Welt einstellten, nicht erfüllt haben. Der Entwicklungsoptimismus in der Soziologie der 50er und 60er Jahre glaubte an eine stufenweise Modernisierung bei schrittweiser Rückbildung und schließlich völligem Verschwinden der primordialen Loyalitäten. Statt dessen gewann der Begriff der Ethnizität seit den 60er Jahren immer stärkere Bedeutung im populären und wissenschaftlichen Diskurs, und verdrängte in vielen Fällen die bisherigen Erklärungsmuster von sozialer Klasse, Kaste, Rasse und Geschlechterungleichheit.
Allein in Afrika ließen sich 1995 74 Konflikte zählen, die man der Kategorie der ethnischen Konflikte zuordnen konnte. Von den 45 Millionen Flüchtlingen zu diesem Zeitpunkt stammten 65% aus 60 ethnischen Krisengebieten. 233 Gruppen hatten ihren Wunsch nach Unabhängigkeit formuliert. An 81 der weltweit schwelenden ethnischen Konflikte waren ethnonationalistischen Gruppen mit separatistischen Zielen beteiligt. Bei 45 ging es um die Forderung nach mehr sozioökonomischer Gerechtigkeit für die eigene ethnische Gruppe. 83 verschiedene Völker beanspruchten innerhalb des jeweiligen Staates Autonomie. 49 wurden durch religiöse Sekten bestritten. 66 ethnonationalistischen Gruppen ging es um eine Vergrößerung der kommunalen Macht2. Die Grenzen der meisten Entwicklungsländer entsprechen den willkürlichen Grenzziehungen der europäischen Kolonialherren. Die Territorien von ethnischen Gruppen wurden auseinander gerissen. Man rechnet daher in Zukunft mit weiteren Abspaltungen ethnisch
1Lentz, S. 14.
2Maninger, S. 1.
Page 2
homogener Staaten von multiethnischen Staaten wie im Fall der Trennung von Eritrea von Äthiopien3.
Die konkreten Auslöser der Auseinandersetzungen waren inner- und zwischenstaatliche Migration, Sprachprobleme, Veränderung des demographischen Gleichgewichts und damit einhergehend Konflikte zwischen Indigenen und Fremden. Den größeren Rahmen für die Herausbildung dieses augenscheinlich neuartigen Konflikttypes gab die so genannte Globalisierung ab, mit der die Privatisierung des Krieges und partielle Entstaatlichung verbunden sind. Der Historiker Thimothy Garton Ash äußerte die Vermutung, „dass ein heutiger europäischer Staat mit einer ethnischen Mehrheit von weniger als 80 Prozent im Grunde instabil ist.“4Die Brisanz dieser These nicht nur für Europa sondern gerade auch mit Sicht auf den außereuropäischen Kontext, in dem die Multiethnizität die Regel und nicht die Ausnahme darstellt, ist offensichtlich. Ein Grund mehr, sich erst einmal die Frage vorzulegen, was genau unter Ethnizität zu verstehen ist. Ziel dieser Arbeit ist es nicht, eine bestimmte theoretische Richtung zu belegen oder zu verwerfen. Vielmehr sollen sowohl die argumentativen Stärken, als auch die Schwächen bestimmter Ansätze herausgearbeitet und ihre Plausibilität anhand verschiedener ethnographischer Beispiele diskutiert werden. Es soll versucht werden, jene Kernaussagen festzustellen, die als einigermaßen gesichertes Wissen gelten können, da sich - der unterschiedlichen Terminologien zum Trotz - im Grunde ein gewisser Konsens der wissenschaftlichen Schulen nachweisen lässt. Die Abhandlung behandelt durchgehend den Antagonismus „materialistischer“ und „idealistischer“ Ansätze, der sich auf allen Argumentationsebenen nachweisen lässt. Im ersten Kapitel in der Form Formalismus versus Primordialismus, im zweiten Kapitel in Bezug auf kollektive Gewalt als kulturökologischer versus kulturell-kognitiver Ansatz und im dritten Abschnitt als rational-strategische versus emotionaldynamische Erklärungsmuster.
Es soll versucht werden, Alternativen zu diesen starren Diskurslinien aufzuzeigen und Syntheseleistungen hervorzuheben. Es wird die Grundthese vertreten, dass die theoretischen Grundströmungen weniger als antagonistische, und vielmehr als komplementäre Interpretationsmöglichkeiten aufzufassen sind, die sich gegenseitig nicht ausschließen, sondern zu einem multifaktionalen Ansatz zusammengeführt werden müssen, um der Komplexität der Ursachen und Formen ethnischer Gewalt gerecht zu werden.
3Maninger, S. 6 f.
4Ash, S. 404.
Page 3
I. Theorien zur Ethnizität
I.1. Essentialismus oder Formalismus?