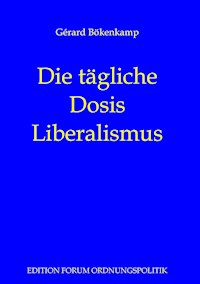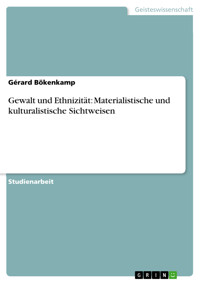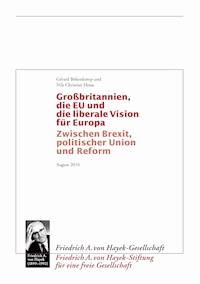
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die im Auftrag der Hayek-Stiftung erstellte Studie untersucht die Gefahren und Chancen des Brexit aus liberaler Perspektive. Welche Optionen gibt es und wie sollte Europa aufgestellt sein, damit es dem Leitbild einer freiheitlichen Ordnung entspricht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Liberale Vordenker
Das Leitbild einer flexiblen europäischen Ordnung
Die britische Vision von Europa als liberale Alternative zur politischen Union?
Die immer engere Union in der Krise
Brexit-Szenarien aus liberaler Perspektive
Ausblick
Literatur
Vorwort:
Nach dem Referendum vom 23. Juni 2016
Das Referendum am 23. Juni 2016 in Großbritannien hat eine Mehrheit für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union erbracht. Die hier vorliegende Studie wurde vor dem Referendum verfasst. Dennoch sind die zentralen Aussagen dieser Studie immer noch relevant, ja gerade in dem nun folgenden Prozess von besonderer Bedeutung. Denn noch ist weder klar, auf welches Abkommen sich Großbritannien und die EU für den Austritt einigen werden. Es ist nicht einmal klar, ob dieser Austritt jemals vollzogen wird.
Diese Studie kann und soll gerade in den nächsten Monaten, bis zur Entscheidung über den Beginn des Austrittsprozesses und auch für die folgenden Verhandlungen einen Beitrag leisten, um die Debatte zu versachlichen. Sie zeigt die möglichen Optionen und das Für und Wider des Brexit aus einer liberalen Perspektive auf. Wir zeigen Reformansätze für die Europäische Union. Auch diese bleiben aktuell, ja können als Antwort auf die besondere Dringlichkeit der Lage gelesen werden.
Sie werden in dieser Studie ein ausgearbeitetes liberales Leitbild finden und eine Problemanalyse der europäischen Politik, die wohl teilweise erklären kann, warum das Votum der Briten so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Die beschriebenen, von David Cameron durchgesetzten Reformen sind nach wie vor sinnvolle Schritte zur Verbesserung der EU und sollten auch nach diesem Referendum zur Umsetzung in Betracht gezogen werden. Die aufgezeigten Optionen und Modelle für die Zeit nach dem Brexit sind nun von besonderem Interesse und Aktualität. Aber auch die Möglichkeit eines Verbleibs Großbritanniens in der EU kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.
Der Brexit und die Reform der EU gehören zu den großen Fragen unserer Zeit. Diese Abhandlung bietet eine liberale Perspektive auf den bisherigen Prozess und eine Hilfe zur Beurteilung der Entscheidungen, die noch vor uns liegen.
1. Einleitung
Am 23. Juni stimmen die Briten über den Verbleib in der Europäischen Union ab. Die Umfragen deuten auf einen knappen Ausgang hin, und auch in Deutschland gehen die Meinungen über Großbritanniens Mitgliedschaft in der EU auseinander.
Es gibt durchaus Gründe für die Meinung, ein Brexit könnte für beide Seiten wohltuend sein – nach dem Motto: Lieber ein guter Nachbar als ein schlechter Mitbewohner.1 Vielleicht sind Großbritannien und die EU einfach nicht füreinander gemacht. Zudem könnte ein Brexit ein Weckruf sein und die EU-Reformbereitschaft, die im Inneren erlahmt, von außen beleben. Aber es gibt auch Gründe für den Standpunkt, dass die Briten weiter als Korrektiv, Beitragszahler und politisches Schwergewicht in der EU gebraucht werden. Ein Austritt Großbritanniens könnte – so die Befürchtungen – zu wirtschaftlichen Verwerfungen, Protektionismus und politischem Chaos führen.
Die Lager lassen sich dabei nicht entlang eines klassischen Links/Rechts- oder Individualistisch/Kollektiv-Schemas einordnen. Viele überzeugte Liberale in Großbritannien erhoffen sich von einem unabhängigen Großbritannien ein neues goldenes Zeitalter des Freihandels auf der Insel. Aber auch viele Linke setzen auf einen Brexit, um ihre Idee eines „sozialistischen“ Großbritanniens der Vor-Thatcher-Ära zu verwirklichen, oder um auf dem Kontinent ohne den Widerstand der Briten endlich den europäischen Bundesstaat durchzusetzen. Manche Liberale auf dem Kontinent erhoffen sich hingegen von einem Brexit, dass in der Folge auch das demokratische Mitbestimmungsbedürfnis in anderen Mitgliedstaaten erwacht und die Träume von eben diesem europäischen Bundesstaat zerplatzen.
Diese Studie wird die Folgen eines „out“ ebenso wie die eines „remain“ aus einer liberalen Perspektive analysieren. Wir werden dazu zunächst die europapolitischen Vorstellungen von sieben liberalen Vordenkern beschreiben: Hayek, Mises, Eucken, Röpke, Erhard, Dahrendorf und Buchanan. Sie alle tragen Einsichten bei, aus denen wir zunächst Kriterien für eine liberale europäische Ordnung ableiten und anschließend ein Leitbild, welches diesen Kriterien entspricht. Dieses Leitbild werden wir mit der British Vision of Europe abgleichen, welche Großbritannien mit seiner Europapolitik seit Jahrzehnten verfolgt.
Diese Leitbilder nutzen wir, um die Situation im Status quo und nach dem Referendum zu betrachten. Der Status quo der EU ist kritisch: Das Wohlstandsniveau ist in großen Teilen der Eurozone in den letzten Jahren gesunken, in den Krisenländern bewegt sich die Arbeitslosigkeit weiter auf Rekordniveau, und in den Rettungsländern steigen die Haftungsrisiken. Die EU verfehlt seit Jahren viele ihrer selbstgesetzten Ziele. Mit neuen Institutionen, einer Überdehnung des Rechts und großen finanziellen Anstrengungen konnten in der Euro- und in der Flüchtlingskrise die offensichtlichen Probleme nur notdürftig überdeckt werden. Die immer engere Union ist in eine Sackgasse geraten, aus der sich kein Ausweg abzeichnet.
In dieser Situation lässt Großbritannien seine Bürger über den Verbleib in der EU abstimmen. Wie sich ein Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU auswirken wird, hängt entscheidend von den Umständen dieses Austritts ab. Deshalb skizzieren wir abschließend verschiedene Szenarien und bewerten sie wieder mit Hilfe der zuvor abgeleiteten Kriterien. Wir geben damit Antworten auf die Frage, was ein Brexit für Freiheit, Marktwirtschaft, Subsidiarität und Wettbewerb in Großbritannien, Deutschland und Europa bedeuten würde.
1 Vgl. Hannan (2014)
2. Liberale Vordenker
Um beurteilen zu können, ob aus liberaler Perspektive die Chancen oder die Risiken eines Brexit überwiegen, werden wir die liberale Perspektive genauer beschreiben. Wir zeigen, wie Friedrich A. von Hayek, Ludwig von Mises, Walter Eucken, Ludwig Erhard, Wilhelm Röpke, Ralf Dahrendorf und James Buchanan sich zur europäischen Integration im Allgemeinen und, insoweit der Fall, zu Sezessionen und der Rolle Großbritanniens im Speziellen geäußert haben. Dabei starten wir weitgehend chronologisch mit den Vorstellungen von Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises und Walter Eucken, die diese zum Teil bereits vor und während des Zweiten Weltkriegs zu Papier brachten.
Als nach dem Krieg die politischen Weichen hin zu einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gestellt wurden, waren Wilhelm Röpke und Ludwig Erhard zwei prominente, liberale Kritiker einer immer engeren Union. In den 70er-Jahren äußerte sich Lord Dahrendorf allgemein zu Europa und speziell zur Rolle Großbritanniens. Nach dem Fall der Mauer blickte James Buchanan mit großem Optimismus auf ein föderales Europa.
Friedrich A. von Hayek
Friedrich August von Hayek hat sich ausgerechnet im Jahr 1939 zu den Möglichkeiten föderativer Zusammenschlüsse optimistisch geäußert. Als ganz Europa sich auf den Krieg einstimmte, blieb Hayek hoffnungsvoll beim Gedanken an eine Föderation souveräner Staaten. Denn aus seiner damaligen Sicht wäre die in diesem Fall sich zwangsläufig einstellende liberale Wirtschafts- und Währungspolitik die beste Vorkehrung gegen die Planwirtschaft.
Von einem liberalen Programm abweichende Maßnahmen – die Subventionierung nationaler Unternehmen, breite Umverteilung oder Protektionismus – würden nach damaliger Einschätzung Hayeks in einer Föderation durch universelle Verbote unterbunden. Der Bund hätte dazu kein Mandat, da in einem internationalen Staatenbund nationale Ideologien und das für eine solidarische Sonderbehandlung notwendige Mitgefühl mit dem Nachbarn fehlen würden.
Da „die Macht der den Bundesstaat bildenden Staaten noch begrenzter sein wird, werden viele Eingriffe in das Wirtschaftsleben, an die wir uns gewöhnt haben, in einer föderativen Organisation völlig undurchführbar sein“.2 Dass Bürger über die allgemeinen Verbote von Marktinterventionen hinaus freiwillig einer internationalen Regierung etwa zur Umverteilung im großen Maßstab oder zur Befriedigung von Sonderinteressen Befugnisse abtreten könnten, hielt Hayek 1939 für schwer vorstellbar.
Doch Hayeks 1939 noch äußerst zuversichtliche Perspektive hinsichtlich der sich in einer Föderation quasi automatisch einstellenden freiheitlichen Wirtschaftspolitik machte er 1944 in Der Weg zur Knechtschaft ( The Road to Serfdom) bereits von einigen zusätzlichen Bedingungen abhängig. So sah er die Gefahr, dass sich, sollte sich eine Föderation auf wirtschaftliche Fragen beschränken, die Macht „in den Händen unverantwortlicher internationaler Wirtschaftsinstanzen“ konzentrieren könnte. Statt auf internationale Wirtschaftsinstanzen komme es deshalb auf „eine internationale politische Organisation [an], die die Wirtschaftsinteressen in Schach halten und im Falle eines Konflikts ausgleichend wirken kann“. Die Machtbefugnisse dieser politischen Organisation sollten lediglich „in jenem Minimum an Befugnissen [bestehen], ohne die keine friedlichen Beziehungen aufrechterhalten werden können, d.h. im Wesentlichen in den Befugnissen des ultraliberalen ‚Laissezfaire-Staates‘. Und noch mehr als im nationalen Rahmen kommt es darauf an, dass diese Befugnisse der internationalen Instanz genau durch die Normen des Rechtsstaats festgelegt werden.“3
Hayeks Vertrauen in die liberale Entfaltungswirkung einer föderativen Organisation war also zumindest in dem Maße gesunken, dass er die Notwendigkeit eines klaren und durchsetzbaren gesetzlichen Ordnungsrahmens stärker betonte.
Ebenfalls in The Road to Serfdom beschrieb Hayek die skeptische Haltung, die besonders Briten gegenüber einer übergeordneten europäischen Zentralinstanz hegen würden: „The English people, for instance, perhaps even more than others, begin to realize what such schemes mean only when it is presented to them that they might be a minority in the planning authority and that the main lines of the future economic development of Great Britain might be determined by a non-British majority.“4
Nach dem Krieg wurde die europäische Integration Wirklichkeit. Doch Hayek äußerte sich in den folgenden Jahrzehnten auffällig selten zur konkreten Gestaltung des europäischen Projektes.5 Bei seinen wenigen Einlassungen zu internationalen Organisationen im Allgemeinen zeigt sich, dass von seiner föderalen Euphorie wenig blieb. 1960 schrieb er in The Constitution of Liberty: „The moral foundations for a rule of law on an international scale seem to be lacking still, and we should probably lose whatever advantages it brings within the nation if today we were to entrust any of the new powers of government to supra-national agencies.“6
Hayek war inzwischen skeptisch, ob es in einer internationalen Organisation gelingen könne, politische Macht zu begrenzen, wenn dies nicht mal in den Nationalstaaten gelinge. Seine Hoffnungen, die er in den 30er- und 40er-Jahren noch in die Kraft föderativer Organisationen gelegt hatte, galten nun verstärkt den kleinen Ländern, die er als Oasen ansah, die der fortschreitenden Zentralisierung in Massengesellschaften standhalten.
Konkret zu den Aufgaben einer übernationalen Autorität äußert sich Hayek in Recht, Gesetz und Freiheit.7 Die von einer solchen Autorität erlassenen Regeln sollen wie alle Regeln großer Gesellschaften eher abstrakten Charakter haben, sich auf allgemeine Verbote beschränken und sich nicht an spezifischen, konkreten Geboten orientieren. So solle die übernationale Autorität zu Handlungen Nein sagen können, die assoziierten Staaten schaden würden. Die meisten Dienstleistungstätigkeiten des Staates könnten hingegen auf regionale und lokale Instanzen delegiert werden, deren „jeweilige Zwangsgewalt durch die von einer übergeordneten gesetzgebenden Instanz aufgestellten Regeln begrenzt wären“.8
Gleichzeitig sieht Hayek auch Mechanismen in internationalen Organisationen, die eine Zentralisierung, Umverteilung und Machtausweitung über die Interessen der Bürger hinaus begünstigen können: „[D]ie Zentralisierung schreitet fort, nicht weil die Mehrheit der Menschen in der großen Region begierig wäre, den ärmeren Regionen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, sondern weil die Mehrheit, um eine Mehrheit zu sein, die zusätzlichen Stimmen aus den Regionen benötigt, die einen Vorteil daraus ziehen, wenn sie am Reichtum der größeren Einheit teilhaben.“9 Auch wenn Hayek nicht die europäischen Institutionen vor Augen hatte, beschreibt er damit den Mechanismus des Stimmentausches, wie wir ihn heute auch in der EU kennen.
Für unser liberales Leitbild einer europäischen Ordnung sind neben Hayeks Aussagen zu internationalen Organisationen auch seine Einsichten zur Wissensteilung und spontanen Ordnung sowie sein Verfassungsmodell relevant, die er zwar mit Blick auf die Nationalstaaten entwickelt hat, die aber auch auf die Europäische Union übertragen werden können.
Eine sich nach diesen Einsichten von unten dynamisch entwickelnde EU würde dem Wissensproblem und dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend einen allgemeinen abstrakten Regelrahmen für die ausführende Staatsgewalt setzen, der diese von den anderen Staatsgewalten schärfer trennt und stärker begrenzt. Die nicht auf Einzelfälle beschränkten, universalisierbaren Regeln sind der Kern von Hayeks konstitutionenökonomischem Versuch, die Demokratie durch Gewaltentrennung und Selbstbindung der Staatsorgane mit dem Liberalismus in Einklang zu bringen.10
In der Verfassungsrealität der westlichen Demokratien bemängelte Hayek die stetige Vermischung der Legislative und der Exekutive, mit der auch die Unterscheidung zwischen echten, allgemeinen Regeln und einer Vielzahl von ebenfalls über Gesetze erlassenen Befehlen verschwimme. Seinen Verfassungsentwurf sieht Hayek nicht als eine Konstruktion an, die mit einem Schlag – revolutionär – die bestehende Ordnung ersetzen soll. Vielmehr sieht er darin einen Idealzustand, an dem wir uns orientieren können, um unsere Verfassung behutsam und Schritt für Schritt – evolutionär – verbessern.
Ludwig von Mises
In seinem Buch Liberalismus widmete Ludwig von Mises den „Vereinigten Staaten von Europa“ und der paneuropäischen Idee ein eigenes Kapitel. Mises bekannte sich dort als Bewunderer der Vereinigten Staaten von Amerika und ihrem freien kapitalistischen System. Deshalb könnte man annehmen, Mises sei auch ein Anhänger der europäischen Einigungsidee gewesen, doch er zeigte eine große Skepsis gegenüber den paneuropäischen Vorstellungen seiner Zeit.
Mises’ Skepsis speiste sich insbesondere aus der Vorstellung der Paneuropäer, die bis heute die Debatte über die europäische Integration bestimmen. Damals wie heute wurde argumentiert, dass die einzelnen europäischen Staaten zu klein und schwach seien, um allein im Wettbewerb mit den aufstrebenden Mächten in anderen Teilen der Welt konkurrieren zu können. Damals wie heute wurden Russland, China und die USA als Mächte genannt, mit denen Europa gleichziehen müsste. Eine europäische Einigung mit dem Ziel, Weltmachtpolitik zu betreiben, lehnte Ludwig von Mises jedoch ab.
Er kritisierte: „Paneuropa soll größer sein als die einzelnen Staaten, die in ihm aufgehen werden, es soll mächtiger sein als diese und daher militärisch leistungsfähiger, besser geeignet, den Großstaaten England, Vereinigte Staaten von Amerika und Russland Widerstand zu leisten. An Stelle des französischen, des deutschen, des magyarischen Chauvinismus soll der europäische treten.“11