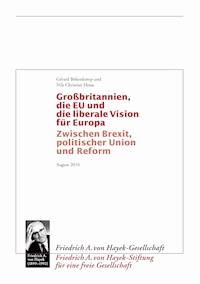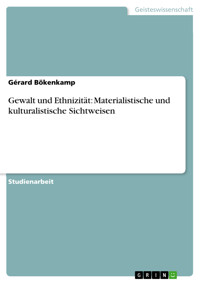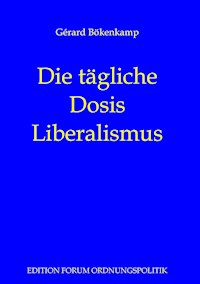
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vom Wert des Liberalismus zeugt der Strom der Beiträge, die der Publizist Gérard Bökenkamp auf dem Blog des Liberalen Instituts „Denken für die Freiheit“ veröffentlicht hat. Einige lesenswerte sind in diesem Band versammelt, vor allem zu Politik, Wirtschaft, Ideengeschichte und einer freien Gesellschaft. "Keine Gruppe hat das Recht in die Lebenswelt der anderen Gruppe durch Repressionen einzugreifen, solange die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe freiwillig ist und das Recht sie auch wieder zu verlassen gewährleistet ist. Das Eigentumsrecht bedeutet, dass jeder seinen Lebensstil selbst finanzieren muss. Die Problemlösung in kleinen, auf freiwilliger Zugehörigkeit beruhenden Gruppierungen ist letztlich nichts anderes als die konsequente Umsetzung der Subsidiarität." Gérard Bökenkamp
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Politik
Die FDP im Parteiensystem der Bundesrepublik
Geschichtsphilosophie: Die Politik und ihre Grenzen
Aufsichtsrat: Kein Experimentierfeld für Gesellschaftspolitik
Schutz der Meinungsfreiheit: Deutschland und USA im Vergleich
Umverteilungspolitik und Macht
Mitfühlender Liberalismus als Alternative zur Umverteilung
Liberalismus nach dem 11. September
Der Weg in die staatlich kontrollierte Quotengesellschaft
Die Krise des politischen Liberalismus: Zwischen zwei Mühlsteinen
Liberalismus als Buhmann
Über die Schwierigkeiten der Liberalen in der Regierung
Otto Graf Lambsdorff 1926-2009 – Der „Marktgraf“. Nachruf auf einen herausragenden Wirtschaftspolitiker
Wirtschaftspolitik
Japan und die Abenomics: Keynesianismus von rechts
Keynes auf Japanisch: Ein verlorenes Jahrzehnt
Krise von 1929 und 2007: Hoover und Bush waren Interventionisten
Der Mythos vom wohltätigen Exportüberschuss
Schuldenkrise: Inflation, Deflation oder dauernde Stagnation?
Demographie ist zu komplex für Bevölkerungspolitik
Massenproteste und Konsolidierung: Bequeme Reformen gibt es nicht
Die monetaristische Revolution
Ideengeschichte
Sigmund Freud und Ludwig von Mises
Wilhelm von Humboldts Liberalismus
Irving Fisher vs. Ludwig von Mises: Wer sah den Crash von 1929 voraus?
Hayeks Argumente gegen Keynes
Die Wiederentdeckung von Hayeks Konjunkturtheorie
Ludwig von Mises vs. Murray Rothbard: Praxeologie oder Naturrecht?
Ludwig von Mises, Geschichte und Thymologie
Die Sozialphilosophie von Ludwig von Mises
Walter Eucken und die Soziale Frage
Walter Eucken über die Zentralverwaltungswirtschaft
Wilhem Röpkes Warnung vor dem Superfiskalismus
Interdependenz der Ordnungen
Max Webers Betrachtung über Märkte
Walter Euckens Antwort auf die Frage: Wie frei ist Wirtschaftspolitik?
Ralf Dahrendorf: Der „skeptische Europäer“
Ralf Dahrendorf über die Frage: Was ist Populismus?
Wilhelm Röpke und die europäische Wirtschaftsordnung
Liberale Sozialpolitik: Ralf Dahrendorf und Milton Friedman
Als sich der Meister vom Magier blenden ließ: Milton Friedman und Alan Greenspan
Die Geschichte der Österreichischen Schule der Nationalökonomie
Politikökonomische Theorie
Gary Becker: Eine Gebühr für das Recht auf Einwanderung
Währungswettbewerb: Lag Hayek falsch?
Politische Ökonomie des Mindestlohns
Quotenregelungen sind Diskriminierung von Individuen
Finanztheorie: Risiko und Streuung
Die Weltwirtschaftskrise und das „Österreichisch-Monetaristische-Interventions-Modell“
Historische Empirie
Free Banking in Schweden 1830-1903: Ein historisches Erfolgsmodell?
Arbeitslosigkeit in Deutschland – Entstehung und Entwicklung kurz erzählt
Griechenland ist wie Großbritannien nach der Rückkehr zum Goldstandard 1925
Freie Gesellschaft
Die Katholische Kirche in der pluralistischen Gesellschaft
Meinungsfreiheit ist weniger geschützt als Religionsfreiheit
Was ist Religionsfreiheit?
Es darf keine Meinungs- und Glaubensmonopole geben
Papst Benedikt und das Kirchenpapier der FDP von 1974
Pluralismus in einer freien Gesellschaft
Religion und Freiheit
Der Autor
„Das Ende des Wirtschaftswunders“
Der Herausgeber
Forum Ordnungspolitik
Vorwort
Vom Wert des Liberalismus zeugt der Strom der Beiträge, die der Publizist Gérard Bökenkamp auf dem Blog des Liberalen Instituts „Denken für die Freiheit“ veröffentlicht hat. Der Berliner Historiker ist ein dezidiert politischer Kopf mit strategischem Blick, der sich für eine pluralistische Gesellschaft einsetzt, für Denken in Freiheit und Vielfalt – vielfach gegen den Mehltau der herrschenden Meinung. Eine Fülle von Vorträgen und Publikationen sowie die nachfolgenden ausgewählten Blogbeiträge sind Ausdruck seines Engagements.
Beispielhaft kommt seine Haltung in einer Begebenheit zum Ausdruck, die mir Gérard Bökenkamp wie folgt schilderte: Er sei im altem West-Berlin direkt an der Mauer aufgewachsen, die von der DDR-Führung als antiimperialistischer Schutzwall bezeichnet wurde. Die Mauer teilte die Straße und über die Straße führte die S-Bahnbrücke. Von dort aus konnte man über die Mauer in den Ostteil der Stadt blicken. Auf der einen Seite war das freie Berlin, auf der anderen Seite der Sozialismus – mit Todesstreifen, Wachtürmen und Stacheldraht. „Ich war neun Jahre alt als die Mauer fiel, die Stimmung war unbeschreiblich euphorisch. Plötzlich war die Mauer nicht mehr da, und ich erinnere mich, wie wir mit der Schulklasse direkt unter der S-Bahnbrücke standen, hinter der sich die Mauer geöffnet hatte. Lange Autokolonnen von Trabanten und Scharen von Bürgern strömten hindurch und wurden von uns begeistert begrüßt.“ Gérard Bökenkamps Eltern gehörten zu den ersten, die nach dem Fall der Mauer mit dem Auto in das bisherige DDR-Territorium, das Berliner Umland, fuhren. „Vom Rücksitz des Wagens aus konnte ich die verfallenen Dörfer sehen, heruntergekommene Altstädte, triste Plattenbauten und Industrieruinen. Meine Eltern verglichen das damals mit der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg.“ Die unmittelbare Anschauung zeigte Gérard Bökenkamp unverstellt, dass der Sozialismus nicht wie behauptet funktioniert, sondern marode Landschaften hinterlässt, während die Menschen, die in ihm leben müssen, vor allem ein Ziel haben: aus ihm zu flüchten.
Freiheitsfeindliche, menschenverachtende Systeme wie das SED-Regime der DDR zeigen besonders eindringlich und zeitlos, welche Bedrohungen einer freien Gesellschaft zusetzen können. Stets geht es allerdings nicht nur um die abstrakte Gesellschaft, sondern das konkrete Schicksal einzelner Menschen; Ordnungen und Systeme bleiben als Konstrukte recht abstrakt. Zugleich wird deutlich wie wichtig eine Ordnung der Freiheit für den Alltag eines jeden Menschen ist.
Grundlage einer Ordnung der Freiheit ist konsequent liberales Denken und Handeln sowie ein kritischer Blick auf verbreitete Annahmen und Behauptungen. Die nachfolgenden Beiträge sind Ausdruck einer liberalen Skepsis und entstammen so unterschiedlichen Bereichen wie Wirtschaftspolitik, Theorie politischer Ökonomie, deutscher Politik und Ideengeschichte. Sie sind entstanden im Liberalen Institut, dem Think Tank der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, das selbst ein Hort des Pluralismus ist. Alle Texte wurden im Blog „Denken für die Freiheit“ veröffentlicht und liegen nachfolgend in sanft überarbeiteter Fassung als eine Fundquelle für Wissenswertes zur Freiheit vor.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre, wohin auch immer Sie den Band mitnehmen. Er passt in jede (Reise)Tasche. Klug wird man bekanntlich nicht durch das Lesen, sondern durch Nachdenken über das Gelesene. Ich wünsche mir, dass die Gedanken Zugang zu möglichst vielen Köpfen finden. Eine Fortsetzung mit anderen Autoren in der mit Uwe Timms „Briefe an die Welt“ begonnenen Reihe freiheitlicher Gegenwartspublizistik für jedermann ist geplant.
Berlin, im Mai 2014
Michael von Prollius
Politik
Die FDP im Parteiensystem der Bundesrepublik
Im Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung (20. Jahrgang 2008) untersucht die Historikerin Marie-Luise Recker die Rolle der FDP und der kleineren Parteien in der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik weist bis heute ein bipolares Parteiensystem auf, bestehend aus zwei großen Volksparteien und ihren Koalitionspartnern. Das war nicht von Anfang an so. Bei der ersten deutschen Bundestagswahl 1949 zogen insgesamt 10 Parteien in den Bundestag ein.
Die rechts- und linksradikalen Parteien wie die SRP, die NPD und KPD bzw. die DKP blieben trotz sporadischer Wahlerfolge eine Randerscheinung. SRP und KPD wurden verboten, nachdem sie jedoch politisch ohnehin gescheitert waren. KPD und DKP konnten in der Polarisierung des Kalten Krieges nur eine Außenseiterposition einnehmen. Rechtsradikale Parteien blieben kurzfristige Protestphänomene. Recker schreibt: „Insgesamt verfügte und verfügt der parteipolitisch organisierte Rechtsextremismus in der Bundesrepublik über keine geschlossene sozialmoralische oder ideologische Gruppe in der Wählerschaft, auf die er sich stützen könnte.“
Daneben gab es eine Reihe kleiner bürgerlich-konservativer Parteien: Die Bayernpartei, die Zentrumspartei, die Deutsche Partei, der Südschleswigsche Wählerverband und der Blog der Heimatvertriebenen und Entrechteten. Recker rechnet in dieser frühen Phase der Bundesrepublik auch die FDP dieser Gruppe von Parteien zu. Die Deutsche Partei, die Zentrumspartei und die Bayernpartei wurden von der CDU und CSU marginalisiert. Der Versuch von DP und BHE durch Fusion zu einer eigenständigen Kraft aufzusteigen, scheiterte. Bei den Wahlen 1961 erhielten sie 2,8 Prozent der Wählerstimmen.
Der CDU gelang es die unterschiedlichen Strömungen zu integrieren und damit ihre politischen Konkurrenten überflüssig erscheinen zulassen. Die Popularität Adenauers und die Erfolge der Außenpolitik sowie der sozialen Marktwirtschaft trugen wesentlich dazu bei. Der FDP gelang es als einziger der kleineren bürgerlichen Parteien sich diesem Sog zu entziehen und ihre Eigenständigkeit zu wahren. Das gelang ihr, indem sie sich deutschlandpolitisch stärker von der CDU/CSU und wirtschafts- und sozialpolitisch von der SPD abgrenzte, zugleich aber mit beiden Parteien koalitionsfähig wurde.
Während die FDP in den fünfziger Jahren eine unter vielen bürgerlichen Parteien war, wurde sie in den sechziger Jahre im Dreiparteien-System zum „Zünglein an der Waage.“ Ihre neue Rolle in der Bundesrepublik war die des Juniorpartners und des politischen Korrektivs. Das ermöglichte ihr, eine Schlüsselposition im Parteiensystem der Bundesrepublik zu spielen. Diese Sonderrolle der FDP als Königsmacher des bundesdeutschen Parlamentarismus wurde jedoch durch das Aufkommen der Grünen als vierte Kraft im Bundestag beendet.
An die Stelle des Dreiparteiensystems trat fortan ein bipolares Parteiensystem mit einem bürgerlichen Lager aus CDU/CSU und FDP und einem linken Lager aus SPD und Grünen. Mit der Wiedervereinigung wurde das Parteiensystem der Bundesrepublik noch komplizierter, da sich nun die Nachfolgepartei der SED, die PDS, auch auf Bundesebene etablieren konnte. Ob sich dieses Fünfparteien-System aus zwei bürgerlichen und drei linken Parteien dauerhaft behaupten kann, wird die Zukunft zeigen.
Literatur:
Marie-Luise Recker: Kleine Parteien im Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland; in: Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung, 20. Jahrgang, Baden Baden 2008, S. 13 ff.
Veröffentlicht am 22. April 2013
Geschichtsphilosophie: Die Politik und ihre Grenzen
Politik und Politiker sind die Projektionen für Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte und Ängste. In der Regel erwarten wir von der Politik zu viel. Die Grenzen des politischen Handelns sind die Grenzen des allgemeinen kulturellen Konsenses. In den USA wird kein Atheist Präsident, in Deutschland wird niemand Kanzler, der den Wohlfahrtsstaat grundsätzlich ablehnt. Es ist nicht wahrscheinlich, dass ein Politiker, der auch noch so guten Willens sein mag, in einem Land, in dem eine große Mehrheit der Bevölkerung die Steinigung von Religionsabweichlern fordert, die Religionsfreiheit nach westlichem Vorbild einführt oder in einer Kultur des Imperialismus eine Politik des Ausgleichs und der Verhandlungen umsetzt. Ein lockeres Scheidungsrecht in einer streng katholischen Gesellschaft zu verwirklichen ist ebenso schwierig, wie ein religiös begründetes Familienrecht in einer säkularen Gesellschaft.
Die Umsetzung einer bestimmten politischen Agenda gegen die herrschenden intellektuellen Strömungen und den allgemeinen kulturellen Konsens erfordert eine Machtvollkommenheit, die – zum Glück – selten ein Politiker in seinen Händen konzentriert. Helmut Kohl wurde von konservativer Seite oft dafür kritisiert, dass er seine Ankündigung einer geistig-moralischen Wende nicht erfüllt habe. Dabei wird aber übersehen, dass es nicht konservative Graswurzelbewegungen waren, die die Plätze füllten und die Debatten beherrschten, sondern die neuen sozialen Bewegungen der Linken. Die Erwartung, dass Politiker und Parteien diese Debatten steuern und den Zeitgeist nach Belieben ändern oder ignorieren können, entspricht einer Überhöhung des Politischen und einer Dämonisierung oder Verherrlichung von Politikern. Dies ist im Grunde ein Geniekult, der unterstellt, jemand könne Luther und Karl V. in einer Person sein.
Bismarck hat die reale Rolle von Politikern einmal treffend auf den Punkt gebracht: Wenn der Mantel Gottes durch die Geschichte wehe, müsse man zuspringen und ihn festhalten. Bismarck wusste, wovon er sprach. Der Kanzler der Reichseinigung hatte noch zu Zeiten der 1848er Revolution (der bürgerlichen Einheits- und Unabhängigkeitserhebungen in Europa) die Forderung nach der nationalen Einigung als „nationalen Schwindel“ bezeichnet. Dass er sich schließlich eines anderen besann, lag daran, dass die Nationalbewegung zu stark geworden war und er sie nicht mehr außer Acht lassen konnte. Starke Politiker sind wie Surfer, sie lassen sich geschickt auf einer Welle nach oben tragen, die sie selbst aber nicht verursachen können.
Die politische Kultur eines Landes steht in einer Beziehung zu seiner sozioökonomischen Basis. Bauern haben in der Regel eine andere Kultur und andere Ansichten über die Welt als Großstädter und Fabrikarbeiter. Hausfrauen sehen die Welt anders als leitende Angestellte usw. Für Kulturänderungen spielt Demographie eine wichtige Rolle. Wenn zum Beispiel die Basis einer Partei aus Landwirten besteht, dann werden Industrialisierung und Schrumpfen der Landbevölkerung ihren politischen Rückhalt schwächen. Wenn die Zahl der Selbstständigen zurückgeht und die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst zunimmt, dann hat das Auswirkungen auf die Anziehungskraft einer liberalen Partei, die sich vor allem auf Selbstständige stützt. Ähnlich verhält es sich beim Rückgang der Zahl der Industriearbeiter für die Sozialdemokraten oder der Kirchenmitglieder für die Christdemokraten.
Die politische Kultur ist mehr als nur der Überbau einer sozioökonomischen Basis wie Marx glaubte. Es gibt allerdings Wechselwirkungen zwischen beiden. Ein mittelalterliches theologisches Weltbild ist den Menschen einer modernen Dienstleistungsgesellschaft kaum mehr zu vermitteln. Zudem fördern und behindern Weltbilder auch Entwicklungen der ökonomischen Basis.
Die Spielräume der Politik werden nicht nur durch die ökonomischen, soziokulturellen und ideengeschichtlichen Rahmenbedingungen bestimmt, sondern auch durch die geopolitischen Rahmenbedingungen. Die Bewohner eines Landes, die sich von außen bedroht fühlen, werden andere politische Entscheidungen treffen und anderen Ideen gegenüber aufgeschlossen sein als Menschen in einem Land, das im tiefsten Frieden lebt. Internationale Verträge, Bündnisse und Abkommen schränken die Entscheidungsspielräume der nationalen Politik ein. Schließlich gibt es zwischen Frieden und Krieg ein ganzes Spektrum unterschiedlicher Möglichkeiten, um Druck auf eine Regierung oder die Bewohner eines Landes auszuüben.
In der Geschichtsphilosophie gab es zwei große Strömungen: Die Deterministen und die Voluntaristen. Für die einen ist die Geschichte determiniert, also festgelegt durch unabänderliche ökonomische, soziologische und kulturelle Gesetzmäßigkeiten. Für die anderen ist die Geschichte bestimmt durch den Willensakt großer Männer und ihre Pläne und Ideen. Friedrich August von Hayeks Ansatz, der eine eigene Geschichtsphilosophie beinhaltet, lautete: Die Gesellschaft sei das Ergebnis menschlicher Handlung, nicht aber menschlicher Planung. Politisches Handeln sei mit unbeabsichtigten Konsequenzen verbunden. Zwar würden Menschen handeln und ihr Handeln würde zu einem Ergebnis führen. Das Ergebnis könne aber ein ganz anderes sein, als es die Handelnden mit ihren Plänen eigentlich bezweckten.
Veröffentlicht am 25. Januar 2013
Aufsichtsrat: Kein Experimentierfeld für Gesellschaftspolitik
Bevor man sich über die Frauenquote unterhält, muss man sich über einige grundlegende Fragen Klarheit verschaffen. Die erste Frage lautet: Wem gehört ein Unternehmen? Im Sozialismus gehört ein Unternehmen dem Staat. Wenn der Staat das Unternehmen führt, dann ist klar, dass der Staat auch die Personalpolitik bestimmt. In einer Marktwirtschaft gehört ein Unternehmen dem Privateigentümer.
Eigentümer und Anleger haben ein überragendes Interesse daran, dass das Unternehmen dauerhaft Gewinne erwirtschaftet. Wenn das Unternehmen abwirtschaftet, dann sind es ihre Aktien, die an Wert verlieren und damit in vielen Fällen ihre Altersvorsorge. Das große Problem ist, dass sich die Interessen der Manager und der Institutionen des Unternehmens immer mehr von den Interessen der Eigentümer entfernt haben. Dem liegt der historische Prozess zu Grunde, dass die Verbindung zwischen dem haftenden Unternehmer und dem Vorstand und Aufsichtsrat immer dünner geworden ist und immer mehr politisiert wurde.
Die Forderung nach einer Frauenquote für den Aufsichtsrat ist eine neue Stufe der Politisierung des Aufsichtsrates, die darauf hinweist, dass die Bedeutung dieses Gremiums inzwischen als so gering erachtet wird, dass es als Spielfeld gesellschaftspolitischer Experimente dienen kann.
Wenn es nach der Politik geht, dann würden sich alle möglichen, politisch ausgewählten Gruppen in den Aufsichtsräten tummeln. Jede kann mit guten Gründen angeben, dem öffentlichen Interesse zu dienen: Politiker, Umweltaktivisten, Kirchen und Ethikbeauftragte. Neben der Frauenquote kann man sich auch eine Quote für Ostdeutsche, für Migranten und Angehörige religiöser, ethnischer und sexueller Minderheiten, für Behinderte, Väter und Mütter und Abkömmlinge aus sozial unterprivilegierten Schichten vorstellen. Die Frage ist aber, ist das sinnvoll?
Was ist überhaupt der Sinn eines Aufsichtsrates? Ein Eigentümer geführtes Unternehmen, bei dem der Eigentümer und der Leiter des Unternehmens identisch sind, braucht keinen Aufsichtsrat. Aufsichtsräte wurden historisch dann relevant, als Aktiengesellschaften auf den Plan traten und die Leitung der Firma nicht mehr in den Händen der Privateigentümer lag, sondern das Unternehmen von Managern im Auftrag der Eigentümer, also der Aktionäre, geführt wurde.
Da von Anfang an das Problem bestand, dass die Interessen des Managers, der als leitender Angestellter einer anderen Handlungslogik folgt als der Eigentümer, wurde der Aufsichtsrat eingerichtet, um die Manager kontrollieren und die Interessen der Eigentümer des Unternehmens wahren zu können. Die zentrale Frage unserer Zeit lautet, wie man die Vorstände und Aufsichtsräte wieder stärker an die Interessen und den Willen der Aktionäre binden kann – sie lautet aber gerade nicht, wie man den Einfluss von Politikern auf die Personalpolitik eines Unternehmens vergrößern kann.
Im Aufsichtsrat sollen also Vertrauensleute der Eigentümer sitzen, die der Unternehmensführung auf die Finger schauen. Es ist nicht die Aufgabe eines Aufsichtsrates Gesellschaftspolitik zu betreiben, Männern oder Frauen zu ihrem Traumjob zu verhelfen oder bei der Karriereplanung zu unterstützen.
Veröffentlicht am 25. September 2012
Schutz der Meinungsfreiheit: Deutschland und USA im Vergleich
Immer wieder irritiert, dass in den USA Meinungen und Positionen als selbstverständlich nicht nur hingenommen, sondern ausdrücklich durch das Recht geschützt werden, die in Deutschland strafrechtlich verfolgt werden können. Warum das so ist wird klar, wenn wir die Bestimmungen des deutschen Grundgesetzes mit dem ersten Zusatzartikel der Verfassung der USA vergleichen, der dort die Meinungsfreiheit schützt.
Das deutsche Grundgesetz führt zur Meinungsfreiheit aus:
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
Im Vergleich dazu lautet der erste Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika:
„Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Staatsreligion zum Gegenstand hat, die freie Religionsausübung verbietet, die Rede- oder Pressefreiheit oder das Recht des Volkes einschränkt, sich friedlich zu versammeln und die Regierung um die Beseitigung von Missständen zu ersuchen.“
Bewertung:
Das deutsche Grundgesetz stellt ausdrücklich heraus, dass die Meinungsfreiheit durch die allgemeinen Gesetze ihre Schranken findet. Diese Schranken dürfen zwar nicht willkürlich gesetzt werden, aber es dürfen ausdrücklich Schranken durch den Gesetzgeber gesetzt werden. Die Verfassung der USA geht in ihrem Schutz der Rede- und Pressefreiheit viel weiter. Hier ist es dem Gesetzgeber ausdrücklich verboten, der Rede- und Pressefreiheit Schranken zu setzen.
Das ist nicht nur ein gradueller Unterschied, das ist ein fundamentaler Unterschied! In den USA gehört das Recht auf Redefreiheit vom Selbstverständnis her unveräußerlich zur Person, in Deutschland wird Recht hingegen gewährt und kann bei Bedarf zurückgezogen werden. Das spiegelt sich in der Häufigkeit wieder, in der in Deutschland das Verbot und die Einschränkung der Meinungsfreiheit gefordert werden, selbst wenn dies in den meisten Fällen folgenlos bleibt. Das Beispiel Meinungsfreiheit zeigt, wie eine Rechtstradition die politische Kultur eines Landes prägt.
Veröffentlicht am 20. September 2012