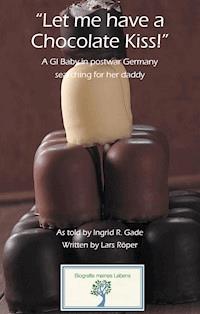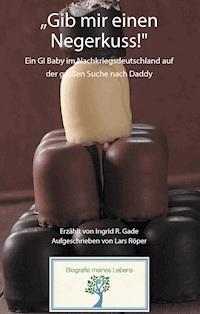
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Ein Negerkind“. Ich. Ingrid. Eine Katastrophe. „Der Bastard muss weg!“ Das riefen sie meiner Mutter am 12. November des Jahres 1946 entgegen: „Das Negerkind muss weg!“ Mutter gab mich weg. Meine Odyssee durch eine Pflegefamilie und die Kinderheime im Nachkriegsdeutschland begann. Wie sehnte ich mich nach Liebe. Und nach Daddy. Würde ich ihn jemals finden? Ingrid R. Gade ist ein GI Baby. Ihre Geschichte ist eine wahre Geschichte. Es ist eine unglaubliche Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 - „Der Bastard muss weg!“
Kapitel 2 - Mutti in Marienwerder
Kapitel 3 - Muttis Flucht nach Geislingen/Steige
Kapitel 4 - Mutti und Vati
Kapitel 5 - „Martha, versündige dich nicht an dem Kind!“
Kapitel 6 - „Sophianer sind wir!“
Kapitel 7 - Wir „Brown Babies“
Kapitel 8 - Rock ’n’ Roll im „Krüppelheim“ & „Memories of Heidelberg“
Kapitel 9 – Ausbildung und „Ausflüge“
Kapitel 10 - „Mutti“
Kapitel 11 - Auf Händen getragen
Kapitel 12 - Daddy
Nachwort
Ein kleiner Zusatz
Verweise
Kapitel 1 - „Der Bastard muss weg!“
Nur wenige Stunden nach meiner Geburt am 12. November 1946, einem Dienstag, klingelte auf der Entbindungsstation in Kirchheim unter Teck das Telefon. Die stolze Industriellenfamilie Schabel, Eigentümerin der Eisengießerei und Maschinenfabrik Schabel im benachbarten Geislingen (Steige), kündigte ihren Besuch an. Das Neugeborene möchte man sehen.
Familie Schabel kam pünktlich. Allen voran der Vater, Wilhelm Schabel, seine Frau Anna Katharina Babette Schabel, geborene Kröner, sowie der Sohn Werner und sein jüngerer Bruder Günther nebst Frau. Allesamt waren sie wohl stolze Nationalsozialisten gewesen, begeistert von Hitler, dem Dritten Reich und der weißen Herrenrasse. Blumen und Pralinen in den Händen, öffneten sie die Tür mit der neugeborenen Ingrid dahinter. Sicher hatte es während der Wochen vor der Geburt bereits schwere Diskussionen gegeben und allesamt waren die Schabels sehr aufgewühlt. Denn Werner Schabel und meine Mutter Brunhilde Gade waren lediglich verlobt. Und jetzt ein Kind! Das galt als ehrenrührig.
All dies aber war sicher nichts gegen die Aufregung, die jetzt losbrach.
Familie Schabel betrat das Zimmer, schloss die Tür hinter sich, schritt auf das Wochenbett zu, in welchem zwischen weißen Decken Mutter lag. Im kleinen Gitterbettchen daneben, ich,
braune Hautfarbe,
schwarze Kringellocken.
Ein „Negerkind“.
Ich. Ingrid. Eine Katastrophe.
„Der Bastard muss weg.“ Das riefen sie. Das riefen die Schabels an diesem 12. November 1946 meiner Mutter entgegen: „Das Negerkind muss weg!“
Und sie waren sich einig darin.
Gleich am nächsten Tag übergab Mutti mich dem Jugendamt. Einen einzigen Tag erst war ich auf dieser Welt, da begann bereits meine unendlich schmerzhafte Odyssee durch Heime und eine Privatpflege.
Wie würde ich mich nach meiner Mutter sehnen und einem Leben als blondes Mädchen im blonden Nachkriegsdeutschland.
Meine Haut aber ist braun, meine Haare krauslockig. Deshalb werde ich mich nach meinem Vater in den USA sehnen, einem Leben unter Gleichgesinnten im Land der Freiheit, von dessen Rassentrennung ich lange nichts wusste. Was für ein hilfloses Sehnen nach Daddy sollte das werden. Mein Vater war für mich ein namenloser Afroamerikaner in New York, der damals mit 12,5 Millionen Einwohnern größten Stadt der Welt. Wie sollte ich ihn jemals finden?
Ich, „Jngrid R. Gade“, wie es versehentlich auf meiner Geburtsurkunde mit der Nr. 476/1946 heißt, bin die Tochter von Brunhilde Margot Gade, ohne Beruf, evangelisch, wohnhaft in Geislingen an der Steige in Baden Württemberg, unweit von Stuttgart. Der Eintrag eines Vaters ist auf diesem E2-Vordruck nicht einmal vorgesehen. Vom ersten Tag an galt ich als: vaterlos.
Es gab wohl kaum ein Lebewesen, das man in diesem noch voller Nazis steckenden, zerstörten Nachkriegsdeutschland weniger wollte, als ein schwarzes Kind. Ein kleines, doch unübersehbares Zeichen der Kapitulation, ein Kind des verlorenen Krieges, ein Besatzungskind.
Wie aber kam es dazu, wo es Mutti doch gelungen war, eine Verlobung mit dem finanziell überaus gut gestellten, eleganten Industriellensohn Werner Schabel zu feiern?
In meinem Besitz befindet sich seit Muttis Tod ein Foto, das sie mit mir auf dem Schoß wohl im Jahre 1947 zeigt. Ich bin damals etwa fünf Monate alt und aus Muttis Gesicht, ihrem wie nach innen gekehrten Blick, den beinahe zu kraftvoll nach hinten gebürsteten Haaren und ihren verkniffenen Augen spricht für mich nicht nur das nach meiner Geburt über sie gekommene Entsetzen, „Der Bastard muss weg!“, sondern das gesamte Grauen, das sie in den vergangenen zwei Jahren und seit ihrer Flucht vor den anrückenden russischen Soldaten aus Marienwerder bei Danzig erlebt haben musste.
Ihr Gesicht scheint mir beinahe wie noch erfroren von der viele Tage langen Flucht in Viehwaggons durch den deutschen Winter 1945 aus diesem Hause, das Mutti, zu damaliger Zeit bereits am Bodensee lebend, im Juni 1979 noch einmal besuchte und fotografierte: Das Haus ihrer Kindheit und Jugend in Marienwerder, dem heute polnischen Kwidzyn, fünf Kilometer von der Weichsel entfernt am Fluss Liwa (Liebe).
Kapitel 2 - Mutti in Marienwerder
Der Landkreis Marienwerder mit der gleichnamigen Kreisstadt war von 1939 bis 1945 dem Reichsgau Danzig-Westpreußen zugeordnet, durch das sich als beinahe vertikales Rückgrat die Weichsel zieht, jener Fluss, der für die Flucht aus Ostpreußen zum katastrophalen Nadelöhr werden und Marienwerder sowie die nahe Weichselbrücke mit Flüchtlingen überschwemmen würde.
Dabei wirkt es, als hätte die überaus beeindruckende und Marienwerder optisch beherrschende Ordensburg, dieses Wunderwerk großer Backsteinbauten der Ordensgotik vom Beginn des 14. Jahrhunderts, die Stadt gegen jegliche Front hätte sichern können.
Nachdem der Versailler Vertrag im Jahre 1919 einen Polnischen Korridor zur Ostsee und somit die Auflösung der Provinz Westpreußen zur Folge hatte, stimmte am 11. Juli 1920 die Bevölkerung im Abstimmungsgebiet Marienwerder mit über 92 Prozent für den Verbleib bei Deutschland.
Der Polenfeldzug im Jahre 1939 gliederte das gesamte Westpreußen wieder in das Deutsche Reich ein, wobei im Mittelpunkt der nationalsozialistischen Besatzungspolitik die Germanisierung stand. Der Volksdeutsche Selbstschutz etwa, eine paramilitärische Organisation, die ihre Mitglieder hauptsächlich aus Angehörigen der deutschen Minderheit rekrutierte, war an 30.000 Morden an der polnischen und jüdischen Bevölkerung beteiligt.
Ein Blick in die Verwaltungsgeschichte der Stadt Marienwerder und auf damalige Einwohnerzahlen lässt einen erschrecken:
1933 - 15.548 Einwohner, davon 12.197 Evangelikale, 3.073 Katholiken, 23 sonstige Christen, 169 Juden
1939 - 19.723 Einwohner, davon 14.778 Evangelikale, 4.307 Katholiken, 122 sonstige Christen, 0 Juden
„0 Juden“ ist kein Rechtschreibfehler.
Mutti war im Jahre 1939 vierzehn Jahre alt.
Am 1. Mai 1925 wurde sie in Marienwerder geboren und wuchs dort an der Liebe gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Ursula und dem jüngeren Bruder Horst in gehobenen Verhältnissen auf.
Während Mutti die Realschule absolvierte, hatten ihre Geschwister das Gymnasium besucht. Vater Otto Paul Gade war als Justizobersekretär ein hochangesehener Beamter im Rathaus von Marienwerder. Er war ein begeisterter Nazi und, wie das stolz präsentierte Wappen des Deutschen Ordens auf seinem Oberarm zeigt, euphorisiert von einer germanischen Vormachtstellung im Osten, einem Deutschherrenorden in seiner Heimat an der Weichsel mit seinen wuchtigen Ordensburgen. Während die nationalsozialistische Führungselite hinsichtlich einer Vereinnahmung des Ordens für ihre Ziele geteilter Meinung war, wurde dessen Symbolik und Tradition gerade in Westpreußen von der Deutschnationalen Volkspartei nach den Versailler Verträgen, gerne und mächtig ausgespielt.
Am 15. Oktober desselben Jahres hatte Muttis Vater, Otto Paul Gade, als damaliger Militäranwärter vor dem Standesamt in Schirwindt, dem heutigen Kutusowo im Osten der Oblast Kaliningrad, die Buchhalterin Bertha Steffenhagen geheiratet.
Otto Paul Gade und seine Frau Bertha sollten drei Kinder bekommen; Ursula, geboren am 2. Februar 1922.
Meine Mutter Brunhilde, geboren am 1. Mai 1925, gestorben am 4. März 2008. Horst, geboren am 29. Juli 1928, gestorben am 1. Juli 2010.
Ihre Mutter Bertha Gade starb an Tuberkulose, als Mutti zehn Jahre alt war. Otto Paul Gade hat, um seine drei hier um ihn posierenden Kinder versorgt zu wissen, bereits im Jahre 1936 wieder geheiratet. Die Stiefmutter Gertrude Gade, geborene Bukowski, muss mit Brunhilde allerdings schlimm umgesprungen sein. Mehrfach hat Mutti das später erwähnt.
Auch ihre Schwester Ursula deutete das schwierige Verhältnis zwischen Brunhilde und ihrer Stiefmutter an und entfaltete in einem Gespräch auch jenes der beiden Schwestern. Demnach stand Mutti in starker Konkurrenz zu ihrer Schwester: Ursula war – wie man so sagt – „fixer“ und gescheiter und hatte wohl auch ein weitaus besseres Verhältnis zur „bösen“ Stiefmutter.
An diese hoch angesehene, innerlich aber wohl auch zerrüttete Beamtenfamilie in Marienwerder rückte im Herbst 1944 die Ostfront heran. Endlose Flüchtlingstrecks aus Ostpreußen zogen durch den Ort.
Im Januar 1945 mussten die Menschen dort ihre Häuser verlassen, die Stadt wurde evakuiert.
Einige Wochen später fanden die Soldaten der Roten Armee eine fast vollständig leere Stadt vor. Deshalb unzerstört, diente Marienwerder den Russen von März bis November des Jahres 1945 als Lazarettstadt. Es kam zu Plünderungen und Brandstiftungen, denen die Altstadt zum Opfer fiel. Tonnenweise Trümmersteine wurden als Baumaterial nach Warschau geschafft, um diese beinahe vollkommen zerstörte Stadt neu zu errichten. Schließlich wurde Marienwerder unter polnische Verwaltung gestellt. Es begann die Zuwanderung von Polen und Ukrainern.
Mutti hat über die Flucht aus ihrer Heimat mir gegenüber nie gesprochen. Glaubt man Zeitzeugen wie dem damals acht Jahre alten Heinz Bomke aus Groß Krebs, einem kleinen Ort im Kreis Marienwerder, muss diese Flucht während des eisigen Winters 1945 aber grauenvoll hart gewesen sein.
Erste Station war die Weichsel.
„Die Weichsel war zu dem Zeitpunkt zugefroren, und wir mussten über das Eis mit den Pferdefuhrwerken. Es war schon ein schrecklicher Anblick. Denn auf dem Eis lagen schon zerborstene Fahrzeuge, leere Kinderwagen, Koffer, Kisten. Das waren dann so die ersten Eindrücke. Und wir waren froh, als wir die Weichsel mit Mühe und Not passiert hatten.“
Die Gades waren, als es im Januar 1945 zur Evakuierung von Marienwerder kam, teils tot, teils in alle Winde verstreut.
Vater Otto Paul Gade war eingezogen worden, überlebte den Krieg. Anschließend sollte ihm Schlimmes widerfahren, wovon noch zu berichten sein wird.
Horst hatte sich freiwillig zur Wehrmacht gemeldet und kämpfte noch lange um Pommern. Er würde den Krieg überleben.
Ursula und ihre Stiefmutter flüchteten auf mir unbekannten Wegen nach Hamm in Nordrhein-Westfalen. Und Brunhilde?
Kapitel 3 - Muttis Flucht nach Geislingen/Steige
Mutti hatte, wie so viele Mädchen und junge Frauen ihrer Generation, den Weg der Arbeitsmaiden genommen: Von einem Dienstlager des Reichsarbeitsdienstes (RAD) ins nächste, von Osten immer weiter nach Westen. Sie gehörte dem „Arbeitsheer“ von Maiden an, die gerade in den letzten Kriegsjahren zunehmend die Aufgaben der Männer übernehmen mussten. „Bauern und Bauernsöhne verlassen das Dorf im feldgrauen Rock. Nun helfen die Arbeitsmaiden die Lücke füllen“, wie damalige Propagandabroschüren zelebrierten. Der Weltkrieg saugte die Menschen alle auf.
„Fröhliche Arbeit. Heil Hitler. Weggetreten“, wurden die Arbeitsmaiden von ihren Dienst-Führerinnen unter gehisster Hakenkreuzfahne an die Arbeit befohlen. Viele Frauen berichten heute oft noch voller Freude von diesem gemeinsamen „Ehrendienst am Deutschen Volke“ und können es immer noch singen, ihr Pflichtlied Nr. 5 des RAD, das Feierlied der Arbeit nach einem Text des Reichsarbeitsdienstleiters Thilo Scheller
„Gott, segne die Arbeit und unser Beginnen,
Gott, segne den Führer und diese Zeit.
Steh uns zur Seite, Land zu gewinnen,
Deutschland zu dienen mit all unsren Sinnen,
mach uns zu jeder Stunde bereit.“
Aber auch Freizeit gab es und Herr Justizobersekretär Otto Paul Gade stimmte, wie auf dieser Mitteilung vom 6. Juli 1944, einem unbeaufsichtigten Badespaß seiner Tochter Brunhilde gerne zu:
In einem Stapel von Feldpost, den ich nach Muttis Ableben erhielt, um ihn dann lange zu betrachten, finden sich einige Briefe und Dokumente, die erlauben, ihren Weg von Marienwerder nach Geislingen wenigstens skizzenhaft nachzuzeichnen. So ein Brief ihres Bruder Horst vom 12. Juni 1944 an das Reichsarbeitsdienstlager 5/252 Freudenthal im westpreußischen Rosenberg nur wenige Kilometer östlich von Marienwerder. „Brunhildchen“ habe es endlich geschafft, sie möge sich gut einleben und frei werden „vom Alpdruck“, schreibt ihr Bruder Horst, woraus sich schließen lässt, dass Mutti der Tyrannei der Stiefmutter im Zuhause in Marienwerder und davon hervorgerufenen Alpträumen als Arbeitsmaid endlich entrinnen wollte.
Wie für viele Mädchen und junge Frauen, muss sich auch für Mutti mit dem Eintritt in den Reichsarbeitsdienst ein großer Wunsch erfüllt haben.
Nicht weniger glücklich sieht ihre Schwester Ursula auf diesem Foto aus, das die beiden jungen Frauen in RAD-Uniform im Freudenthaler Lager zeigt.
Nur wenige Monate später jedoch ließ die anrückende Ostfront die Menschen zurückweichen und flüchten. So auch „Brunhildchen“, die ihre Familie schon bald aus den Augen verlor, wie diese Postkarte an ihren Bruder Horst deutlich macht, die Mutti, dem Poststempel zufolge am 16. Februar 1945 bereits aus dem südwestmecklenburgischen Neustadt-Glewe im Landkreis Ludwigslust-Parchim an den inzwischen unter der Adresse der Adolf-Hitler-Schule in Sonthofen lebenden Bruder verschickt hatte. Die Ordensburg Sonthofen mit der angeschlossenen Adolf-Hitler-Schule ist ein Bau der Superlative, war Nazi-Kaderschmiede und zum Kriegsende Lazarett. Horst aber scheint nicht als Verwundeter dort gewesen zu sein. Brunhilde hatte ihren Bruder noch unter der Feldpostnummer L 35388 bei der Luftwaffe (L) zu erreichen versucht. Mutti schrieb verzweifelt und vorwurfsvoll:
„Warum schreibst du nicht? Ich warte so sehr auf Post. Weisst du noch nichts von Papa und Uschi? Ich habe bis jetzt überhaupt keine Post erhalten.“
Horst antwortete auf die Karte am 1. März 1945 mit einem Brief:
„Von Ulla, Papa und Mutti habe ich auch noch keine Nachricht wer weiss wo die sind. Marienwerder ist ja nun auch schon lange weg. hoffentlich wird das bald wieder anders.“
Nach „Mutti“, wie Horst die Stiefmutter bezeichnete, hatte Brunhilde auf ihrer Karte nicht gefragt.
Das Deutsche Reich lag in seinen letzten Zuckungen. Muffi diente diesem Reich in mecklenburgischen RAD-Lagern als Arbeitsmaid, wie etwa in dem auf dem Entlassungsschein genannten Lager Neuhof bei Parchim. Sie muss damals fürchterliche Angst gehabt haben. Fürchterliche Angst, was nun werden würde. Würde Deutschland den Krieg verlieren? Wie weit waren die Russen bereits? Und die Amerikaner? Alle wussten, die Alliierten kommen immer näher. Wann muss ich flüchten? Wohin?
Mutti fand eine Antwort auf die letzte Frage.
Zu den Aufgaben der Arbeitsmaiden gehörte die Feldarbeit, das Hüten und die Versorgung von Kleinkindern, das Waschen von Wäsche, Reinigungsarbeiten, Kochen, Gartenarbeiten, im letzten Kriegsjahr war es üblich, etwa als Luftwaffenhelferinnen zur Wehrmacht abkommandiert zu werden. Mutti wird als Arbeitsmaid sicher einige der erstgenannten Tätigkeiten verrichtet haben.
Von einer Arbeit jedoch weiß ich sicher: Mutti hat in einem der von ihr besuchten RAD-Lager Pakete für die Frontsoldaten gepackt.
Wollkleidung war in solchen Paketen, Verbandszeug, Bücher, Schokolade, Kaffee. Solche Dinge legte Mutti in die sicher endlos vielen Kartons. Dabei muss ihr, geboren aus Angst, eine Idee gekommen sein.
Eines Tages fügte sie einem der Päckchen einen handgeschriebenen Hilferuf bei. Mutti hat es mir erzählt. Ihre Zeilen müssen etwa so gelautet haben:
„Wir müssen bald flüchten. Ich weiß nicht wohin. Habe keinen Menschen. Bitte helfen Sie mir. Brunhilde Gade / Arbeitsmaid.“
Das Päckchen wurde an die Front verschickt.
Der Zettel mit dem Hilferuf, der für Muttis weiteres Leben eine überaus bedeutende Rolle spielen würde, lag obenauf.
Und wurde gefunden.
Der Frontsoldat Werner Schabel erhielt das Päckchen, öffnete es, entnahm den Zettel, las diesen und antwortete postwendend.
Der Brief enthielt sicher einige aufmunternde Worte, vor allem aber eine Adresse in Geislingen an der Steige.
Nach Muttis „Reichsarbeitsdienst Entlassungsschein wJ“ verließ sie am 4. April 1945 das Lager bei Parchim. Am selben Tag warfen 33 amerikanische B-24 Bomber ihre Bomben über dem Fliegerhorst in Parchim ab, verfehlten diesen Luftwaffenstützpunkt der Wehrmacht aber größtenteils.
Mutti, in ihrem Entlassungsschein noch charmant mit „wJ“ für weibliche Jugend tituliert, muss sich eben dort im Westmecklenburgischen befunden haben, wo Anfang Mai 1945 die United States Army und die Rote Armee aufeinandergetroffen wären, hätte nicht die Konferenz von Jalta zuvor eine Demarkationslinie gezogen, die beide Truppen auseinanderhielt.
Monatelang müssen ununterbrochen Flüchtlingstrecks durch die Gegend gezogen sein. Außerdem Wehrmachtseinheiten, erst geordnet, dann in Gruppen, oder vereinzelte Soldaten.
Dennoch muss Mutti noch Glück in diesem Grauen gehabt haben. Wohl trat sie rechtzeitig, Anfang April ihre Flucht an.
Ihren auch als Fahrkarte für eine Fahrt dritter Klasse von Parchim nach Geislingen/Steige gültigen Entlassungsschein sowie die Adresse der Schabels in der Tasche, wird Mutti vermutlich wirklich einen Zug bestiegen haben.
Ob es ein Personenzug oder ein Güterzug war, mir ist es nicht bekannt. Die meisten Menschen allerdings flüchteten auf Güterwaggons, vollgestopft mit Menschen, voll von Angst und noch mehr Angst.
Am 8. Mai 1945 hörte das Schießen auf.
Der Krieg war vorbei.
Deutschland hatte kapituliert.
Mehr als 60 Millionen Menschen waren gestorben. Mein Großvater Otto Paul Gade, einstiger Volkssturm-Mann, galt als verschollen. 1964 wurde er offiziell für tot erklärt.
„Seit dem 6. April 1945 habe sie nichts mehr von ihm gehört“, teilt seine Witwe Gertrude Gade damals den Behörden mit. Meine Tante Ursula jedoch erzählte eine andere Geschichte: Vater sei nach Kriegsende aus einem Lager in Torgelow bei Stettin heimgekehrt und habe das Haus in Marienwerder wieder auftauen wollen. Russen hätten ihn im Keller des Hauses erschossen. Gertrude Gade und Ursula blieben im nordrhein-westfälischen Hamm, Horst und seine Frau Lore bauten ein Haus in Lüdingshausen und zogen dort ihre drei Kinder groß; meine Cousinen und meinen Cousin.
Mutti bewohnte im Mai des Jahres 1945 und noch weitere sechs Jahre eine Dachwohnung an dieser auf einem Bankbeleg der Volksbank Geislingen vermerkten Adresse in der Langen Straße 34.
Mein Vater hatte dieselbe Adresse.
Kapitel 4 - Mutti und Vati
Voller Heimweh und einsam lebte Mutti in der Dachgeschosswohnung in der Langen Straße 34 in Geislingen. Werner Schabel und Mutti hatten einen regen Briefaustausch und sich auf diesem Wege ineinander verliebt. Und gesund kehrte der Oberleutnant, ihr „geliebtes Wernerli“, wie es in den Briefen heißt, nach Kriegsende heim nach Geislingen. Dennoch sah sie ihn nur selten: ständige Dienstreisen mit der Bahn und viel Arbeit beim Umrüsten der Fabrik von der Waffenschmiede zur Maschinenfabrik, wie sich ihrem regen Schriftverkehr entnehmen lässt. Dass Werner Schabel damals liiert war, eine Standesheirat, um seine SS-Offizierslaufbahn und seinen Sold zu beflügeln, wusste Mutti lange nicht. „So viel habe ich heute an Dich denken müssen“, schreibt sie in einem nicht datierten und wohl auch nicht abgeschickten Brief an „Wernerli“ Schabel und gibt sich dann doch ihrem Heimweh hin:
„Warum kann ich nicht wenigstens mit Papa, Ursel oder Horst zusammen sein? Nie hätte ich geglaubt, dass ich mal solch Heimweh haben würde. Wie oft wünsche ich mir, dass alles wieder so wäre wie früher. Ich in Marienwerder, im Büro und zu Hause. Württemberg ist doch so anders als Westpreussen. Wenn ich dich immer hätte, Wernerle, wäre alles viel leichter.“