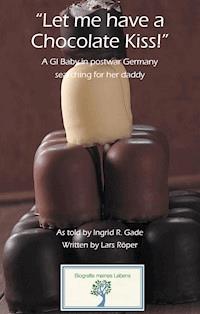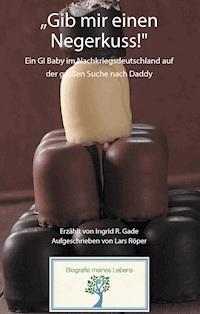Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Da kommen die Räuber“, raunte es wieder, während Bernhard und ich mit hintendrein rumpelndem Bollerwagen durch unser schlesisches Heimatdorf Ossig zogen. Ebenso hätten diese letzten im Dorf verbliebenen Menschen meinen Freund Bernhard und mich als „die Maulwürfe“ bezeichnen können, schließlich durchkämmten wir während unserer täglichen Suche nach Essen, Kleidung, Werkzeugen und Abenteuern nicht nur die hintersten Winkel aller leerstehenden Häuser des Dorfes, sondern gruben uns mit meinem Panzerspaten auch bis in die dunkelsten Löcher und ehemaligen Schützengräben hinein. Es sind die Jahre 1945 und 1946, von denen ich hier berichten möchte. Jahre unserer bitteren Flucht und Vertreibung, aber auch eine Zeit, in der unsere schlesische Heimat uns zum Abenteuerspielplatz wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet
meiner Mutter
Hildegard von Fritschen, geborene Seidel,
(1. März 1906 – 7. April 2003),
sowie meiner
Schwester Christa
(26. Oktober 1930 – 18. Februar 2016),
in Erinnerung daran,
wie wir gemeinsam
mit meinen weiteren Geschwistern
die alte Kaffeemühle
drehten
und all das
überlebten.
Gruß aus Ossig
„Da kommen die Räuber“, raunte es wieder, während Bernhard und ich mit hintendrein rumpelndem Bollerwagen durch unser schlesisches Heimatdorf Ossig zogen. Ebenso hätten diese letzten im Dorf verbliebenen Menschen meinen Freund Bernhard und mich als „die Maulwürfe“ bezeichnen können, schließlich durchkämmten wir während unserer täglichen Suche nach Essen, Kleidung, Werkzeugen und Abenteuern nicht nur die hintersten Winkel aller leerstehenden Häuser des Dorfes, sondern gruben uns mit meinem Panzerspaten auch bis in die dunkelsten Löcher und ehemaligen Schützengräben hinein. Es sind die Jahre 1945 und 1946, von denen ich hier berichten möchte. Jahre unserer bitteren Flucht und Vertreibung, aber auch eine Zeit, in der unsere schlesische Heimat Bernhard und mir zum Abenteuerspielplatz wurde. Ein Spielplatz mit auf Äckern und in Gräben verwesenden Menschen, übersät von Waffen, durchzogen von Krankheiten und Zerstörung, aber dennoch ein Abenteuerspielplatz. Ich betrat ihn mit einer klaren Mission.
„Junge, du musst auf deine Mutter und deine Geschwister aufpassen, es werden harte Zeiten auf euch zukommen“, hatte mein Vater Josef mich Anfang des Jahres 1945 vor seinem Abschied nach Dänemark ins Gebet genommen.
Mir wurden die Worte Befehl.
Mit neun Jahren sollte ich nun zum Mann im Hause, zum Versorger der Familie werden. Mit allem Grauen und Zauber, die damals dazugehörten. Ein ganzes Butterfass etwa fand ich, mit einem Fuß im qualligen Brustkorb eines Toten stehend.
„Mein Gott, wonach stinkst du denn, oh Gott, Klaus!“, rief meine Mutter und gleichzeitig leuchteten ihre Augen beim Anblick der Butter. Sie wusch mich, nahm mich in den Arm. Wie stolz ich war. Was wusste ich Junge denn schon vom Leben? Seit meiner Geburt am 7. Mai des Jahres 1935 war in meiner Erinnerung immer nur Krieg gewesen. So, wie ich es erlebte, musste das Leben wohl sein; mit all der Suche nach Nahrung, den Toten, den leeren Häusern voller „Schätze“ und Waffen, überall Soldaten, die deutschen und russischen, später tschechische und polnische Soldaten und Milizionäre. Was spielte das schon für eine Rolle? Uns Dorfkinder mochten sie wie ein Wunder ja alle irgendwie. Königlich aßen wir am Abend unser tägliches „Russenbrot“ mit meinem gehobenen Butterschatz, den wir verflüssigt und den Dreck abgefischt hatten. Wir sechs, meine Mutter Hildegard und meine vier blonden Schwestern
Renate, Christa, Gabriele und die kleine Mechthild, unser Nesthäkchen, das uns bald verlassen sollte. Die dunkelhaarige junge Frau auf dem Foto war unser Hausmädchen. Ein tolles Mädchen! Was bin ich damals in sie verknallt gewesen! Damals, im Winter des Jahres 1944, kurz vor Weihnachten, als unsere Geschichte beginnt.
Welch Jubel, als unser Vater Josef von Fritschen auf Fronturlaub, begleitet von einem Kameraden, kurz vor Weihnachten des Jahres 1944 das Schulhaus in Ossig betrat. In diesem lebte unsere Familie. Vater war der Lehrer des Ortes mit seinen damals etwa 700 Einwohnern. Im Jahre 1939 war Vater erstmals eingezogen worden, wie meine Mutter Hildegard in ihren viele Jahr später verfassten Aufzeichnungen zur damaligen Zeit schreibt:
„1939 brach der Krieg aus. Mein Mann machte den Polenfeldzug mit, danach wurde er entlassen. 1944 kam mein Mann zur Wehrmacht nach Dänemark.“
Prall gefüllt waren die beiden Seesäcke, die Vater und sein Kamerad über den Schultern trugen und alsbald vor unseren staunenden Augen öffneten und leerten. Riesige Stangen von Butter, ein großer, runder Käse, rote Wurst und Schinken, welche Köstlichkeiten fanden sich darin. Wie üblich schlachteten wir vor Weihnachten auch noch ein Schwein, pökelten es in einem Fass im Keller, das wir mit einem Steindeckel verschlossen. Ein neues Ferkel wurde angeschafft und gesellte sich zu den Enten, Gänsen und Hühnern, die drüben unterm Taubenschlag ihr Leben genossen, während unsere große Familie Weihnachten feierte. Am Abend besuchten wir gemeinsam die Messe, die Vater als Organist und Kantor unserer Kirchengemeinde mit Musik, Freude und Melancholie erfüllte. Niemand von uns ahnte während dieser Weihnachtstage, wie nahe die russische Armee unserer Heimat bereits war. Unser Schlesien, es galt als sicher, unsere dreißig Kilometer entfernte, wunderschöne Hauptstadt Breslau als uneinnehmbar. Wie trügerisch diese heile Welt und die Nachrichten aus unserem Volksempfänger waren. Wieder hätten unsere Soldaten Flugzeuge abgeschossen, wieder hätten sie die Russen zurückgedrängt, hieß es. Und es erfüllte mich mit Stolz, was ich als Neunjähriger da vernahm. Bald würde ich zur Hitlerjugend dürfen, würde auch eine dieser todschicken Uniformen und ein Fahrtenmesser bekommen. Sicher würden wir im Frühling auch wieder Heilkräuter sammeln, Kamille und Salbei, Schachtelhalm und Bärlauch, auf unserem Dachboden trocknen und gemeinsam mit den von Mutter und meinen Schwestern gestrickten Socken und Kleidungsstücken an die Front schicken. Kein Gedanke daran, dass sich unser Leben bald vollends ändern sollte, in nur wenigen Wochen die erste russische Panzerspitze unseren kleinen Ort erreichen und der Weltkrieg unsere große, auf diesem Foto zur Hochzeit meiner Eltern, Josef von Fritschen und Hildegard Seidel, am 30. Januar 1928 in Kaltenbrunn vereinte Familie, teils auslöschen, teils als Flüchtlinge und Vertriebene in den Westen jagen würde. Der adrette, neben der Braut sitzende Herr mit Schnurrbart und Fliege war mein Opa Bernhard, dem ich, wenn er uns besuchte, immer auf ganz besondere Weise einen Streich spielte. Bäuchlings auf der mannshohen, unser Haus umgebenden Natursteinmauer liegend, schnappte ich mir, kaum ging mein Großvater an mir vorüber, den Hut von seinem Kopf und flitzte damit davon. Nach einer Weile spürte Opa Bernhard mich unter einem der Pulte in den beiden Klassenräumen auf, zupfte maßregelnd an meinem Ohr und beide lachten wir.
Es war übrigens dieselbe Natursteinmauer, auf der meine kleine Schwester Gabriele immer so gerne herumspazierte und den vorbeikommenden Leuten ein freundliches „Heil Hitler“ zurief. Grauenvoll, wie die Propaganda bereits uns Kinder bis ins Innerste durchdrang.
Nach Neujahr des Jahres 1945 musste Vater uns wieder in Richtung Dänemark verlassen. Inzwischen hatte er wohl doch schlimme Nachrichten erhalten. Aufgewühlt nahm er unsere Mutter beiseite, sprach eindringlich, während ich lauschte, doch nur wenige seiner Worte verstand. „Die Russen“, das konnte ich verstehen, „Schlimmes auf uns zu“. Bevor er ging, nahm Vater dann mich zur Seite und gab mir „meinen Auftrag“.
Nur wenige Tage später standen wir Kinder von Ossig hoch oben auf unserem Kirchturm, schauten fasziniert und wohl auch begeistert aus den östlichen Turmfenstern auf die emporblitzenden Lichter bei Breslau. Das war schon phänomenal, dieses Feuerwerk aus Flakfeuer und Bomben, wie das leuchtete, wie es rumste und krachte. Am 12. Januar 1945 hatte die Rote Armee die Offensive auf Breslau begonnen, am 17. und 18. Januar 1945 warfen die Alliierten Bomben auf die dortigen Eisenbahnknotenpunkte. Heute vermute ich, dass wir diesen Angriff beobachteten.
Zwei Tage später, am 20. Januar des Jahres 1945, rief unser Gauleiter Karl Hanke Frauen, Kinder und alte Menschen auf, die Stadt Breslau zu verlassen. Alle nicht wehrtauglichen Personen sollten die zur Festung erklärte Stadt umgehend räumen. Eine Evakuierung allerdings war nicht vorbereitet, sodass gleich am ersten Tage Panik auf den Bahnhöfen ausbrach. Eilig zusammengesuchte Habseligkeiten in den Händen, drängelten und schubsten sich die Menschen durch die Bahnhofshallen, auf Bahnsteige und in Züge. Diese konnten die Massen nicht aufnehmen. Frauen, Kinder und alte Menschen mussten die Stadt nun zu Fuß verlassen. Bei Frost und Schnee zogen die Trecks in Richtung des südwestlich gelegenen Kostenbluts (polnisch Kostomloty) und der Stadt Kanth. Tausende erfroren, starben an Erschöpfung.
Während dieser Tage tauchten am Horizont, ganz hinten in der eisigen und verschneiten Landschaft rund um Ossig, die ersten Flüchtlinge aus der Gegend von Breslau und wohl auch aus Ostpreußen auf und zogen in unser Dorf. Meist auf Viehwagen hatten sie ihre Habe untergebracht, völlig von Schnee bedeckt, steifgefroren. Dazwischen saßen die Kinder, Frauen und Alten, eiskalt war den Menschen. Viele mussten bereits einen weiten Weg hinter sich gebracht haben. In ihrer abgewetzten Kleidung und mit den nahezu vereisten Gesichtern sahen sie aus, als sei bereits das meiste Leben aus ihnen gewichen. Über Nacht kamen einige der Menschen bei uns im Schulhaus unter. In den Klassenzimmern bot Mutter ihnen eine Bettstatt, wir bekochten die Menschen, die, ausgehungert und beinahe erfroren, die warmen Suppenschüsseln in den noch lange Zeit eisigen Händen hielten. Zwischen den verhärteten Gesichtern dampften die Suppen in unseren Klassenzimmern. Fasziniert von der großen Zahl an Menschen in unserem Hause, drückte ich mich dazwischen herum, beäugte die hilflosen und jammernden Gesichter der Kinder, verfolgte zufällig ein Gespräch zwischen einer Frau und meiner Mutter.
„Sehen Sie bloß zu, dass sie schnellstens hier rauskommen. Was die Russen mit uns gemacht haben“, sagte sie halblaut und mit verzweifeltem Gesichtsausdruck, „das kann ich gar nicht beschreiben.“
Die Worte der Frau machten mir Angst in diesem Moment. Gleichwohl waren sie bald und spätestens nachdem die Flüchtlinge unser Haus verlassen hatten, aus meinem Kopf gewichen. Verband ich doch keinerlei Vorstellung damit, welch unbeschreibliche Dinge die Russen getan haben sollten oder uns anzutun vermochten. Bald jedoch würde ich diese Gräuel selber und mit meinen Kinderaugen sehen, sie als Teil meines Lebens wahrnehmen, Deutsche, Russen, Polen und Tschechen beim Töten von Menschen erleben.
Los ging es nur wenige Stunden oder Tage später, ebenfalls im Januar des Jahres 1945.
„Ein Elendszug, sie werden durchs Dorf getrieben!“, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer in Ossig. Was auch immer das bedeutete, als neugieriger Junge will man es sehen. „Nein, ihr Kinder bleibt daheim!“, wollte Mutter mich aufhalten. Doch da schlich ich mich davon, schlug wie so oft ihre Ratschläge und wenig nachdrücklichen Anweisungen in den Wind und rannte ins Dorf, wollte etwas erleben und erlebte nun das Grausamste und Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ein Zug von etwa 200 abgemagerten, völlig zerlumpten und halbtoten Menschen wurde von Soldaten der Wehrmacht durch Ossig getrieben. Barfuß humpelten und schleppten sich die meisten dieser Gestalten durch den Schnee, mitten über unseren Marktplatz, der so bezeichnet wurde, auch wenn man dort nie einen Markt abhielt.
Die Soldaten der Wehrmacht trieben die bereits halbtoten Menschen voran, gellende Kommandoschreie und Pfiffe, sobald jemand an Tempo verlor erschossen, ja, tatsächlich erschossen sie jeden dieser Menschen, der aus dem halbwegs geschlossenen Treck ausscherte. Viele Schüsse fielen. Die Menschen sackten blutend in den Schnee, mitten in unserem Dorf, tot, blieben liegen, bis jenes den Zug abschließende Transportfahrzeug der Wehrmacht auf Höhe des jeweils Erschossenen war. Soldaten warfen die Leiche dann wie einen Müllsack auf den Wagen. All das betrachteten wir Dorfkinder von der Seite des Platzes aus, hatten beim Eintreffen des Trecks und voller Unkenntnis gerätselt, ob es sich um gefangene Russen oder um Häftlinge eines Konzentrationslagers handelte. Heute glaube ich, dass der Treck das Konzentrationslager Groß-Rosen, an der Eisenbahnstrecke von Jauer nach Striegau (polnisch Strzegom), zum Ziel hatte.
Wir hatten getuschelt und aufgeregt unsere Kinderkommentare abgegeben. „Seht nur den, wie der schwankt!“, „Er kann kaum noch laufen!“, „Das sind doch Deutsche, oder?“. Jetzt aber schwiegen wir, standen wie erstarrt, bis ein noch schlimmeres Grauen mich durchzuckte. Ein nahezu unmenschliches Gurgeln ausstoßend, hatte einer der Gefangenen seine Kontrolle verloren und sprang nun, wohl in den Wahnsinn getrieben, einen Wehrmachtssoldaten an, wollte diesen niederwerfen, so unendlich vergeblich das auch war. Im selben Moment stürmten deutsche Soldaten ihrem Kameraden bereits zur Seite, ließen mit ganzer Kraft einen Karabiner auf den Schädel des Mannes niederschmettern und zertrümmerten seinen Kopf. Sein Schädel teilte sich. Was ich damals fühlte, weiß ich nicht mehr, rannte aber heim und musste mich übergeben. Der Wahnsinn dieses Krieges hatte auch unser Dorf erfasst.
Am Ortsausgang von Ossig, auf der Straße nach Striegau, wurde der ganze Treck erschossen. Einige Kinder waren ihm nachgelaufen, die Soldaten hatten sie verscheucht. Dann krachten die Schüsse durchs Dorf. Und wir Kinder rochen das verbrannte Fleisch. Der süßliche Geruch von Tod und Verwesung würde in den kommenden Monaten oft in meine Nase ziehen. Er gehörte zu meiner Kindheit. Ebenso wie der Geruch von Berliner Pfannkuchen zur Fastnachtszeit.
Gegenüber unserem Schulhaus lag ein Bauernhaus, dessen Winkel ich später auf meinen Streifzügen allesamt erkunden sollte. Auf dessen Hof stand an diesen Tagen bereits ein mit Planen abgedeckter Leiterwagen, beladen mit jenen Gegenständen unserer Familie, die wir auf unsere geplante Flucht mitnehmen wollten. Warum wir nicht loszogen, weiß ich nicht. Vereinzelt auffindbare Aufzeichnungen im Internet lassen allerdings darauf schließen, dass man sich im Dorf nicht auf eine gemeinsame Flucht einigen konnte. Ob mangelnde Anweisungen unseres SS-Kreisführers O., von dem noch zu berichten sein wird, und der im uns benachbarten Gasthof nebst großer Stallungen am Marktplatz residierte, damit zu tun hatten, weiß ich nicht, vermute es aber. O. war unser „Obernazi“, ein Herrenmensch, der mir mächtig Angst machte in seiner SS-Uniform mit den hohen, schwarzen Stiefeln und seinem immer zornigen Gesicht. Auch er würde einen schlimmen Weg nehmen.
So kam es, dass der mit unseren Habseligkeiten beladene Leiterwagen unberührt dastand, als am 9. Februar des Jahres 1945 eine russische Panzerspitze das Oberdorf von Ossig erreichte: ein Panzer, ein Panzerspähwagen, russische Soldaten.
„Umgehend drangsalierten die Russen uns Dorfbewohner“, wird Mutter später in ihren Aufzeichnungen schreiben, „vergewaltigten Frauen und Mädchen, plünderten Geschäfte und Wohnhäuser. Nur Stunden später aber rückte die Wehrmacht nach, kesselte die Russen ein und vernichtete nach kurzem Gefecht die russische Vorhut.“
Morgens ging es los. Das wollte ich sehen. Schnell rannte ich auf den Speicher und suchte mir einen Platz am runden Giebelfenster. Von dort aus konnte man prima sehen. Aufgeregt und fasziniert beobachtete ich das Gefecht, Soldaten, die hinter Mauern in Deckung gegangen waren, auf dem Boden krochen, schossen, trafen, wieder in Deckung sprangen oder selbst getroffen und getötet wurden. Granaten flogen durchs Dorf. Eines der Geschosse raste direkt durch das Giebelfenster und nur Zentimeter an meinem