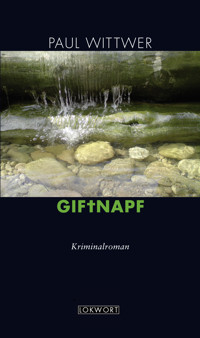
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
In Trub stirbt der Dorfarzt völlig unerwartet. Die junge Witwe sucht dringend eine Praxisvertretung. Doktor Ben Sutter meldet sich. Der Job im Emmental soll ihm nach strengen Assistenzjahren eine Luftveränderung bringen. Schon bald wird er konfrontiert mit Vorkommnissen, die in krassem Gegensatz zur beschaulichen Napfwelt stehen. Unklare Todesfälle, merkwürdige Notfälle, einsilbige Patienten, wortgewandte Prediger und die verwirrend hübsche Witwe stören ihn bei seiner Praxistätigkeit. Der frühere Dorfarzt Doktor Eggimann, Mediziner, Maler und Menschenkenner, trägt mit seinen Theorien über das Unsichtbare weiter zur Verunsicherung bei. Mit argloser Neugier erforscht Sutter alles was ihm begegnet. Seine Entdeckungen sind mindestens so verwirrend wie die Topografie des Napfgebietes und er verliert zunehmend die Orientierung. Als er endlich den Überblick zurückzugewinnen scheint, ist es zu spät. Viel zu tief ist er in die Geheimnisse rund um den Napf vorgedrungen. Um seine Haut zu retten, bleibt ihm nur die Flucht nach vorn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien
2008 im Nydegg Verlag
3. Auflage 2012
Taschenbuchausgabe
Alle Rechte vorbehalten
© by Nydegg Verlag Bern, 2010
Lektorat: Urs Heiniger
Umschlaggestaltung und Satz: Rohner & Brechtbühl, Prêles
Umschlagbild: Barbara Hirt
E-Book-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
E-Book-ISBN 978-3-905961-08-9
Nydegg Verlag, CH-3015 Bern
www.nydegg-verlag.ch
Inhalt
Prolog
Futternapf
Erster Teil
Goldnapf
Zweiter Teil
Fettnapf
Dritter Teil
Giftnapf
Prolog
Futternapf
Brot für Brüder
Prolog
Das Asyl «Brüder Rumäniens» lag in Rahova im Sektor fünf von Bukarest.
Der Laster fuhr direkt zum Kücheneingang des Heims. Der Chauffeur und sein Beifahrer entluden die Ware und stapelten die Kisten unter den Anweisungen der Köchin im Vorratsraum.
Es lebte sich gut bei den Brüdern Rumäniens seit den regelmässigen Lebensmittellieferungen aus der Schweiz.
Erster Teil
Goldnapf
Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind,sondern wie wir sind.
(Immanuel Kant)
1
Am letzten Abend im März, dem Tag, als der kranke Papst auf die Intensivpflegestation verlegt werden musste, traf Ben Sutter im Emmental ein. Die Meldung, dass der Kirchenvater grosse gesundheitliche Probleme hatte, erreichte ihn an einer geschlossenen Bahnschranke kurz nach Langnau. Sie beschäftigte ihn ähnlich stark wie die in der gleichen Nachrichtensendung aufgeworfene Frage nach dem gerechten Milchpreis – nämlich überhaupt nicht.
Im Moment war er mit sich selber beschäftigt. Er betrachtete im Rückspiegel sein Gesicht. Mit der rechten Hand fuhr er kontrollierend über den Kopf. Sein dichtes blondes Haar hatte er straff nach hinten gekämmt und am Nackenansatz mit einem feinen Gummiband zu einem Pferdeschwanz gebunden.
Die Frisur und der dunkelblonde Dreitagebart führten oberflächlich betrachtet zu einer gewissen Ähnlichkeit mit dem ehemaligen Schweizer Fussballstar, der sich jetzt als Fernsehmoderator versuchte. Da Ben zufälligerweise aus der gleichen Stadt stammte und auch noch den gleichen Familiennamen trug, war er schon oft deswegen angesprochen worden. Dabei war er mit dem Fussballer überhaupt nicht verwandt und interessierte sich kaum für dessen Sportart.
Seine beiden Brüder spielten zwar leidenschaftlich in der dritten Liga. Aber Ben hatte die harten körperlichen Auseinandersetzungen um den Ball stets gemieden. Als jüngster von drei Buben hatte er andere Qualitäten entwickelt, um sich Beachtung zu verschaffen. Seine Anpassungsfähigkeit hatte ihm manchen sinnlosen Abnützungskampf erspart. Diese nicht ganz uneigennützige Friedfertigkeit machte ihn im Grossen und Ganzen zu einem umgänglichen und zufriedenen Menschen. Bei seinen Kollegen galt Ben als Lebenskünstler und er selber teilte diese Einschätzung.
Die Suche nach der Sonnenseite des menschlichen Daseins war zu seinem eigentlichen und erklärten Lebenssinn geworden. Er verwendete ganz bewusst einen guten Teil seiner Energie und seiner Intelligenz auf die Frage, wie er möglichst sorgenfrei und bequem durchs Leben komme. Bei alledem verhielt er sich aber nicht einfach nur müssig – schliesslich hatte er das Medizinstudium erfolgreich und ohne Umwege hinter sich gebracht, wobei auch hier die Angst vor dem Mehraufwand eines zusätzlichen Studienjahres mehr zur Motivation beigetragen hatte als der Ehrgeiz.
Das erste Berufsziel war Zahnmedizin gewesen. Aber nach den Praktika in der Zahnklinik hatte er seine Meinung geändert. Der Anblick verängstigter Gesichter, aufgerissener Mäuler und würgender Schlünde sowie die auf ein Glucksen und Augenverdrehen reduzierten Mitteilungsmöglichkeiten der Patienten hatten ihn schliesslich auf Humanmedizin umsteigen lassen.
Allerdings waren ihm gerade in diesem Winter Zweifel an seinem damaligen Entscheid gekommen.
Seine Studienkollegen aus dem ersten Semester arbeiteten zum Teil schon in einer eigenen Praxis, verfügten über ein Einkommen, das ihnen wenige Wünsche offen liess, und genossen eine unbeschwerte Freizeit. Ihm dagegen erschien es in letzter Zeit eher schwierig, sich im oder neben dem Beruf auf der unbeschwerten Seite des Lebens zu sehen. Und dies, obgleich er bei der Auswahl seiner Assistentenstellen sorgfältig darauf geachtet hatte, dass die Rahmenbedingungen stimmten, dass ihm Zeit zum Leben blieb, wie er sich auszudrücken pflegte.
Seine Suche nach einem optimalen Lebensrhythmus und nach seiner beruflichen Zukunft hatte ihn zuletzt auf eine Stelle in der Psychiatrie geführt. Nach einem strengen chirurgischen Assistenzjahr hatte er dort auf eine Verbesserung seiner Lebensqualität gehofft.
Aber die Situation bei dieser letzten Anstellung war alles andere als befriedigend gewesen. Trotz gut geregelten Arbeitsbedingungen hatte er sich gestresst gefühlt. Wahrscheinlich hatte dies mehr mit seinen lieben Kollegen als mit dem schwierigen Patientengut zu tun gehabt: Dummerweise strebten auf der Abteilung noch andere nach der Sonnenseite des Lebens. Das hatte zur Folge gehabt, dass Arbeitsverteilung und Dienstplanbesprechungen zeitweise mehr Kraft beanspruchten als der Job an sich.
Anstatt sich gross zu ärgern, hatte Ben nach einer Aussprache mit seinen Vorgesetzten die Stelle vorzeitig gekündigt. Da zeigten sich die Vorteile der Psychiatrie: Sein Vorhaben, sich eine Auszeit zu nehmen, stiess allseits auf verständnisvolle Zustimmung.
Ben löste den Blick vom Rückspiegel und beobachtete, wie ein herrenloser Hund entlang den Geleisen die Strasse überquerte. Von einem Zug war weit und breit nichts zu sehen. Es hätte ihn nicht besonders erstaunt, wenn sich in diesem Moment die Schranken gehoben hätten; aber der rot-weiss gestreifte Balken blieb unten.
Nun lag er seit über einem Monat brach. Er konnte sich das ohne weiteres leisten, lebte er doch noch immer in der gleichen WG wie zu seiner Studentenzeit. Natürlich belegte er dort inzwischen zwei Zimmer – wie übrigens auch einer seiner beiden Mitbewohner –, aber seine festen Auslagen waren relativ bescheiden geblieben.
Die ersten Tage nach der Stellenaufgabe hatte er ziellos abgehangen. Er besuchte ein paar Freunde und alte Bekannte, Leute, die allesamt über weniger Zeit verfügten als er selber und über sein Auftauchen nicht immer in helle Freude ausbrachen. Danach widmete er sich seinem Bike, aber die Kälte war widerlich. Nachdem Bern Anfang März erneut im Schnee versunken war, hatte er sich kurzerhand entschlossen, dem Frühling entgegenzureisen.
Er war mit Bike und Malkasten auf die Balearen geflogen und hatte auf eine umfassende Intuition gehofft. Doch nach zwei Wochen Wind und Wolken und halbleeren Hotels, besetzt von Rentnern und Familien mit Kindern im Vorschulalter, floh er zurück in die Schweiz.
Der Spott seiner Mitbewohner und die weiterhin miesen Wetterbedingungen hatten schliesslich ein Wesentliches dazu beigetragen, dass er sich auf das Stelleninserat in der Ärztezeitung gemeldet hatte: «Dringend. Infolge Todesfalls Landpraxis im Emmental zu verkaufen. Kurzfristig auch Vertretung erwünscht. Möglichkeit zur Teilzeitarbeit.»
Das war genau, was er im Moment benötigte. Eine neue Herausforderung, weg von Bern, aber doch nicht zu weit weg, und eine Arbeit mit gewissen Freiräumen.
Vorgestern hatte er telefoniert, heute ging er sich vorstellen, und vorausgesetzt, die Konditionen stimmten, würde er in vier Tagen seine neue Stelle antreten. In einem Monat machte er dann unter Umständen schon wieder etwas anderes. Diese Art von Leben sagte Ben zu: mal hier und mal da, immer wieder etwas Neues, aber nichts allzu Verbindliches.
Er betrachtete seine Umgebung: eine reich gegliederte Hügellandschaft, vielfältig und doch ruhig, unüberblickbar und trotzdem einladend. Tannen, Felder, Strassen und Bauernhöfe schienen von gerechter Hand auf die einzelnen Hügel verteilt worden zu sein. Eine Welt wie im Sandkasten, ein bisschen kleinkariert, aber fürs Bike bestimmt ein Paradies. Ein paar Wochen würde er es hier schon aushalten können.
Sein Ziel, Trub, lag im Fankhausgraben, am Fusse des Napfs. Der Napf war mit seinen tausendvierhundert Metern Höhe sozusagen der Urhügel der Region. Ben hatte erwartet, die auf der Karte doch imposante Erhebung müsste von Weitem sichtbar sein. Aber nun schien es, als ob der Berg sich vor ihm versteckte.
In diesem Moment querte der Zug der regionalen Bahnlinie mit nervender Gemütlichkeit die Strasse. Nach einer weiteren unerklärlichen Verzögerung hob sich endlich die Barriere.
*
Er grölte mit Grönemeyer «… der Mensch heisst Mensch … weil er lacht, weil er lebt …», als wenig später die Abzweigung nach Trub auftauchte. Gemäss Frau Zehnders Wegbeschreibung war er bald am Ziel.
Ben schaltete die Musik leiser. Er musste sich jetzt auf die Strasse konzentrieren. Die Sicht hatte sich verschlechtert. Leichter Regen hatte eingesetzt und die rasch einbrechende Dämmerung liess das Tal eng und düster erscheinen. Die Strasse folgte einem Bachbett, das mehr Steine als Wasser zu führen schien. Sie war ziemlich schmutzig. Kuhfladen, Erdschollen und Regenwasser bildeten eine rutschige Masse. Stellenweise säumten Schneeresten den Wegrand.
Er fuhr vorsichtiger. Der Wagen – ein sportliches Coupé – gehörte nicht ihm, sondern seinem Mitbewohner. Viktor war Betriebsökonom im letzten Studienjahr, und er setzte das Gelernte sofort – und ganz offensichtlich erfolgreich – in die Praxis um. «Geld macht glücklich», Viktor hatte sich diesen Werbeslogan einer Bank hemmungslos zum Lebensmotto gemacht.
Ben verbot sich solch einfache Ziele. Er suchte den Sinn des Lebens eher in ideellen als in materiellen Werten. Der Haken daran war nur, dass er sich manchmal in Verdacht hatte, aus der Not eine Tugend zu machen. Eine Verbesserung seiner materiellen Situation hätte er nur mit mehr Arbeit erreichen können, und das war definitiv nicht sein Ziel.
Obwohl der Besitzer des Wagens erklärtermassen nicht sein Vorbild war, verbiss er sich allfällige Neidgefühle noch aus einem andern Grund. Mit geradezu familiärem Vertrauen lieh Viktor sowohl ihm wie auch Felix, dem Dritten im WG-Bunde, seinen Luxus aus: seinen Wagen, sein Handy, seine Digitalkamera und bei Bedarf – das heisst bei Grossmutters Beerdigung – sogar seinen schwarzen Anzug. Es gab Zeiten, da hätte Viktor auch gern das Bett mit ihm geteilt, aber da war Ben dann doch andersartig veranlagt.
Für das Vorstellungsgespräch im Emmental hatte ihm Viktor seinen Wagen allerdings nicht ganz widerstandslos abgetreten. «Ein Audi TT ist kein landwirtschaftliches Fahrzeug, Ben», hatte er zu bedenken gegeben, «und Trub, das bedeutet Outback, Feldweg, Traktor, Heuwender, Wanderschuh, Gummistiefel.»
Erst als Ben ihm versichert hatte, dass Trub mit einer Arztpraxis, zwei Gasthöfen, einem Familalädeli, einer Grundschule und einer Bushaltestelle bestimmt mit einer Teerstrasse an den Rest der Welt angeschlossen sein dürfte, und sich Viktor selber überzeugt hatte, dass die Postautoverbindungen um diese Zeit wirklich unmöglich waren, hatte er ihm den Wagen ausgeliehen.
Ben walzte ein paar Kuhfladen platt und erinnerte sich genüsslich an Viktors mahnende Worte. Die Dreckspritzer war er seinem Wohnpartner schuldig, sonst wären dessen Sorgen ja völlig unbegründet gewesen.
Je näher er Trub kam, desto zahlreicher wurden die glitschigen Spuren glücklicher Kühe. Trub schien sich den Zugang zuzuplättern. Als auch an den Seitenscheiben ein paar Spritzer klebten, gab er das Dreckspiel auf. Vielleicht benötigte er den Wagen noch einmal. Falls er diesen Job tatsächlich annehmen würde, mussten Koffer und Bike irgendwie ins Emmental verfrachtet werden.
Er selber war zwar stolzer Besitzer eines alten Triumph Spitfire. Aber der war mehr Liebhaberobjekt als Gebrauchsgegenstand. Das Auto benahm sich wie eine verschnupfte britische Lady und befand sich häufiger in der Reparatur als auf der Strasse. Nur weil der Triumph seinen Jahrgang trug, hatte es Ben bisher nicht übers Herz gebracht, ihn abzustossen.
Arzt signalisierte der Wegweiser kurz nach dem Dorfzentrum am Strassenrand. Wollte man in Bern sämtliche Praxen auf diese Art anzeigen, müsste an jeder Strassenkreuzung mindestens ein derartiges Schild angebracht werden.
Er bog ab. Nach wenigen Metern erreichte er das gesuchte Haus, einen unschönen Bau aus den sechziger Jahren, betont anders als die umliegenden Bauernhäuser, aber ohne Stil.
Falls der verstorbene Doktor die Praxis hatte erstellen lassen, dann bedeutete dies, dass er um die vierzig Jahre praktiziert haben musste und folglich ungefähr im Alter von siebzig Jahren verstorben sein dürfte.
Reichlich spät, um einen Nachfolger zu suchen.
Er stellte den Wagen auf einen der Patientenparkplätze. Praxis Dr. Zehnder – Arzt für allgemeine Medizin, stand an der einen Tür, Privat an der andern. Durch das Milchglas der Praxistür drang weisses Neonlicht.
Ben drückte die Klingel.
*
Die Frau, die ihm öffnete, war überraschend jung und erschreckend blass. Sie blickte ihn an, als ob sie jemand anderen erwartet hätte.
Tochter oder Enkelin?, fragte sich Ben und sagte: «Guten Abend. Mein Name ist Ben Sutter. Ich bin mit Frau Zehnder verabredet.»
Die Spannung im Gesicht der Frau löste sich. Sie streckte ihm die Hand entgegen: «Ich bin Sophie Zehnder. Freut mich, Sie kennen zu lernen.»
«Haben wir zusammen telefoniert?», fragte Ben.
«Ja genau. Haben wir.» Sie wischte sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und lächelte unsicher.
Ben lächelte nicht minder unsicher zurück.
Frau Zehnder trat etwas zur Seite, um ihn einzulassen. Dabei fiel ihr Blick auf den verdreckten Wagen. «Oh, das tut mir leid. Heute war Viehmarkt, wissen Sie …»
«Schliesslich sind wir auf dem Land», unterbrach Ben. «Und zudem: Der Wagen gehört nicht mir.»
Sie sah ihn kurz fragend an und sagte dann: «Aha.»
Ben wurde bewusst, wie dumm seine Bemerkung gewesen war. «Das war kein guter Spruch», stellte er mit der ihm eigenen Offenheit fest. «Aber mit dem Besitzer des Wagens verbindet mich ein besonderes Verhältnis. Die Dreckspritzer werden eine gewisse Wirkung erzielen, auf die ich mich schon jetzt freue.»
Frau Zehnder lächelte abermals, sie schien noch etwas unsicherer. Sie war wirklich deutlich jünger als erwartet, vielleicht sogar jünger als er selber. Ihre fast jugendlichen Gesichtszüge und das wilde dunkle Haar, das sich durch die Spange nicht ganz zähmen liess, passten schlecht zum dunkelgrauen Deux-Pièces. Das Kleid hatte etwas Uniformartiges an sich, nicht zuletzt wegen der glänzenden Knöpfe an den Ärmeln.
«Ich komme gerade vom Treuhänder, er war mir behilflich beim Vertragsentwurf für die Praxisvertretung», wandte sie sich an Ben. Er fragte sich, ob und wo sie seine Gedanken gelesen haben könnte.
«Ich denke, als Erstes zeige ich Ihnen die Praxisräumlichkeiten und Ihr Zimmer und – falls Sie dann noch Interesse an der Stelle haben – den Vertragsentwurf. Ich habe Sie doch richtig verstanden, ein Kauf der Praxis kommt für Sie im Moment nicht in Frage?»
«Nein. Ich interessiere mich lediglich für eine Vertretung.»
Frau Zehnder führte ihn zum Empfang. «Wie Sie sehen, ist die Praxis nicht ganz neu. Ich kann Ihnen aber versichern, die technischen Einrichtungen sind absolut zeitgemäss. Mein Mann hat im letzten Jahr viel investiert. Sprechzimmer und Behandlungszimmer sind mit elektrischer Liege ausgerüstet, Röntgen und EKG praktisch neuwertig und das Labor funktioniert mit Trockenchemie und automatischer Zählkammer. Die Spirometrie wurde vor kurzem erneuert und mit einer Schnittstelle zum Computer versehen …»
Ben nickte. Den Zustand der technischen Einrichtungen konnte er überhaupt nicht beurteilen. Mit Laborarbeiten und Röntgengeräten hatte er seit dem Studium keinen direkten Kontakt mehr gehabt und von der Handhabung der erwähnten Apparate hatte er schlicht keine Ahnung.
«Gibt es auch eine Praxisassistentin oder Sprechstundenhilfe?», fragte er mit plötzlichem Unbehagen.
«Selbstverständlich. Fräulein Grunder. Sie arbeitet seit über zwanzig Jahren hier. Wir haben sie sozusagen mit dem Inventar übernommen. Sie macht ihre Sache sehr gut. Bei Engpässen arbeitete ich gelegentlich mit.»
«Sie sind ebenfalls Praxisassistentin?»
«Nein.»
Statt sich über ihre berufliche Tätigkeit auszulassen, erklärte sie ihm den Tagesablauf. «Sprechstunde ist jeweils vor allem vormittags. Die Nachmittage sind meist nicht voll besetzt, diese Zeit können Sie sich selber einteilen. Das bietet Ihnen einen gewissen Spielraum. Hausbesuche, Berichte und andere administrative Arbeiten werden Sie natürlich auch beanspruchen. Am Donnerstag bleibt die Praxis geschlossen, ausser wenn wir den regionalen Notfalldienst verrichten. Das wird für Sie anfangs kaum aktuell sein. Im Übrigen werden Sie auch ohne Notfalldienst häufig genug mit Unvorhergesehenem zu tun haben. Die täglichen kleineren und grösseren Notfälle machen fast einen Viertel der Praxisarbeit aus.»
Sie betraten das Sprechzimmer. Das Zimmer war modern und geschmackvoll und, wie es Ben schien, ziemlich teuer ausgestattet. «Sehr schön», sagte er anerkennend.
«Mein Mann legte Wert auf Qualität. Abgesehen von dieser Vorgabe hatte ich bei der Gestaltung freie Hand.»
«Wie lange hat Ihr Mann praktiziert?», fragte Ben.
«Er hat die Praxis vor fast vier Jahren übernommen. Zu Beginn waren wir nicht ganz sicher, ob wir im Trub bleiben würden. Mir aber gefiel die Gegend auf Anhieb, und ich hatte den Eindruck, dass das Tal Lars – meinem Sohn – eine ideale Umgebung zu einer glücklichen Kindheit bieten könnte. Mein Mann hatte etwas mehr Schwierigkeiten, sich einzuleben.»
Sie verstummte und strich sich verlegen eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Ben sah erstmals etwas Rot auf ihren Wangen.
Sie verliessen das Sprechzimmer. Ein kurzer Gang verband Praxis und Wohnhaus. Angehängt an diesen Gang befand sich ein grosszügiges Zimmer, eher schon ein Studio, mit eigenem WC und Dusche. Der Raum war praktisch möbliert, neben Bett und Schreibtisch gab es einen bequemen Sessel, Fernseher, Telefon und sogar einen kleinen Kühlschrank.
«Das wäre sozusagen Ihr privater Bereich», erklärte Frau Zehnder, «die Küche müssen wir uns teilen, und bei einem längeren Aufenthalt könnten Sie auch die Stube mitbenutzen.»
Die Küche war so angelegt worden, dass sie durch eine seitliche Tür ebenfalls vom Zwischentrakt aus erreichbar war. Dieses Raumkonzept würde es Ben erlauben, von seinem Zimmer aus Küche und Praxis zu erreichen, ohne Zehnders Wohnbereich betreten zu müssen.
«Falls Sie noch immer Interesse an der Vertretung haben, könnten wir nun den Vertragsentwurf zusammen durchgehen», schlug Frau Zehnder nach dem Rundgang vor.
«Doch ja. Ich bin interessiert», erwiderte Ben, «für vier Wochen, wie ich Ihnen am Telefon erklärt habe. Auf der einen Seite muss sich zeigen, ob mir die Arbeit eines Landarztes überhaupt liegt, auf der andern Seite ist noch unklar, wann ich meine nächste Assistentenstelle antreten werde.»
Frau Zehnder nickte, aber sie war etwas enttäuscht, wie ihm schien. Sie überreichte ihm eine Kopie des Vertragsentwurfs und beide lasen stumm die Bedingungen durch. Zum Lesen schob sie ihre Brille nach oben. Sie verschwand beinahe im dichten Haarschopf.
Kurzsichtig, dachte Ben. Wie Meret, seine Freundin im zweiten Studienjahr. Die war so kurzsichtig gewesen, dass sie ihn ohne Brille nur beim Küssen richtig scharf sehen konnte. Sie hatten sich daraus verschiedene aufregende Spässe gemacht. «Ich will dich scharf sehen», war zum erotischen Reizwort geworden.
«Ich kann Ihnen für den Anfang einen Tagesansatz von dreihundert Franken bieten», sagte Frau Zehnder jetzt. «Donnerstag bleibt die Praxis wie gesagt geschlossen, dafür sollten Sie am Samstagmorgen in der Regel verfügbar sein. Nachteinsätze werden gesondert entschädigt. Wohnen, Essen und Praxiswagen sind inklusive.»
Sie blickte ihn erwartungsvoll an. Ben realisierte erst jetzt, dass das Grau des Kleides perfekt mit ihrer Augenfarbe übereinstimmte.
«Mein Buchhalter meint, es seien gute Bedingungen. Ich versichere Ihnen, die Sprechstunde wird kaum je ausgebucht sein», fügte sie an und die Angst vor einer Absage war ihr anzusehen. «Der jetzige Unterbruch sowie der abgelegene Standort wirken sich aus.»
Ben rechnete rasch nach. Ohne Zulagen ergab das ein Grundgehalt von keinen Sechstausend im Monat. Eigentlich hatte er mit mehr gerechnet. Auf der andern Seite würde ihm eine nicht voll ausgelastete Praxis auch gewisse Freiräume bieten, und das wiederum war ganz in seinem Sinne. Und da war neben dem Drang, etwas Neues anzupacken, und dem Wunsch, Bern und insbesondere seiner WG für eine Weile zu entfliehen, auch die noch ungelöste Frage, wie seine berufliche Zukunft aussah.
«Trub ist keine Goldgrube – obwohl ganz in der Nähe noch immer Gold gewaschen wird», fügte Frau Zehnder an, als Ben zögerte. «Aber die Leute hier sind in Ordnung, Sie werden sehen – dankbare Patienten. Die meisten sind sich bewusst, dass sie in einer Randregion wohnen und dass der Service hier tendenziell eher schlechter als besser wird.»
«Erhalte ich auch Bergzulagen?», fragte Ben.
Frau Zehnder wurde noch blasser, ihre Haut erschien fast durchsichtig. «Wenn Sie finden, das Gehalt sei Ihrer Arbeit nicht angemessen …»
Ben grinste. Erst da verstand sie seinen Scherz.
«Vier Wochen sind gebucht», sagte Ben und zog den Vertrag zu sich.
Eigentlich hatte er sich vorgenommen, ordentlich zu feilschen, aber nun hinderte ihn etwas daran, weiter zu verhandeln.
Er unterschrieb.
2
Am ersten Samstag im April, dem Tag, als der Papst verstarb, feierte die WG ihr fünfjähriges Bestehen. Die drei Wohnpartner hatten sich schon seit Längerem vorgenommen, dieses Jubiläum mit einem Fest zu begehen, und bereits Anfang Jahr die Einladungen verschickt.
Wenn allerdings die Stimmung der letzten beiden Monate ausschlaggebend gewesen wäre, hätte der Event wohl nicht stattgefunden. Vor allem Viktor und Felix waren sich in letzter Zeit des Öfteren in die Haare geraten. Felix, der Philosoph und Gesellschaftskritiker, fühlte sich durch Viktors unverhohlenen Materialismus provoziert, und Viktor, oder besser gesagt der Ökonom in ihm, ertrug Felix’ Kapitalismuskritik immer schlechter.
Felix studierte seit Menschengedenken irgendwelche philosophischen Randfächer, forschte und verfasste Schriften, allerdings ohne dafür die gebührende Anerkennung zu erhalten. Seit einem Jahr flossen keine Stipendien mehr und er war deshalb dauernd auf Jobsuche. Dabei lag ihm daran, dass seine Arbeitgeber nicht nur seine Präsenz, sondern auch seine «der soziokulturellen Weiterentwicklung verpflichtete Grundhaltung» (Ende Zitat Felix) schätzten. Dies führte dazu, dass er oft von Gesinnungsgenossen und Freunden engagiert wurde. Derartige Arbeitgeber waren im Allgemeinen materiell kaum besser gestellt als er selber und konnten ihn deshalb meistens mehr schlecht als recht bezahlen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























