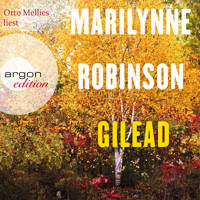8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
›Gilead‹ ist das erste Buch der großartigen Romanserie von der amerikanischen Meistererzählerin Marilynne Robinson und längst ein Klassiker der amerikanischen Literatur. Wie das Licht über der Prärie den Blick in die Weite lenkt und die Nähe umso bedeutender erscheinen lässt, verleiht sie dem Leben eine ungeahnte Perspektive. Auf seinem Sterbebett schreibt John Ames einen Brief an seinen siebenjährigen Sohn. Dem Kind will er alles erklären: Die Einsicht, mit der man das eigene Leben auf einen Schlag begreift, den Trost, der in einer einzelnen Berührung liegen kann, und den Ort, der sein Ende beschließt: Gilead, die kleine Stadt unter dem unermesslichen Himmel des Mittleren Westens, leicht wie Staub und so schwer wie die Welt. Seit Generationen lebte seine Familie in Gilead, waren die Männer Pastoren. Der Großvater half schwarzen Sklaven in die Freiheit, der Vater versuchte das Leben der Menschen in der Dürrekatastrophe erträglich zu machen. Sie lebten eng verwoben mit den Menschen und waren getrieben von einer unerbittlichen Sehnsucht nach Versöhnung. Mit visionärer Kraft und sprachlicher Eindringlichkeit erzählt Marilynne Robinson von der Ungeheuerlichkeit des Lebens, das wir erst in der Rückschau begreifen. Und wie John Ames fühlen wir uns im Blitz dieser Einsicht weniger allein. Dieser Trost macht ihre Bücher so einzigartig. »Gefühlvoll, ergreifend, fesselnd – Robinson gelingt es, das Wunder der Existenz zu fassen.« Merle Rubin, L. A. Times Book Review »Doch am Ende steht das Glück und die Rettung, und man begreift – auch so könnte eine Geschichte wirklich enden.« Zsuzsa Bánk »Was für ein Geschenk: Marilynne Robinsons Texte üben eine magische Wirkung aus.« Carolin Emcke »Ich liebe ihre Bücher.« Barack Obama
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Marilynne Robinson
Gilead
Roman
Über dieses Buch
Wie das Licht über der Prärie den Blick in die Weite lenkt und die Nähe umso bedeutender erscheinen lässt, verleiht die amerikanische Meistererzählerin Marilynne Robinson dem Leben eine ungeahnte Perspektive.
Auf seinem Sterbebett schreibt John Ames einen Brief an seinen siebenjährigen Sohn. Seit Generationen lebt die Familie in Gilead, waren die Männer Pastoren. Der Großvater half schwarzen Sklaven in die Freiheit, der Vater versuchte das Leben der Menschen in der Dürrekatastrophe erträglich zu machen. Sie lebten eng verwoben mit den Menschen und waren getrieben von einer unerbittlichen Sehnsucht nach Versöhnung.
Mit visionärer Kraft und sprachlicher Eindringlichkeit erzählt Marilynne Robinson von der Ungeheuerlichkeit des Lebens, das wir erst in der Rückschau begreifen. Und wie John Ames fühlen wir uns im Blitz dieser Einsicht weniger allein. Dieser Trost macht ihre Bücher so einzigartig.
»Gefühlvoll, ergreifend, fesselnd – Robinson gelingt es, das Wunder der Existenz zu fassen.«
Merle Rubin, L. A. Times Book Review
»Alles, was du verlierst, schreibt Robinson, gibt dir die Sehnsucht wieder, und auf diese eigensinnige, stille Weise gestaltet sie eine schöne und geheimnisvolle Welt.«
Judith Hermann, Literaturspiegel
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Marilynne Robinson, geboren 1943, ist eine preisgekrönte amerikanische Autorin und Essayistin. Ihr Roman ›Housekeeping‹ (1980) wurde mit dem PEN Award ausgezeichnet, ›Gilead‹ (2004) mit dem Pulitzer Prize (Fiction) und dem National Book Critics Circle Award. ›Home‹ (2008) erhielt den Orange Prize for Fiction. Ihr neuer Roman ›Lila‹ (2014) bildet den Abschluss der Trilogie, war »New York Times«-Bestseller und wurde mit dem National Book Critics Circle Award 2015 ausgezeichnet. 2016 wurde ihr für ihr Lebenswerk der »Library of Congress Prize for American Fiction« zugesprochen. Marilynne Robinson lebt in Iowa und lehrt am Writers‘ Workshop der University of Iowa.
Uda Strätling lebt in Hamburg und hat u. a. Emily Dickinson, Henry David Thoreau, Sam Shepard, John Edgar Wideman und Aldous Huxley übersetzt.
Inhalt
Motto
Teil I
Teil I Fortsetzung
Teil II
Für John und Ellen Summers,
meinen lieben Vater und meine liebe Mutter
Gestern Abend habe ich dir gesagt, dass ich eines schönen Tages vielleicht gehen müsste, und du meintest, Wohin, und ich sagte, Zu unserem lieben Herrn, und du meintest, Wieso, und ich sagte, Weil ich alt bin, und da hast du gesagt, Gar nicht. Und du hast deine Hand in meine geschoben und gesagt, Du bist gar nicht so alt, als wäre damit alles geklärt. Ich habe dir gesagt, dass dein Leben vielleicht ganz anders sein würde als meines und als dein Leben hier bei mir und dass es ein prima Leben sein würde, weil es so viele Arten gebe, ein gutes Leben zu leben. Und du hast gesagt, Das hat mir Mama doch schon gesagt. Und dann hast du gesagt, Lach nicht!, weil du glaubtest, ich lachte dich aus. Du hast hochgelangt und mir die Finger auf die Lippen gelegt und mich mit diesem Blick angesehen, den ich in meinem ganzen Leben auf keinem Gesicht sonst gesehen habe als dem deiner Mutter. Es ist eine Art wilder Stolz, brennend und streng. Ich staune immer ein bisschen, dass es mir nicht die Augenbrauen versengt, wenn mich ein solcher Blick straft. Er wird mir fehlen.
Es scheint unsinnig, anzunehmen, dass den Toten irgendetwas fehlen könnte. Wenn du dies als erwachsener Mann liest – und so ist dieser Brief ja gedacht –, werde ich lange schon fort sein. Ich werde über das Totsein so ziemlich alles wissen, was man wissen kann, es aber wahrscheinlich für mich behalten. So scheint es vorgesehen.
Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft mich Leute gefragt haben, wie das ist mit dem Tod, manchmal keine zwei Stunden, bevor sie von ganz alleine dahinterkommen würden. Schon, als ich noch ein ganz junger Mann war, fragten mich selbst Menschen so alt, wie ich es jetzt bin, danach, packten meine Hände und sahen mir mit ihren alten, trüben Augen in die Augen, als wüssten sie, dass ich es weiß, und als würden sie mich zwingen, es ihnen zu sagen. Ich sagte dann meist, es wäre wie heimkehren. Denn in dieser Welt sind und bleiben wir heimatlos, sagte ich meist, dann ging ich die Straße wieder zu diesem alten Haus hinab, machte mir Kaffee und ein Spiegelei-Toast und hörte, als ich schließlich eines besaß, Radio, und zwar meist im Dunkeln. Kannst du dich an dieses Haus erinnern? Ich denke schon, ein bisschen. Ich bin in Pfarrhäusern großgeworden. In diesem habe ich fast mein ganzes Leben gelebt, und in vielen anderen war ich zu Gast, weil die Freunde meines Vaters und ein Großteil der Verwandtschaft ebenfalls in Pfarrhäusern lebten. Und wenn ich überhaupt einmal drüber nachdachte damals, was nicht oft der Fall war, fand ich dieses von allen das schlimmste, zugig und trostlos wie kein andres. So war es damals um mich bestellt. An diesem alten Haus ist nicht das Geringste auszusetzen, aber ich war eben darin ganz allein. Und das machte es für mich fremd. Ich war damals in der Welt heimatlos, keine Frage. Jetzt nicht mehr.
Und nun muss ich hören, dass mein Herz langsam versagt. Der Arzt sprach von »Angina pectoris«, was ein bisschen einen theologischen Beiklang hat, wie Misericordia. Nun, in meinem Alter muss man mit derlei rechnen. Mein Vater ist alt geworden, aber seine Schwestern haben nicht so arg lange gelebt, eigentlich. Also kann ich nur dankbar sein. Ich bedauere allerdings, dass ich deiner Mutter und dir fast nichts hinterlassen kann. Ein paar alte Bücher, die sicher niemand sonst haben will. Ich habe nie sehr viel Geld bekommen, und auf das Geld, das da war, habe ich nie sehr geachtet. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich eine Frau und ein Kind zurücklassen könnte, glaub mir. Hätte ich es geahnt, wäre ich ein besserer Vater gewesen. Ich hätte vorgesorgt.
Das wollte ich dir vor allem sagen: wie sehr ich die schweren Zeiten bedauere, die du und deine Mutter gewiss durchgemacht habt, ohne nennenswerte Hilfe von mir, außer Gebeten, und ich bete immerzu. Das habe ich getan, als ich lebte, und das tue ich noch – wenn das nächste Leben danach ist.
Ich höre dich mit deiner Mutter reden: dich fragen, sie antworten. Ich höre nicht, was ihr sagt, nur eure Stimmen. Du schläfst abends ungern ein, und jeden Abend muss sie dich wieder von neuem dazu bereden. Nie höre ich sie sonst singen, nur abends im Zimmer nebenan, wenn sie dich in den Schlaf lullt. Und ich weiß nie, was sie da singt. Sie tut es sehr leise. Für mich klingt es schön, aber wenn ich das sage, lacht sie.
Ich weiß nicht mehr recht, was schön ist. Neulich bin ich auf der Straße an zwei jungen Burschen vorbeigekommen. Ich weiß, wer sie sind, sie arbeiten in der Autowerkstatt. Es sind keine Kirchgänger, beide nicht, einfach anständige junge Gauner, die andauernd Witze reißen müssen, und da standen sie also, lehnten in der Sonne mit dem Rücken an der Werkstattwand und steckten sich ihre Zigaretten an. Immer starren sie so vor schwarzer Ölschmiere und stinken sie so nach Benzin, dass ich mich frage, warum sie nicht selbst Feuer fangen. Sie plänkelten, wie sie es gern tun, und lachten auf ihre dreckige Art. Und ich fand es schön. Menschen lachen zu sehen ist ein erstaunlicher Anblick: wie es sie irgendwie überkommt. Manchmal müssen sie regelrecht dagegen ankämpfen. Das sehe ich in der Kirche oft genug. Ich frage mich, was das ist und wo es herkommt, und ich frage mich, was der Körper da ausschüttet, dass man nicht anders kann, bis man nicht mehr kann, ähnlich wie beim Weinen, eigentlich, nur dass man sich leichter vor Lachen ausschüttet.
Als sie mich kommen sahen, war natürlich Schluss mit der Witzelei, aber ich sah sie weiter in sich hineinlachen bei der Vorstellung, was der alte Prediger sie um ein Haar hatte sagen hören.
Ich hätte ihnen gern gesagt, dass ich genauso viel für Witze übrig habe wie jedermann sonst. Es hat in meinem Leben viele Gelegenheiten gegeben, wo ich das gern gesagt hätte. Aber das wollen die Leute nicht hören. Sie wollen dich ein bisschen entrückt haben. Ich hätte gern gesagt, Ich sterbe, und es wird für mich zum Lachen nicht mehr viel Gelegenheit geben, zumindest nicht in dieser Welt. Aber dann wären sie wahrscheinlich bloß sehr ernst und höflich geworden. Ich behalte meinen Gesundheitszustand noch möglichst für mich. Für einen, der stirbt, geht es mir ja eigentlich gut, und das ist ein Segen. Deine Mutter weiß natürlich Bescheid. Sie meinte, wenn es mir aber doch gut gehe, irre sich der Doktor vielleicht. Aber irren kann er sich in meinem Alter nur bedingt.
Das ist wirklich kurios an einem solchen Leben, an einem geistlichen Amt. Die Leute wechseln in deiner Gegenwart gleich das Thema. Und dann kommen aber genau dieselben Leute zu dir ins Kirchenbüro und erzählen dir die erstaunlichsten Dinge. Im Leben spielt sich vieles im Verborgenen ab, das weiß jeder. Viel Böswilligkeit und Grauen und Schuld – und viel Einsamkeit, wo du es gar nicht vermutest.
Der Vater meiner Mutter war Geistlicher und auch der Vater meines Vaters und dessen Vater davor, und was davor war, weiß niemand, aber ich kann es mir denken. Das geistliche Leben war ihnen zweite Natur, wie es das auch für mich ist. Es waren gute Menschen, und wenn es eines gibt, was ich von ihnen hätte lernen müssen, aber nicht gelernt habe, dann, meinen Zorn im Zaum zu halten. So weise müsste ich längst geworden sein. Selbst jetzt, wo schon ein flatternder Puls mich an die Letzten Dinge ermahnt, verliere ich noch die Beherrschung, wenn eine Schublade klemmt oder ich meine Brille verlegt habe. Das sage ich dir, damit du bei dir selbst darauf achten kannst.
Ein bisschen zu viel Zorn nur, zu oft oder zur Unzeit, kann mehr zerstören, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Vor allem achte auf deine Worte. »Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet’s an! Und die Zunge ist auch ein Feuer« – wahrlich, so ist es. Als mein Vater alt war, hat er mir genau das in einem Brief geschrieben. Den ich, wohlgemerkt, verbrannt habe. Ich habe ihn kurzerhand in den Ofen geworfen. Das hat mich seinerzeit weit mehr überrascht – als jetzt im Rückblick.
Ich denke, ich werde es mal mit der ungeschönten Wahrheit wagen. Also, und das sage ich mit dem größten Respekt. Mein Vater war ein Mann, der sich von Prinzipien leiten ließ, das sagte er selbst. Er handelte getreu dem Glauben, wie er ihn verstand. Aber irgendetwas an der Art, wie er ihn lebte, machte ihn von Zeit zu Zeit enttäuschend, und das nicht nur für mich. Das sage ich trotz der großen Sorgfalt, mit der er mich aufzog, wofür ich ewig in seiner Schuld stehe, obwohl er das selbst bestreiten würde, Gott hab ihn selig. Ich jedenfalls habe ihn gewiss enttäuscht. Das ist schon bemerkenswert, wenn man’s bedenkt. Wir meinten es schließlich gut miteinander.
Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht, und mit hörenden Ohren hören sie nicht; denn sie verstehen es nicht, so steht es geschrieben. Ich kann nicht behaupten, dass ich den Vers verstehe, sooft ich ihn auch gehört und für meine eigenen Predigten verwandt habe. Es ist schlicht eine zutiefst rätselhafte Feststellung. Man kann etwas zu Tode kennen und doch nicht das Geringste davon wissen. Da glaubt ein Mann seinen Vater zu kennen, seinen Sohn, und doch verbindet sie womöglich nichts als Loyalität und Liebe und gegenseitiges Unverständnis.
Das erwähne ich deshalb, weil Menschen, die Grund sehen, dich zu bedauern, dir oftmals Trotz und Zorn unterstellen werden und das in allem erkennen wollen, was du tust, selbst wenn du nur still und leise dem Leben deiner Wahl nachgehst. Sie geben dir Selbstzweifel ein, und die können, je nachdem, zur ernsten Irritation werden und dir viel Zeit rauben. Ich wünschte, ich hätte das eher begriffen. Schon darüber nachzudenken ärgert mich etwas. Auch Ärger ist eine Form von Zorn; ich weiß.
Ein großer Vorteil der Berufung ist, dass sie eine innere Sammlung begünstigt. Du entwickelst ein ganz gutes Gespür dafür, was von dir verlangt ist und was du vernachlässigen kannst. Wenn ich überhaupt einen weisen Rat für dich habe, dann vor allem den.
Du segnest unser Heim nun seit knapp sieben Jahren, noch dazu recht mageren Jahren, so spät in meinem Leben. Es war mir nicht möglich, noch bessere Vorkehrungen für euch zwei zu treffen. Aber es beschäftigt mich, und ich bete. Ich mache mir deswegen Gedanken. Das sollst du wissen.
Wir erleben einen trefflichen Frühling, und heute ist wieder ein vortrefflicher Tag. Du bist fast zu spät zur Schule aufgebrochen. Wir haben dich auf einen Stuhl gestellt, und du hast ein Marmeladentoast gegessen, während deine Mutter dir die Schuhe geputzt hat und ich dir die Haare kämmte. Du hattest noch eine ganze Seite Rechenaufgaben, die du gestern Abend hättest machen müssen, und heute Morgen hast du dafür ewig gebraucht, bemüht, alle Ziffern richtig herum zu schreiben. Du bist wie deine Mutter: in allem so ernst. Unsere alten Männer nennen dich Diakon, aber der Ernst kommt nicht allein von meiner Seite. So wie bei ihr habe ich ihn noch nie erlebt. Na ja, abgesehen von meinem Großvater. Ihren Ernst empfand ich halb als Trauer, halb als Ingrimm, und ich fragte mich, was in aller Welt ihren Augen diesen Ausdruck verliehen haben mochte. Und dann, du warst ungefähr drei, ein Dreikäsehoch nur, bin ich eines Morgens ins Kinderzimmer gekommen, und du hocktest im Sonnenlicht in deinem Schlafanzug mit der Poklappe auf dem Fußboden und versuchtest, einen zerbrochenen Wachsstift zu kitten. Du hast zu mir hochgesehen, und es war genau ihr Blick. An diesen Moment habe ich seither häufig gedacht. Ich sage dir, mir war es, als blicktest du auf ein Leben, auf Nöte zurück, die du nie, so bete ich, wirst erleben müssen, und als fordertest du mich auf, mich gefälligst zu rechtfertigen.
»Du bist genau wie die Alten da in der Bibel«, sagt deine Mutter zu mir, und da wäre etwas dran, wenn ich nur einhundertzwanzig Jahre leben und es zu ein paar Rindern und Ochsen und Knechten und Mägden bringen könnte. Mein Vater hat mir einen Beruf vermacht, der zufällig meiner Berufung entsprach. Aber im Grunde war mir das alles längst zur zweiten Natur geworden; ich bin damit großgeworden. Das wirst du sehr wahrscheinlich nicht.
Ich sah eine Seifenblase an meinem Fenster vorbeischweben, dick und fett wabbelnd und zu fast diesem Libellenblau kurz vorm Platzen gereift. Ich blickte in den Garten hinunter, und da wart ihr, du und deine Mutter, pustetet der Katze Seifenblasen zu, ein solches Sperrfeuer, dass das arme Tier vor lauter Gelegenheiten ganz außer sich war. Sie machte richtiggehend Luftsprünge, unsere sonst so süffisante Soapy! Ein paar Blasen stiegen durch die Zweige bis ganz über die Bäume hinauf. Aber ihr beide wart zu sehr mit der Katze beschäftigt, um die himmlischen Folgen eurer irdischen Bemühungen zu sehen. Sie waren sehr schön. Deine Mutter trug dabei ihr blaues Kleid, und du lagst in deinem roten Hemd im Gras auf den Knien mit Soapy dazwischen und den schillernden Blasen über euch und dem hellen Gelächter. Ach, dieses Leben, diese Welt.
Deine Mutter hat dir gesagt, ich schriebe deine Vätergeschichte, und dir gefiel die Vorstellung wohl. Also gut. Was soll ich dir berichten? Ich, John Ames, wurde im Jahr des Herrn 1880 im Bundesstaat Kansas als Sohn von John Ames und Martha Turner Ames, Enkelsohn von John Ames und Margaret Todd Ames geboren. Ich lebe, da ich dies niederschreibe, seit sechsundsiebzig Jahren, vierundsiebzig davon hier in Gilead, Iowa, abgesehen von meiner Zeit am College und am Predigerseminar.
Was soll ich dir weiter sagen?
Als ich zwölf war, pilgerte mein Vater mit mir zum Grab meines Großvaters. Damals lebte meine Familie seit etwa zehn Jahren hier in Gilead, mein Vater diente der hiesigen Kirche. Sein Vater, der ursprünglich aus Maine stammte und in den 1830ern ins Kansas Territory übersiedelte, lebte, nachdem er aus dem Amt verabschiedet worden war, noch einige Jahre bei uns. Dann machte er sich davon, um als Wanderprediger oder so ähnlich die frohe Botschaft zu verkünden, jedenfalls glaubten wir das. Er starb in Kansas und wurde dort begraben, in der Nähe einer weitgehend aufgelassenen Siedlung. Eine Dürre hatte auch noch die fast sämtlich vertrieben, die nicht schon längst näher an die Bahnstrecke gezogen waren. Es hatte dort bestimmt immer nur die eine Siedlung gegeben; wir sprechen hier schließlich von Kansas, wo die Menschen, die sich hier ursprünglich niedergelassen hatten, als Anhänger der Free Soil Party nicht unbedingt in längeren Zeiträumen dachten. Ich verwende den Ausdruck »gottverlassen« wirklich nicht oft, aber wenn ich an diesen Ort zurückdenke, dann drängt sich das Wort unweigerlich auf. Mein Vater brauchte Monate, um den alten Mann aufzuspüren, viele schriftliche Anfragen bei Kirchen und Zeitungen usw. Er gab sich die allergrößte Mühe. Schließlich antwortete jemand auf einen solchen Brief, schickte ein kleines Päckchen mit einer Taschenuhr und einer zerfledderten Bibel und einer Reihe von Briefen, einem Bruchteil nur, wie ich später erfuhr, der Anfragen meines Vaters, die dem altem Mann wahrscheinlich von Leuten überreicht wurden, die glaubten, ihn damit zur Rückkehr bewegt zu haben.
Meinen Vater schmerzte zutiefst, dass die letzten Worte, die er an seinen Vater gerichtet hatte, sehr zornige Worte gewesen waren und dass es in diesem Leben zwischen ihnen keine Versöhnung mehr geben konnte. Er ehrte seinen Vater im Großen und Ganzen durchaus, und er konnte nur schwer damit leben, dass es zwischen ihnen so geendet hatte.
Das war 1892, und entsprechend mühsam war damals das Reisen. Wir legten von dem Weg so viel als möglich mit der Bahn zurück, dann mietete mein Vater ein zweispänniges Fuhrwerk. Das war übertrieben, aber etwas anderes war einfach nicht zu bekommen. Irgendwo schickte man uns in die falsche Richtung, wir kamen vom Weg ab und hatten solche Not, die Pferde noch ordentlich zu tränken, dass wir sie auf einer Farm unterstellen mussten und zu Fuß weiterzogen. Die Wege waren ohnehin schlimm: zu Staub zermalmt, wo sie viel benutzt waren, bucklig und verbacken, wo nicht. Mein Vater trug in einem Sack ein paar Geräte bei sich, damit er das Grab ein wenig herrichten könnte, ich trug den Proviant – Hartbrot und Dörrfleisch und die paar kleinen gelben Äpfel, die wir hier und da am Weg auflasen – und die Hemden und Socken zum Wechseln, alle inzwischen längst verdreckt.
Er hatte damals eigentlich gar nicht die Mittel für die Reise, aber weil ihm die Sache keine Ruhe ließ, hatte er nicht warten wollen, bis er genug ansparen könnte. Ich sagte, ich müsse mit, und das akzeptierte er, obwohl es vieles erschwerte. Meine Mutter hatte gelesen, wie schlimm die Dürre weiter westlich war, und sie war gar nicht erbaut, als er sagte, er wolle mich mitnehmen. Er sagte ihr, es werde lehrreich sein, und das war es allerdings. Mein Vater war entschlossen, das Grab zu finden, koste es, was es wolle. Noch nie in meinem Leben hatte ich mir Gedanken darüber machen müssen, wo ich den nächsten Schluck Wasser hernehmen sollte, und dass ich das seither nicht mehr gemusst habe, betrachte ich als großen Segen. Es gab Zeiten, da glaubte ich wirklich, wir würden uns in der Wildnis verlieren und sterben. Einmal, als mein Vater mir aufgelesenes Feuerholz auf die Arme packte, sagte er, wir wären wie Abraham und Isaak auf dem Weg zum Berg Morija. Genau dasselbe hatte ich auch gedacht.
Es war so schlimm da draußen, dass wir nirgends mehr was zu essen kaufen konnten. Wir hielten an einer Farm an und versuchten es dort bei einer Frau, und da holte sie von einem Bord ein kleines Bündel herunter, wickelte es auf, zeigte uns Münzen und Scheine und meinte, »Nützt mir grad so viel wie Konföderiertengeld.« Die Gemischtwarenhandlung hatte dichtgemacht; nirgends mehr konnte sie Salz oder Zucker oder Mehl erstehen. Wir tauschten etwas von unserem elenden Dörrfleisch – seither kann ich nicht einmal mehr den Anblick davon ertragen – gegen zwei gekochte Eier und zwei gekochte Kartoffeln ein, und die schmeckten auch ohne Salz köstlich.
Dann fragte mein Vater sie nach seinem Vater, und sie sagte, Ja, der habe in der Gegend gewohnt. Sie wusste gar nicht, dass er gestorben war, dafür aber, wo er am ehesten begraben sein musste, und sie zeigte uns den kaum noch zu erkennenden Fahrweg, der uns direkt hinführen würde, keine drei Meilen von der Stelle, wo wir standen. Der Weg war überwuchert, aber wenn man ihm aufmerksam folgte, konnte man noch gerade die Fahrrillen erkennen. In denen schoss das Kraut nicht so auf, weil sie steinhart waren. Zweimal liefen wir glatt an dem Friedhof vorbei. Die paar wenigen Grabsteine waren umgestürzt und vor lauter Kraut und Gras nicht zu sehen. Beim dritten Mal fiel meinem Vater ein Zaunpfosten auf; zu dem gingen wir hin, und da sahen wir eine Handvoll Gräber, sieben oder acht in einer Reihe und darunter noch mal eine halbe, erstickt unter einer braunen Grasmatte. Ich weiß noch, dass ich die unfertige Reihe sehr traurig fand. In dieser zweiten Reihe entdeckten wir ein kurzes Stammstück, von dem jemand einen Teil der Rinde geschält hatte, dann hatte er ins nackte Holz ein paar Nägel getrieben und so umgeschlagen, dass sie die Buchstaben REV AMES formten. Das R sah genauso aus wie das A, und das S war ein umgekehrtes Z, aber er war es, keine Frage.
Inzwischen war es Abend, also kehrten wir erst einmal zur Farm der Frau zurück, wuschen uns an der Zisterne, tranken von ihrem Brunnen und schliefen auf ihrem Heuboden. Sie brachte uns Maisbrei zu essen. Ich liebte diese Frau wie eine zweite Mutter. Ich liebte sie zu Tränen. Vor Morgengrauen waren wir wieder auf, molken für sie, spalteten Kienholz und schleppten Wasser, und sie kam uns an der Tür mit einem Frühstück entgegen: aufgebratenem Maisbrei mit Brombeerkompott und einem Löffel Milchrahm, und wir aßen dort in der Kühle und im Dunkeln vor der Veranda im Stehen, und es war einfach herrlich.
Dann wanderten wir wieder zum Friedhof hinaus, der nichts weiter war als ein öder Flecken Erde mit einem halbverfallenen Zaun drum herum und einem Gatter, das sich dank einer mit Kuhglocke beschwerten Kette von selbst schloss. Mein Vater und ich reparierten erst einmal notdürftig den Zaun. Dann lockerte er die Graberde ein wenig mit seinem Klappmesser. Dann fand er, wir sollten zur Farm zurückkehren und uns zwei Hacken borgen und es gründlicher machen. Er sagte, »Wenn wir schon da sind, sollten wir uns auch um die anderen kümmern.« Diesmal hatte die Frau für uns Weißbohnen bereitet. Ich kann mich leider nicht mehr an ihren Namen erinnern, was schade ist. Ihr fehlte ab dem ersten Knöchel ein Zeigefinger, und sie lispelte etwas. Damals kam sie mir alt vor, aber sie war wohl einfach eine Landfrau am Ende ihrer Kräfte und ganz allein, die sich alle Mühe gab, mit einem Rest Verstand und Manieren zu überleben. Mein Vater meinte, ihrem Tonfall nach seien ihre Leute vielleicht ursprünglich aus Maine gekommen, aber er fragte nicht nach. Sie weinte, als wir uns von ihr verabschiedeten, und wischte sich mit der Schürze übers Gesicht. Mein Vater fragte sie, ob sie uns einen Brief oder eine Nachricht mitgeben wolle, und sie sagte nein. Er fragte sie, ob sie vielleicht mitkommen wolle, und sie dankte ihm, schüttelte den Kopf und meinte, »Da ist ja die Kuh.« Sie sagte, »Wenn erst der Regen kommt, wird es schon wieder.«
Einsamer, als es dieser Friedhof war, kann kaum ein Ort sein. Zu sagen, die Natur holte sich ihn schon zurück, ließe zu sehr an Leben denken. Der Flecken Erde war einfach wüst und verbrannt. Man konnte sich kaum vorstellen, dass das Gras je grün gewesen war. Wohin man auch trat, schwirrten Wolken kleiner Heuschrecken mit diesem Ratschen hoch, das wie ein angerissenes Streichholz klingt. Mein Vater schob die Hände in die Hosentaschen, sah sich um und schüttelte den Kopf. Dann begann er, das Kraut mit der extra mitgeschleppten Handsichel zu lichten, und wir richteten die umgestürzten Kopfsteine auf – die meisten Gräber waren bloß mit Feldsteinen markiert, ohne Namen oder Daten oder sonst was darauf. Mein Vater mahnte mich, aufzupassen, wo ich hintrete. Es gab nämlich da und dort auch kleine Gräber, die ich nicht bemerkt oder vielmehr nicht als solche erkannt hatte. Natürlich wollte ich nicht auf sie draufsteigen, da ich sie aber erst sah, als er das strohig verfilzte Gras zurückgeschnitten hatte, wusste ich, dass es mir doch passiert war, und da wurde mir übel. Nur als Kind habe ich je solche Schuld empfunden und solchen Jammer. Ich träume noch heute davon. Mein Vater sagte immer, wenn jemand sterbe, sei der Körper bloß ein zerschlissener Anzug, den die Seele abgelegt habe. Aber da waren wir, hatten uns schier umgebracht, um ein Grab zu finden, und achteten peinlich darauf, wohin wir die Füße setzten.
Wir plagten uns eine gute Weile mit dieser Arbeit ab. Es war heiß, und es lärmten die Heuschrecken gewaltig und rasselte der Wind im trockenen Gras. Wir streuten Samen aus, Bienenbalsam, Sonnenhut, Sonnenblumen, Kornblumen und Wicken. Das war Saat aus unserem eigenen Garten. Als wir fertig waren, setzte sich mein Vater neben das Grab seines Vaters auf die Erde. Dort blieb er eine ganze Weile, zupfte an den paar strohigen Halmen, die stehen geblieben waren, und fächelte sich mit seinem Hut Luft zu. Ich glaube, es dauerte ihn, nicht mehr tun zu können. Schließlich erhob er sich, klopfte sich ab, und dann standen wir dort beide in unseren armseligen verschwitzten Sachen mit staubigen, zerschundenen Händen im Sägen der ersten Grillen und dem Gebrumm der zunehmend lästigen Fliegen, während Vögel riefen, wie sie es tun, wenn sie sich langsam zur Ruhe begeben, und mein Vater beugte den Kopf und betete, empfahl den Verstorbenen dem Erlöser und bat den Herrn um Vergebung und seinen Vater auch. Mir fehlte mein Großvater mächtig, und auch ich wünschte mir Vergebung. Aber das Gebet wurde lang und länger.
In dem Alter kam mir jedes Gebet lang vor, und ich war doch hundemüde. Ich gab mir Mühe, die Augen geschlossen zu halten, aber schon bald musste ich ein bisschen linsen. Und an das, was dann geschah, erinnere ich mich so deutlich, als wäre es heute. Zuerst glaubte ich, ich sähe die Sonne im Osten versinken; wo Osten war, wusste ich deshalb, weil die Sonne, als wir morgens hier eintrafen dort eben erst am Horizont erschienen war. Dann wurde mir klar, dass das, was ich sah, ein Vollmond sein musste, der genau zum Sonnenuntergang aufging. Beide standen sie an ihren jeweiligen Himmelsrändern, und dazwischen herrschte ein wundersames Licht. Es war fast, als könnte man es anfassen, als fluteten spürbare Lichtströme hin und her oder als spannten sich zwischen beiden dicke Lichtstränge. Ich wollte, dass mein Vater das auch sieht, aber ich wusste, dazu müsste ich ihn aus seinem Gebet reißen, und weil ich das auf die bestmögliche Art tun wollte, ergriff ich seine Hand und küsste sie. Und dann sagte ich, »Sieh nur, der Mond.« Und er schaute. Wir standen einfach da, bis die Sonne unten und der Mond oben war. Sie schienen lange am Horizont zu schweben, wahrscheinlich, weil beide so hell waren, dass man nicht richtig hingucken konnte. Und das Grab und mein Vater und ich lagen genau dazwischen, was mich damals erstaunte, weil ich nie groß darüber nachgedacht hatte, was ein Horizont ist.
Mein Vater sagte, »Ich hätte nie gedacht, dass es hier so schön sein kann. Das ist gut zu wissen.«
Wir sahen, als wir es heimgeschafft hatten, so wüst aus, dass meine Mutter bei unserem Anblick in Tränen ausbrach. Wir waren beide in unseren schlotternden Sachen dünn geworden, wir waren abgerissen. Wir waren zwar nur knapp einen Monat unterwegs gewesen, aber wir hatten in der einen Woche unseres Herumirrens in Scheunen und Schuppen genächtigt und sogar auf der blanken Erde. Im Rückblick war es ein großes Abenteuer, und mein Vater und ich lachten oft über richtig schlimme Erlebnisse. Ein alter Mann hatte sogar auf uns geschossen. Mein Vater hatte aus einem Garten, an dem wir vorbeikamen, ein paar verholzte Möhren »stoppeln« wollen, wie er das nannte. Er hatte für das, was wir würden stibitzen können, und das war wenig genug, ein Zehn-Cent-Stück auf die Veranda gelegt. Das war vielleicht ein Bild: mein Vater in Hemdsärmeln rittlings auf dem wackligen Gartenzaun, die Möhre am Schopf in der Hand, und hinter ihm ein Kerl mit Gewehr, der anlegte. Wir schlugen uns in die Büsche, und als wir uns sicher waren, dass der Mann uns nicht folgte, hockten wir uns auf die Erde, und mein Vater schabte mit seinem Messer den Dreck von der Möhre, hackte sie in Stücke und legte sie auf die Krone seines Huts, den er wie einen Tisch zwischen uns gesetzt hatte, und dann sprach er den Segen; den vergaß er nämlich nie. Er sagte, »Für Speis und Trank«, und da platzten wir los und lachten Tränen. Heute ist mir klar, dass die Frage der Wegzehrung ihm große Sorge bereitete. Es trieb ihn fast zu so etwas wie Gesetzlosigkeit. Seine Mohrrübe war so groß und alt und verholzt, dass er Schnitze davon absäbeln musste. Es war, als kaute man auf einem Zweig, und wir hatten auch nichts, um sie herunterzuspülen.
Erst im Nachherein wurde mir klar, wie aufgeschmissen ich gewesen wäre, wenn ihn die Kugel getroffen oder sogar getötet hätte und ich da draußen allein zurückgeblieben wäre. Ich träume noch heute davon. Ich glaube, er empfand die Art Scham, die einen überkommt, wenn einem erst hinterher wirklich bewusst wird, wie leichtsinnig man gewesen ist. Aber er war eben fest entschlossen, das Grab zu finden.
Einmal hatte mir mein Großvater, um mir einzuschärfen, dass ich lieber lernen solle, solange ich jung sei und mir das Lernen noch leichtfiele, von einem Mann erzählt, den er kurz nach seiner Ankunft in Kansas kennengelernt hatte, einem Prediger, der sich unlängst dort niedergelassen hatte. Er sagte, »Der Kerl war im Hebräischen einfach nicht firm. Der riskierte wegen einer Auslegungsfrage mitten im Winter einen Treck von fünfzehn Meilen übers offene Land. Den mussten wir auftauen, ehe er uns überhaupt sagen konnte, was ihn umtrieb.« Mein Vater lachte und meinte dazu, »Das Komische ist, das kann sogar sein.« An diese Geschichte musste ich damals denken, weil ich fand, wir beide machten ganz etwas Ähnliches.
Mein Vater verzichtete fortan aufs Stoppeln und klopfte lieber wieder an, was ihm widerstrebte, weil die Leute, sobald sie begriffen, dass er Geistlicher war, uns vielleicht mehr aufdrängen würden, als sie entbehren konnten. Fürchtete er jedenfalls. Und sie begriffen es immer, so schäbig wir auch schon nach nur wenigen Tagen unserer Wüstenwanderung, wie er es nannte, aussahen. Wir boten ein paarmal für die Bissen irgendwelche Hilfsdienste an, aber immer baten die Leute ihn bloß, aus der Bibel zu lesen oder ein Gebet zu sprechen. Ihn beschäftigte sehr, wie sie es ihm gleich ansehen konnten und was ihn eigentlich verriet. Er war doch so stolz darauf, schwielige Hände zu haben und kein Gramm zu viel auf den Rippen. Mir ist das selbst auch oft passiert, und auch ich habe mich gewundert. Nun, wir verbrachten jedenfalls nicht wenige Tage am Rande der Katastrophe, und wir lachten noch Jahre darüber. Es waren immer die schlimmsten Sachen, über die wir lachten. Meine Mutter regte sich auf, aber sie sagte bloß, »Ich will es gar nicht hören.«
Sie war in vielem eine überaus gründliche Mutter, die Arme. Ich war ja in gewisser Weise ihr einziges Kind. Vor meiner Geburt hatte sie sich ein neues Handbuch für häusliche Pflege gekauft. Es war groß und teuer und um einiges penibler als das Buch Levitikus. Diesem Ratgeber folgend, versuchte sie, uns nach dem Essen eine Stunde lang an jeglicher Hirntätigkeit zu hindern – und am Lesen grundsätzlich, wenn wir kalte Füße hatten. Das sollte dem Blutkreislauf konträre Beanspruchungen ersparen. Mein Großvater sagte einmal zu ihr, wenn es nicht möglich wäre, mit kalten Füßen zu lesen, gäbe es in ganz Maine nur Analphabeten, aber sie nahm die Sache sehr ernst und wischte seine Einwände beiseite. Sie sagte, »Da in Maine ja keiner viel zu essen bekommt, gleicht sich das wieder aus.« Als ich glücklich wieder daheim war, schrubbte sie mich von Kopf bis Fuß ab, steckte mich ins Bett, brachte mir sechs-, siebenmal am Tag zu essen und verbat mir nach jeder Mahlzeit, meinen Kopf zu benutzen. Das war eine ziemliche Geduldsprobe.
Die Reise war für mich ein großer Segen. Rückblickend wird mir bewusst, wie jung mein Vater damals noch war. Er kann höchstens fünf- oder sechsundvierzig gewesen sein. Er blieb bis ins hohe Alter regsam und kräftig. Jahrelang vertrieben wir uns abends nach dem Essen mit einem bisschen Catch die Zeit, bis die Sonne weg war und der Baseball beim besten Willen nicht mehr zu sehen. Ich glaube, er genoss es einfach, ein Kind im Haus zu haben, einen Sohn. Tja, auch ich war bis vor kurzem ein regsamer alter Mann.
Du weißt wahrscheinlich, dass ich in jungen Jahren ein Mädchen geheiratet habe. Wir waren zusammen aufgewachsen. Wir heirateten im letzten Jahr meiner Seminarzeit, und dann kehrten wir hierhin zurück, damit ich meinen Vater vertreten könnte, während er und meine Mutter ihrer Gesundheit wegen ein paar Monate in den Süden zogen. Nun, mein Mädchen starb im Kindsbett, und das Kind starb mit ihr. Sie hießen Louisa und Angeline. Ich habe das Baby noch lebend gesehen und ein paar Minuten gehalten, und das war ein Segen. Boughton hatte sie auf den Namen Angeline getauft, weil ich an dem Tag drüben in Tabor zu tun hatte – das Kind kam sechs Wochen zu früh –, und es war keiner da, der ihm hätte sagen können, auf welchen Namen wir uns letztlich geeinigt hatten. Sie hätte Rebecca heißen sollen, aber Angeline ist auch ein guter Name.
Als wir am vergangenen Sonntag zum Essen bei Boughtons eingeladen waren, sah ich dich seine Hände studieren. Sie bestehen vor lauter Arthritis nur noch aus Haut und Knöcheln. Du findest ihn steinalt, dabei ist er jünger als ich. Bei meiner ersten Trauung war er Trauzeuge, und später dann hat er mich und deine Mutter getraut. Seine Tochter Glory ist jetzt wieder zu ihm gezogen. Ihre Ehe ist gescheitert, und das ist ein Jammer, aber für Boughton ist es ein Segen. Sie hat mir vor ein paar Tagen eine Zeitschrift gebracht. Sie hat mir gesagt, dass auch Jack möglicherweise heimkehren wird. Ich brauchte doch wahrhaftig einen Moment, um mich darauf zu besinnen, wer das ist. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht groß an den alten Boughton. Er wird jetzt manchmal ein bisschen unwirsch, was bei seinem Leiden verständlich ist. Es wäre schade, wenn du von ihm nur das in Erinnerung behalten hättest. Zu seinen besten Zeiten hielt er Predigten wie kein Zweiter.
Mein Vater nahm für seine Predigten Notizen zur Hilfe, ich selbst habe meine immer Wort für Wort niedergeschrieben. Es gibt ganze Kartons davon oben auf dem Dachboden, und die der letzten Jahre sind gestapelt im Schrank. Ich habe nie mehr nachgesehen, ob sie taugen, ob ich wirklich etwas gesagt habe. Fast mein ganzes Lebenswerk steckt in diesen Kartons, was erstaunlich ist, wenn man’s bedenkt. Ich könnte sie mir natürlich vorknöpfen und vielleicht ein paar heraussuchen, die du haben solltest. Aber ich fürchte mich ein wenig. Ich habe den Verdacht, ich könnte deshalb so gründlich an ihnen gefeilt haben, weil ich so immer beschäftigt war. Wenn jemand vorbeikam und ich an einer Predigt saß, ging der- oder diejenige meist wieder weg, außer es war wirklich dringend. Ich weiß auch nicht, wieso Alleinsein die Einsamkeit lindert, aber für mich war es damals so, und ich genoss sogar Ansehen wegen meiner endlosen Stunden im Studierzimmer und der Bücher, die mir per Post zugeschickt wurden – gar nicht so viele, eigentlich, aber mehr, als ich mir leisten konnte. Da ist zum Teil das Geld geblieben, das ich hätte beiseitelegen können.
Das war es aber nicht allein, weißt du. Für mich ist Schreiben immer wie Beten gewesen, selbst wenn ich keine Gebete und Fürbitten schrieb, was ich ja oft genug tat. Man hat dabei das Gefühl, bei jemandem zu sein. Jetzt zum Beispiel habe ich das Gefühl, bei dir zu sein, was immer das heißen kann, denn momentan bist du noch ein kleiner Junge, und wenn du erst ein Mann bist, sind diese Briefe für dich vielleicht nicht von Interesse. Oder sie erreichen dich, aus vielerlei Gründen, nie. Nun, wie sehr bedauere ich jeden Kummer, den du gehabt haben magst, und wie dankbar sehe ich allem Guten entgegen, das du erfahren haben wirst. Ich will damit sagen, ich bete für dich. Und das schafft eine große Nähe. Wahrlich, so ist es.
Deine Mutter respektiert meine Stunden hier oben im Arbeitszimmer. Sie ist stolz auf meine Bücher. Sie ist es, die mich auf die große Zahl der Kartons aufmerksam gemacht hat, die ich mit meinen Predigten und meinen Gebeten gefüllt habe. Sagen wir fünfzig Predigten im Jahr, und das fünfundvierzig Jahre lang, ohne Trauergottesdienste usw., von denen es viele gab. Zweitausendzweihundertfünfzig. Wenn man im Schnitt dreißig Seiten rechnet, dann wären das siebenundsechzigtausendfünfhundert Seiten. Kann das sein? Ja, doch, ich glaube schon. Und meine Handschrift ist noch dazu klein, wie du inzwischen wissen wirst. Sagen wir mal, dreihundert Seiten ergäben einen Band. Dann habe ich zweihundertfünfundzwanzig Bücher geschrieben; da kann ich dem Umfang nach sogar mit Augustinus und Calvin mithalten. Erstaunlich. Das meiste habe ich voller Hoffnung und Überzeugung geschrieben. Habe meine Gedanken sortiert und meine Worte gewählt. Habe nach der Wahrheit gestrebt. Und ich sage dir, es war herrlich. Ich bin dankbar für die vielen dunklen Jahre, auch wenn sie mir rückblickend erscheinen wie ein einziges langes, bitteres Gebet, das spät endlich doch noch erhört wurde. Mitten in diesem Gebet nämlich spazierte deine Mutter in die Kirche – suchte Zuflucht vor dem Wetter, dachte ich damals, denn es goss in Strömen. Und sie betrachtete mich mit so ernsten Augen, dass es mich verlegen machte, vor ihr zu predigen. Mich wehte die Leere meiner Worte an, würde Boughton sagen.
Mir hat die friedvolle Stimmung eines ganz gewöhnlichen Sonntags oft sehr gefallen. Das ist, als stündest du nach einem warmen Regen in einem frisch bepflanzten Garten. Du spürst das stille, unsichtbare Leben. Es fordert von dir nichts weiter, als dass du achtgibst, es nicht zu zertreten. Und das war so ein stiller Tag, Regen auf dem Dach, Regen an den Fenstern und alle dankbar, weil wir, scheint es, nie ganz genug Regen kriegen. Da ist mir dann vielleicht gar nicht so wichtig, ob die Leute hören, was ich zu sagen habe, weil ich ihre Gedanken kenne. Wenn aber dann eine Fremde erscheint, kommt dir dieser Friede wie Halbschlaf und tumbe Gewohnheit vor, weil du fürchtest, ihr muss es so vorkommen.
Hätte Rebecca gelebt, wäre sie heute einundfünfzig, zehn Jahre älter als deine Mutter. Lange Zeit habe ich mir ausgemalt, wie es wäre, wenn sie dort zur Tür hereinkäme, welcher Worte ich mich in ihrer Gegenwart zumindest nicht schämen müsste. Weil ich mir immer vorgestellt habe, sie käme von einem Ort zurück, an dem man weiß, und hörte meine ganzen Hoffnungen und Mutmaßungen wie eine, die die Wahrheit von Angesicht gesehen hätte und das Ausmaß meiner Unwissenheit kennte. Damit suchte ich mich selbst zu überlisten und gegen übermächtige Lehrmeinungen und Debatten zu wappnen. Ich las doch damals so viele Bücher und führte im Geiste ständig Dispute, aber ich denke, ich war in der Regel so klug, dergleichen nicht mit auf die Kanzel zu tragen. Und ich glaube, eben weil ich meine Predigten verfasste, als könnte jederzeit Rebecca zur Tür hereinspazieren, war ich nicht ganz unvorbereitet, als deine Mutter erschien, jünger als es Rebecca gewesen wäre, natürlich, aber nicht so sehr anders als die Rebecca meiner Vorstellung. Das hatte weniger mit ihrem Aussehen zu tun als damit, dass sie dort nicht hinzugehören schien, und zugleich, als wäre sie von uns allen die Einzige, die dort wahrhaftig hingehörte.
Das erzähle ich, weil sie von einem Ernst war, der fast etwas von Zorn an sich hatte. Als wollte sie sagen, »Da komme ich nun aus der unsagbaren Ferne, aus dem unvorstellbar Anderen deinen Gebeten entgegen. Also sag gefälligst etwas von Belang.« Meine Predigt zerfiel mir auf der Zunge zu Asche. Nicht, dass ich mir keine Mühe mit dem Text gegeben hätte. Ich gab mir mit allen meinen Predigten Mühe. Ich weiß noch, dass ich an jenem Tag zwei Säuglinge taufte. Ich spürte, wie genau sie mich dabei beobachtete. Beide Gottesgeschöpfe weinten, als ich ihnen die Stirnen erstmals mit Wasser betupfte, dann sah ich hoch, und auf ihrem Gesicht lag ebendas strenge Staunen, das ich zu sehen erwartet hatte, noch bevor ich aufsah, und am liebsten hätte ich geradeheraus gesagt, »Wenn du einen besseren Vorschlag hast, bitte, nur zu.« Kaum ein halbes Jahr später taufte ich sie. Und ich hätte sie am liebsten gefragt, »Was habe ich getan? Was hat es zu bedeuten?« Das war eine Frage, die oft in mir aufstieg, nicht, weil ich mir nicht sicher gewesen wäre, dass ich etwas tat, was bedeutsam war, sondern weil mir, ganz gleich wie sehr ich darüber nachgrübelte und las und betete, das Geheimnis im Kern verschlossen blieb. Ihr liefen die Tränen übers Gesicht, der lieben Guten, das werde ich nie vergessen. Wenn ich nicht überhaupt alles vergesse, wie es so vielen alten Menschen passiert. Aber wie es aussieht, werde ich gar nicht lange genug leben, um noch das zu vergessen, was ich nicht ohnehin schon vergessen habe, und das ist nicht wenig, das weiß ich wohl. Ich habe im Laufe der Jahre viel über die Taufe nachgedacht. Boughton und ich haben oft darüber gesprochen.
Also, das mag jetzt angesichts des ernsten Themas etwas platt erscheinen, doch das finde ich eigentlich nicht. Wir waren sehr fromme Kinder aus frommen Elternhäusern in einem halbwegs frommen Ort, und das hat natürlich stark unser Verhalten bestimmt. Einmal haben wir einen Wurf kleiner Katzen getauft. Es waren staubige kleine Scheunenkatzen, gerade einigermaßen sicher auf den Beinen, streunerische Geschöpfe, die namenlos ihr Leben mit dem Mausen verbringen und überhaupt kein Interesse am Menschen haben, außer ihm aus dem Weg zu gehen. Aber die Tiere beginnen ihr Leben als gesellige Wesen, also freuten wir uns immer, neue Kätzchen aus irgendeiner der Ritzen krauchen zu sehen, in denen ihre Mütter sie zu verbergen suchten, ebenso zum Spiel aufgelegt wie wir. Einem der Mädchen fiel es ein, sie in ein Puppenkleid zu stecken – es gab nur das eine Kleid, und das war gut so, denn die Kätzchen hielten es darin kaum ein paar Sekunden aus und mussten sowieso gleich nach der Taufe wieder daraus befreit werden. Ich selbst betupfte ihre Stirnen und sprach die volle Taufformel.
Ihre zählebige, krummschwänzige Mutter ertappte uns beim munteren Taufen am Bach und schleppte ihre Jungen eins nach dem anderen am Nacken fort. Wir hatten zwar nicht Buch geführt, waren uns aber ziemlich sicher, dass ein paar Geschöpfe noch in heidnischer Umnachtung davongetragen worden waren, und das machte uns große Sorgen. Also fragte ich schließlich meinen Vater so beiläufig wie nur irgend möglich, was eigentlich mit einer Katze wäre, wenn man sie zum Beispiel taufen würde. Er sagte, die Sakramente müssten stets mit der höchsten Achtung behandelt und gehandhabt werden. Das beantwortete nicht unbedingt meine Frage. Wir achteten die Sakramente ja, aber wir gaben auch viel auf die Katzen. Ich begriff allerdings, was er meinte, und ich taufte erst wieder, als ich ordiniert war.
Zwei, drei Junge aus diesem Wurf nahmen die Mädchen mit und machten sie zu halbwegs anständigen Hauskatzen. Louisa wählte eine rote. Sie hatte sie noch, als wir heirateten. Die übrigen lebten verwildert dahin, von ihren Artgenossen nicht zu unterscheiden: ob Heiden oder Christen, ließ sich nicht sagen. Ihre eigene Katze nannte Louisa Sparkle, wegen der weißen Blesse. Sie verschwand irgendwann. Ich vermute, dass sie beim Kaninchenwildern erwischt wurde, einer Sünde, für die diese unbestreitbar christliche Katze, das konnten wir bezeugen, sehr anfällig war, wie steif auch immer ihre Gelenke wurden. Einer unserer Spielkameraden meinte, sie hätte sie sowieso lieber Sprinkle nennen sollen. Er war als Baptist Verfechter der Totalimmersion, anders als, zum Glück der Katzen, ich. Er meinte, mit unserer Methode würden wir gar nichts erreichen, und wir konnten ihn nicht widerlegen. Unsere Soapy muss eine ferne Verwandte sein.
Ich erinnere mich noch heute, wie sich die warmen kleinen Stirnen unter meiner Hand anfühlten. Jeder hat schon mal eine Katze gestreichelt, aber sie so zu berühren, im reinen Wunsch, sie zu segnen, das ist etwas vollkommen anderes. Das vergisst man nicht. Jahrelang haben wir uns gefragt, was wir ihnen aus kosmischer Sicht angetan haben. Für mich bleibt das bis heute eine berechtigte Frage. Eine Segnung ist wirksam, und als solche sehe ich die Taufe vor allem. Sie macht nicht heiliger, aber sie bestätigt die Heiligkeit, und darin liegt Kraft. Diese Kraft ist durch mich hindurchgegangen, möchte ich mal sagen. Sie gibt dir das Gefühl, ein Wesen wirklich zu kennen, ich meine, das Geheimnis des anderen und des eigenen Lebens gleichzeitig zu spüren. Ich will dich keineswegs zu einem geistlichen Amt drängen, aber es bietet Vorzüge, die du übersehen könntest, wenn ich sie dir nicht aufzeige. Nicht, dass du Geistlicher sein musst, um zu segnen. Du würdest dich nur sehr viel häufiger in der Lage befinden. Die Leute erwarten es von einem. Ich weiß nicht, warum von diesem Aspekt der Berufung in der Literatur so wenig die Rede ist.
Ludwig Feuerbach sagt über die Taufe etwas sehr Schönes. Ich habe es mir angestrichen. Er sagt, »Das Wasser ist die reinste, klarste sichtbare Flüssigkeit, vermöge dieser seiner Naturbeschaffenheit das Bild von dem fleckenlosen Wesen des göttlichen Geistes. Kurz, das Wasser hat zugleich für sich selbst, als Wasser, Bedeutung; es wird ob seiner natürlichen Qualität geheiligt, zum Organ oder Mittel des Heiligen Geistes erkoren. Insofern liegt der Taufe ein schöner tiefer Natursinn zugrunde.« Feuerbach ist ein berühmter Atheist, aber zu den freudvollen Aspekten des Glaubens ist er unübertroffen, und er liebt die Welt. Er findet natürlich, dass die Religion beiseitetreten und die Freude sich rein und unverhüllt entfalten lassen sollte. Das ist sein einziger Irrtum, und der ist erheblich. Aber wunderbar ist er zum Thema der Freude, und auch zu ihren religiösen Ausdrucksformen.
Boughton ist auf Feuerbach nicht gut zu sprechen, weil er den Glauben so vieler Menschen erschüttert hat, aber mit denen hadere ich kaum weniger als mit Feuerbach selbst. Meinem Eindruck nach legen es manche Leute regelrecht darauf an, ihren Glauben erschüttern zu lassen. Das geht schon seit gut hundert Jahren um. Mein Bruder Edward hat mir Feuerbachs Buch Das Wesen des Christentums geschenkt, um mich aus meiner unkritischen Frömmigkeit aufzuschrecken, das war mir durchaus klar. Ich musste es heimlich lesen, oder jedenfalls glaubte ich das. Ich packte es in eine Keksdose und versteckte es in einem Baum. Du kannst dir sicher vorstellen, welche Bedeutung die Lektüre unter diesen Umständen bekam. Zudem bewunderte ich Edward, der an einer deutschen Universität studiert hatte, sehr.
Mir wird klar, dass ich Edward noch gar nicht erwähnt habe, obwohl er für mich immer sehr wichtig war. Und bleibt, Gott hab ihn selig. Einerseits habe ich das Gefühl, ihn kaum gekannt zu haben, andererseits, als unterhielte ich mich mit ihm schon ein Leben lang. Er wollte mir den Gefallen tun, mir ein bisschen was vom Mittleren Westen auszutreiben. Diesen Gefallen hatte ihm Europa getan. Aber hier stehe ich und habe bis zum Ende das Leben geführt, vor dem er mich warnte, und das eigentlich recht zufrieden, alles in allem. Trotzdem, beim Thema Provinzialität werde ich empfindlich.
Edward hat in Göttingen studiert. Er war ein bemerkenswerter Mann. Er war fast zehn Jahre älter als ich, weshalb wir uns als Kinder nicht so sehr nahestanden. Es hatte zwischen uns zwei Schwestern und einen Bruder gegeben, die alle innerhalb von kaum zwei Monaten an Diphtherie starben. Er kannte sie, ich dagegen natürlich nicht, und auch das trennte uns. Obwohl davon selten gesprochen wurde, war ich mir immer dessen bewusst, dass es im Haus ein munteres, vielstimmiges Leben gegeben hatte, an das er und meine Eltern sich noch gut erinnerten und das ich mir nicht wirklich vorstellen konnte. Jedenfalls zog Edward mit sechzehn aus, um ans College zu gehen. Mit neunzehn machte er seinen Abschluss in Klassischer Philologie und ging gleich nach Europa. Wir kriegten ihn jahrelang nicht mehr zu Gesicht. Es gab nicht einmal sehr viele Briefe.